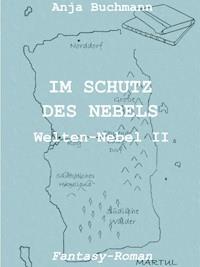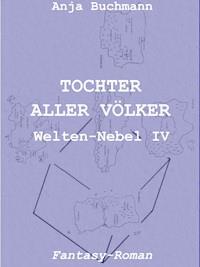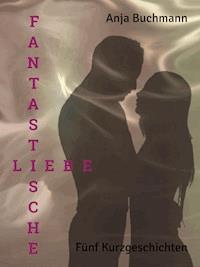Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Gezeichnet von den Sternen und von ihren Mitmenschen gemieden sieht Phoenix sich wegen ihrer Hautmuster als Abnormität. Niemand erkennt, welche Kräfte in ihr schlummern, bis sie auf den Priester Gabri trifft. Aus anfänglicher Furcht wird unwiderstehliche Anziehung. Doch Phoenix' Gaben machen sie zum Spielball düsterer Interessen. Wird sie das falsche Spiel erkennen oder bringt sie Tod und Verderben über die sechs Planeten? Werden sie und Gabri eine Zukunft haben?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 118
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Phoenix - Im Bann der Planeten
Phoenix - Im Bann der PlanetenEinsZweiDreiVierFünfSechsSiebenAchtNeunZehnElfZwölfDreizehnVierzehnFünfzehnDie Prophezeiung der ProtosSechzehnSiebzehnAchtzehnNeunzehnZwanzigEinundzwanzigZweiundzwanzigDreiundzwanzigVierundzwanzigFünfundzwanzigSechsundzwanzigSiebenundzwanzigAchtundzwanzigNeunundzwanzigDreißigEinunddreißigZweiunddreißigLust auf mehr?ImpressumPhoenix - Im Bann der Planeten
Romance in Space
von Anja Buchmann
Eins
Sie schnippte den abgeknipsten Fingernagel in Phoenix‘ Richtung. Phoenix entfuhr ein »Igitt!«, bevor dezenter Blutgeschmack ihren Mund füllte. Den Bruchteil eines Tiggs zu spät. Sie hätte sich auf die Lippe beißen sollen, bevor ihr die Reaktion auf Leylas Provokation entschlüpfte. »Endlich sieht sie es ein«, kommentierte die mit der Nagelpflege Beschäftigte an Tome gewandt. »Was sieht sie ein?«, gab der zurück. Fast meinte Phoenix, die Fragezeichen in den trübgrauen Augen zu sehen. »Dass ihre ganze Existenz eine abscheuliche Widerwärtigkeit ist, eine Abnormität, wie sie kein zweites Mal auf den sechs Planeten zu finden ist.« Sieben war alles, was sie unsinnigerweise denken konnte, während sich die Gemeinheit ihrer Papierschwester wie Säure durch den Körper fraß, ihren Atem lähmte und ihre Sinne vernebelte. Ihr Geist klammerte sich an diese belanglose Zahl, als wäre diese Antwort und Rettung. Phoenix war sich nicht sicher, ob sie die Nummer murmelte. Wenn dem so war, wäre es übertönt worden von Tomes Heiterkeitsausbruch. Dieses Lachen eines Dummkopfs, der einen Witz erklärt bekommen hatte, währte lange genug, um ihre Fassung wiederzuerlangen. Wie oft hatte sie schon beschlossen, sich nicht mehr von der zwei Umläufe älteren Leyla ärgern zu lassen, deren Familie durch eine bedauerliche Entscheidung der Familienkommission zu der ihren geworden war. In Momenten wie diesem, welche viel zu häufig auftraten, verfluchte sie das Schicksal und das Konzept der Papiergeschwisterschaft, welches den Zusammenhalt des Planetenbundes gewährleisten sollten. Jedes sechste Kind eines Planeten wurde gleich nach der Geburt auf einen der fünf anderen gegeben. Gegenseitige Toleranz, Verständnis und die Vermischung der Völker waren die Ziele. Dabei gab es keine sichtbaren Unterschiede zwischen den Ethnien. Wie sonst hätte man den getauschten Kindern ihre Volkszugehörigkeit vorenthalten können? Phoenix konnte bei keinem ihrer Bekannten sagen, ob er oder sie zu den Getauschten gehörte oder von Secundus stammte. Und Spekulationen darüber waren verboten. Bei ihr selbst hingegen war es offensichtlich, auch wenn wenige es so offen auszusprechen wagten wie Leyla: Phoenix war anders. Unmöglich, dass Blut sie mit ihrer Schwester und ihren Eltern verband. Nicht genetisch zu dieser kalten, gefühllosen Sippe zu gehören, war nicht der Grund für ihren Schmerz. Der lag in der Wahrheit hinter Leylas Worten: Sie war eine Abnormität. Wie sehr, das wusste ihre Papierschwester glücklicherweise nicht. Niemand weiß es. Sieben. Atmen! Niemand wird es je erfahren. Sieben. Atmen! Eher bringe ich mich um! Es war still geworden. Leyla tätschelte Tome die Wange, während sie Phoenix nicht aus den Augen ließ. Das boshafte Lächeln tat der Perfektion ihres Gesichts keinen Abbruch. Phoenix wünschte, sich unsichtbar machen zu können. Stattdessen drehte sie sich um und verließ das Zimmer, das Haus, die Stadt. Erst an den einsamen Klippen am Rand der Wüstenei gestattete sie sich Tränen.
Zwei
»Ich habe meinen Samen in ihren Schoß gepflanzt«, sagte Ian mit dem Anflug eines spitzbübischen Lächelns. Thally wollte glauben, dieser Ausdruck des Schalks bezöge sich auf den Inhalt seiner Aussage, doch sie kannte ihn gut genug, um sich einzugestehen: Die Belustigung bezog sich teils auf den Gebrauch der altertümlichen Wendung, teils auf die von ihr zu erwartende Reaktion. Daher verkniff sie sich eine ungläubige Nachfrage ebenso wie das Aufreißen der Augen, sondern beschränkte sich auf ein Stirnrunzeln, während sie überlegte, ob sie ihn wegen seines unverantwortlichen Handelns schelten sollte. So sehr sie seinen Drang, der Geliebten seinen Besitzanspruch zu zeigen, nachvollziehen konnte – die Freunde teilten diese Vorliebe –, das ging nun wirklich zu weit. Wenn seine Zuneigung in ein bis zwei Dezi-Umläufen wieder erlosch, stand das arme Mädchen mit einem dicken Bauch da. Wobei, eigentlich geschah ihr das recht. Schließlich hatte sie der Sache zugestimmt. Sollte ja Verrückte geben, die ein Kind bekamen, nur um es dann der Familienkommission zu überlassen. Immerhin winkte bei freiwilliger Abgabe eine stattliche Prämie vonseiten der quintischen Regierung. Gerade als sie sich entschied, die Sache unkommentiert zu lassen, legte Ian nach: »Ich denke, ich werde den Bund mit Solaya eingehen.« »Das wirst du nicht!«, quiekte sie und schüttelte so heftig den Kopf, dass ihr schulterlanges, lilafarbenes Haar ihr ins Gesicht schlug. »Das kannst du nicht machen«, fügte sie atemlos hinzu. »Ach ja?« Er verschränkte die Arme vor der breiten Brust. »Und warum nicht, wenn ich fragen darf?« Ja, warum eigentlich nicht? Was interessierte es sie, dass er dem kleinen Blondchen früher oder später das Herz brechen würde? Schließlich kannte sie Solaya kaum, hatte nie mehr als einige Höflichkeitsfloskeln mit ihr gewechselt und war ihr ansonsten aus dem Weg gegangen. Thally konnte weder das Püppchengesicht noch die hohe Lache länger als fünf Hekto-Tiggs ertragen. »Weil es ein ungemeiner Bürokratie-Aufwand ist, den Bund wieder zu lösen. Von den Kosten mal ganz abgesehen«, versuchte sie sich als Stimme der Vernunft – nicht unbedingt ihre übliche Rolle. »Warum sollte ich den Bund wieder lösen? Ich liebe Solaya!« Eine Hitzewelle durchlief ihren Körper, gefolgt von Übelkeit. Thally schluckte schwer. Das konnte unmöglich sein Ernst sein. »Du verarschst mich«, japste sie und klang dabei weit weniger überzeugt, als sie es sich vorgenommen hatte. »Das würde ich nie tun, du bist meine beste Freundin.« »Würdest und hast du«, insistierte Thally in der Hoffnung, er würde endlich lachen und seinen Scherz zugeben. »Okay«, räumte er ein und rieb sich den Nacken. »Aber mit so etwas macht man keine Scherze. Ich – liebe – Solaya. Und sie hat meinen Antrag angenommen.« Da war ein Strahlen in seinen bergseeblauen Augen, das Thally noch nie gesehen hatte. Erneut stieg Übelkeit in ihr auf. »Herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche euch alles Gute«, sagte sie mechanisch. Dann drehte sie sich um und rannte los. Sie verstand nicht, was er ihr nachrief. Es war egal. Alles war egal.
Drei
Der größere der beiden Monde verbreitete sein bläuliches Licht. Sie sollte nach Hause zurückkehren. Mutter hing sehr an den gemeinsam verbrachten Mondfreizeiten, doch Phoenix konnte sich nicht dazu durchringen. Sie bekäme ohnehin Ärger, weil sie so lange fortgeblieben war. Es machte keinen Unterschied, warum Vater sie mit diesem speziellen Blick bedachte, einer Mischung aus stummem Vorwurf und Enttäuschung. Sie war kein kleines Mädchen mehr, das sich davon einschüchtern ließ. Nur noch einige wenige Centi-Umläufe und sie vollendete ihren achtundzwanzigsten Lebensumlauf. Dann wäre sie frei, könnte ihrer Papierfamilie endlich den Rücken kehren. Wohin? Sieben, dachte sie kopfschüttelnd und blickte weiter gebannt auf die Einöde, welche sich bis zum Horizont erstreckte. Die Wildnis wirkte so friedlich. Ein sanfter Wind strich über die Ebene, bewegte die trockenen Gräser, die in einzelnen Büscheln auf dem kargen, wasserarmen Untergrund gediehen. Phoenix liebte diesen Anblick – niemand sonst tat dies wohl. Der vorherrschenden Meinung nach war die Wüstenei nichts als totes, unproduktives Land; zu trocken, um Nahrungsmittel anzubauen; der Boden zu instabil, um Fabriken darauf zu errichten. Wobei diese Ansicht offenbar überholt war, gab es doch Bestrebungen, einige Industriefirmen, die die Luft der nahen Stadt verpesteten und den raren Platz beanspruchten, hierher umzusiedeln. Sie würden diesem Ort die Seele nehmen. Die Erde würde plattgewalzt, die Dünen eingeebnet, der Boden versiegelt. Sie würden versuchen, ihn zu einem gewöhnlichen Industriestandort zu machen, wie so viele in ihrer ganzen Hässlichkeit Secundus bedeckten. Warum nur konnte dieser Ort nicht in seiner Einzigartigkeit fortbestehen? Mit feuchten Augen riss sie sich von dem Anblick los und machte sich auf den Heimweg. Viel zu schnell kamen die spiegelnden Türme von Spes, der Stadt am Rand zum Nirgendwo, in der sie mit ihrer Familie lebte, näher. Dominiert wurde das Bild von einer goldenen Kuppel, welche von den Türmen zwar überragt, doch gleichsam flankiert wurde. Wie ein fetter König, umgeben von seinen Gardisten. Der Tempel bildete sowohl das geografische als auch das tatsächliche Zentrum der Kleinstadt. Kaum ein Bewohner, der nicht mindestens wöchentlich diese Stätte aufsuchte, in der Hoffnung auf spirituellen Beistand für sein Leben oder mehr. Phoenix mied diesen Ort – sehr zu Vaters Missfallen –, denn sie fürchtete sich vor den Priestern in den silbernen Gewändern, welche das Schicksal eines jeden Menschen aus den Sternen lesen konnten. Oder dies zumindest behaupteten. Vielleicht gab es unter den Hunderten einige wenige, die aus dem physikalisch gesteuerten Lauf der Sterne und Planeten Rückschlüsse auf der Menschen Glück ziehen konnten. Die Hauptgeschäftszweige der emsigen Männer aber waren andere: spirituelle Lebenshilfe für zahlungskräftige Bürger, Beratung von politischen Entscheidungsträgern im Auftrag von Interessengruppen sowie leere Versprechungen gegen Spenden an den Tempel. Und das war nur das, was für jeden offensichtlich geschah. Phoenix konnte die Seife beinahe schmecken, die Mutter ihr in den Mund geschoben hatte, als sie diese Sicht auf die goldene Kuppel auch nur andeutete. Es musste jetzt sechs oder sieben Umläufe her sein. Seitdem schwieg sie zu diesem Thema. Der Sandweg mündete in eine befestigte Straße. Zunächst vereinzelt, dann immer dichter reihten sich die Häuser aneinander. Nach der sanften Helligkeit der mondbeschienenen Natur blendeten sie die Straßenbeleuchtung und das Licht aus zahllosen Fenstern. Ein Hindernis. Sie kam stolpernd zum Stehen. Ein plötzlicher Druck an ihren Oberarmen. Erst als sie den Blick hob und in ein Gesicht schaute, dämmerte es ihr, dass es kräftige Hände waren, die sie hielten und einen Sturz verhinderten. Er blickte sie an. Phoenix erstarrte. Wollte davonlaufen. Die in silbernen Stoff gehüllten Arme waren stärker. Vielleicht hätte die Furcht gereicht, um sich loszureißen, doch die gelbgrünen Augen bohrten sich in sie, verfingen sich in ihrem Innersten. Obwohl er weder sprach noch sich bewegte, schien der Priester sie auszuweiden wie ein erlegtes Tier. Er sah ES. Nackte Panik bemächtigte sich ihrer. »Du bist anders.« Ein Lächeln erleuchtete das jungenhafte Gesicht. »Ich habe dich gefunden. Das ist gut.« Eine unbekannte Wärme durchströmte sie. Ihre Haut prickelte. Es war, als liefen Rinnsale warmen Wassers ihre Narben entlang. Sie konnte jede einzelne spüren. Das Muster ergibt Sinn, dachte sie während eines Wimpernschlags, doch die strahlenden Augen des Priesters ließen den Gedanken verblassen. Es kann nicht stimmen, schoss es ihr plötzlich durch den Kopf. Der Umstand, dass ein in Silber Gehüllter sie nicht voller Abscheu betrachtete – die Priester waren immer die mit dem härtesten Urteil im Blick –, verwirrte sie. Phoenix schlüpfte aus dem gelockerten Griff und verschwand. Gefunden und verloren innerhalb weniger Tiggs. Wie hatte das passieren können? »Du hast ihr Angst gemacht«, antwortete die Stimme auf seine unausgesprochene Frage. »Wie denn? Ich habe doch fast nichts gesagt.« Gabri schüttelte den Kopf, den Blick noch immer auf die Stelle gerichtet, an der sie gestanden hatte. Langsam ließ er die Arme sinken. »Aber sie angestarrt wie Bruder Nikos Früchtekuchen nach einem mehrtägigen Fasten. Wenn ich sie gewesen wäre, hätte ich mich auch davongemacht.« »Kannst du mal ruhig sein? Ich versuche nachzudenken. Irgendwie muss ich sie wiederfinden«, sprach der Priester in die Leere hinein. »Na dann viel Glück! Hinterherlaufen ist jedenfalls keine Option.« Schwang da ein tonloses Lachen mit? Gabri knirschte mit den Zähnen. »Sehr hilfreich. Das weiß ich selbst. Immerhin ist sie nicht um die Ecke gerannt. Das Mädchen könnte sonst wo sein.« Obwohl der Spezialstoff seines maßgefertigten Anzugs dies nicht zulassen sollte, begann er zu schwitzen. Wenn er daran dachte, dass sie gerade gesprungen war … »Meinst du, es war ihr erster Sprung?«, unterbrach sein zumeist lästiges Anhängsel Gabris Überlegungen. Er zuckte mit den Schultern. »Woher, bei den Sternen, soll ich das denn wissen?«, polterte er los, um sich gleich darauf die Hand vor den Mund zu schlagen. Gefühlsausbrüche waren eines Priesters unwürdig. Gabri nestelte am Stoff seines Hemdes. Am liebsten würde er es sich vom Leib reißen. Beinahe. Doch er hatte sie entwischen lassen. Er sank rücklings in den Staub des Straßenrandes. »Was tust du?« »Wonach sieht es denn aus?«, blaffte er. »Aufgeben?!«, stichelte es aus dem Nichts. »Ich – gebe – niemals – auf! Ich versuche zu meditieren. Also halt endlich deine vorlaute Klappe!« »Okay, du bist der Boss.« Und tatsächlich folgte wohltuende Ruhe. Gabri senkte die Lider und richtete seinen Blick nach innen. Seine Atmung glitt von selbst in einen tiefen, gleichmäßigen Rhythmus. Er sah ihr Gesicht vor sich. Ihre bebende volle Unterlippe hatten seinen Blick gefangen genommen, so sehr, dass er sich konzentrieren musste, um die feinen Linien auf Stirn, Wangen und Kinn wahrzunehmen, die ihm Gewissheit gaben. Er jagte nicht länger einem Phantom hinterher. Drei Umläufe lang hatte er jeden wachen Tigg mit Zweifeln zugebracht, unsicher, ob er sein Ziel jemals erreichen würde. Nun hatte er sie gefunden, sie gehalten. Die Sterne hatten sie endlich zueinander geführt, nur um sie ihm gleich danach wieder zu nehmen. Er verstand nicht, warum. Hatte er nicht genug geopfert? Nicht genug gelitten? Nicht genug geglaubt? Noch nie in seinem Leben hatte er sich so leer gefühlt. Er gab dem Drang nach, in dieser Leere zu versinken. Da war diese Melodie …
Vier
Unten war oben. Oben war unten. Und wieder anders herum. Sie überschlug sich mehrfach, bevor sie auf dem Bauch landete. Ihr Gesicht wurde in den sumpfigen Rasen gedrückt. Kaum hatte sie den Kopf zur Seite gedreht, um nach Luft zu schnappen, wurde ihr diese aus den Lungen gepresst, als etwas hart auf ihren Rücken aufschlug. Lange rotbraune Haar fielen ihr ins Gesicht. Der Geruch von Staub breitete sich aus. Thallys durchgeschüttelter Kopf brauchte einen Moment, um die Eindrücke zusammenzusetzen. Etwas hatte sie von dem Baum, auf den sie sich geflüchtet hatte, gerissen. Und dieses Etwas war ein menschliches Wesen, wahrscheinlich weiblich, das jetzt auf ihr lag. War da ein zweites Atemgeräusch? Angestrengt lauschte sie. Nichts. Mit vorsichtigen Bewegungen versuchte sie, unter der Frau hervorzukriechen, was ihr misslang. Das Gewicht auf ihrem Rumpf war einfach zu viel. Ihrem zierlichen Körper, wegen dessen Thally oft für ein Kind gehalten wurde, fehlte es an der nötigen Stärke. Und es fiel ihr immer schwerer, genügend Luft zu bekommen. Auf die Gefahr hin, die andere zu verletzen – oder war sie tot? – setzte sie alle Kraft ruckartig ein und wälzte sich herum. Der fremde Körper geriet ins Rollen. Auf dem Rücken liegend rang Thally nach Atem, bevor sie sich aufsetzte. Die Frau lag auf der Seite, das Gesicht von ihr abgewandt. Ein für den frischen Wind zu dünnes, schwarzes Kleid bauschte um ihren Körper und eine wahre Haarflut ergoss sich auf die Wiese. Was würde ich für eine so wundervolle Mähne geben, dachte Thally und strich sich gedankenverloren durch ihren lilafarbenen halblangen Schopf. Und verpasste sich im gleichen Zug eine Kopfnuss. Wie konnte sie solch oberflächlichen Mist denken, während dort jemand lag, der verletzt, möglicherweise sogar tot war. Die aufwühlenden Ereignisse nicht einmal zwei Kilo-Tiggs zuvor durften keine Entschuldigung sein. Unsicher, was sie tun sollte, tun konnte, trat Thally an die am Boden Liegende heran und legte ihr die Hand auf die Schulter. Keine Reaktion. Ein leichtes Heben und Senken des Brustkorbs war auszumachen und Verletzungen gab es auf den ersten Blick keine, zumindest keine blutenden. Die junge Frau wirkte vielmehr so friedlich, als habe sie sich auf der grünen Wiese für ein Schläfchen gebettet. Dabei war sie geradewegs vom Himmel gefallen. Unsinn! Wie sollte das möglich sein? Und doch musste sie von oben gekommen sein, um Thally aus ihrem Zufluchtsort in der Blätterkrone zu reißen. »Hallo?«, sprach sie die Fremde zaghaft an. Keine Reaktion.