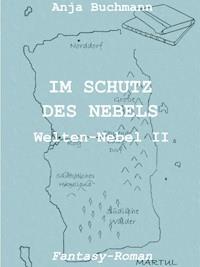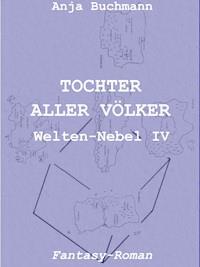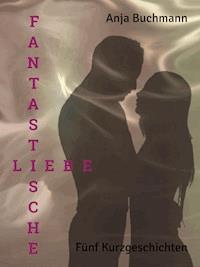Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Geflohen vor Kontrolle und Gewalt. Angekommen in einer trügerischen Freiheit. Gefangen zwischen zwei Männern. Konfrontiert mit den Dämonen ihrer Vergangenheit. Als Hannah aus einem System der staatlichen und privaten Unterdrückung flieht, sucht sie Freiheit, aber erwartet den Tod. Unverhofft gerät sie in die Siedlung Newtopia, deren Bewohner abgeschnitten von der Zivilisation ein selbstbestimmtes Leben führen. Der charismatische Don zieht sie in seinen Bann, während sie sich insgeheim nach der Freundschaft des abweisenden Alex sehnt. Die Schrecken ihrer Vergangenheit machen es Hannah schwer, sich vollends auf ihr neues Leben einzulassen. Und bald schon zeigen erste Risse in der perfekten Gesellschaft ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wir nannten es Newtopia
Wir nannten es NewtopiaI – Ende AugustII – Am übernächsten TagIII – Am AbendIV – Ende SeptemberV – Am Abend des gleichen TagesVI – Am folgenden MorgenVII – An einem Abend Ende OktoberVIII – Am nächsten TagIX – Am folgenden MorgenX – Anfang DezemberXI – HeiligabendXII – Anfang JanuarXIII – In der Schwärze der NachtXIV – Am nächsten TagXV – Zwei Tage späterXVI – Elf Jahre zuvorXVII – Vor zehn JahrenXVIII – Vor acht JahrenXIX – Zwei Monate späterXX – Zurück in der GegenwartXXI – Am folgenden AbendXXII – In der NachtXXIII – Am Morgen in der SiedlungEpilogDie AutorinImpressumWir nannten es Newtopia
Dystopischer Roman
von
Anja Buchmann
I – Ende August
Ihre Beine spürte sie schon geraume Zeit nicht mehr. Die ganze Nacht war Hannah gerannt, erst über die gespenstisch leeren Straßen der Stadt, dann durch Felder und über Wiesen. Schließlich durch eine von scharfen Gräsern und Gestrüpp geprägte Wildnis. Die Schritte ihres Verfolgers waren bald dem Hämmern ihres eigenen Herzens gewichen. Dennoch war sie weitergelaufen. Noch immer glaubte sie, Miles zu hören, wie er ihren Namen brüllte. Hannah wusste nicht, wie weit seine unbändige Wut ihn führen würde. Sie konnte nicht riskieren, dass er sie einholte.
Grenzenlose Furcht. Todesangst.
Der Rucksack drückte schwer auf ihre Schultern. Lange konnte sie nicht mehr durchhalten. Der neue Tag würde bald anbrechen. Vielleicht sollte sie sich nach einem Versteck umsehen. Sie blickte zurück in die Richtung, aus der sie gekommen war. Die Lichter der Stadt lagen weit hinter ihr. Niemand war zu sehen. Kein Geräusch deutete auf die Anwesenheit eines anderen Menschen hin. Aber das bedeutete nichts. Allein der Gedanke an Miles ließ sie entgegen aller Erschöpfung weiterlaufen. In der weiten Ödnis, die sie gerade durchquerte, würde sie ohnehin keinen Unterschlupf finden.
Der Horizont färbte sich rosa. Sie ließ sich auf den Boden fallen. Nur kurz rasten. Ihr Blick war auf die aufgehende Sonne gerichtet. Die Entscheidung, in Richtung Osten zu laufen, war eine spontane gewesen, die zur Flucht nicht. Sie zog eine Flasche mit nährstoffangereichertem Wasser aus ihrem schwarzen Rucksack, nahm ein paar Schlucke. Sie würde es einteilen müssen, hatte sie sich doch vorgenommen, jedweden Kontakt zur Zivilisation vorerst zu meiden. Wenn Miles unter all seiner Brutalität etwas Verstand zurückbehalten hatte, so hatte jede Polizeistation des Staates inzwischen ein Foto von ihr. Fasste man sie, wäre sie schnell wieder zu Hause, bei Miles. Sie stöhnte auf, musste ein Zittern unterdrücken. Plötzlich war sie unendlich erschöpft, ließ sich auf den Rücken fallen. Hannah schloss die Augen, bedeckte ihr Gesicht mit den Armen.
Seine Hände gruben sich in die sonnenwarme Erde, zerdrückten die Klumpen. Obwohl es noch früher Morgen war, schwitzte er. Feine Flüssigkeitsperlen standen ihm auf der Stirn, sammelten sich in den Falten seines sorgenvollen Gesichts, ließen sein T-Shirt am Rücken kleben. Der Boden war viel zu trocken, rann ihm fast wie purer Sand durch die Finger. Wenn es nicht bald regnete, war die Ernte auf diesem Feld verloren. Ein halber Monat absolute Trockenheit war einfach zu viel für die zarten Gemüsepflanzen.
Alex fluchte. Er hätte darauf dringen müssen, die Bewässerungsgräben auf dieses Feld auszudehnen und eine entsprechende Erweiterung des Systems aus kleinen und größeren Sammelbecken vorzunehmen. Mit etwas mehr Einsatz hätte er die Herbstversammlung vielleicht überzeugen können, diesem Projekt eine höhere Priorität einzuräumen. Nicht, dass die Schule nicht wichtig gewesen wäre und ebenso die zwei neuen Wohngebäude, die im Winter errichtet worden waren, aber musste die Nahrungsmittelversorgung nicht immer an allererster Stelle stehen? Die Mehrheit der 266 Stimmberechtigten hatte dies anders gesehen und nichts lag Alex ferner, als die Weisheit der Vielen, auf der die Entscheidungsfindung ihrer Gemeinschaft beruhte, in Abrede zu stellen. Manchmal schlichen sich Zweifel in Herz und Verstand.
Er musste zugeben, sie würden ohne den Ertrag dieses Feldes nicht verhungern, nicht einmal Mangel leiden – sofern nicht andere Ernteausfälle hinzukämen. Zur Abwechslung wäre ein gewisser Überschuss schön gewesen.
Er betrachtete seine gebräunten Hände und Unterarme. Die Sehnen und Muskeln traten deutlich hervor. Vor zehn Jahren noch war er erheblich wohlgenährter gewesen.
Er blickte hinauf zum Himmel, über den lediglich ein paar Schleierwolken zogen. Der strahlende Sonnenschein erschien ihm wie Hohn. Letztes Jahr waren viele Feldfrüchte im Dauerregen verfault.
Seine Finger strichen über die hängenden Blätter der Rüben. Noch waren die Pflanzen nicht gänzlich hinüber. Ein paar Eimer Wasser retteten sicher einiges. Es gab nur niemanden, der sie hätte herbeitragen können. Jeder in der Gemeinschaft hatte mehr Arbeit, als er oder sie in den hellen Stunden des Tages bewältigen konnte. Niemand klagte darüber und ein jeder versuchte, so viel wie möglich zu leisten. Zum Wohle aller.
In ihrem früheren Leben wäre keiner von ihnen auf die Idee gekommen, so etwas längere Zeit mitzumachen. Nun standen die Dinge anders. Absoluter Einsatz war viel mehr als eine Frage des Überlebens. Sie wollten etwas aufbauen, Großes schaffen. Jeder tat, was er konnte, damit dies gelang.
Er erhob sich und klopfte den Staub von den Knien der zerschlissenen und mehrfach geflickten Jeans. Bisher hatte er es nicht für nötig gehalten, seinen Anspruch auf neue Kleidung geltend zu machen. Was er besaß, genügte vollkommen.
Das Knarren der sich öffnenden Tür ließ ihn aufschrecken. Schnell schloss Don den Schrank. Als er sich umwandte, stand Alex bereits im Zimmer. Don konnte nur hoffen, dass sein Körper dem Freund jedweden Einblick verwehrte.
»Du kommst spät«, begrüßte er Alex.
»Entschuldige, ich musste noch nach meinem Feld sehen.«
»Dein Feld?«, fragte er und hob die Augenbraue. Er war stets aufs Neue erstaunt, wie hartnäckig sich Ausdrucksweisen wie diese hielten.
»Verzeih, ich meine natürlich das Feld, für das ich verantwortlich bin. Es sieht nicht gut aus. Die Trockenheit. Wir hätten die Bewässerungsgräben bauen sollen.« Er fuhr sich mit der Hand durch das blonde Haar, welches für Dons Geschmack schon wieder zu lang war.
»Höre ich da Zweifel an den Entscheidungen der Gemeinschaft? Das sieht dir nicht ähnlich, mein Freund.« Er kannte Alex als einen eisernen Verfechter der Sache. Von jedem anderen hätte er Bedenken erwartet, nicht jedoch von ihm. War dies ein Grund zur Sorge?
»Ich akzeptiere die Meinung der Mehrheit. Es ist trotzdem schade um die Ernte«, sagte er mit einem leichten Kopfschütteln.
»Meinst du, wir bekommen Probleme mit der Lebensmittelversorgung?« Wäre dem so, würde sie dies um Jahre zurückwerfen und damit seine Pläne gefährden.
»Nein. Ein Großteil der Felder ist bewässert. Ich sehe keine Gefahr.«
Alex‘ Antwort beruhigte ihn, doch Don machte sich eine mentale Notiz, die Lebensmittelproduktion künftig im Auge zu behalten, obwohl dies nicht zu seinen Aufgaben gehörte. »Gut. Ich will nie wieder jemanden verhungern sehen.« Hungertote waren nicht gut für die Moral, sorgten für Unruhe. Das war das Letzte, was sie gebrauchen konnten.
»Ich auch nicht.« Für einen Augenblick verzerrte sich Alex‘ Gesicht. Er trauerte tatsächlich noch immer um jene, die sie verloren hatten.
Don war geneigt, die Sache pragmatischer zu sehen. Die ersten Jahre hatten gezeigt, wer wirklich für diese Unternehmung geeignet war. Nur die Stärksten überlebten. So war der natürliche Lauf der Dinge. Die moderne Gesellschaft neigte dazu, dies zu vergessen. Technologie hatte die Menschen bequem gemacht, ihnen die natürlichen Instinkte und das Gespür für die Erbarmungslosigkeit des Lebens genommen. Jeder, der sich auf dieses Experiment eingelassen hatte, war im Vorfeld über dessen Härten aufgeklärt worden. Verluste waren Bestandteil der Kalkulation gewesen. Er schob diese Überlegungen beiseite, würde sie nicht mit Alex teilen. Der Freund würde es nicht verstehen. Stattdessen sagte er: »Dann lass uns mal mit der Arbeit anfangen. Wir haben nicht viel Zeit. Ich hoffe, du hast dir schon Gedanken darüber gemacht.«
»Habe ich. Ich weiß allerdings nicht, ob sie wirklich taugen. Schließlich bin ich kein Lehrer.«
»Genauso wenig wie ich. Es geht nicht darum, fertige Unterrichtskonzepte zu erarbeiten. Die Aufzeichnungen sollen Martha lediglich als Anhaltspunkte für die Unterrichtseinheiten zum Thema Ackerbau dienen. Daher genügen zunächst einige Stichworte und Überschriften. Die Details wird Martha erfragen, sobald sie die Thematik im Unterricht aufgreifen will.«
»Wenn du mich fragst, wird es noch etwas dauern. Wie alt sind ihre ältesten Schüler? Sieben?«
»Acht. Martha unterrichtet sie seit drei Jahren. Die Zwillinge können lesen, schreiben und rechnen. Es wird Zeit, ihnen die Welt, in der sie leben, zu erklären.« Er hatte zwischenzeitlich Papier und Stift bereitgelegt und nahm hinter dem Schreibtisch Platz. »Setz dich!«, sagte er und deutete auf den Stuhl, der seinem gegenüberstand.
Alex schüttelte den Kopf. »Nein danke, ich stehe lieber.« Er begann, auf und ab zu gehen. Deutlicher hätte er seinen Widerwillen kaum zum Ausdruck bringen können. Don wusste sehr wohl, was seinen Freund umtrieb. Er empfand die Aufgabe, bei der Gestaltung des Lehrplans mitzuhelfen, als unproduktiv. Er bevorzugte praktische Arbeiten, die substanzielle Ergebnisse hervorbrachten. Deswegen war es Don nicht gelungen, ihn für die Mitarbeit in der Verwaltung der Siedlung zu gewinnen.
Wie unterschiedlich sie waren. Er selbst war froh über jede Minute, die er sich der körperlichen Arbeit auf den Feldern und Baustellen entziehen konnte, seinen Intellekt nicht am Ende eines Spaten verschwenden musste.
»Ich denke, der Landwirtschaftsunterricht sollte grundlegendes Wissen über die verschiedenen Nutzpflanzen vermitteln. Außerdem sollten die Kinder etwas über die Techniken der Bodenbearbeitung, Bewässerung und Ernte lernen. Wichtig finde ich außerdem Sachen wie Schädlinge und Nützlinge, Unkräuter, Bodenqualität und deren Erhaltung«, zählte Alex auf.
»Halt, stopp, nicht so schnell, ich muss das alles mitschreiben.«
»Okay. Weißt du was, am besten, ich notiere das alles selbst. Am Abend. Dann kann ich jetzt den anderen bei der Ernte der Frühkartoffeln helfen.«
»Wie du meinst. Bloß vergiss es nicht. Ich erwarte deine Liste morgen.«
»Sagen wir übermorgen. So eilig kann es nicht sein.«
»Meinetwegen, übermorgen«, gab Don nach.
»Gut. Wir sehen uns.« Schon war Alex zur Tür hinaus.
Don blickte auf das Blatt mit den Notizen. Er hätte es ihm mitgeben sollen. Ihre Papiervorräte waren begrenzt und eine halb volle Seite war Verschwendung. Irgendwann würden sie sich über die Herstellung von Papier Gedanken machen müssen. Er überlegte, ob ihre bescheidene Bibliothek eine Anleitung dazu enthielt. Er würde es herausfinden müssen. Es verlangte ihn, es gleich zu tun, aber er konnte sich nicht den ganzen Tag drinnen verstecken. Er musste bei der Ernte anpacken, musste Präsenz zeigen. Einzig sichtbare Tatkraft sicherte das Wohlwollen der anderen Bewohner. Die administrativen Tätigkeiten im Hintergrund blieben oft unbemerkt. Was ihm Ärgernis und Segen gleichermaßen war.
Als sie aufwachte, stand die Sonne hoch am Himmel. Hannah fluchte. Sie hätte nicht einschlafen dürfen, nicht hier, vollkommen ungeschützt, mitten auf einer Wiese. Es grenzte an ein Wunder, dass weder Menschen noch irgendwelche Tiere sie entdeckt hatten. Wobei, gab es überhaupt wilde Tiere hier? Ihr bisheriger Kontakt mit Tieren beschränkte sich auf den städtischen Zoo und was dort zu sehen war, kam in der freien Natur in der Regel nicht mehr vor. Und im näheren Umkreis von Metropolen gleich gar nicht.
Der Gedanke daran, wie wenige Kilometer sie nur von ihrer alten Heimat trennten, fuhr wie ein Frösteln durch ihren Körper. Hannah schlang die Arme um ihren Leib, nur um sie im gleichen Moment wieder wegzunehmen. Ihr war heiß. Das Gesicht brannte wie Feuer, die Haut spannte. Sonnenbrand. Ob es einen Sinn hatte, jetzt noch Sonnenschutz aufzutragen? Sie zog die Tube aus der Tasche und tat es einfach, trotz der Schmerzen, die jede noch so vorsichtige Berührung verursachte. In ein paar Stunden würde die Haut anfangen, sich zu pellen.
Sie hatte weitaus Schlimmeres durchmachen müssen.
Sie zog ihren Pullover aus und cremte ihre Arme ein. Die Haut dort war noch heller als ihr Gesicht. Kein Wunder, denn sie hatte einen Großteil ihrer Zeit in Gebäuden verbracht. Es war lange her, seit sie wirkliche Weite genossen, den Wind in ihren Haaren und reine Luft auf ihrer Haut gespürt hatte. Eine Ahnung von Hoffnung stieg in ihr auf.
Ein Schluck Wasser, mehr gestand sie sich nicht zu, um den trockenen Mund zu benetzen. Dann erhob sie sich und blickte um sich. So weit das Auge reichte nichts als steppenähnliches Grasland. Sie hatte nicht gewusst, dass solch riesige Flächen unberührter Natur existierten. Es gab so vieles, was sie nicht gewusst hatte. Diese Zeit der Naivität, des Vertrauens auf andere war vorbei. Jetzt würde sie ihre eigenen Entscheidungen treffen. Sie zog einen Kompass aus der Tasche. Das GPS des Handys wäre sinnvoller gewesen, aber das Mobiltelefon hatte sie bei ihrer Flucht zurücklassen müssen. Zu leicht konnte man sie darüber aufspüren. Weiter nach Osten zu gehen, würde sie in die dicht besiedelte Küstenregion bringen. Daher beschloss sie, sich nach Süden zu wenden. Und obgleich sie nicht wusste, wohin dieser Weg sie führen würde, ihr Ziel hatte Hannah dennoch klar vor Augen: Freiheit.
Gemessen an der Trockenheit war die Kartoffelernte ausgezeichnet. Es gab einen hohen Anteil an mittelgroßen und großen Knollen. Ein Grund zum Aufatmen. Die anderen Erntearbeiter schienen das ebenso zu sehen, denn beim gemeinsamen Abendessen herrschte eine ausgelassene Stimmung.
»Alex, möchtest du nach dem Essen noch vorbeikommen? Die Kinder wünschen sich, dass du ihnen mal wieder eines dieser Holztiere schnitzt, und wir haben dich so gerne zu Besuch«, meinte Esther lächelnd.
Wir bedeutete sie, ihr Mann Felix und ihre zwei Kinder.
»Danke für das Angebot, aber ich muss mich noch um eine Sache für Don kümmern«, antwortete er und schob die Hände in die Taschen.
Vor ein paar Jahren wäre dies eine willkommene Ausrede gewesen, hatte es ihn doch geschmerzt, Zeuge einer solchen Familienidylle zu werden. Er selbst hatte immer von einer Familie geträumt. Das Schicksal hatte anders entschieden. Mittlerweile war er darüber hinweg und gerne zu Gast bei der jungen Familie. Verpflichtungen gingen vor. So machte er sich auf in Richtung des Hauses, das er sich mit Don und zwei weiteren alleinstehenden Männern teilte. In den Anfangsjahren waren sie hier zu zwölft gewesen, je drei in einem Zimmer. Die Enge hatte besonders im Winter häufig zu Konflikten geführt. Es hatte eine Weile gedauert, bis ausreichend Wohnraum für alle zur Verfügung stand. Gemessen an den neuen Familienhäusern, die in den letzten Wintern entstanden waren, wohnte er trotz des eigenen Raums bescheiden. Ihm war es gleich, da das Zimmer für ihn kaum mehr darstellte als einen Schlafplatz.
Der Mond tauchte alles in ein mildes Licht. Warum sollte er die Zeit mit Schreibarbeiten verschwenden? Aus dem Materiallager holte er sich zwei Eimer. Ein Viertel der Rüben, so viel würde er zu retten versuchen.
Wie so oft verließ Don das Büro im Gemeinschaftsgebäude weit nach Einbruch der Dunkelheit. Nachdem er eine gute Weile bei der Kartoffelernte geholfen hatte, war er dorthin zurückgekehrt, um den Rest des Tages über Statistiken und Listen zu brüten. Das war es, was er besonders gut konnte. In einem anderen Leben wäre er wohl Steuerbeamter oder Buchprüfer geworden, angesehen und von einigen gefürchtet. In dieser Welt brachte niemand diesen Tätigkeiten ein solches Maß an Respekt entgegen. Der Mehrheit erschloss sich der Sinn dieser Verwaltungsarbeiten kaum. Dabei hatte sein koordinierendes Eingreifen einen nicht unwesentlichen Anteil an den Erfolgen der letzten Jahre. Wenn ihn die fehlende Anerkennung zu arg schmerzte, erinnerte er sich daran, wie gut und richtig es war, dass niemand das Ausmaß seines Einflusses auf das Leben in der Siedlung erkannte. Würde es in seinem Umfang bekannt, wären die Zeiten des ungestörten Schaltens und Waltens vorbei.
Nur wenige Fenster in der Siedlung waren noch beleuchtet, als er nach draußen trat. Umso erstaunter war Don, als er im schwachen Mondlicht eine Gestalt ausmachte. Weniger verwunderte ihn, dass es Alex war, der Eimer über das Rübenfeld schleppte. Seit ihrem ersten Tag hier arbeitete der Freund härter als alle anderen. Wann immer es ein Beispiel an Fleiß und Opferbereitschaft brauchte, so war Alex der Richtige. Dass er dabei manchmal über das Ziel hinausschoss, spielte keine Rolle. Dieser Versuch, den mangelnden Niederschlag auszugleichen, erschien Don mehr als fragwürdig. Nichtsdestotrotz würde er Alex nicht nur gewähren lassen, sondern ihm helfen. Schnell brachte er das Buch, welches er aus dem Büro mitgenommen hatte, in sein Zimmer, bevor er sich zwei Eimer besorgte und diese am nächsten Brunnen füllte.
Trotz beinahe völliger Dunkelheit lief sie weiter, setzte einen Fuß vor den anderen. Schließlich hatte sie einen nicht unerheblichen Teil des Tages geruht. Die Hitze hatte ein zügiges Vorankommen unmöglich gemacht. Selbst Stunden nach Sonnenuntergang war es noch unangenehm warm. Die trockene Luft machte das Atmen schwer. Sie rang um jeden Meter. Wie gerne hätte sie sich einfach auf den Boden fallen lassen. Das ging nicht. Nur die körperliche Anstrengung und die damit einhergehenden Schmerzen betäubten Hannahs kreisende Gedanken. Je weiter sie sich von ihrer Heimat entfernte, desto übermächtiger wurden ihre Zweifel. War es wirklich klug gewesen, davonzulaufen? Machte sie damit nicht alles noch schlimmer? Bei Lichte betrachtet gab es nur zwei mögliche Ausgänge: Entweder sie starb in der Wildnis oder der Versuch, in einer anderen Stadt ein neues Leben anzufangen, endete damit, dass Miles sie fand. Ihre Wahl wäre der Tod.
Die Hoffnung, sich im Verborgenen eine neue Existenz aufzubauen, erschien ihr wie eine riesige Dummheit, ein Traum, der niemals den Albtraum ersetzen konnte, den sie Leben genannt hatte. Es war ausgeschlossen, dass sie es alleine schaffen konnte. Keine vierundzwanzig Stunden war sie in der Wildnis unterwegs und schon setzte die Einsamkeit ihr zu. Hannah vermisste ihre Mutter.
Nicht durchdrehen, mahnte sie sich. Sie war stark, sie würde es schaffen.
Der Schweiß brannte auf der sonnengeschädigten Haut. Nicht nur ihr Gesicht schien zu glühen. Ihr ganzer Körper stand in Flammen. Gleichzeitig fröstelte sie. Sie blieb stehen, griff nach ihrer Trinkflasche. So gern sie es wollte, sie durfte sich nicht setzen, denn dann würde sie nicht wieder aufstehen. Einige gierige Schlucke, die das innere Brennen nicht mildern konnten, dann schleppte sie sich weiter.
»Du musst das nicht tun, Don.« Alex wollte seinem Freund die Eimer abnehmen.
»Ich weiß. Da ich dich wohl kaum dazu überreden kann, damit aufzuhören, werde ich dafür sorgen, dass du nicht zusammenbrichst«, sagte der Freund mit einem Kopfschütteln.
»Danke. Nur noch ein paar Pflanzen. Alles schaffen wir nicht.« Er blickte auf, um abzuschätzen, wie viel sie schon bewässert hatten. Als er eine Gestalt am anderen Ende des Feldes entdeckte, glaubte er, sein Sehsinn spielte ihm einen Streich. Er rieb sich die Augen, stieß dann Don an und deutete in die Richtung.
»Wer ist das?«, fragte dieser. Also sah er es ebenfalls. Normalerweise streifte zu so später Stunde niemand allein durch die Gegend.
»Ich glaube nicht, dass es jemand von uns ist. Das Rübenfeld liegt am äußersten Ende unseres Gebiets. Und niemand ist so kühn, das Gebiet zu verlassen. Schon gar nicht bei Nacht.« Es war eine Frage der Sicherheit, sich nicht allzu weit von der Gruppe und den schützenden Häusern zu entfernen.
»Du meinst, es ist jemand von außerhalb? Unmöglich!« Don schüttelte energisch den Kopf.
»Dann hat sich jemand verlaufen. Ich gehe nachsehen.« Mit diesen Worten lief er los, ignorierte Dons gerufene Bitte, auf ihn zu warten.
Er ließ das Rübenfeld hinter sich und mit ihm die unsichtbare Linie, die ihre Siedlung umgab. In den vergangenen Jahren hatten sie diese immer weiter ausgedehnt, immer mehr Land urbar gemacht. Allmählich stießen sie an die Grenze dessen, was die Gemeinschaft bewirtschaften konnte. Zumindest, wenn sie bei den einfachen Ackerbaumethoden blieben.
Das Gras unter seinen Füßen war so trocken, dass es sofort brach. Feuergefahr. Vielleicht sollten sie eine Brandschneise schaffen. Rechtfertigte das Risiko die zusätzliche Arbeit?
Er hatte die Person fast erreicht, erkannte ihre schwerfälligen Schritte. Die Frau war kein Mitglied ihrer Gemeinschaft! Er war geschockt und ratlos. Sollte er sie fortschicken?
Sie schien ihn entdeckt zu haben, drehte sich um. In diesem Augenblick wurde ihm klar: Er konnte sie nicht gehen lassen! Er wollte sie rufen, als sie taumelte, dann fiel.
Mit wenigen Schritten war er bei ihr. Ihre Haut schimmerte unter all den roten Flecken blass im Licht des Mondes. Ihr mutmaßlich dunkles Haar klebte wirr in ihrem Nacken und an den Schläfen. Sie schien bewusstlos. Wahrscheinlich Erschöpfung. Um hierher zu gelangen, musste das Mädchen lange Zeit durch die Einöde gelaufen sein. Sie brauchte Hilfe. Routiniert prüfte Alex Atmung und Puls, bevor er sie behutsam hochhob.
Don hatte zwischenzeitlich zu ihm aufgeschlossen.
»Was tust du da?«, fragte er harsch.
»Ich werde sie ins Haus bringen«, antwortete Alex mit ruhiger, leiser Stimme.
»Sie ist eine Fremde.« Don machte einen halben Schritt rückwärts.
»Soll ich sie hier liegen lassen? Das wäre ihr Todesurteil. Sie ist fast noch ein Kind.« Für einen Augenblick erstarrte er. Zog sein Freund ernsthaft in Betracht, dieser jungen Frau die Hilfe zu verweigern?
»Die Regeln«, wandte Don ein.
»Sind nicht für Fälle wie diesen gemacht.« Er verstärkte den Griff um den schlaffen Körper und lief los. Die Diskussion war für ihn beendet. Alex lenkte seine Schritte in Richtung seines Wohnhauses. Don folgte, schweigend.
II – Am übernächsten Tag
Ihr Kopf dröhnte und ihr Mund war trocken. Ansonsten spürte sie erstaunlich wenig Schmerz. Ihr Körper fühlte sich seltsam an, gar nicht so, als läge sie auf dem Boden.
Das Letzte, woran Hannah sich erinnerte, war, dass sie durch die Wildnis gestolpert war. Unendliche Erschöpfung, Schmerzen, gleichzeitig der unbedingte Wille, voranzukommen. Ihren Blick fest auf den Boden gerichtet, hatte sie ihn nicht kommen sehen. Dann hatte sie den Kopf gehoben und einer schwarzen Silhouette gegenübergestanden. Ein Mann, nah, viel zu nah, und er kam weiter auf sie zu. Sie hatte sich umgewandt, hatte rennen wollen. Flucht war ihr einziger Gedanke gewesen. Dann war alles schwarz geworden.
Sie öffnete die Augen. Über sich erkannte sie eine hölzerne Decke. Ihrer Kraft nicht trauend, drehte sie nur den Kopf. Die Wände des kleinen Zimmers waren ebenfalls aus Holz. Erleichterung machte sich breit. Weder war sie zu Hause noch in einem Krankenhaus. Wo war sie dann? In Sicherheit? Oder hatte derjenige, der sie hierher brachte, schon die Behörden verständigt? Was würde sie tun, träfe sie mitten in der Nacht auf eine Person, die zu fliehen versuchte und dann zusammenbrach? Mutmaßlich war schon jemand auf dem Weg, um sie abzuholen.
Wie lange war sie wohl bewusstlos gewesen? Blieb ihr noch genug Zeit, um zu verschwinden, bevor die Polizei kam? Sie musste sich schleunigst Klarheit über ihre Situation verschaffen.
Die Läden des kleinen Fensters waren geschlossen. Der Versuch, aufzustehen und einen Blick nach draußen zu wagen, missglückte. Als sie sich aufsetzte, überkamen sie Schwindel und Übelkeit. Der Durst brannte schlimmer als zuvor.
Auf einem Stuhl neben ihr standen ein tönerner Krug und ein hölzerner Becher . Das Bett war schmal, sodass Hannah danach greifen konnte, ohne ihre Position zu ändern. Dennoch war die Anstrengung fast zu viel. Langsam führte sie den Becher an die Lippen, ließ das klare Wasser ihre Kehle hinabfließen, setzte erst ab, als das Gefäß restlos geleert war. Gerne hätte sie mehr gehabt, doch sie fühlte sich zu schwach, um sich nachzuschenken. Sie stellte den Becher ab und ließ sich zurück auf die Matratze sinken, die seltsam knisternde Geräusche von sich gab. Das Bettzeug entsprach nicht dem, was sie gewohnt war. Die Decke war aus grober Wolle, eine weitere zusammengelegte Decke ersetzte das Kissen. Es passte in dieses Zimmer, in dem alles aus Holz oder anderen Naturmaterialien zu sein schien. Ein seltsamer Ort. Ärmlich traf es nicht, eher altmodisch, irgendwie aus der Zeit gefallen. Kein Vergleich zu dem zeitgemäßen Glas- und Stahlgebäude, das sie ihr Zuhause genannt hatte. Modern und trotzdem gemütlich, mit vielen farbenfrohen Textilien, so hatte sie ihre Wohnung eingerichtet. Sie war stolz auf ihr schönes Heim. Oder war es vielmehr gewesen.
Ihr Leben war Vergangenheit. Sie hatte alles zurückgelassen. Es war ihr schwergefallen. Als sie ihr Handy auf der Flucht in einen Abwasserschacht hatte gleiten lassen, hatte es ihr beinahe das Herz gebrochen. Schließlich war dies der endgültige Kontaktabbruch zu allen Menschen gewesen, die ihr je etwas bedeutet hatten. Sie hatte keine Wahl gehabt, Miles hatte ihr keine Wahl gelassen.
Furcht. Was, wenn sie hier nicht sicher war?
Ihr Herz raste, ihr Atem ging schneller. Hektisch ließ sie den Blick schweifen, darauf gefasst, dass ihr Verfolger jeden Moment durch die Tür treten würde.
Die Angst verging so schnell, wie sie aufgekommen war. Das Gefühl von Sicherheit durchströmte sie. Dieser Ort war gut. Er würde ihr Schutz bieten. Woher diese Gewissheit kam, wusste Hannah nicht. Sie vertraute auf ihre Empfindung, so irrational dies sein mochte.
Nichtsdestotrotz zuckte sie zusammen, als die Tür geöffnet wurde. Mehrere Wimpernschläge starrte sie den bärtigen, blonden Mann an, der das Zimmer betrat. Kurz flackerten Bilder vor ihrem inneren Auge auf: sie in seinen Armen; er, wie er sich über sie beugte und ihr mit einem feuchten Tuch über das Gesicht fuhr. Erinnerungen an die letzten Stunden? Sie konnte es nicht beschwören.
Seine Augen schauten gütig. Wie lange war es her, dass jemand sie auf diese Weise angeblickt hatte. Viel zu lange.
»Du bist wach.« Sie mochte den Klang seiner Stimme. Raue Wärme.
Am liebsten wäre er nicht von ihrer Seite gewichen, aber Alex konnte seine Pflichten der Gemeinschaft gegenüber nicht komplett vernachlässigen. Nachdem er einen Tag und zwei Nächten beinahe ununterbrochen über sie gewacht hatte, ständig ihre Stirn kühlte, war ihr Fieber endlich geschwunden. An diesem Morgen hatten ihre Wangen nicht länger geglüht. Magdalena, die Heilerin des Dorfes, war der Meinung gewesen, die Fremde sei eindeutig auf dem Weg der Besserung und bedürfe keiner konstanten Fürsorge mehr. Dennoch hatte sie angeboten, hin und wieder nach ihr zu sehen. Dieses Angebot hatte Alex ausgeschlagen. Er hatte die fremde junge Frau gefunden, folglich war es allein seine Aufgabe, für sie zu sorgen. Und so machte er immer wieder Pausen, um nach ihr zu sehen. Vier Mal hatte er an diesem Morgen schon nach ihr geschaut, sie dabei stets schlafend vorgefunden.
Diesmal nicht. Sie war wach und blickte ihn mit großen Augen an. »Wo bin ich? Wie bin ich hierher gekommen? Wie lange bin ich schon hier? Wer bist du? Was hast du mit mir vor? Hast du die Polizei gerufen? Bitte, sag mir, dass du nicht die Polizei gerufen hast. Wer weiß, dass ich hier bin?« Sie klang panisch. Obwohl sie leise sprach, war da ein schriller Unterton in ihrer Stimme. Ihre Hände untermalten flatternd ihre Worte wie zwei durch eine umherschleichende Katze aufgeschreckte Vögelchen.
Es war nicht gut, wenn sie dermaßen außer sich geriet. Das brachte ihre Genesung in Gefahr. Er hob die Hände. »Beruhig dich bitte. Dir wird nichts geschehen. Niemand will dir etwas Böses.« Bei diesen Worten senkte er den Blick, sich der Tatsache bewusst, dass er sie belog. Dieser Ort war nicht so ungefährlich für sie, wie er vorgab. Noch war nicht über ihr Schicksal entschieden worden. Er hatte keine Ahnung, wie die anderen zu diesem Eindringling standen. Im Augenblick zählte nur, sie nicht zu ängstigen. Wie sie da saß, die Decke fest an sich gepresst, wirkte sie so verletzlich. Ohne das Fieberglühen war ihr Gesicht unnatürlich blass.
»Ich heiße Alex. Und du?« Er streckte ihr die Hände entgegen.
Sie schwieg, die Lippen fest aufeinander gepresst.
»Du willst mir deinen Namen nicht verraten? Warum nicht? Wovor hast du Angst?« Er setzte sich zu ihr auf die Bettkante. Sie wich zurück, zog die Knie an und schlang ihre Arme darum.
Es war besser, auf Abstand zu gehen. Als er das Geschirr vom Stuhl nahm, bemerkte den leeren Becher. »Möchtest du noch etwas trinken?«
»Ja, bitte«, sagte sie leise.
Er reichte ihr den gefüllten Becher, setzte sich auf die Stuhlkante. Sie trank so gierig, dass sie sich verschluckte, husten musste. Er wollte ihr helfen. Seine Berührung führte zu einem merklichen Zusammenzucken. Es würde nicht leicht werden, ihr die Ängste zu nehmen.
»Du hast mich gefragt, wo du bist. Die Frage ist leider nicht so leicht zu beantworten.« Er zögerte kurz. Durfte er ihr überhaupt erzählen, was es mit der Siedlung auf sich hatte? Oder brachte er sie und die Gemeinschaft damit in Gefahr? Verschlechterte er möglicherweise ihre Situation? Oder zwang er die Gemeinschaft so dazu, ihr das Recht zu bleiben zuzugestehen?
Unsicherheit und Zweifel lagen nicht in seinem Naturell. Seit er die fremde Frau gefunden hatte, hatten ihn diese fest im Griff.
Als spürte sie seinen Zwiespalt, bot sie an: »Vertrauen gegen Vertrauen. Ich verrate dir meinen Namen, wenn du mir erzählst, wo ich bin.«
Alex nickte. Er hätte es ihr ohnehin gesagt. Zum einen glaubte er nicht, dass die junge Frau eine Bedrohung für die Sache war; zum anderen, und das war sein eigentlicher Antrieb, wollte er unbedingt, dass sie ihm vertraute. »Du bist an einem Ort, der auf keiner Landkarte verzeichnet ist. Offiziell gibt es weder dieses Dorf noch die Menschen, die hier leben. Das ganze Gebiet in einem Umkreis von vierzig Kilometern ist als hochgradig verseuchtes und verstrahltes militärisches Sperrgebiet klassifiziert. Nur eine Handvoll Leute außerhalb weiß von diesem Projekt und unserer Anwesenheit hier.« Er schaute sie unverwandt an.
»Was ist das für ein Projekt?«
»Wir nennen es Newtopia. Es ist eine neue Form des Zusammenlebens.«
»Also eine Art Experiment?«, hakte sie nach.
Sie begriff schnell.
»Wenn du so willst«, antwortete er.
Sie runzelte die Stirn. »Warum unter einer solchen Geheimhaltung?«
»Um Einflüsse und Manipulationsversuche von außen zu vermeiden. Seit zehn Jahren haben wir keinen Kontakt zu Menschen von außerhalb. Oder besser gesagt, hatten.«
»Dann sollte ich wohl besser schnell wieder verschwinden.« Sie wirkte, als schwänge sie jeden Augenblick die Beine über die Bettkante und ginge davon.
So einfach würde das nicht werden. Spätestens nach seinen Ausführungen wusste sie zu viel. Aller Wahrscheinlichkeit nach würde sie bleiben müssen. Er sollte wütend sein über diese Störung des Experiments, doch er war es nicht. Sie in die Gemeinschaft aufzunehmen, erschien ihm gut und richtig. Da er nicht abschätzen konnte, wie sie auf die Aussicht, bleiben zu müssen, reagierte, antwortete er vage: »Erst einmal musst du wieder zu Kräften kommen. Du warst eine ganze Weile bewusstlos.«
»Wie lange?«
»Immer neue Fragen. Wie wäre es, wenn du mir erst einmal deinen Namen verrätst?« Der neckende Tonfall entschärfte die berechtigte Forderung.
Ein leichtes Lächeln umspielte ihre Lippen. »Ich heiße Hannah.«
Es klang, als wäre es die Wahrheit. Es spielte im Grunde genommen keine Rolle.
»Also Hannah, was deine Frage angeht: Du warst zwei Nächte und einen Tag bewusstlos. Als ich dich fand, hattest du sehr hohes Fieber.«
»Dann hast du mir das Leben gerettet. Danke.« Kein Glück über die zweite Chance sprach daraus, sondern stille Resignation.
Er verdrängte den Gedanken, dass Hannah hatte sterben wollen, und sagte freundlich: »Nichts zu danken. Was hast du allein da draußen in der Wildnis gemacht?«
Binnen eines Augenblicks verschloss sie sich. Sie schlug ihre neugierig auf ihn gerichteten Augen nieder. Angestrengt betrachtete sie das Muster der gewebten Wolldecke.