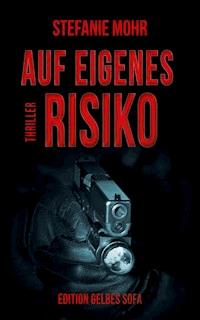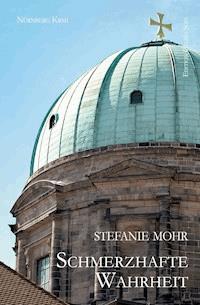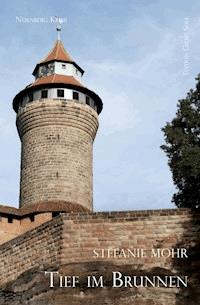Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Gelbes Sofa
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In der Erlanger Uni-Klinik erwacht der SEK-Beamte Maxwell Charles Schmidbauer aus dem Koma – nachdem ihn jemand am helllichten Tag in einer Autowerkstatt in den Kopf geschossen hatte – und kann sich zunächst an nichts erinnern. Doch dann stürzt ihn das Foto einer Tätowierung in ein Kaleidoskop der Erinnerungen: Szenen vom Tatort tauchen wieder auf und überblenden sich mit Erlebnissen während seines Einsatzes im Bosnien-Krieg. Wieder bei Kräften macht sich Maxwell auf die Jagd nach dem Kerl mit dem Piranha-Tattoo am Hals und folgt der Spur nach Lissabon. Auf der anderen Seite des Erdballs entgeht währenddessen die junge Journalistin Renata Teixeira nur knapp einem Anschlag, als sie im Auftrag eines Londoner Magazins auf einem Weingut in der Nähe von São Paulo für eine Reportage über brasilianischen Rotwein recherchiert. In keinem Versteck ist sie vor ihrem Verfolger sicher - weder auf einem Containerschiff, noch in Afrika oder London, wo sie versucht, die Abnehmer des Rotweins aufzuspüren, um mehr über die Machenschaften auf dem Weingut herauszubekommen. Immer wieder findet sie der Killer und fährt mit seiner grausamen Jagd fort. Wie belastend, wie explosiv sind die Unterlagen, die sie von der Winzerin vor deren Ermordung erhalten hat?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 553
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Piranha
Stefanie Mohr
Piranha
Stefanie Mohr
KINDLE EDITION
Stefanie Mohr, geboren 1972, liebt ihre Heimatstadt Nürnberg, in der sie (fast) jeden Winkel kennt. Sie wohnt und arbeitet als freiberufliche Autorin und Fotodesignerin im Nürnberger Norden. Nähere Informationen: www.stefanie-mohr.com
Renata Teixera ist eine junge ehrgeizige Journalistin in São Paulo. Sie befindet sich auf der Flucht, seit sie im Auftrag eines Londoner Klatschmagazins für eine Reportage auf einem brasilianischen Weingut recherchiert hat.
In keinem Versteck ist sie vor ihrem Verfolger sicher - weder auf einem Containerschiff, noch in Afrika oder London, wo sie versucht, die Abnehmer des Rotweins aufzuspüren, um mehr über die Machenschaften auf dem Weingut herauszubekommen. Immer wieder findet sie der Killer und fährt mit seiner grausamen Jagd fort. Wie belastend, wie explosiv sind die Unterlagen, die sie von der Winzerin vor deren Ermordung erhalten hat?
In Deutschland erwacht unterdessen Maxwell Charles Schmidtbauer, ein erfahrener SEK-Beamter, in der Erlanger Uni-Klinik aus dem Koma, nachdem ihm ein Unbekannter am helllichten Tag in einer Autowerkstatt in den Kopf geschossen hat.
Mit der schrittweisen Rückkehr seiner Erinnerung macht er sich nicht nur auf die Suche nach dem Mann mit einem Piranha-Tattoo am Hals, sondern kämpft auch gegen das Trauma aus der Zeit seines Bosnien-Einsatzes.
Copyright © Stefanie Mohr, 2014.
All Rights Reserved - Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggrafik: Dietmar Höpfl/shockfactor.de
Umschlaggestaltung: Stefanie Mohr
Verlag: Edition Gelbes Sofa, Inh. Stefanie Mohr, Nordring 125, 90409 Nürnberg
ISBN: 978-3-9816768-5-3
Originalausgabe
Für
Rudi, Jürgen und Rainer
May your soul arrive in heaven
half an hour before the devil knows you're dead
Mono Inc., »Forgiven«
1
São Paulo, Brasilien
Zweiundfünfzig Jahre Gefängnis. Renata Teixeiras Bleistift flog in ihrer notorisch eigenwilligen Kurzschrift über den Schreibblock. Je länger sich die Urteilsbegründung hinzog, desto labyrinthischer wurde ihr Kunstwerk. Wahrscheinlich würde sie in der Redaktion Schwierigkeiten bekommen, die Notizen wieder zu entziffern.
Erst allmählich sanken die Worte des Richters in ihr Gehirn. Zweiundfünfzig Jahre Gefängnis. Renata strich sich ihre langen schwarzen Locken zurück und sah quer durch den Gerichtssaal zum Angeklagten hinüber. Tiago da Moura Brandãos Gesicht war eine starre Maske, keine Gefühlsregung erkennbar. Der Tumult, der bei der Nennung des Strafmaßes ausgebrochen war, hielt die Menge um Renata noch immer auf den Beinen. Plötzlich wandte da Moura Brandão sich ihr zu. Für einen kurzen Augenblick bohrten sich seine Augen in ihre.
Er gehörte zum Primeiro Comando da Capital – dem PCC; einer berühmt-berüchtigten kriminellen Organisation mit Hauptsitz in São Paulo. Der Mann war einer der acht Bereichsbosse, die direkt den beiden Führern unterstellt waren und geschätzte viertausend Favela-Bosse befehligten.
Renata spürte keinerlei Mitleid wegen des hohen Strafmaßes, aber auch keine Genugtuung für die Opfer, deren Ermordung er angeordnet hatte. Das PCC würde die Gefängniswärter wie immer gut schmieren, sodass da Moura Brandão mit einem Mobiltelefon vom Knast aus seinen Geschäften nachgehen konnte – oder er wurde von einem anderen Kerl abgelöst, der schon bereitstand, um seinen Platz einzunehmen.
Renata war früh in ihrer Journalistenkarriere mit dem PCC konfrontiert worden. Die erste ihr übertragene große Berichterstattung drehte sich um den Fall des ermordeten Richters Antônio José Machado Dias. Er war für die Gefängnisaufsicht im Bundesstaat São Paulo zuständig gewesen und wurde auf dem Heimweg in Presidente Prudente auf offener Straße getötet. Im Fahrwasser ihrer Recherchen stieß Renata auf den Mord an einer dreiundzwanzigjährigen Kulturredakteurin, die ebenfalls in Presidente Prudente aus nächster Nähe erschossen worden war. Wie Renata vom Herausgeber der Tageszeitung erfuhr, berichtete die Kollegin eine Woche vor ihrem Tod über einen Werbeevent in einem Supermarkt, der einem Mitglied des PCC gehörte. Noch am selben Abend durchsuchte die Polizei den Laden und schloss ihn. Mutmaßungen wurden laut, das PCC könne geglaubt haben, die junge Frau hätte den Event als Vorwand benutzt, um Informationen zu beschaffen und Aktivitäten auszuspähen, die sie an die Polizei weitergab. Schließlich meldete sich ein Zeuge, den der mutmaßliche Mörder gezwungen hatte, ihn in seinem Auto in den Nachbarstaat Mato Grosso du Sul zu bringen. Auf der Flucht gestand er ihm, er sei vom PCC beauftragt worden, die junge Journalistin umzubringen. Auch der Mörder des Richters sei ein Auftragskiller gewesen.
Über ihre Gedanken an die Anfänge ihrer Karriere verließ Renata das Gericht und trat auf die Straße.
Das Tribunal de Alçada Criminal lag im zentralsten Innenstadtviertel von São Paulo. Wirtschaftszentrum und größte Stadt Brasiliens, zwanzig Millionen Einwohner. In der Nähe eine fünfspurige Hauptstraße, Höchstgeschwindigkeit: siebzig Stundenkilometer – die Taxis fuhren über hundert, fürchterlicher Verkehrslärm, der Smog greifbar in der Luft.
Ein Auto wartete mit laufendem Motor am Bordstein, ein weißer VW, mit Beulen und Rostflecken, ein Privatwagen, kein Dienstwagen der Redaktion. Der Fahrer rauchte einen Zigarillo und hielt Ausschau nach Parkwächtern. Das Kennzeichen hatte eine Sechs als letzte Ziffer. Renata grinste: Zé hätte an dem Tag gar nicht mit dem Auto fahren dürfen.
Er sah sie kommen, beugte sich herüber und öffnete ihr die Tür von innen.
»Was tust du hier?« Renata stieg ein.
»Wir müssen nach São Roque.«
»Jetzt?«
»Die Frau des Winzers hat angerufen.«
»Moema Parzeres?«
Zé nickte. »Sie sagt, wenn wir Fotos machen wollen, müssen wir heute Nachmittag kommen. Morgen haben sie alle Rebstöcke abgeerntet.«
»Dann fahren wir eben.«
»Es wird uns nichts anderes übrigbleiben.« Zé, eigentlich José Antônio Corrêa dos Santos Leite, entdeckte eine Lücke im Verkehr und trat aufs Gaspedal.
Das Weingut Casa Garibaldina lag rund fünfundsechzig Kilometer westlich von São Paulo im gleichnamigen Bundesstaat. Die Fahrt würde eine gute Stunde dauern. Renata zog ihren Schreibblock aus der Handtasche und verfasste konzentriert einen Kommentar über das Gerichtsverfahren. Dann rief sie in der Redaktion an und diktierte ihn der Sekretärin.
»Kommst du heute nicht mehr her?«, fragte Adriana.
»Wenn, dann erst spät. Ich bin mit Zé unterwegs. Eine freie Sache. Das Weingut, ich habe dir davon erzählt.«
»Okay. Wir sehen uns morgen. Sag Zé, er soll nicht so viel rauchen.«
Renata lachte und legte auf. Sie hatten die Innenstadt hinter sich gelassen. Im dichten Verkehr fuhren sie durch die Außenbezirke.
»Wie bist du eigentlich an den Job gekommen?«, fragte Zé, während er sich einen weiteren Zigarillo ansteckte.
»Erinnerst du dich an den EU-LAK-Gipfel, bei dem ich letztes Jahr war? Ich habe dort Journalisten aus London kennengelernt. Einer von ihnen hat mir eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob ich für sein Magazin einen Beitrag über brasilianische Rotweine schreiben könnte.«
»Und du hast zugesagt? Lifestyle ist doch überhaupt nicht dein Ressort.«
»Ich will den Kontakt halten. Netzwerke sind wichtig. Man weiß nie, wozu man die Kollegen mal braucht.« Sie machte eine Pause. »Du musst dort vorn rechts abbiegen. Es ist nicht mehr weit. Bald kannst du die ersten Weinberge sehen. Ich war letzte Woche schon einmal hier.«
»Warum ausgerechnet Casa Garibaldina?«
»Der Kollege in London hat es in seiner Mail genannt, er hat schon davon gehört.«
»Und die Winzer?«
»Moema Parzeres und ihr Mann Edmundo haben den Betrieb vor einigen Jahren von Moemas Eltern übernommen. Es gibt zwei kleine Töchter. Die Alten leben auch auf dem Hof und packen bei der täglichen Arbeit mit an. Wenn sie gerade bei der Weinernte sind, wird es nur so von Erntehelfern wimmeln. Fang mit deiner Kamera die Stimmung ein.«
Sie folgten einer schmalen, staubigen Straße zu einer Anhöhe hinauf. Vor ihnen erstreckte sich ein langgezogenes Tal. Die Hänge zu beiden Seiten waren voller Rebstöcke. Zé stellte den Wagen an den Straßenrand und stieg aus, um ein paar Panoramaaufnahmen zu machen.
Renatas Augen glitten über die Berghänge, folgten der sich windenden Straße hinab zu dem imposanten Anwesen. Sie hatte erwartet, dass die Straße zu beiden Seiten von Autos gesäumt wäre und Traktoren mit Anhängern voller Weintrauben sich hindurchschlängelten, doch das Tal lag still und verlassen vor ihr. Keine Menschenseele war zu sehen. Hoffentlich hatte die Winzerin sie nicht falsch verstanden. Sie wollte brasilianische Betriebsamkeit und Lebensfreude in ihrem Artikel vermitteln – nicht die abgeschiedene Idylle des Weinguts.
»Eine himmlische Ruhe, findest du nicht?« Zé packte seine Kamera weg und stieg wieder ins Auto. Die letzten zwei Kilometer fuhren sie schweigend.
Das Anwesen wurde von einer drei Meter hohen Mauer umgeben, an welcher der Putz großflächig abgefallen war und das darunterliegende nackte Mauerwerk zum Vorschein kam. Der ärmliche Eindruck wurde von dem in der Sonne blitzenden Natodraht konterkariert, der in Doppelreihen auf der Mauer angebracht war.
Das grüne Metalltor mit den großen Rostflecken stand offen, Zé fuhr auf den Hof. Vor ihnen lag das Haupthaus, ein flacher, im brasilianischen Kolonialstil gehaltener Bau, gestrichen mit der typisch weißen Kalkverdünnung. Die weithin sichtbaren Dächer aus roten Lehmziegeln erstreckten sich weit über die Wände und liefen in Traufen aus. Von den Kindern vergessenes Spielzeug lag verstreut im rötlichen Staub.
Renata stieg aus und sah sich stirnrunzelnd um. Die harte Mittagssonne warf kurze Schatten. Kein lebendes Wesen weit und breit. Nicht einmal eine Katze.
Das Zuschlagen der Autotür in ihrem Rücken klang in der Stille wie eine kleine Explosion. Renata zuckte zusammen und fuhr herum. Mit lautem Krächzen erhob sich ein Riesentukan vom Dachfirst eines Nebengebäudes, sein glänzendes schwarzes Gefieder und der lange gelbe Schnabel gut sichtbar. Zé hob entschuldigend die Hände. Er hatte seine Kameratasche und das Stativ geschultert. Renata wandte sich ab.
»Hallo?«, rief sie. »Jemand zu Hause?«
Keine Antwort.
»Schau mal!« Zé stand vor einem kniehohen gemauerten Becken, von dem der Winzer bei ihrem ersten Besuch erklärt hatte, dass darin die Trauben gewaschen würden. »Sind das Piranhas?«
Renata ging hinüber. Zé hatte recht: Die unscheinbaren silbrig glänzenden Fische waren Piranhas. Es schwamm aber noch etwas anderes in dem Wasser. Fell. Eine tote Katze.
Ein Schauder lief Renata über den Rücken. Trotz der Hitze bekam sie eine Gänsehaut. Irgendetwas stimmte hier nicht. Ihr Instinkt befahl ihr, zum Auto zurückzugehen und wegzufahren.
Ein leises Quietschen in ihrem Rücken. Erneut fuhr Renata herum. Die Haustür stand offen. Im Inneren war es dunkel, auf dem Hof gleißender Sonnenschein. Der Umriss einer Gestalt zeichnete sich im Rahmen ab. Renata konnte sie nicht richtig erkennen.
»Moema?«
»Kommen Sie herein.« Eine schleppende Frauenstimme.
»Wo ist Moema?«
Die Gestalt drehte sich um und verschwand. Zé sah Renata fragend an. Sie zuckte mit den Schultern.
»Vielleicht die Mutter.«
Gemeinsam überquerten sie den Hof, traten ins Dunkel. Die schmalen Ritzen in den geschlossenen Fensterläden gaben kaum Licht. Ein süßlicher Geruch hing in der Luft. Sofort krampfte sich Renatas Magen zusammen. Der Gestank erinnerte sie an ihre Kindheit, an die Besuche im Schlachthaus, wo ihre Tante gearbeitet hatte, bevor sie ihrer Liebe zum Segeln nachgab. Jetzt glaubte Renata, das panische Blöken der Tiere wieder zu hören.
Ein Stöhnen drang aus einem Zimmer zu ihrer Rechten. Renata erstarrte, Zé drängte sich an ihr vorbei, griff nach der Türklinke. Renata packte ihn am Arm, wollte ihn zurückhalten.
Zu spät.
Im selben Moment, in dem Zé die Tür aufstieß, ertönten Schüsse. Drei Stück, getrennt nur von einer minimalen Pause. Zés schwerer Körper wurde gegen Renatas geworfen, warme, klebrige Flüssigkeit spritzte ihr ins Gesicht, in den Mund, in die Augen. Sie taumelte, fiel gegen die Wand, sank auf ein Knie, würgte, spuckte, rappelte sich hoch, sah die Hälfte von Zés Kopf an der Tapete kleben, rutschte mit dem linken Fuß in einer Lache aus, strauchelte gegen eine angelehnte Tür, drückte sie auf, fiel zu Boden.
Ein einzelner Schuss.
Sie schrie, kam auf die Füße, lief auf ein helleres Viereck im Dunkeln zu. Ein Durchgang. Vor ihr die Küche. Ein Mann auf einen Stuhl gefesselt, die Kehle durchgeschnitten. Auf dem Boden vor dem Herd drei Körper, ein großer und zwei kleine, Moema und ihre beiden Töchter.
Renata erreichte das Fenster, riss es auf. Ihr Herz raste. Hinter ihr absolute Stille. Grabesstille. Sie sah hinaus. Drei Meter bis zu einem schmalen Grat neben den Grundmauern, dann ein steiler Abhang zum Weinberg hinunter.
Springen oder erschossen werden?
Sie sprang, kam auf den Füßen auf, verlor die Balance. Eine Dreiersalve ertönte. Sand spritzte auf, ein brennender Schmerz am Oberarm, sie fiel auf die Knie, kippte vornüber, rollte den felsigen Abhang hinunter, schlug sich die Stirn auf, schlitterte über lose Steinchen, blieb mit einem Fuß in einem Rebstock hängen, ein Ruck, Schmerzen im Knöchel. Sie strampelte sich frei, kroch eng gegen den Boden gepresst weiter.
Nichts war zu hören außer dem Hämmern ihres Herzschlags in ihren Ohren. Blut rann ihr in die Augen. Diesmal ihr eigenes. Sie robbte weiter. Wagte nicht, sich umzudrehen und zurückzuschauen. Minute um Minute verstrich.
Ein paar hundert Meter von ihr entfernt stand eine kleine Hütte mitten in den Weinbergen. Moema hatte sie ihr bei ihrem ersten Besuch gezeigt. Sollte sie dort Schutz suchen? Was, wenn der Mann, der Zé erschossen hatte, sie ebenfalls kannte?
Renata entschied sich dagegen, kroch nach Westen, kam nur langsam voran, alle paar Meter versperrten ihr Weinstöcke und Drähte den Weg.
Plötzlich hörte sie einen Motor, ein schwarzer Fiat rollte aus dem Weingut. Sofort drückte sie sich wieder dicht auf den Boden.
Der Mann fuhr unendlich langsam, suchte sie, verschwand hinter einer Serpentine.
Renata sprang auf und riss sich die fleckenübersäte weiße Bluse vom Leib. Ihre karamellfarbene Haut war unauffälliger, ähnelte der staubtrockenen Erde. Gebückt lief sie, so schnell sie konnte, den Weinberg hinauf. Sie keuchte vor Anstrengung. Die Zunge klebte ihr am Gaumen, sie hatte Durst.
Wieder hörte sie den Motor, warf sich flach auf den Boden, halb in eine Mulde, wagte nicht, sich zu bewegen. Horchte, blinzelte mit einem Auge.
Der Wagen hielt neben der kleinen Hütte.
Zum Glück hatte sie die entgegengesetzte Richtung gewählt, sonst säße sie nun in der Falle.
Sie schloss die Augen, sah Zé vor sich, ohne Kopf. Tränen drückten gegen ihre Augenlider, quollen unter ihren Wimpern hervor, liefen ihr über die Wange. Ihr ganzer Körper zitterte.
Nach einer Weile sprang der Motor wieder an, kam näher, rollte einen schmalen Feldweg entlang, der nur hundert Meter unter ihr vorüberführte.
Sie drückte sich noch tiefer in die Mulde, hielt den Atem an, betete.
Endlich entfernte sich das Motorengeräusch. Ihre Muskeln entspannten sich allmählich, dennoch: Sie traute sich nicht, sich zu bewegen. Er könnte zurückkommen; über ihr gab es einen weiteren Weg.
Die Schatten wurden allmählich länger. Nichts war zu hören außer dem Ruf des Riesentukans – und ihrem eigenen erstickten Schluchzen. Vorsichtig stand sie auf. Ihr Knöchel schmerzte mehr als vorher. Dafür war jetzt keine Zeit. Sie biss die Zähne zusammen und humpelte den steilen Weinberg hinauf, ihre Hände umklammerten die langen Reben, suchten Halt.
Während sie in der Mulde lag, hatte sie sich die Karte ins Gedächtnis gerufen, die sie vor ihrem ersten Besuch studiert hatte. Sie marschierte los, in Richtung Zivilisation, so schnell es ihr Knöchel erlaubte.
Noch bevor sie ein nordwestlich des Weinguts gelegenes kleines Dorf erreichte, kam sie zu einem einsamen Gehöft. Ein Geländewagen stand vor dem Haus, von einem schwarzen Fiat war weit und breit nichts zu sehen. Dennoch versteckte sie sich in einem Gebüsch und beobachtete das Anwesen eine Weile. Niemand kam, niemand ging.
Als die Dämmerung hereinbrach, fasste sie Mut und schlich in großem Bogen um den Bauernhof. Auch auf der Rückseite stand kein schwarzer Fiat.
Mit zitternden Knien wagte sie sich auf das Grundstück. Sie war nicht weit gekommen, als sie plötzlich ein Knurren erschreckte. Im nächsten Moment sah sie die Silhouette eines großen Hundes. Er rannte direkt auf sie zu, bellte, fletschte die Zähne. Renata blieb wie angewurzelt stehen. Dann wurde der Hund mitten im Sprung zurückgerissen. Ein metallenes Klirren, die Kette, an der er lag, war bis zum Äußersten gespannt.
Renata rannte zum Eingang und hämmerte gegen das verwitterte Holz. Eine Frau öffnete. Sobald sie Renatas blutverschmiertes Gesicht und die zerrissenen Kleider sah, wollte sie die Tür wieder zuschlagen. Panisch stemmte Renata ihre Hände gegen das spröde Holz und lehnte sich mit ihrem ganzen Gewicht dagegen.
»Es hat einen Überfall auf Casa Garibaldina gegeben. Die Parzeres sind tot«, schrie sie.
»Damit wollen wir nichts zu tun haben. Gehen Sie weg!« Die Frau keuchte vor Anstrengung, während sie versuchte, die Haustür zuzudrücken.
»Bitte! Sie müssen mir helfen.« Renatas Stimme stand kurz davor zu kippen. Die erhoffte Sicherheit, so greifbar nah und doch so fern.
»Gehen Sie weg!«
»Ich bin Journalistin. Ich habe nichts mit der Sache zu tun!« Noch einmal warf sie sich mit aller Kraft dagegen, aber die andere Frau war stärker. Die Tür fiel ins Schloss, ein Schlüssel knirschte. Renatas Brust entfuhr ein verzweifeltes Heulen. Sie schlug mit den Fäusten gegen das Holz. »Rufen Sie die Polizei. Bitte. Rufen Sie die Polizei!« Rasch rannte sie zum Fenster, klopfte an die Scheibe.
»Keine Polizei! Gehen Sie weg, oder ich schieße!«
Zu ihrem Entsetzen sah Renata durch das schmutzige Glas, dass die Frau eine Schrotflinte in der Hand hielt. Tränen rannen ihr über das Gesicht, als sie sich abwandte und zurück auf die staubige Straße lief.
Sie war erst wenige hundert Meter gegangen, als sie plötzlich von zwei grellen Lichtkegeln erfasst wurde. Warum hatte sie das Auto nicht kommen hören? Sie blieb stehen, paralysiert, ihr Herz hämmerte, ihr Hirn schrie »Renn!«, und doch setzten sich ihre Beine nicht in Bewegung. Nur ihre Hand hob sich langsam, spreizte die Finger, um ihre Augen vor den blendenden Scheinwerfern zu schützen.
»Was ist passiert?« Eine Männerstimme. »Brauchen Sie Hilfe?«
Renata kniff die Augen zusammen und versuchte, den Sprecher zu erkennen, aber er verbarg sich hinter der offenen Fahrertür des Wagens. Ein Jeep. Kein schwarzer Fiat. Ein Jeep!
»Was ist Ihnen zugestoßen?«
Renata sah an sich hinab. Ihre Brust wurde nur zum Teil von ihrem verdreckten BH verborgen, die Bluse lag in den Weinbergen, ihre Hose war voller Flecke und hatte Risse. Schützend hob sie die andere Hand vor ihren Oberkörper.
»Polizei«, stieß sie hervor. »Rufen Sie die Polizei. Bitte!« Noch während sie sprach, sah sie, wie der Mann langsam auf sie zukam. Panik ergriff sie, sie wusste, dass sie nicht genug Kraft hatte, um vor ihm davonzurennen. »Bleiben Sie, wo Sie sind!«
»Mein Name ist Aurelio Buarque. Ich bin Polizist.« Er blieb stehen, hob die Hände leicht zur Seite, so, als wolle er ihr signalisieren, dass er ihr nichts tun werde. »Ich habe einen Ausweis.« Langsam glitt seine Hand zur Hosentasche, entnahm ihr den Geldbeutel und zog eine schmale Plastikkarte heraus. Wieder machte er ein paar Schritte auf sie zu, bis sie das Dokument sehen konnte.
Grenzenlose Erleichterung. Renatas Körper begann unkontrolliert zu zittern, als die Anspannung von ihr abfiel. »Ich bin überfallen worden. Es war ... schrecklich.« Ihre Stimme versagte, Tränen rannen über das Gesicht.
Der comissário griff sie behutsam am Ellbogen und führte sie zu seinem Auto. »Beruhigen Sie sich. Ich bringe Sie jetzt zu meiner Dienststelle. Dann erzählen Sie, was passiert ist.«
2
Erlangen, Deutschland
Eine Hand kroch Millimeter für Millimeter über den Verband. Tastete von der Stirn über die pochende Schläfe hinab zum bartstoppeligen Kiefer. Ein leises, raspelndes Geräusch war zu hören.
Es dauerte eine Weile, bis sein Gehirn die Verbindung zwischen dem herstellte, was sein Kinn spürte und was seine Fingerspitzen fühlten. Dann erkannte er, dass die Finger, die sein Gesicht betasteten, seine eigenen waren. Langsam ließ er die Hand sinken und noch langsamer schlug er die Augen auf.
Minutenlang starrte er an eine weiß getünchte Zimmerdecke mit verwaschenen grauen Schlieren. Schließlich drang ein penetrantes Piepen ganz in seiner Nähe in sein Bewusstsein. In Zeitlupe drehte er den Kopf zur Seite. Ein greller grüner Punkt sprang neben ihm auf und ab.
Wieder lag er minutenlang bewegungslos da, starrte auf seinen sichtbar gemachten Herzschlag.
Eine Erkenntnis schob sich durch das vernebelte Labyrinth seiner Gehirnwindungen. Nach einer Weile verlor sie die Orientierung, verweilte bei lang verloren geglaubten Gedanken. Dann irrte sie weiter und gelangte endlich in die Zentrale.
Kran-ken-haus!
Das Wort verursachte Panik.
Warum? Warum bin ich in einem Krankenhaus?
Irgendwo in der Nebelwelt, die ihn umgab, musste die Antwort liegen.
Er sandte Kundschafter aus in die unendlichen Weiten seines Gehirns, befahl ihnen, nicht ohne brauchbare Resultate zurückzukehren. Vor Anstrengung presste er die Augen zusammen. Doch alle Puzzleteile, die sie aus entlegenen Ecken hervorlockten, passten nicht.
Sein Kopf fühlte sich an, als werde er jeden Moment explodieren. Er wollte aufgeben, sich einfach zurücksinken lassen in die weichen weißen Wolken.
Nein! Er hatte noch nie aufgegeben. Er erlaubte sich keine Schwächen. Er suchte weiter, tastete sich durch Monate, Wochen, Tage, Stunden, Minuten.
Nach einer Unendlichkeit bekam er ein verschwommenes Bild zu fassen: Er hielt eine Waffe in seinen Händen. Zielte. Schoss.
Und dann?
Ein Zittern lief durch ihn hindurch, ihm wurde heiß und kalt. Langsam glitt er in ein gähnend weißes Loch.
3
Erlangen, Deutschland
Wieder schlug er die Augen auf. Weiße Decke, chemischer Geruch, regelmäßiges Piepen neben seinem Ohr. Kein Traum – er war im Krankenhaus. Der Nebel in seinem Gehirn lichtete sich ein wenig.
Sein Körper. Was war mit seinem Körper?
Nach einer gefühlten Ewigkeit gelang es ihm, die Hand davon zu überzeugen, tiefer zu gleiten, sich unter das dünne Laken zu schieben und seinen Leib zu betasten. Feststand: Er war nackt. Weder trug er Pyjama noch Unterhosen.
Plötzlich ertönte ein lautes Geräusch, dem Heulen einer amerikanischen Polizeisirene nicht unähnlich. Er zuckte zusammen. Tausend kleine Nadelstiche rannten seine Wirbelsäule entlang vom Nacken bis zum Steißbein. Die Härchen auf seinen Armen stellten sich auf. Im selben Moment flog die Zimmertür auf. Ein kühler Luftzug traf ihn an seiner schweißnassen Stirn.
Menschen in grüner Kleidung stürzten in den Raum. Ein Gesicht beugte sich über ihn. Zitternd und unendlich langsam zog er die Hand wieder unter der Leinendecke hervor. Ein Kabel hatte sich in der Kanüle auf seinem Handrücken verfangen. Mit einem Mal wich die Anspannung aus den ernsten Gesichtszügen. Behandschuhte Finger griffen nach dem losen Ende des Kabels, eine zweite Hand schob das Laken ein Stück zur Seite. Langsam folgten seine Augen den Bewegungen, beobachteten, wie der Druckknopf wieder an der Elektrode auf seiner Brust befestigt wurde. Die Sirene verstummte, das rhythmische Piepen seines Herzens setzte ein.
Er hob den Blick, sah in helle, graublaue Augen mit einem dunklen Rand um die Iris. Ein schwacher Duft nach Honig lag in der Luft.
»Ich bin Dr. Susanne Schirmer. Sie sind in der Uni-Klinik Erlangen.« Die Frau sprach langsam und überdeutlich. »Können Sie mich verstehen?«
Er nickte.
»Gut. Das ist sehr gut.« Behutsam tupfte sie ihm den Schweiß vom Gesicht. »Wie heißen Sie?«
Seine Zunge klebte an seinem ausgetrockneten Gaumen. Angestrengt versuchte er, ein wenig Spucke in den Mund zu bekommen. Die Frau bemerkte seine fruchtlosen Bemühungen, griff nach einem Feuchtigkeitsstäbchen und benetzte damit seine spröden Lippen, drang sanft in die Mundhöhle, fuhr über seine Zunge.
»Besser?«
Er nickte, schluckte, dann konnte er endlich antworten. »Maxwell ... Charles ... Schmidbauer.« Die Stimme, die seinen Namen flüsterte, klang rau und brüchig – und so gedehnt, als spreche er in Zeitlupe.
»Sehr gut.« Aufmunternd berührte Dr. Schirmer seine Schulter. »Können Sie mir auch Ihr Geburtsdatum nennen?«
Hätte seine ausgetrocknete Kehle es zugelassen, hätte Maxwell gelacht. So zuckten nur seine Bauchmuskeln ein paarmal krampfartig. Wie sollte er das je vergessen? »The day ... the music ... died.«
Die sanft geschwungenen Augenbrauen der Ärztin wanderten nach oben.
»3. Februar 1959. Der Tag ... an dem ... Buddy Holly ... starb. Meine Mutter ... war ein großer Fan.«
»Es ist ein gutes Zeichen, dass Sie sich an all das erinnern.« Die zwei Grübchen neben ihren Mundwinkeln vertieften sich. »Können Sie mir die Hand drücken?«
Sie hielt ihm ihre Finger ein kurzes Stück von seinen entfernt entgegen. Millimeterweise schaffte er es, seine Hand hochzuheben. Als sich ihre Fingerspitzen schließlich berührten, war sein Händedruck so schlaff, dass er sich schämte. Sie lobte ihn trotzdem überschwänglich.
»Was ist ... passiert?« Endlich wagte er die Frage zu stellen, die ihm schier den Verstand raubte.
»Der Rettungshubschrauber hat Sie am Samstag mit einer Kopfschussverletzung zu uns gebracht. Sie hatten ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und wurden sofort operiert. Seither lagen Sie im Koma. Sechs Tage. Wir haben uns große Sorgen um Sie gemacht.«
Ein Kopfschuss? Erneut bemühte er sich, seinem Gehirn Bilder abzuringen, aber da war nichts. Kein Knall. Kein Schmerz. Er wusste nicht einmal, wo er Samstag gewesen war.
»Ich kann mich ... an nichts ... erinnern.«
»Das wird schon wieder.« Eine Floskel. Dr. Schirmer hielt einen Augenblick inne. »Versuchen Sie jetzt zu schlafen. Es ist mitten in der Nacht.«
4
São Paulo, Brasilien
Renata drückte die Klingel und wartete ungeduldig auf das Knacken in der Sprechanlage. Immer wieder sah sie sich über die Schulter, bemerkte jedoch nichts Verdächtiges. Das Taxi, das sie nach Hause gebracht hatte, war schon längst verschwunden. Mit einem leisen Klack schaltete sich die Außenbeleuchtung über der Pforte ein. Renata wusste, dass der Sicherheitsdienst des Hochhauses, in dem sie wohnte, sie nun auf seinem Bildschirm sehen konnte.
»Mein Name ist Renata Teixeira.« Sie hielt ihren Ausweis direkt in die Kamera. Zum Glück hatte sie wie immer ihren Geldbeutel in der vorderen rechten Hosentasche bei sich gehabt, um ihn vor Diebstahl zu schützen – daher war er nicht verschwunden wie all die anderen Dinge, die in Zés Auto gelegen hatten. »Ich bin die Mieterin von Appartement elf-fünf. Sie müssen mir helfen. Ich wurde überfallen, meine Handtasche und meine Schlüssel sind weg.«
»Santo Deus! Senhora Renata, kommen Sie herein«, rief einer der beiden Wachmänner durch die Sprechanlage. Renata erkannte seine Stimme. Carlos. Mitte zwanzig, spitz zulaufendes Ziegenbärtchen, gedrungen, ansehnliche Armmuskeln, eine lange Narbe auf der linken Wange, über deren Herkunft er eisern schwieg. Aufgewachsen in einem Armenviertel, hatte er ein feines Gespür für Menschen und Situationen entwickelt. Er hatte sie – gegen großzügige Bezahlung – schon das eine oder andere Mal als Personenschützer begleitet, wenn sie für ihre Recherchen in unsichere Stadtteile musste.
Der Türsummer ertönte, Renata stieß die schwere metallene Gartenpforte auf. Die Männer des Sicherheitsdienstes saßen in der mit Panzerglas verkleideten Kanzel.
»Was kann ich für Sie tun, Senhora?«, fragte Carlos durch ein Mikrofon. Renata fühlte, wie sein Blick über ihr blutverschmiertes Gesicht, den schmutzigen BH und die zerrissene fleckige Hose glitt. »Soll ich einen Krankenwagen rufen? Oder die Polizei?«
»Ich möchte etwas aus meiner Wohnung holen – können Sie mir mit dem Generalschlüssel aufsperren?«
Carlos schien erleichtert. Er stand auf und ging zu einem Panzerschrank, den er nur gemeinsam mit der Berechtigungskarte seines Kollegen öffnen konnte, und entnahm ihm den Schlüssel zu Appartement fünf im elften Stock.
»Was ist passiert?«, fragte er, während sie in den Fahrstuhl stiegen.
»Ich habe mit einem Kollegen das Weingut besucht, über das ich eine Reportage schreiben wollte. Ich hatte Ihnen von dem Auftrag erzählt, erinnern Sie sich?«
Carlos nickte.
»Als wir ankamen, war dort ein Mann, er hat auf uns geschossen. Ich konnte fliehen, mein Kollege ... nicht.« Tränen quollen aus ihren Augen. Unwirsch wischte sie sie weg. Sie durfte nicht zusammenbrechen. Nicht jetzt. Zeit, um Zé zu trauern, würde sie später haben.
»Waren Sie bei der Polizei?«
»Ja, in São Roque.«
Carlos fragte nicht weiter. Renata wusste, dass er ein gespaltenes Verhältnis zur Obrigkeit hatte.
Die Aufzugtür glitt zurück. Nervös sah sie den schmalen Flur entlang. Fast erwartete sie, der Mann, der auf sie geschossen hatte, werde hinter einer Abmauerung hervorspringen und wieder auf sie feuern. Ein Zittern lief durch ihren Körper.
Carlos berührte sie am Ellbogen und führte sie aus der Kabine. »Alles ist gut. Kein Fremder befindet sich im Haus.« Dennoch sperrte er ihr Appartement auf, ging hinein und durchsuchte es rasch. »Niemand da.«
»Können Sie warten? Ich brauche nur fünf Minuten.«
»Kein Problem.«
Hastig holte sie ihren Hartschalenkoffer aus dem Schrank und warf wahllos Kleidungsstücke hinein, bis er fast voll war. Dann ging sie ins Wohnzimmer, holte ihren Laptop und stopfte die Dokumente, die auf ihrem Schreibtisch verstreut lagen, in ein großes Kuvert. Beides packte sie ebenfalls in ihren Koffer, bevor sie ihn schloss und zu Carlos zurückkehrte.
»Haben Sie kein Verbandszeug?« Sein Blick streifte ihren Arm und ihr Gesicht.
Sie schüttelte den Kopf.
»So können Sie nicht auf die Straße gehen.« Er führte sie ins Bad, befeuchtete ein Handtuch und wusch ihre Wunden behutsam aus. »Gibt es hier irgendwo Alkohol?«
Renata wies zu einer kleinen Bar im Wohnzimmer. Carlos ging hinüber und inspizierte die Flaschen.
»Beißen Sie die Zähne zusammen. Es wird brennen wie Feuer – aber wir müssen Ihre Verletzungen desinfizieren, sonst entzünden sie sich.«
Trotz der Warnung zuckte Renata reflexartig zurück, als der erste Tropfen ihre geschundene Haut berührte, und schrie erschrocken auf. Ohne zu zögern, legte Carlos ihr seine Hand über Mund und Kinn und hielt ihren Kopf gegen seinen Körper gepresst, während er vorsichtig noch mehr Rum in die Wunde träufelte. Sie schrie gegen seinen Handballen. Der Schmerz war kaum auszuhalten. Tränen sickerten unter ihren geschlossenen Augenlidern hervor.
»Gleich haben Sie es überstanden.« Carlos ließ ihren Kopf los und griff nach ihrem Arm. »Versuchen Sie die Zähne zusammenzubeißen, bevor Ihre Nachbarn meinen Kollegen rufen!«
Wieder ein Gefühl, als stoße er eine heiße Klinge in ihren Körper. Sie sog scharf die Luft ein, wimmerte, stöhnte, dann ließ er sie los.
»Das ist nicht optimal, aber besser als nichts.« Er musterte sie besorgt. »Wo wollen Sie hin?«
»Ich weiß nicht«, murmelte sie. »Untertauchen, nur zur Sicherheit, für ein paar Tage.«
»Achten Sie bei dem Hotel darauf, dass es eine ordentliche Feuertreppe gibt – und dass von außen niemand hereinkommen kann, Sie aber die Möglichkeit haben, jederzeit zu fliehen. Das Capitania ist zum Beispiel so gebaut und das Porto Do Sol oder das Jardins.«
Renata nickte.
»Haben Sie eine Waffe?«
Renata schüttelte den Kopf.
»Wenn Sie Hilfe brauchen, rufen Sie mich an. Ich habe noch ein paar Tage Urlaub, die ich nehmen kann.«
5
Erlangen, Deutschland
»Hi! Alles klar? Wie geht’s dir?« Die Stimme klang hoch, fast piepsig, wie aus einem Walt-Disney-Film und wollte so gar nicht zu dem großen, breitschultrigen Mann passen.
»Mickey ... Mouse«, murmelte Maxwell. Der Nebel ließ ihn nicht los.
»Hey! So ganz können sie dir das Gehirn nicht weggepustet haben, wenn du mich trotz der Verkleidung wiedererkennst.« Der Hüne deutete auf den grünen Kittel, den er über seiner Straßenkleidung trug.
Maxwell musste sich darauf konzentrieren, dass ihm die Augen nicht zufielen.
»Mensch, hast du uns allen einen Schrecken eingejagt.« Mickey beugte sich über das Bett, boxte ihn sanft gegen die Schulter. »Aber jetzt wird alles wieder gut, sagen die Ärzte.«
»Was ... tust du hier?«
»Dich beschützen.«
»Warum? Was ... ist ... passiert?« Ein verwaschenes Lallen.
»Oh Mann, du klingst wie damals, als du auf Bum-Bums Ausstand einen über den Durst getrunken hast und uns danach das Surfen auf der Motorhaube bei Tempo siebzig beibringen wolltest. Erinnerst du dich?«
In dem Augenblick kam eine Krankenschwester herein, blieb abrupt an der Tür stehen. »Was ist hier los? Sie wissen doch, dass Herr Schmidbauer nach wie vor unter starken Medikamenten steht und Ruhe braucht. Heute können Sie ihn noch nicht vernehmen!«
»Yes, Ma’am.« Breit grinsend salutierte Mickey zackig. Danach drehte er sich zu Maxwell um und zwinkerte ihm zu. »Die tut nur so. Ich schätze, bis zum Schichtende habe ich sie flachgelegt.«
Doch Maxwell war schon zurück in die Nebelwelt geglitten.
6
Erlangen, Deutschland
»Herr Schmidbauer?« Eine Hand berührte ihn sanft an der Schulter.
Maxwell stöhnte, öffnete die Augen und kniff sie sofort wieder zusammen. Ein Blitz explodierte mitten in seinem Gehirn.
»Haben Sie Schmerzen?«
»Es ... ist ... zu ... hell.« Er hatte das Gefühl, als würden die Worte tropfenweise aus ihm perlen.
Schritte entfernten sich vom Bett, ein leises Summen ertönte, dann wurde es vor seinen geschlossenen Lidern dunkler. Langsam öffnete er erneut die Augen.
»Ich habe Ihnen eine Tasse frischen Pfefferminztee mitgebracht.« Der Pfleger hob Maxwells Kopf leicht an und flößte ihm ein paar Schlucke aus einer Schnabeltasse ein.
»Ich ... hasse ... Pfefferminztee«, murmelte er anstelle eines Danks. Gequält versuchte er zu lachen, stattdessen musste er husten. Es klang wie nach zwei Schachteln filterloser Zigaretten.
»Wollen wir mal testen, wie die Welt im Sitzen aussieht?« Der Krankenpfleger hielt ihm das Bedienteil für die Elektrik des Krankenbetts hin. »Probieren Sie es selbst, Sie müssen hier drücken.«
Maxwells Hand zitterte vor Anstrengung, als er sie hob und einen Finger auf den Knopf presste. Das Kopfteil bewegte sich mit einem leisen Surren nach oben.
»Und stopp.«
Die Hand fiel kraftlos aufs Bett zurück.
»Wunderbar. Dann wollen wir Sie mal tageslichttauglich machen.«
»Kann das ... nicht eine ... der jungen Damen ... übernehmen?«
»Ihnen scheint es ja schon ziemlich gut zu gehen«, bemerkte der Pfleger trocken. »Was sagt Ihre Frau zu solchen Machosprüchen, kaum dass Sie wieder unter den Lebenden weilen? Oder ist das bei SEK-Beamten üblich?«
Maxwell runzelte die Stirn. Grübelte. War sich schließlich sicher. »Ich bin ... nicht mehr ... verheiratet.«
»Na dann. Möchten Sie sich das Gesicht selbst waschen?« Ohne eine Antwort abzuwarten, drückte ihm der Mann ein feuchtes Etwas in die Hand.
Maxwell versuchte, seinen Fingern die Anweisung zu geben, den Waschlappen festzuhalten und damit über seine Wangen zu fahren. Sie taten es nur zögerlich, zitternd, kraftlos. Der Krankenpfleger schlug das Laken zurück und begann den durchtrainierten nackten Körper mit distanzierter Professionalität zu waschen.
»Soll ich Sie rasieren?«
»Dann ... hätte ich mich ... mit dem Waschlappen ... nicht so ... plagen müssen!« Maxwell war am Ende seiner Kraft angelangt.
»Das war ein gutes Training für die Feinmotorik.«
Er schloss die Augen.
»Ich werte das als ein ›Nein, danke‹. Mit Verlaub, ich finde auch, dass Ihnen der Bart gut steht.«
»Zum Teufel ... rasieren Sie mich!«
»Was ist mit den Koteletten?«
»Die ... nicht.«
»Meinen Sie nicht, dass die ohne Bart etwas verloren wirken?«
Anstatt einer Antwort presste Maxwell die Lippen, so fest er konnte, zusammen.
Kaum war der Pfleger gegangen, trat die Frau mit den hellen, graublauen Augen an sein Bett.
»Wie geht es Ihnen?«
»Ging ... schon mal ... besser.«
»Haben Sie Schmerzen?«
»Ich ... fühle mich wie ... in Watte gepackt.«
»Wir können Ihre Medikation testweise reduzieren, allerdings kann es sein, dass Sie Kopfschmerzen bekommen.« Sie machte sich an einem der Geräte zu schaffen. »Wenn es zu schlimm wird, sagen Sie Bescheid, dann erhöhen wir die Dosis.«
»Werde ich ... wieder gesund?«
»Sie hatten unvorstellbares Glück.«
»Was ... heißt das?«
»Die Kugel hat links auf Höhe der Schläfe den Schädelknochen durchschlagen und ist durch die Dura mater und Arachnoidea encephali hindurch in den Subarachnoidalraum gedrungen. Und hier ist etwas Bemerkenswertes passiert, worüber ich bislang nur in der Fachliteratur gelesen habe: Die Kugel hat die Flugrichtung gewechselt, Ihren Hinterkopf durch den Subarachnoidalspalt umrundet und ist dann auf der anderen Seite ausgetreten. Wie es im Moment aussieht, ohne größere Schäden an den Großhirnlappen anzurichten.«
»Was?« Er hatte kein Wort verstanden. »Werde ich ... wieder gesund?«
»Sie bringen die besten Voraussetzungen dafür mit.«
7
Nürnberg, Deutschland
Ein verschwommenes Bild quälte sich durch seine Gehirnwindungen.
Er stand neben Mickey im Schießstand, hielt seine Glock in beiden Händen, zielte, drückte ab, traf den Umriss der Schulter anstatt den Kopf.
Maxwell: Scheiße!
Mickey: Willst wohl in allen Disziplinen Schützenkönig werden? Gönn uns anderen doch auch mal was.
Maxwell: Mit der Glock habe ich immer Probleme.
Mickey: Versuch, die Arme etwas anzuwinkeln! Dann geht es leichter.
Maxwell: Ich habe es mit durchgestreckten gelernt.
Mickey: War nur ein Vorschlag. Bei mir funktioniert es so besser.
Danach gab es nur ein weißes Loch.
8
São Paulo, Brasilien
Tack! Tack!Tack! Drei kurze, harte Schläge – wie die Salven auf dem Weingut. Renata zuckte zusammen, sprang vom Bett auf, sah sich panisch in ihrem Hotelzimmer um. Ihr Herz raste. Dann merkte sie, dass es nur Fingerknöchel auf Holz gewesen waren. Ein energisches Klopfen. Sie schloss die Augen, atmete tief durch und versuchte, sich zu beruhigen.
»Wer ist da?«
»Housekeeping.«
Ein Blick auf den Radiowecker: neun Uhr einundfünfzig. Das Mädchen war eine halbe Stunde später dran als gestern. Renata ging zur Tür, öffnete.
»Alles in Ordnung, Senhora?«
»Ja, ja. Ich habe allerdings starke Kopfschmerzen.« Für morgen musste sie sich eine andere Ausrede einfallen lassen. Die Angestellte würde misstrauisch werden, wenn sie noch einen weiteren Tag nicht das Zimmer verließ. Am besten ging sie in den Frühstücksraum.
»Brauchen Sie Tabletten? Soll ich Ihnen etwas aus der Apotheke besorgen?«
»Nein, nein. Ich ... äh ... machen Sie morgen sauber, ja?« Morgen würde sie auschecken und in ein anderes Hotel ziehen.
Verwundert sah das Mädchen sie an, nickte und verschwand.
Renata setzte sich zurück aufs Bett und zog die Decke bis zum Kinn. Ihr war kalt – und schlecht. Sie hatte in ihren gut dreißig Lebensjahren schon viele Opfer von Gewaltverbrechen gesehen – aber noch nie war ein Freund, ein Mensch, den sie sehr mochte, in ihrer unmittelbaren Nähe gewaltsam zu Tode gekommen. Hätte sich Zé nicht an ihr vorbeigedrängt, wäre sie es, die nun tot wäre. Oder beide. Beide wäre gerechter. Der Überlebende wurde unter Schuldgefühlen begraben.
Die vertraute Übelkeit stieg wieder in ihr hoch. Seit dem Morgen der Gerichtsverhandlung hatte sie nichts mehr gegessen. Nur getrunken, Wasser aus der Leitung, im Zahnputzbecher. So lange hatte ihr Magen noch nie rebelliert, nachdem sie ein Gewaltopfer gesehen hatte. Aber Zé war ja nicht irgendein Fremder gewesen.
Renata blickte zu ihrem unausgepackten Koffer hinüber. Sollte sie morgen in ihre Wohnung zurückkehren? Dann müsste sie jetzt einen Spaziergang machen, eine neue Telefonkarte kaufen, ein neues Handy, Carlos anrufen und ihn bitten, die Schließzylinder ihrer Wohnung auszutauschen. Stattdessen schaltete sie den Fernseher ein.
Sie zappte durch die verschiedenen Programme. Frühstücksfernsehen, Shoppingsender, Daily Soaps, auf Globo TV kamen Nachrichten. Eine Reporterin stand auf einer Straße und berichtete live aus der Stadt. Renata starrte auf den Bildschirm. Das Redaktionsgebäude. Rauchschwaden quollen aus dem fünften Stock, ihrem Stockwerk. Sie schaltete den Ton lauter, hörte, dass es in der Nacht mehrere Explosionen in den Redaktionsräumen gegeben hatte. Die Reporterin berichtete, dass die Polizei einen Zusammenhang vermutete mit einem Anschlag auf einen Fotografen und eine Redakteurin der Zeitung sowie mit Bränden, die annähernd zeitgleich in deren Wohnungen ausgebrochen waren. Ein Foto wurde eingeblendet. Es zeigte Zé, lächelnd, mit intaktem Kopf.
Renata schaltete den Fernseher aus, froh, das Hotelzimmer nicht verlassen zu haben, griff zum Telefon, wählte Carlos’ Handynummer. Die Mailbox. Sie biss sich auf die Unterlippe, hinterließ keine Nachricht. Wahrscheinlich schlief er nach der Nachtschicht.
Es klopfte.
»Roomservice!« Eine Männerstimme.
Renata gefror, wagte nicht zu atmen. Sie hatte nichts bestellt.
Erneutes Klopfen.
»Ich ...« Ihre Stimme kippte. »Ich bin im Bad. Lassen Sie es einfach stehen«, rief sie auf Englisch mit einem dicken amerikanischen Akzent, den sie einmal auf einem Kongress gehört hatte.
»Sim, Senhora.« Ja.
Die Schritte entfernten sich, laut, demonstrativ. Renata drückte sich an die Wand, atmete stoßweise durch den geöffneten Mund. Kamen die Schritte zurück? Zumindest hörte sie sie nicht. Sie schlich ins Badezimmer und drehte das Wasser der Dusche auf. Dann öffnete sie behutsam das Fenster und wuchtete ihren Hartschalenkoffer auf die schmale Feuertreppe. Sie führte zickzackförmig an der Rückseite des Hotels hinab. Ein Stockwerk nach links, eins nach rechts. Alter grauer Waschbeton, kein quietschendes Gitter. Fünf Stockwerke. Die ganze Zeit wartete Renata auf schnelle Schritte, einen Schuss, wütendes Rufen, eine empörte Angestellte.
Nichts.
Von der letzten Etage musste sie eine marode Metallleiter hinabklettern. Keine leichte Sache mit dem Koffer. Sie schaffte es.
Ohne sich umzublicken, überquerte sie den Hinterhof, drückte sich an einer Palme vorbei durch einen schmalen Durchgang. Auf der Hauptstraße wandte sie sich in die dem Hotel entgegengesetzte Richtung und suchte nach einem Taxi.
Zwei Mal musste sie winken, bis einer der vorüberfahrenden schneeweißen Wagen mit dem grünen Karomuster neben ihr am Bordstein hielt.
»Senhora?«
»Perdizes, 1142 Rua Ministro Godói.«
Der Fahrer nickte und fädelte sich in den dichten Verkehr ein. Zumindest war die obstipação vorüber – die Verstopfung, der kollektive Stillstand in den Straßenschluchten, an dem São Paulo morgens wie abends mehrere Stunden lang zugrunde zu gehen drohte, obwohl an Werktagen ohnehin nur einem Teil der fünf Millionen Autos das Fahren erlaubt war.
Das Taxi hielt vor ihrem Haus. Sie bat den Fahrer zu warten, stieg aus, hob den Blick zur elften Etage, blieb wie angewurzelt stehen. Verkohlte Fassade, geborstene Fensterscheiben.
Als Nächstes ließ sie sich zu Zés Wohnblock fahren und schließlich zum Hochhaus, in dem die Redaktion untergebracht war. Überall bot sich ihr dasselbe Bild.
»Und jetzt?«, fragte der Fahrer.
»São Paulo-Guarulhos.«
»Zum Flughafen.Wie Sie wünschen.«
9
Erlangen, Deutschland
Die hellen, graublauen Augen mit dem dunklen Rand um die Iris starrten ihn an.
»Sie haben tolle Augen.«
»Es stimmt also, was mir über Sie berichtet wurde: Sie sind auf dem Weg der Besserung.« Sofort vertieften sich die beiden Grübchen links und rechts neben ihren Mundwinkeln. Sie hatte eine etwas zu exponierte Nase, dafür aber schön geschwungene Lippen, wobei die untere ein wenig voller war als die obere. »Wie fühlen Sie sich?«
»Ich kann nicht einmal die Tasse festhalten.« Immerhin, das Sprechen fiel ihm inzwischen leichter.
»Sie müssen Geduld haben. In ein paar Tagen werden Sie Ihre Hände wieder wie gewohnt einsetzen können.« Sie griff nach der Schnabeltasse. Ihre blonden Haare waren zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, nur der Pony fiel ihr in die Stirn.
Zum ersten Mal nahm er bewusst ihre hochgewachsene Gestalt wahr. Sie musste annähernd einen Meter achtzig groß sein. Er mochte große Frauen, vor allem wenn ihre femininen Rundungen an den richtigen Stellen saßen. Deshalb konnte er ihr nachsehen, dass sie schätzungsweise bereits Mitte vierzig war – und damit ein bisschen zu alt für seinen Geschmack.
Als sie sich zu ihm herabbeugte, schloss er die Augen und atmete tief ein. Auch heute umhüllte sie ein schwacher Duft nach Honig. Er spürte die weiche Haut ihrer Fingerspitzen, während sich ihre Hand in seinen Nacken schob und mit sanftem Griff seinen Kopf ein Stück anhob, um ihm Schluck für Schluck den lauwarmen Tee einzuflößen.
»Werden Sie mir jedes Mal behilflich sein, bis ich es wieder selbst kann?«
Anstelle einer Antwort tupfte sie ihm mit einem kleinen Stofflappen über die Mundwinkel.
»Ihre Haare riechen übrigens sehr gut. Nach Honig.«
Als sie sich abwandte, krampften sich seine Bauchmuskeln reflexartig zusammen. War er mit seiner letzten Bemerkung zu weit gegangen? Doch dann sah er, dass sie sich einen Stuhl holte und neben ihn setzte. Langsam entspannte er sich wieder.
»Ich musste heute Nachmittag an Sie denken, als ich meinen Vater besucht habe: Auf einem seiner alten Tonbänder waren ein paar Lieder von Buddy Holly.«
Sein Herz schlug schneller. Offenbar hatte er sie beeindruckt. Sehr gut. Diese Wirkung hatte er auf viele Frauen – allerdings nicht wegen der Assoziation seines Geburtsdatums; das ließ er geflissentlich unter den Tisch fallen. Normalerweise punktete er mit seinem Aussehen: mit seinen dunkelbraunen Augen, seinem kurzen schwarzen, an den Schläfen allmählich ergrauenden, aber dennoch nach wie vor vollen Haar. Den langen, schmalen Koteletten. Dem markanten Kinn mit dem Grübchen und natürlich seinem muskulösen Körper, auf den er neben dem regulären Training sehr viel Zeit verwendete.
Allein zwei kleine, entgegengesetzt gedrehte Haarwirbel direkt oberhalb der Stirn ließen einen Teil seiner Haare zu seinem heimlichen Leidwesen oftmals herzförmig ins Gesicht stehen, wenn sie zu lang wurden. In seiner Jugend hatte er einmal alle von den Wirbeln betroffenen Strähnen abrasiert – mit der Folge, dass es ausgesehen hatte, als leide er unter einem kreisrunden Haarausfall. Seither beschränkte er sich darauf, die Stelle alle paar Tage mit der Nagelschere in Form zu schneiden. Mit Herzchen auf der Stirn konnte er definitiv nicht herumlaufen; der Spott seiner Kollegen wäre vernichtend gewesen.
Unwillkürlich tastete seine rechte Hand zu seiner Stirn, fühlte den Verband. Erleichtert atmete er aus. Die Haarwirbel waren verborgen, er musste sich keine Sorgen machen, nicht gut auszusehen.
»Ist Ihr Vater auch Buddy-Holly-Fan?«
»Zumindest früher war er es.« Sie wich seinem fragenden Blick aus, griff nach seiner linken Hand und begann sie fachmännisch zu massieren.
»Mein Vater«, murmelte sie schließlich, »lebt in einem Pflegeheim – er hat Alzheimer. Im Grunde genommen erkennt er mich nicht einmal mehr an guten Tagen. Meistens glaubt er, ich wäre seine Schwester.«
»Das tut mir leid.«
»Immerhin: Die alten Lieder bedeuten ihm noch etwas; zumindest beruhigen sie ihn.«
Sie schwiegen.
»Warum hat Ihre Mutter Sie nicht nach Buddy Holly benannt, wenn sie so ein großer Fan war?«, fragte sie nach einer Weile.
»Das hat sie.« Maxwell räusperte sich. Die Wärme, die ihre kräftigen Fingerbewegungen in seiner Hand erzeugte, verteilte sich in seinem gesamten Körper. »Er hieß mit bürgerlichem Namen Charles Hardin Holley. Maxwell war der Vorname meines Vaters. Meine Mutter hat sich wohl verpflichtet gefühlt, mich nach ihm zu nennen, aber ihr Herz hing an meinem zweiten Vornamen: Sie hat mich immer Charly gerufen.«
»Ihre Eltern leben nicht mehr?« Sie musterte ihn mit einem raschen Blick. Dann drückte sie seine Finger für ein paar Sekunden zur Faust, strich sie flach aus, presste sie erneut zusammen.
»Maxwell King war ein blutjunger amerikanischer GI, als ihm meine Mutter eröffnet hat, dass sie von ihm schwanger war.« Maxwell starrte auf seine Hand. »Sie war fast zwanzig Jahre älter als er. Wahrscheinlich hat er Panik bekommen und sich umgehend in die USA zurückversetzen lassen. Ich habe keine Ahnung, was aus ihm wurde; meine Mutter ist jedenfalls 1989 gestorben.«
»Und trotzdem hat sie Sie nach ihm benannt?«
»Ihrer Liebe zu ihm und allem Amerikanischen hat das keinen Abbruch getan. Sie hat nie auch nur ein einziges böses Wort über meinen Vater verloren, obwohl sie nicht wie gehofft Mrs. King wurde, sondern weiterhin Schmidbauer hieß und plötzlich mit einem unehelichen Kind dastand.«
Wie immer, wenn er an seine Mutter dachte, breitete sich ein Gefühl der Zuneigung in ihm aus. Sie war bereits achtunddreißig Jahre alt gewesen, als sie ihn auf die Welt brachte. Für damalige Verhältnisse ein kleines Wunder. Anstatt ihn heimlich auf einem Küchentisch irgendeines Quacksalbers abzutreiben, machte sie ihn zu ihrem persönlichen Sonnenschein.
»Haben Sie denn nie versucht, Kontakt zu Ihrem Vater zu bekommen?«
»Meine Mutter war in alles vernarrt, was über den großen Teich zu uns herübergeschwappt kam«, erzählte Maxwell, anstatt auf ihre Frage einzugehen. »Bei uns zu Hause liefen den ganzen Tag Buddy-Holly-Platten rauf und runter. Sie hat alle seine Alben gekauft und noch so einige andere. Manchmal war nur noch Geld für Milch und Brot da, aber auf dem Plattenspieler drehte sich eine nagelneue Scheibe. Musik gehört seit meiner Kindheit zu meinem Leben. Ohne Musik würde mir etwas fehlen. In den unmöglichsten Situationen gehen mir Songtexte durch den Kopf.« Er hielt inne. »Warum kann ich mich an all das erinnern, aber nicht daran, dass jemand auf mich geschossen hat?«
»Geht Ihnen jetzt auch ein Lied durch den Kopf?«, stellte sie ihm eine Gegenfrage.
»Bob Marley – I shot the sheriff.«
»Ich musste gerade an Nancy Sinatra – Bang Bang denken.«
Er starrte sie an, für Sekundenbruchteile stockte sein Atem. Bislang war er nur sehr wenigen Menschen begegnet, die seinen »Musikfimmel« teilten.
»Erzählen Sie mir von Ihrer Arbeit«, lenkte Dr. Schirmer das Gespräch in eine andere Richtung.
»Ich bin beim SEK.«
»Das weiß ich von Ihren Kollegen, und das sieht man Ihnen auch an. Ich habe selten derart gut trainierte Patienten in Ihrem Alter. Aber irgendwie habe ich gedacht, beim SEK würden nur jüngere Männer arbeiten.«
Maxwells wohlgefälliges Grinsen gefror, unbewusst spannte er seine Muskeln an.
»Nur weil ich einundfünfzig bin, heißt das noch lange nicht, dass ich zum alten Eisen gehöre«, stieß er gepresst hervor. »Ich kann nach wie vor über fünfzig Liegestütze am Stück machen, schaffe beim Bankdrücken problemlos hundertzwanzig Kilo und laufe dreimal die Woche fünfzehn Kilometer. Wenn ich mich ein bisschen vorbereite, sprinte ich bei unseren Leistungstests vierhundert Meter in –«
»Hoppla, da scheine ich wohl einen wunden Punkt getroffen zu haben. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten«, unterbrach sie ihn mit einem Lächeln.
Einen Augenblick lang war er irritiert. Er hatte ihr nur beweisen wollen, was alles in ihm steckte. Offenbar hatte er es übertrieben. Brummig lenkte er ein.
»Meine Tage als Gruppenführer beim SEK sind gezählt. Ich bin der älteste Einsatzbeamte hier in Nordbayern. Wir haben nicht genügend Nachwuchs.«
»Und was möchten Sie dann jetzt machen? Mit den Verletzungen können Sie nicht zu Ihrer Einheit zurück.«
Mit einem Ruck entzog er ihr schroff seine Hand und starrte auf seine Finger. Eine schlimmere Frage hätte sie ihm nicht stellen können.
10
Nürnberg, Deutschland
Er stand neben Mickey im Schießstand, lud seine Waffe nach, zielte, winkelte die Arme leicht an, zielte erneut, schoss, traf mitten ins Schwarze. Er ließ die Waffe sinken. Vielleicht hatte Mickey doch recht: Auf diese Weise traf er besser. Sein Handy klingelte. Die Einsatzzentrale. In der Kölner Straße drohte jemand, aus dem Fenster zu springen.
Sie fuhren hin. Im siebten Stock hockte eine Gestalt auf dem Fenstersims. Ein Bein innen, eins außen. Der Einsatzleiter wusste vom Wohnungsinhaber, der die Beamten verständigt hatte, dass der Mann bis vor kurzem in Ansbach in der Psychiatrie gewesen war.
Maxwell legte alles ab, woran man ihn als Polizeibeamten hätte erkennen können. Als er eintrat, hielt der Mann ein Brotmesser in der rechten Hand, mit der anderen umklammerte er das Fensterbrett.
Maxwell: Servus, ich bin ein Kumpel vom Thomas. Ich heiße Max.
Mann: Bleib, wo du bist, sonst stech ich dich ab.
Maxwell: Thomas hat gesagt, du kommst aus Ansbach? Da wohn ich auch.
Mann: Bleib stehen!
Maxwell: Sag mal, bist du mit dem Auto da? Könntest du mich heute Abend mit nach Hause nehmen?
Maxwell benahm sich, als sei es die natürlichste Sache der Welt, sich mit einem auf dem Fensterbrett kauernden Suizidenten mit einem Messer zu unterhalten.
Mann: Ich geh da nicht wieder hin zurück.
Maxwell durchwühlte einen Küchenschrank: Weißt du, wo hier der Kaffee ist?
Der andere schüttelte den Kopf.
Maxwell: Ich brauch jetzt erst mal was zu trinken.
Er öffnete den Kühlschrank und holte eine kleine Flasche Beck’s heraus, hielt sie in die Luft, sah zu dem Mann hinüber: Du auch?
Mann: Klar, Alter. Super Idee.
Maxwell holte eine zweite Flasche aus dem Kühlschrank und ging damit auf ihn zu.
Mann: Bleib stehen, ey!
Maxwell: Wie soll ich dir denn dann das Bier geben?
Dennoch ging er nicht näher. Der Abstand betrug noch knapp drei Meter. Zu viel.
Mann: Wirf’s her.
Das Messer wechselte von der rechten in die linke Hand. Er hielt sich nicht mehr am Fensterbrett fest.
Maxwell: Das gibt doch eine Riesensauerei, wenn du’s aufmachst.
Mann: Tu her!
Maxwell zuckte mit den Schultern, zielte und warf so knapp, dass sich der andere weit nach innen lehnen musste, um die Flasche zu erwischen. Er schaffte es, richtete sich wieder auf.
Mann: Und jetzt den Öffner.
Das Bier wechselte zum Messer in die linke Hand. Maxwell warf erneut – diesmal aber viel zu kurz. Mit einem Klirren landete der Flaschenöffner etwa einen Meter vom Fenster entfernt auf dem Boden.
Mann: Scheiße! Und jetzt, du Idiot?
Maxwell: Hol ihn dir doch einfach.
Keine Reaktion.
Maxwell setzte sein Bier an und trank die halbe Flasche leer, rülpste: Das tut gut.
Keine Reaktion.
Maxwell wandte sich ab, ging zwei Schritte in Richtung Tür, betrachtete scheinbar einen Kalender: Wenn du deins nicht magst, gib es mir.
Aus den Augenwinkeln sah er, dass der Mann das Bein zum Fenster hereinzog und Anstalten machte, zum Öffner zu gehen. Das war der Augenblick, auf den er gewartet hatte. Er schnellte herum und sprang. Noch im Flug schlug er dem Kerl mit der Faust Flasche und Messer aus der Hand. Dann landeten sie beide auf dem Boden. Maxwell relativ weich auf dem Unbekannten. Mickey kam ins Zimmer und half ihm, ihn zu fesseln.
Danach war wieder nur ein weißes Loch.
11
Erlangen, Deutschland
»Aufwachen, Herr Schmidbauer.« Eine Hand berührte ihn an der Schulter. »Sie haben Besuch.«
Maxwell schlug die Augen auf. Eine rothaarige Krankenschwester stand über ihn gebeugt und lächelte ihn an. Dann traten zwei Männer in grünen Übermänteln in sein Gesichtsfeld. Er drehte den Kopf.
»Hallo Max, wie geht es dir?« Maxwells Chef, der Leiter der Abteilung Spezialeinheiten. Ohne eine Antwort abzuwarten, schob er gleich die Frage hinterher, die ihn eigentlich interessierte. »Was ist am Samstag passiert?«
Maxwell ließ den Kopf zurück aufs Kissen sinken. »Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, dass ich Bereitschaft hatte, geschweige denn, zu welchem Einsatz ich gefahren bin.«
»Zu gar keinem – du hattest frei.«
Die Antwort traf ihn wie ein Schlag. Es fühlte sich an, als habe ihn jemand gegen das Brustbein getreten und die Luft aus seiner Lunge gepresst. Sein Magen krampfte sich zusammen, sein Herzschlag beschleunigte sich, mühsam rang er nach Atem. Bislang war er davon ausgegangen, dass er einen Arbeitsunfall gehabt hatte und in Ausübung seines Dienstes verletzt worden war. Wer sonst sollte ihn in den Kopf schießen?
»Du bist gegen dreizehn Uhr von Passanten in einer Autowerkstatt in der Industriestraße gefunden worden. Ein kleiner Ein-Mann-Betrieb, der sich auf exklusives Cartuning und Autozubehör spezialisiert hat«, hörte Maxwell den zweiten Mann wie aus dem Off sagen. Mit einem Mal wurde das große weiße Loch, das ihn gerade noch hatte verschlucken wollen, von einem Karussell verschwommener Bilder abgelöst, die zwar alle mit Autos, aber nichts mit jenem Tag zu tun hatten.
»Was habe ich dort gemacht?«
»Das hätten wir gern von dir erfahren.«
Endlich gelang es Maxwell, das Karussell in seinem Kopf anzuhalten und seinen Blick auf den Sprecher zu fokussieren.
»Kennen wir uns?«
»Wächter, Thomas, MK2.«
Ein Kollege von der Mordkommission. Ein Sesselfurzer. Einer, der seinen Arsch nur im Notfall aus dem Büro bewegte.
»Ich habe keine Ahnung. Ich fahre mit meinem Wagen seit Jahren immer in dieselbe Vertragswerkstatt.« Plötzlich klickte sich Maxwells Gehirn wieder in den Denkmodus. »Außer mir muss zumindest noch jemand von der Firma anwesend gewesen sein. Was hat er ausgesagt? War es ein Raubüberfall? Konnte er Hinweise auf den Täter geben?«
Die beiden Besucher tauschten einen Blick, Maxwells Chef räusperte sich.
»Der Inhaber ist tot.« Er machte eine kurze Pause. »Das Ganze ist allerdings wesentlich komplizierter: Die Waffe, aus der geschossen wurde, ist vorher schon bei einem anderen Mord verwendet worden. In London wurde damit der Besitzer eines Obst- und Gemüseladens umgebracht, regelrecht hingerichtet. Ein achtundvierzigjähriger Portugiese.«
»Wir können das Geschehen vom Samstag noch nicht vollständig rekonstruieren. Aber wir wissen immerhin, dass du unmittelbar zuvor bei dem thailändischen Lebensmittelhändler nebenan eingekauft hast.«
Maxwell kniff die Augen zusammen, um das Karussell zur Ruhe zu zwingen, das sich in seinem Kopf erneut zu drehen drohte. »Was habe ich mitgenommen?«
»Take-away-Food: Scampi mit Bambus, Paprika, Kokossoße, rotem Curry und Reis.Die Plastiktüte mit der Portion lag neben dir.«
Langsam atmete er aus, nun ergab das alles schon viel mehr Sinn. Zu dem Thai in der Industriestraße fuhr er manchmal, wenn er keine Lust zum Kochen hatte.
»Danach musst du hinüber in die Werkstatt gegangen sein«, fuhr der Kriminaler fort.
»Wir gehen davon aus, dass der Täter bereits vor dir dort war. Als man dich gefunden hat, hast du gleich neben dem Eingang gelegen, der Inhaber jedoch auf der entgegengesetzten Seite nahe der Tür, die zum Lager führt.«
Plötzlich war es wieder da: das große weiße Loch. Maxwell fühlte sich, als habe jemand Watte in seinen Kopf gestopft. Er konnte kein zu der geschilderten Szene passendes Bild abrufen.
»Da ist noch etwas anderes«, sein Chef räusperte sich. »Jetzt, wo du aus dem Koma aufgewacht bist und klar ist, dass du keine sachdienlichen Hinweise geben kannst, muss ich den Personenschutz für dich leider abziehen. Das verstehst du doch, oder? Du weißt ja, wie personalintensiv das ist. Ich kann diese enorme Ausgabe einfach nicht länger in unserem Etat rechtfertigen. Alle Dienststellen müssen den Gürtel enger schnallen. Ich muss genau abwägen, was wir uns leisten können und was nicht. Später lasse ich eine Pressemeldung herausgeben, dass du dich an nichts erinnern kannst und in eine Spezialeinrichtung gebracht wurdest. Damit verliert der Täter mit Sicherheit das letzte bisschen Interesse an dir.« Er räusperte sich erneut. »Aber seien wir mal ehrlich: Wenn er sich bis dato nicht hat blicken lassen, wird er es auch nicht mehr versuchen.« Es klang, als wolle er seine Entscheidung vor sich selbst rechtfertigen.
12
Flughafen Guarulhos, São Paulo, Brasilien
Renata stieg aus dem Taxi und betrat Terminal 1. Sie brauchte einen Augenblick, um sich in der riesigen Halle zu orientieren. Kinder sprangen kreischend auf und ab, Menschen hasteten hin und her, Rollkoffer ratterten über den Boden, Gelächter lag in der Luft, hektische Betriebsamkeit, Rolltreppen, lange Menschenschlangen, blaue Abflugtafeln, die sich ständig aktualisierten, rote Schalter, eine kaum zu verstehende Durchsage.
Endlich entdeckte sie, was sie suchte: die Schalter von GOL. Sie stelle sich an und wartete.
Es dauerte gefühlte Ewigkeiten, bis sie an die Reihe kam.
»Wohin geht das nächste Flugzeug?«
»Haben Sie Gepäck?«
Renata nickte und wies auf ihren pinkfarbenen Hartschalenkoffer.
»In zweieinhalb Stunden startet eine Maschine nach Salvador da Bahia.«
Salvador da Bahia. Traumhafte Strände. Sie war einmal dort im Urlaub gewesen – als Kind, als ihre Eltern noch lebten.
»Gibt es keinen früheren Flug?«
Die Stewardess schüttelte den Kopf. »Den Flieger nach João Pessoa schaffen Sie nicht mehr. Die Gepäckbänder sind schon geschlossen.«
»Gut, dann nach Salvador.«
»Handgepäck?«
»Ja.«
Während die Stewardess das Ticket ausdruckte, öffnete Renata rasch ihren Koffer, holte die Laptoptasche und das große braune Kuvert heraus. Dann stellte sie das Gepäckstück auf das Förderband.
Sobald sie die Bordkarte in Händen hielt, atmete sie tief durch, drehte sich um und lief ein paar Schritte in Richtung der Rolltreppen. Plötzlich prallte etwas gegen sie. Sie zuckte zusammen, blickte von ihrem Flugschein auf, fuhr herum. Ein Kind hatte mit seiner Schwester Fangen gespielt. Es hatte sie nicht gesehen. Renata wandte sich ab, erstarrte, das Ticket fiel ihr aus der Hand.
Keine fünfzig Meter von ihr entfernt stand ein Mann in der Wartehalle. Der Mann, der Zé den Kopf weggeschossen und sie in den Weinbergen gesucht hatte. Bei der Polizei konnte sie ihn nicht beschreiben. In ihrer Erinnerung hatte sie ihn überhaupt nicht richtig zu Gesicht bekommen. Doch offenbar hatte ihr Unterbewusstsein mehr gespeichert, als ihr Gehirn preisgeben wollte.
Zitternd bückte sie sich nach dem Flugschein, hob ihn auf. Ihre Gedanken rotierten. Der Kerl würde ihr hier inmitten all der Menschen doch bestimmt nichts antun? Noch einmal blickte sie in seine Richtung. Er stand nicht mehr da, wo sie ihn gesehen hatte. Wie eine der an der Ostküste so häufig anzutreffenden Giftschlangen glitt er ruhig und unauffällig zwischen den herumstehenden Menschengruppen auf sie zu.
Renata drehte sich weg – und entdeckte einen zweiten Mann, der sie einkreiste.
Einen Moment fühlte es sich an, als sei ihr Herz stehen geblieben, dann begann es zu rasen, pumpte heißes Adrenalin in ihren Magen, Übelkeit stieg in ihr hoch. Die Härchen an ihren Armen stellten sich auf. Sie drehte sich um und rannte los.
Vor ihr lagen Bars, Restaurants, Autovermietungen, Telefonläden, Kleidershops, eine Wechselstube, ein Wickelraum, Toiletten. Sie wählte den einzigen Ort, an den ihr die beiden Männer nicht ohne Weiteres folgen konnten: die Damentoilette. Ein fensterloser Raum, zwei Waschbeckenreihen, eine ältere Dame, die sich die Hände trocknete. Dahinter ein zweiter Raum mit grünen Toilettenkabinen, ebenfalls fensterlos.
Renata drückte die Abteiltür hinter sich zu, ihre Knie gaben nach, sie sank auf den Boden. Wie sollte sie hier unbemerkt herauskommen? Ohne Fenster, ohne Notausgang? Sie saß in der Falle. Es war aussichtslos. Lautes Schluchzen. Ihr Magen zog sich zusammen, sie konnte nicht mehr, erbrach das bisschen Leitungswasser, das sie am Morgen getrunken hatte, würgte, als würde sie ihre Eingeweide auch noch loswerden wollen.
So hilflos hatte sie sich zuletzt gefühlt, als der Krebs ihre Mutter dahingerafft hatte, bevor ihre Tante Adélia der damals Fünfzehnjährigen versprach, sich um sie zu kümmern.
Sie hatte nichts bei sich außer den Kleidern, die sie trug, ihrem Geldbeutel, der Laptoptasche, dem Kuvert. Keine Schminksachen, keine Kleider, sie konnte sich nicht umziehen, nicht verkleiden.
Es gab eine Zeit zum Leben und eine zum Sterben. Alle, die in ihrem Leben eine Rolle gespielt hatten, waren tot. Ihre Großeltern, ihr Vater, ihre Mutter, Tante Adélia, Zé. Und keiner von ihnen war alt geworden; ihre Großeltern hatte sie gar nicht erst kennengelernt.
Vielleicht war nun ihre Zeit gekommen.
Ein sanftes Klopfen an der Kabinentür. »Do you need help, darling?«
Es musste die ältere Dame sein, die am Waschbecken gestanden hatte. Renata konnte sich nicht erinnern, wie sie aussah. Ihrem Akzent nach stammte sie aus dem Süden der USA. Texas vielleicht.
Renata rührte sich nicht.
»Schauen Sie, meine Liebe, ich habe Mineralwasser und Taschentücher.« Im nächsten Moment erschienen weinrot lackierte Fingernägel in dem Schlitz zwischen Boden und Tür, dann dicke Fingergelenke, vier Finger mit auffälligen Goldringen, runzelige Haut, Altersflecken, drei goldene Armkettchen. Definitiv eine Ausländerin. Brasilianer trugen aus Angst vor Entführungen und Lösegelderpressungen praktisch keinen Schmuck außerhalb der eigenen vier Wände. Die Hand schob eine Packung Taschentücher zu ihr und dann eine kleine Flasche Mineralwasser.