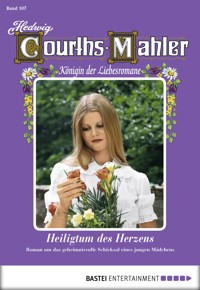Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Seit dem Tod des Vaters befinden sich Prinzess Lolo und ihre Stiefschwester in einer schwierigen finanziellen Lage. Ein Ausweg aus dieser prikären Situation könnte eine Hochzeit mit Prinz Joachim darstellen. Doch Prinzess Lolo will den Mann nicht heiraten. Sie liebt einen Anderen. Sein Name: Baron Schlegell. Doch weiß die junge Frau überhaupt, für wenn ihr Herz da schlägt...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hedwig Courths-Mahler
Prinzess Lolo
Saga
Prinzess Lolo
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1916, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726950250
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
I
Fürst Egon entließ den Verwalter Seltmann mit einem gnädigen Händedruck.
»Ich danke Ihnen, lieber Seltmann. Sie haben mir und meinem Haus einen großen Beweis Ihrer Anhänglichkeit gegeben und mir Ihre Treue bewiesen. Das weiß ich zu schätzen — und an meiner Dankbarkeit soll es seinerzeit nicht fehlen.«
Seltmann verneigte sich tief und verließ das Audienzzimmer im erhebenden Bewußtsein, für einen Dienst die Anerkennung seines Landesherrn gefunden zu haben.
Fürst Egon von Schwarzenfels blieb, als er allein war, mitten im Zimmer stehen und betrachtete nachdenklich das etwas verblichene Teppichmuster zu seinen Füßen.
Dann machte er eine kleine Promenade durch das Zimmer. Endlich blieb er am Fenster stehen. Genau so sinnend wie vorhin auf das Teppichmuster blickte er jetzt auf den Schwarzenfelser Marktplatz hinab.
Da wurde gerade Wochenmarkt abgehalten, denn es war Sonnabend. Unter den Augen ihres Landesherrn kauften hier die Schwarzenfelser Hausfrauen und Köchinnen ihren Wochenbedarf ein.
Fürst Egon schaute gewöhnlich sehr ernst drein. Aber heute lag ein froher Glanz auf seinen hageren Zügen, und um seinen Mund, dessen charakteristische Linien durch keinen Bart verdeckt wurden, spielte sogar zuweilen ein Lächeln. Nachdem er eine Weile auf das Leben und Treiben da unten geschaut, schritt er, sorgsam über sein spärliches graues Haar streichend, zum Schreibtisch hinüber und setzte die Zimmerglocke in Bewegung.
Wittmann, der Kammerdiener des Fürsten, trat geräuschlos ein und blieb neben der Tür straff und aufrecht stehen, das unbewegte, glattrasierte Gesicht seinem Herrn zugewandt. Fast sah Wittmann würdevoller und erhabener über den Nasenrücken herab als Serenissimus. Lakaien pflegen meist viel Wert auf vornehme Miene und Haltung zu legen.
»Wittmann!«
»Durchlaucht!«
»Seine Durchlaucht Prinz Joachim ist im Vorzimmer?«
»Zu Befehl, Durchlaucht!«
»Vorlassen!«
Wittmann verschwand mit einer tadellosen Rechtsschwenkung und ließ Prinz Joachim, den zweiten und jüngsten Sohn des Fürsten, eintreten. Da war es, als ob es plötzlich heller wurde in dem düsteren Gemach, als ob ein Sonnenstrahl verklärend über die etwas verblichene Pracht der alten Barockmöbel glitt. Und auch das Gesicht des Fürsten klärte sich noch mehr. Lächelnd und wohlgefällig betrachtete er die schlanke, kräftige Gestalt des Prinzen, der die Uniform des Leibregimentes seines Vaters trug, dem er als Leutnant angehörte. Vater und Sohn waren einander gar nicht ähnlich. Während der Erbprinz Alexander das verjüngte Ebenbild des Vaters war, glich Prinz Joachim seiner verstorbenen Mutter, einer lebenslustigen Frau, die sich durch eine Erkältung auf einem Ball den frühen Tod geholt hatte.
Das Gesicht Prinz Joachims zeigte nicht die aristokratisch feinen Züge des Fürsten. Er hatte ein gutgeschnittenes gebräuntes Gesicht mit klugen, guten Augen, die lebensfroh strahlten und oft genug übermütig aufblitzten. Nur der von einem flotten braunen Lippenbärtchen beschattete Mund verriet im Schnitt einige Ähnlichkeit mit dem des Fürsten.
»Du hast warten müssen, Joachim«, sagte der Fürst, seinem Sohn lächelnd einen Platz zuweisend und sich ihm gegenüber setzend. Seine Augen bekamen dabei einen fast zärtlichen Ausdruck. Joachim war sein Lieblingssohn, vielleicht weil er seiner Mutter glich, die der Fürst sehr geliebt hatte.
Prinz Joachim lachte, und in seinen grauen Augen blitzte der Schalk.
»Die Zeit ist mir nicht lang geworden, Papa. Ich habe am Fenster gestanden und zugesehen, wie die mehr oder minder hübschen Schwarzenfelserinnen ihre Einkäufe auf dem Markt besorgten. Das ist gar nicht so uninteressant.«
Der Fürst strich sich über das Kinn.
»Du bist ein Lebenskünstler und weißt allem die beste Seite abzugewinnen. Doch — wir haben jetzt Ernsteres zu besprechen.«
Prinz Joachim machte ein komisch betretenes Gesicht.
»O weh! Wird’s schlimm, Papa?«
Wieder lächelte der Vater.
»Diesmal gibt es keine Strafpredigt.«
»Gott sei Dank«, seufzte der Prinz erleichtert.
»Nun, ein besonders reines Gewissen scheinst du wieder einmal nicht zu haben.«
»Lieber Himmel, Papa — mein Gewissen ist meist so rein wie das eines neugeborenen Kindes. Aber es gibt wenig Menschen, die meiner Ansicht sind. In der Hofluft gibt es einen Bazillus, der jede Harmlosigkeit vergiftet und zu einem Verbrechen aufbauscht.«
Fürst Egon hob warnend die Hand. »Du bist entschieden Demokrat, Joachim — das weiß ich längst. Und mit Vorliebe übst du deinen Witz an unseren Hofbeamten.«
»Ich ein Demokrat, Papa? Das weiß ich nicht. Ich bin überzeugt, daß ich hier ersticken würde, wenn ich nicht ab und zu mal für einen frischen Luftzug sorgte. Sei nicht böse, Papa, es ist niemals schlimm gemeint. Weißt du, hier stagniert mir das Leben zu sehr. Draußen in der Welt weht eine frischere, freiere Luft, die einem das Blut kräftiger durch die Adern treibt. Wie danke ich dir, daß du mir, trotz pekuniärer Nöte, diese Reise ermöglicht hast. Das war ein Jahr, wert, gelebt zu werden. Und wenn ich noch ein wenig übermütiger und lebensfroher heimgekehrt bin — was schadet es? Gott sei Dank bin ich nicht Erbprinz! Alexander erfüllt in dieser Hinsicht die höchsten Ansprüche. Also schilt mich nicht und sei auch in Zukunft mein gütiger, verständnisvoller und nachsichtiger Vater, auch wenn ich einmal etwas über die Stränge schlage.«
Ein weicher Ausdruck lag in des Fürsten Augen.
»Du bist deiner Mutter Sohn, Joachim. Ihre Lebensfrische gab meinem Leben leider nur kurze Jahre Sonnenschein und Wärme. Du gleichst ihr so sehr, daß ich in der Erinnerung an sie zuweilen schwach gegen dich bin. Ihre Art hat mich gelehrt, die deine zu verstehen, obwohl sie der meinen fremd ist.«
Prinz Joachim faßte impulsiv des Vaters Hand mit warmem Druck.
»Und ich danke dir, daß du mich Mensch sein läßt, allem Hofbrauch zum Trotz.«
Fürst Egon strich seufzend mit der Hand über die Stirn.
»Mensch sein! Das ist etwas, das ich mir nicht oft gestatten kann. Aber dir will ich dein Menschenrecht so wenig wie möglich verkümmern und wünschte nur, daß ich es nie zu tun brauchte. Und doch habe ich gerade heute etwas mit dir zu besprechen, eine Angelegenheit, die vielleicht einen Zwang für dich im Gefolge haben könnte.«
»Einen Zwang?« fragte der Prinz unbehaglich.
Fürst Egon legte seine Hand auf die des Sohnes.
»Es ist nichts Unangenehmes, Joachim, vielmehr das Gegenteil. Aber laß uns zur Sache kommen. Du sahst wohl eben den Verwalter von Falkenhausen, Seltmann, aus meinem Zimmer treten?«
»Allerdings, Papa. Er erinnerte mich an schöne Zeiten — an meinen besten, treuesten Freund, Georg Falkenhausen. Nun sind schon drei Jahre vergangen, seit er beim Jagdrennen verunglückte. Ich hätte Seltmann gern aufgehalten und mich nach Georgs unglücklichem Vater erkundigt, wenn ich nicht gewußt hätte, daß ich jeden Augenblick zu dir gerufen werden könnte. Hat er dir über Graf Falkenhausens Befinden Nachricht gebracht?«
»Ja. Der Ärmste geht seiner Auflösung mit immer schnelleren Schritten entgegen. Seit man ihm seinen einzigen Sohn und Erben tot nach Hause brachte, ist er ja nur noch ein Schatten seiner selbst, und jetzt müssen die Arzte die schlimmsten Befürchtungen hegen. Mit dem Ärmsten stirbt ein altes, herrliches Geschlecht aus. Er ist der letzte Falkenhausen.«
Prinz Joachims Gesicht hatte sich verdüstert.
»So ist es, Papa. Und man kann es ihm nicht verdenken, wenn er nach dem Schicksalsschlag, der ihn getroffen hat, zum Einsiedler wurde. Wie gern hätte ich ihn oft besucht, aber niemand durfte zu ihm.«
»Du am wenigsten, Joachim. Seltmann hat mir gesagt, daß schon dein Name genügte, einen neuen Verzweiflungsausbruch hervorzurufen, wenn er vor seinen Ohren genannt wurde. Du warst in seiner Erinnerung zu innig mit Georg verknüpft, ich kann ihm das nachfühlen.«
»Gewiß, es hat ihm immer Freude gemacht, daß wir uns so viel waren, Georg und ich — ich kann es verstehen. Das Schlimmste für Graf Falkenhausen ist, daß mit seinem Sohn der Erbe seines Namens und seiner Güter ihm vorausgegangen ist.«
»Es existieren auch keine Verwandten mehr?«
»Nein. Auch nicht seitens der verstorbenen Gräfin Falkenhausen. Georg hat mir oft im Scherz versichert, daß er völlig onkel-, tanten- und vetterlos sei. Nur eine sogenannte »Nenntante« hatte er, eine Jugendfreundin seines Vaters, die an einen Fürsten Wengerstein verheiratet war. Fürst Wengerstein war General, jedoch ohne jedes Vermögen. Ich glaube, Graf Falkenhausen hat diese Jugendfreundin geliebt, aber sie war ihm nur freundschaftlich zugetan. Sie wurde dann des Fürsten Wengerstein zweite Frau. Und Graf Falkenhausen hat seiner Gattin keine allzu große Liebe entgegengebracht. Um so zärtlicher hing er an seinem Sohn und Erben. Mit ihm war sein ganzes Dasein vernichtet.«
»Und nun ist dieses Dasein im Begriff, ganz auszulöschen. Mein Gott — ein fürstlicher Besitz und ein enormes Vermögen wird herrenlos.«
Der Fürst stieß einen tiefen Seufzer aus. Joachim legte seine Hand liebevoll auf die des Vaters.
»Du hast schwere Sorgen, Papa, aber sieh — möchtest du mit Graf Falkenhausen tauschen?«
Der Fürst fuhr auf.
»Nein, nein, das nicht. Aber, Gott sei’s geklagt, wir sind arm, ärmer als viele unserer Untertanen, und müssen doch das Dekorum wahren. Das ist manchmal sehr schwer, mein Sohn.«
»Ist es denn nicht etwas besser geworden seit Alexanders Heirat?«
Der Fürst zuckte die Achseln.
»Theodora hat uns ja einiges Vermögen zugebracht, aber dafür erfordert der Haushalt des jungen Paares auch hohe Ausgaben. Theodora ist verwöhnt und sehr anspruchsvoll. Die Zinsen ihres Vermögens decken kaum ihre eigenen Bedürfnisse.«
»So hat sich Alexander umsonst dieses Opfer auferlegt?«
»Opfer? Nun — er wußte, daß diese Verbindung uns manchen Vorteil brachte. Der pekuniäre Standpunkt war hier nicht ausschlaggebend, wenn er auch wichtig genug für uns ist. Wenn meine lieben Untertanen wüßten, daß ich zum Beispiel nicht genug Mittel habe, um diese fadenscheinigen Brokatbezüge auf den Möbeln zu erneuern, sie würden mein Dasein weniger beneidenswert finden. Aber wir schweifen wieder ab von dem, was ich dir zu sagen habe. Seltmann, der mir sehr viel Treue und Anhänglichkeit erweist, weil ich ihn vor Jahren an den Grafen Falkenhausen empfohlen habe, war bei mir, um mir eine bedeutungsvolle Mitteilung zu machen, die vorläufig außer dir und mir kein Mensch erfahren darf. Deiner strengsten Diskretion bin ich sicher.«
»Selbstverständlich, Papa.«
»Nun gut. Also höre: Graf Falkenhausen hat gestern sein Testament gemacht, und zwar im Beisein Seltmanns, der sein volles Vertrauen erworben hat.«
»Ah! Und Seltmann? Er hat dir wohl gar verraten, wer der Erbe des Grafen sein wird?«
»Allerdings — aus alter Anhänglichkeit an unser Haus.«
»Das ist interessant. Aber ich möchte wohl wissen, ob Seitmann zu dieser Indiskretion berechtigt war.«
»Berechtigt? Darüber läßt sich streiten. Aber ich will nicht mit ihm rechten, denn wenn er indiskret war, geschah es aus Liebe und Treue zu seinem Fürstenhaus. Er kennt unsere Kalamitäten, und es trieb ihn, mir eine erfreuliche Botschaft zu bringen.«
»Dir? Eine erfreuliche Botschaft? Wie soll ich das verstehen?«
Fürst Egon stand auf. Zugleich erhob sich der Prinz, dessen Hand der Vater erfaßte.
»So höre denn, mein Sohn. Graf Heinrich Falkenhausen hat dich, den besten Freund seines Sohnes, zu seinem Erben eingesetzt.«
Prinz Joachim trat erschrocken zurück. Sein frisches Gesicht erblaßte jäh.
»Mich, Papa? Mich zu seinem Erben? Zum Erben eines der reichsten Grundbesitze Deutschlands und eines nach Millionen zählenden Vermögens? Das ist doch unmöglich!«
»Seltmann versicherte es mir auf seinen Eid. Freilich — du wirst dieses Erbe eventuell zu teilen haben mit der Prinzessin Lokandia Wengerstein, einer Tochter jener bereits verstorbenen Jugendfreundin des Grafen, der Fürstin Wengerstein, geborenen Freiin von Ried, von der du vorhin sprachst.«
Prinz Joachim schüttelte fassungslos den Kopf.
»Das ist mir unfaßbar, Papa, ganz unfaßbar.«
Der Fürst zog seinen Sohn neben sich auf einen Diwan.
»Ich will dir alles zu erklären versuchen. Daß Graf Falkenhausen dich als den Freund seines Sohnes über alles schätzt, weißt du. Sein Interesse an der jungen Prinzessin Wengerstein wurzelt anscheinend in der Teilnahme, die er für deren Mutter hegte. Wie ich höre, lebt jene seit ihres Vaters Tod mit ihrer Stiefschwester aus dessen erster Ehe in Weißenburg, wo den Schwestern vom Herzog von Liebenau das sogenannte Prinzessinnenschlößchen als Obdach überlassen worden ist. Die Schwestern sind ganz vermögenslos und leben nur von einer bescheidenen Pension. Warum Graf Falkenhausen sich der noch jugendlichen Prinzessin Lokandia — sie wird nur Lolo gerufen — nicht genähert hat, wußte Seltmann nicht zu sagen. Jedenfalls scheute er sich in seinem Gram vor jeder Berührung von außen. Nun aber hat er also testiert, daß du sein Universalerbe werden sollst, wenn du dich bereit erklärst, Prinzessin Lolo zu heiraten. Weigerst du dich, dann ist Prinzessin Lolo Universalerbin, und du gehst leer aus. Weigert sie sich indessen, dann erhält sie gewissermaßen als Abfindung — eine halbe Million Mark und die Falkenhausenschen Familiendiamanten. Diese soll niemand tragen als die Tochter jener Frau, die er einst geliebt hat. Dir aber bleibt auch in diesem Fall dann das Haupterbe. Weigert ihr euch aber alle beide, dann werden die Güter und das Vermögen nach genauen Bestimmungen verteilt. Jedenfalls habt ihr beide eure Erklärung, ob ihr annehmt oder verzichtet, zu gleicher Zeit abzugeben, so daß nicht der eine seine Bestimmung nach der des anderen treffen kann.«
Prinz Joachim sprang auf und lockerte seinen Halskragen.
»Verzeih, Papa, aber da muß ich mir erst einmal ein wenig Bewegung machen. Darf ich das Fenster öffnen? Es ist unsinnig heiß hier im Zimmer. Also das ist ja — Herr des Himmels —, ganz unfaßbar ist die Sache! So ein sonderbares Testament! Ob denn der alte Herr durch sein Unglück im Kopf gelitten hat?«
»Nein, nein, er hat das alles ganz logisch begründet. Am liebsten wollte er jedem von euch beiden das Erbe ungeteilt hinterlassen. Auch sähe er es nicht gern, wenn der Besitz zersplittert wird. Seiner Ansicht nach soll die Prinzessin famos zu dir passen. Er hofft, daß ihr beide vernünftig seid und euch heiratet. Dir wird eigentlich gar keine Wahl gelassen; er meint wohl, ein Mann müßte in solchen Fällen die Vernunft am höchsten stellen. Nur der Prinzessin läßt er eine Entschädigung bieten, falls sie sich nicht zu einer Verbindung mit dir entschließen kann. Eine halbe Million und der Familienschmuck, das ist immerhin etwas für eine arme Prinzessin, wenn es auch nicht den zehnten Teil der übrigen Erbschaft ausmacht. Ich gebe zu, daß das Testament etwas sonderbar ist, aber die Prinzessin wird wohl ebensowenig verzichten, wie du.«
Prinz Joachim wurde dunkelrot.
»Aber Papa — ich kenne doch diese Prinzeß Lolo gar nicht. Ich kann mich doch nicht ohne weiteres bereiterklären, sie zu heiraten.«
»Nun, so wirst du sie kennenlernen. Durch Seltmanns Nachricht haben wir Zeit gewonnen. Noch lebt Graf Falkenhausen und sein Testament wird erst am Tag seines Todes eröffnet. Zehn Tage danach muß dann eure Erklärung schriftlich an Justizrat Hofer eingereicht worden sein. Da jedoch täglich das Ableben des Grafen Falkenhausen zu befürchten ist, so ist keine Zeit zu verlieren, wenn du die Prinzessin vor der Entscheidung kennenlernen willst.«
Prinz Joachim machte ein unbehagliches Gesicht.
»Mir ist nicht allzu wohl bei deinen Eröffnungen, Papa.«
Fürst Egon runzelte die Brauen.
»Ich hoffe dennoch, dich in dieser Angelegenheit vernünftig zu finden. Einem gewissen Zwang ist jeder Mensch unterworfen. Und bedenke doch, was du dafür eintauschst. Wirst du Herr von Falkenhausen und den dazugehörigen Nebengütern, dann bist du ein freier Mann, der sich sein Leben nach Wunsch gestalten kann. Ich will gar nicht davon reden, daß es unsern fürstlichen Nimbus erhöhen wird, wenn ein großes Privatvermögen uns gewissermaßen ein Relief gibt. Nur an dich selbst brauchst du zu denken. Du bist jung und lebensfroh, und der Reichtum bietet dir alles, was du dir wünschst.«
»Papa — meinst du nicht, daß es mir auch Vergnügen machen würde, dir zu helfen? Bisher war ich dir nur eine Last. Ich brauche gar nicht an mich allein zu denken, um diese Erbschaft erstrebenswert zu finden. Aber du kannst mir doch nachfühlen, daß mir der damit verbundene Zwang nicht behagt. Vielleicht weigert sich aber die Prinzessin, mich zu heiraten.«
Diese Aussicht genügte schon, den Prinzen Joachim wieder aufzuheitern.
»Sie wird es kaum tun, Joachim. Eine arme Prinzessin ist noch schlechter dran als ein armer Prinz. Immerhin wäre es nicht unmöglich, daß sie sich mit der halben Million und dem Familienschmuck begnügt — vielleicht hat sie ihr Herz schon verschenkt.«
Der Prinz fuhr sich hastig über das kurzgeschnittene Haar.
»Jedenfalls könnte mir nichts angenehmer sein, als wenn die Prinzessin sich weigerte, meine Gemahlin zu werden.«
»Auf keinen Fall darf jedoch eine Weigerung von dir ausgehen.«
Prinz Joachim lachte gezwungen auf.
»Es wäre außerdem sehr ungalant von mir.«
»Also ich kann beruhigt sein, Joachim, du wirst der Vernunft Gehör geben?«
Der Prinz sah eine Weile nachdenklich vor sich hin. Dann blitzte es aber schon wieder lustig und übermütig in seinen Augen auf.
»Gut, Papa — aber ich stelle eine Bedingung.«
»Nun?«
»Ich will zuvor die Prinzessin sehen, und zwar ohne daß sie eine Ahnung hat, wer ich bin. Es wird sich irgendein Weg finden, mich den beiden Schwestern unauffällig zu nähern. Wenigstens will ich sie von Angesicht kennenlernen — vielleicht auch einige Züge ihres Charakters und Wesens. Mich so gewissermaßen mit gebundenen Händen und geschlossenen Augen ausliefern, nein — das kann ich nicht. Ich will der Gefahr mit offenem Blick gegenübertreten. Und wenn die Prinzessin weder meinen Namen kennt noch den Grund, weshalb ich in ihre Nähe komme, dann erhalte ich jedenfalls ein richtigeres Bild von ihr, als wenn ich ihr gewissermaßen auf einem Präsentierbrett als garnierte Schüssel vorgesetzt werde.«
Fürst Egon atmete lächelnd auf.
»Gottlob — du machst schon wieder schlechte Witze. Ein gebrochenes Herz wirfst du also anscheinend nicht in die Waagschale!«
Prinz Joachim seufzte.
»Lieber Gott, Papa — den Luxus, mich sterblich zu verlieben, hab ich mir noch nicht gegönnt. So ein paar harmlose Flirts, manchmal auch ein bißchen mehr, das ist alles. Zur Zeit bin ich, oder ist vielmehr mein Herz, völlig frei. Prinzessin Lolo hat’s leicht. Wenn sie nicht eine Vogelscheuche ist, verliebe ich mich in sie, damit ich wenigstens mit gutem Gewissen ja sagen kann.«
»Seltmann behauptet, gehört zu haben, daß Prinzeß Lolo eine sehr hübsche und noch sehr junge Dame sei.«
»Hm! Seltmanns Ansicht in Ehren — aber ich will mir doch lieber eine eigene bilden. Daß sie jung ist, ist kein Fehler — hoffentlich stimmt auch das andere. Also ran an die Kreide.«
Der Fürst machte ein unsicheres Gesicht.
»Du nimmst doch alles ein wenig sehr leicht.«
Prinz Joachims Gesicht wurde mit einem Mal ernst.
»Leicht? O nein, Papa. Ich liebe es nur nicht, mich von irgend etwas niederdrücken zu lassen. Und hier hilft doch alles Kopfhängen nichts. Wäre es dir lieber, ich ginge mit Seufzen und Klagen an die Sache ran? Wozu habe ich denn so breite Schultern, wenn ich sie nicht benutzen will, auch Unangenehmes aufrecht zu tragen. Ich fasse frisch zu, wenn es gilt, dem Leben etwas abzugewinnen. Trotzdem bin ich kein Luftikus, das kannst du mir glauben. Wenn ich wirklich mal über die Stränge schlage, so liegt das nur an den engen Grenzen, die mir überall gezogen sind. Laß dir doch an einem Mustersohn genügen, Papa! Alexander wird mit Würde und Grandezza das fürstlich Schwarzenfelser Zepter schwingen.«
Der Fürst drohte lächelnd mit der Hand.
»Das war schon wieder ein demokratischer Ausfall.«
Joachim lachte vergnügt.
»Wir sind ja unter uns, Papa.«
»Nun — lassen wir das. Also es bleibt dabei. Du reist in den nächsten Tagen nach Weißenburg. Ich will darüber nachdenken, wie du dich unauffällig bei den Prinzessinnen einführen kannst. Wir sprechen dann noch darüber. Für den nötigen Urlaub werde ich sorgen.«
»Vielen Dank, Papa. Und noch eins. Ob ich wohl noch einmal versuche, bei Graf Falkenhausen vorgelassen zu werden? Ich könnte ja heute nachmittag nach Falkenhausen fahren. Es quält mich, daß der alte Herr so allein und verlassen mit dem Tod ringt. Er ist doch, von allem andern abgesehen, der Vater meines liebsten Freundes.«
»Trotzdem kannst du dir diesen Weg sparen. Es wird niemand vorgelassen. Seltmann sagte mir, die Ärzte verlangten strengste Ruhe für den Patienten. Selbst wenn er jemand sehen wollte, was jedoch nicht der Fall ist, da er ganz apathisch ist, dürfte kein Mensch zu ihm.«
»Dann freilich — dann muß ich verzichten. Aber es tut mir furchtbar leid.«
»Das glaube ich dir. Aber nun habe ich noch andere Geschäfte zu erledigen. Wir sprechen heute nachmittag noch über deine Reise. Hast du Theodora und Alexander schon begrüßt?«
»Ja, ehe ich zu dir kam. Theodora war wie immer recht langweilig und still, und Alexander schien schlechter Laune zu sein. Dies Ehepaar sieht man leider nie vergnügt. Ich gehe jetzt zu Tante Sibylle, um ihr guten Morgen zu sagen und mich über ihr heiteres Gesicht zu freuen.«
»Und nebenbei läßt du dich von ihr noch ein wenig in deinen demokratischen Ideen bestärken«, sagte der Fürst lächelnd.
»Ach, Papa — Tante Sibylle zuliebe ginge ich in ein Kloster! Sie ist eine charmante, entzückende Dame.«
»Ja, ja, ich weiß schon. Wenn sie nicht weißes Haar hätte, würde sie dir, wie fast allen Männern, den Kopf verdrehen.«
Prinz Joachim lachte fröhlich auf.
»Das kann eine Prinzessin Sibylle auch noch mit weißem Haar. Du findest sie ja auch im Grunde deines Herzens unwiderstehlich.«
Der Fürst lachte. Es war ein schwaches, dünnes Lachen — ein Lachen, das man sehr selten hörte und das den Klang verloren hatte. Aber er lachte doch. Und darüber war Prinz Joachim sehr erfreut.
Ja — Tante Sibylle! Schon ihr Name genügte, um alle frohen Lebensgeister zu wecken.
Sehr herzlich verabschiedete Fürst Egon seinen Sohn.
II
Wenige Minuten später schritt Prinz Joachim mitten durch das Getümmel des Wochenmarktes. Mit lachendem Gesicht sprang er zur Seite, als er in Gefahr kam, mit einem riesigen Gemüsekorb zu kollidieren. Wo er vorüberkam, stockte das Geschäft. Aller Augen sahen ihm mit lächelndem Wohlgefallen nach. Prinz Joachim konnte wohl in seiner schlanken jugendkräftigen Männlichkeit noch verwöhnteren Augen gefallen als denen der guten Schwarzenfelserinnen.
»Prinz Joachim kommt über den Markt!«
Diese Kunde pflanzte sich mit Windeseile von Stand zu Stand fort, und für die Dauer der nächsten Minute stockte jeder Handel. Es gab nichts Wichtigeres zu tun, als den jungen Prinzen anzusehen. Er war es gewöhnt und sah den Leuten lachend in die Augen. Manchen rief er einen frohen Gruß zu — es waren ihm ja alles bekannte Gesichter. Und wenn er sich auf der Straße sehen ließ, gab es kein ehrfurchtsvolles Schweigen, sondern frohe Zurufe und vergnügtes Lachen. Ebenso vergnügt strahlten die Gesichter der Schwarzenfelser, wenn Prinzeß Sibylle auf der Straße zu sehen war. Diese und Prinz Joachim waren die Lieblinge der Schwarzenfelser. Prinzeß Sibylle, die Prinz Joachim jetzt aufsuchte, war die Witwe des verstorbenen Bruders des Fürsten Egon. Von Geburt Wienerin — sie entstammte einem österreichischen Fürstengeschlecht —, hatte es die lebensfrische, gemütvolle Frau verstanden, in dem kleinen deutschen Fürstentum alle Herzen zu gewinnen. Solange Fürst Egons Gemahlin lebte, teilte sie sich mit dieser in die große Volkstümlichkeit. Sie und Fürstin Maria waren unzertrennliche Freundinnen gewesen. Gemeinsam gaben sie den Ton an am fürstlichen Hof, und wo sie sich zeigten, wurde es amüsant und lebendig.
Nach dem frühen Tod der Fürstin, die man allseitig herzlich betrauert hatte, ging von Prinzeß Sibylle allein alle Anregung, alles geistige Leben aus. Ihr Frohsinn, ihre Lebensfrische und Klugheit war wie ein Quell, der immer neues Leben spendet. Das blieb auch so, als später der Erbprinz sich mit der Prinzessin Theodora vermählte. Diese war zu passiv und indolent, um die Führung zu übernehmen. Eine Prinzessin Theodora konnte nie eine Prinzessin Sibylle entthronen oder ersetzen. Sie wollte es auch gar nicht und beugte sich mit allen anderen willig unter das beglückende Zepter der geistvollen, liebenswürdigen Frau. Wohl kritisierten einige eingefleischte Höflinge nach wie vor heimlich ihre »demokratischen« Ansichten, so gut wie die des Prinzen Joachim. Aber zuletzt beugten sich auch die unausstehlichsten Nörgler dem Zauber, den diese noch als angehende Greisin entzückende Frau ausstrahlte. Man ließ sich willig von ihrer sprühenden Laune fortreißen, wenn sie eine neue »Hetz«, eine neue »Gaudi« in Szene setzte. Ihre Stärke war die froheste Lebensbejahung. Und trotz schwieriger Finanzverhältnisse setzte sie immer alles durch.
Wenn Fürst Egon zuweilen, voll der Sorgen, ein wenig bremsen wollte und versuchte, seiner Schwägerin etwas zu versagen, dann strahlten ihre dunklen Augen, in denen ein so warmer Humor lebte, übermütig und in ihrem noch immer wienerisch anklingenden Dialekt sagte sie gemütlich:
»Geh, Durchlaucht — sei nit fad — grad du brauchst ein wenig Sonnenschein. Wir rosten ja all miteinander ein in unserem verschlafenen Residenzchen, wenn wir nit a bisserl fesch sind. Pack dein Sorgenbündel nur ein Weilchen zusammen, es stiehlt dir keiner was davon. Morgen packst es wieder fein sorglich aus. Und kosten soll dich die Gaudi nit einen Heller — ich zahl’s halt. Also geh — laß mir das Plaisier und gönn es dir und den andern auch.«
Da gab der Fürst jeden Widerspruch auf — und unterwarf sich ihrem Zauber.
Sie besaß viel Temperament, Prinzeß Sibylle. Ihr sprühender Geist, das rassige Blut und ihre Begeisterung für alles Gute und Schöne rissen sie zuweilen fort — über das Ziel hinaus. Die engen Schranken, die den fürstlichen Hof einkreisten, lockten sie manchmal, sie zu durchbrechen. Das geschah aber dann immer mit so viel unwiderstehlicher Liebenswürdigkeit, daß ihr niemand zürnen konnte.
Schön war sie nie gewesen, aber über ihrem Gesicht lag der Abglanz großer Seelengüte, eines freien großen Geistes und anmutiger Schelmerei. So erschien sie immer reizend. Das Alter vermochte diesem Gesicht nichts von seinem Zauber zu nehmen. Sie war noch heute mit weißem Haar eine herzgewinnende Erscheinung und entzückte, wo sie sich sehen ließ.
Mit großer Vorliebe arrangierte sie bei den Hoffestlichkeiten Theatervorstellungen, lebende Bilder und allerlei Maskeraden und Mummenschanz. Immer war sie von einer Lebhaftigkeit und Unermüdlichkeit, die bei ihrem Alter bewundernswürdig war. Dabei stellte sie nicht etwa große Ansprüche an die Geldbeutel der Mitwirkenden. Sie hatte ein außerordentliches Geschick, aus nichts etwas zu machen und wußte jedem einen praktischen Wink zu geben. Alles was jung und begeisterungsfähig war, schwärmte für sie, denn unter ihrer Führung schien das Leben doppelt schön.
Sie bewohnte noch heute, wie bei Lebzeiten ihres Gatten, das sogenannte Prinzenpalais. Das war ein schlichtes, schmuckloses Gebäude mit einer graugestrichenen, nüchternen Fassade. Es bestand aus zwei Stockwerken. Seinem stolzen Namen entsprachen höchstens die ziemlich hohen und breiten Fenster und der hinter dem Haus liegende, parkähnliche Garten, in dem die Prinzessin herrliche Gartenfeste zu arrangieren pflegte, die immer das Entzücken der Schwarzenfelser Gesellschaft bildeten.
Dieses Haus hatte Prinzeß Sibylle bewohnt, seit sie mit ihrem Gemahl in Schwarzenfels ihren Einzug hielt als junge Frau. Sie war glücklich darin gewesen an der Seite ihres Gemahls, mit dem sie einen reinen Herzensbund geschlossen hatte. Daß dieser Ehe kein Kindersegen beschieden war, hatte zuweilen in den frohen dunklen Frauenaugen einen Schatten aufsteigen lassen. Aber sie hatte sich bezwungen.
»Alles muß der Mensch nit haben, sonst wird er halt zu übermütig. Es soll nit sein — also schick ich mich drein.«
Damit fand sie sich ab. Und als die Fürstin Maria starb, wurde sie deren Kindern eine treusorgende Mutter.
Ihr ausgesprochener Liebling war Prinz Joachim, dessen Wesen dem ihren entschieden verwandt war. Des Erbprinzen stille, verschlossene Art war ihr unverständlich. Sie bedauerte ihn darum, als sei es eine Art Krankheit.
»Er kann halt nit aus sich herausgehen — so ein armes Hascherl«, sagte sie oft bekümmert. Aber trotzdem hing sie auch an ihm mit ihrem reichen Herzen, das so viel Liebe zu verschenken hatte.
Nun lebte sie schon seit zehn Jahren als Witwe im Prinzenpalais, und sie hatte diesem Haus, das in einer schmalen, stillen Nebenstraße am Markt lag, den Stempel ihrer Persönlichkeit aufgedrückt. Da war alles hell, sonnig und behaglich. An allen Fenstern blühte ein reicher Blumenflor und verschönte die nüchterne, graue Fassade. Die nach dem Garten hinausliegende Terrasse verschwand fast unter der Fülle blühender Blumen. Für ihre eigene Person war Prinzeß Sibylle schlicht und anspruchslos. Sie sparte, wo sie konnte, von den Zinsen ihres Vermögens, um ihren beiden Neffen zuweilen den Überschuß zukommen zu lassen oder ihnen einige heitere Feste zu verschaffen. Wenn Prinz Joachim in heimlichen Nöten war, dann ging er zu Tante Sibylle, und die half — ohne Moralpauke. Sie zwinkerte nur mit den Augen und sagte mehr zärtlich als strafend: »Hast wieder ein Loch in der Börse gehabt, du Unband?«
Zu ihrem Hofstaat gehörten nur wenige Personen, die ihr alle treu ergeben waren und für sie durchs Feuer gegangen wären. Ihre einzige Hofdame war alt und gebrechlich, die Gicht hatte ihre Hände krumm gezogen, und sie brauchte viel mehr Hilfe und Bedienung als die Prinzessin selbst. Diese gab sich in ihrer Herzensgüte den Anschein, als könne sie ohne Fräulein von Sassenheim gar nicht fertig werden. Dabei aß die arme Sassenheim tatsächlich nur das Gnadenbrot. Sie kam selten einmal aus ihrem freundlichen, sonnigen Zimmer, aber die Prinzessin besuchte sie gewissenhaft jeden Tag einmal, und wenn sie nicht bei Tisch erscheinen konnte, dann kam die Prinzessin zu einem Plauderstündchen zu ihr. Der Haushofmeister und die spärliche Dienerschaft sorgten für den einfachen Haushalt, der sich nicht von dem guter Bürgersleute unterschied. Prinzessin Sibylles Vertraute und rechte Hand war ihre Kammerfrau, die sie schon von Wien mitgebracht hatte, Frau Broschinger. Die Prinzessin nannte sie jedoch nicht anders als Bröschchen.
Bröschchen war sehr stolz auf diesen Kosenamen, und ihr rundes, freundliches Gesicht strahlte, wenn auch Prinz Joachim sie so anredete.
Zu derselben Zeit, als Prinz Joachim über den Marktplatz ging, stand Frau Broschinger am Fenster im traulichen Wohnzimmer ihrer Herrin und zupfte die welken Blätter von den blühenden Geranien. Prinzeß Sibylle saß im schlichten grauen Seidenkleid in einem bequemen Lehnstuhl und blätterte in neuen Zeitschriften.
»Also, die arme Sassenheim hat wieder eine schlimme Nacht gehabt? Hast du dafür gesorgt, daß sie eine kräftige Bouillon zum Frühstück bekommt, Bröschchen?«
Die Kammerfrau legte sorgsam die welken Blätter in ein Körbchen.
»Durchlaucht können ganz unbesorgt sein, Fräulein von Sassenheim wird bestens gepflegt.«
»Ist doch ein armes Hascherl, gelt, Bröschchen? Da sind wir zwei gottlob ganz anders auf den Füßen.«
»Gott sei Dank! Durchlaucht nehmen es noch mit den Jüngsten auf.«
»Na, und du etwa nit?«
Bröschchen lächelte zufrieden.
»Oh, ich — Durchlaucht wissen ja, ich bin aus zähem Holz.«