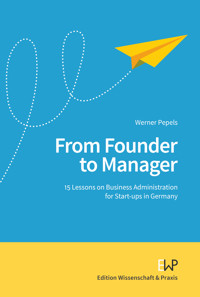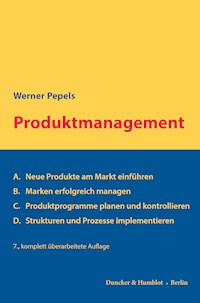
69,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Duncker & Humblot
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
»Produktmanagement« erscheint auch in der siebten Auflage mit den bewährten vier Kapiteln: Neue Produkte am Markt einführen, Marken erfolgreich managen, Produktprogramme planen und kontrollieren sowie Strukturen und Prozesse implementieren. Dies bietet einen umfassenden und fundierten Überblick über die Themeninhalte sowohl im Studium (meist in der Vertiefung Marketing) als auch im Management. Das Buch richtet sich dementsprechend an Studierende an wissenschaftlichen und anwendungsbezogenen Hochschulen sowie anspruchsvollen Weiterbildungseinrichtungen. Darüber hinaus an Manager in Marketing-, Vertriebs- und Werbeabteilungen als Update auf den Stand der Technik oder als Informationsbasis bei Quereinstieg. Das Buch besteht aus vier Teilbänden und ist in seiner Konzeption einzigartig auf dem deutschsprachigen Markt. Es ist mit sehr vielen Beispielen und Abbildungen versehen. Der Autor verfügt über jahrzehntelange berufspraktische und hochschuldidaktische Erfahrung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
WERNER PEPLES
Produktmanagement
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten © 2016 Duncker & Humblot GmbH, Berlin Fremddatenübernahme: TextFormA(r)t Daniela Weiland, Göttingen Druck: buchbücher.de gmbh, Birkach Printed in Germany
ISBN 978-3-428-14943-8 (Print) ISBN 978-3-428-54943-6 (E-Book) ISBN 978-3-428-84943-7 (Print & E-Book)
Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier entsprechend ISO 9706 ƀ
Internet: http://www.duncker-humblot.de
Vorwort
Die vorliegende siebte Auflage von „Produktmanagement“ weist gegenüber den Vorauflagen erhebliche Veränderungen auf. Seit 1998 sind die ersten sechs Auflagen des erfolgreichen Werks im Oldenbourg-Verlag erschienen (2000, 2001, 2002, 2006, 2013). Überraschend wurde eine weiterführende Zusammenarbeit dort aber offensichtlich nicht mehr gewünscht. Erfreulicherweise hat der Duncker & Humblot-Verlag die Neuauflage dieses Standardwerks übernommen. Hier fühlt man sich als Autor sehr gut aufgehoben. Dafür sei an dieser Stelle Dr. Florian Simon und seinem Team gedankt. Leitidee bleibt es unverändert, komplizierte und komplexe Sachverhalte einfach darzustellen. Dafür wurden alle Inhalte redaktionell überarbeitet und aktualisiert. Somit befindet sich die siebte Auflage wieder auf dem Stand des Wissens für die anspruchsvolle Praxis.
Die Inhalte sind in vier Teilen aufgebaut: Neue Produkte am Markt einführen – Marken erfolgreich managen – Produktprogramme planen und kontrollieren – Strukturen und Prozesse implementieren. Insofern handelt es sich praktisch um vier Fachbücher in einem. Somit erhalten Leserinnen und Leser einen kompletten Überblick über gängige Aufgaben im Produktmanagement. Der Verfasser kennt diese aus seiner Erfahrung als Key Accounter in der Beratung, in denen er über zwölf Jahre mit Produktmanagern als Auftraggebern zusammengearbeitet hat. Außerdem kennt er aus über einem Vierteljahrhundert Hochschullehrertätigkeit auch die Anforderungen an die Wissensvermittlung im Lehrbetrieb.
Der Band ist eingebettet in weitere Veröffentlichungen des Autors, welche die Inhalte ergänzen, weil das Produktmanagement zunehmend zu einer Integration der Marketingaufgaben führt. Hierzu einige Beispiele:
„Marketing“ (siebte Auflage) gibt einen kompletten Überblick über das konzeptionelle und operative Marketing (Duncker & Humblot, 2016),
„Strategisches Markt-Management“ (dritte Auflage) vertieft die konzeptionellen Aspekte des Produktmanagements (Berliner Wissenschafts-Verlag, 2015),
„Käuferverhalten“ (zweite Auflage) thematisiert die Prozesse und Strukturen von privaten und gewerblichen Kaufentscheiden (Erich Schmidt Verlag, 2013),
„Kommunikations-Management“ (fünfte Auflage) erfasst das wichtige ergänzende Feld des Kommunikationsmanagements (Duncker & Humblot, 2014),
„Preis- und Konditionenmanagement“ (dritte Auflage) vertieft das Umfeld der entgeltpolitischen Entscheidungen (Berliner Wissenschafts-Verlag, 2015),
[6]
„Moderne Marktforschung“ (dritte Auflage) befasst sich mit den Informationsgrundlagen der Produktmanagement-Arbeit (Duncker & Humblot, 2014),
„Lexikon Produktmanagement“ (zweite Auflage) stellt ein Nachschlagewerk zu relevanten Begrifflichkeiten dar (Symposion Publishing, 2010),
„Launch – Die Produkteinführung“ (zweite Auflage) ist ein strukturiertes Sammelwerk profilierter Fachautoren zum Thema (Symposion Publishing, 2012).
Das Produktmanagement als organisatorische Strukturierungsform betrifft somit allgemein die Planung, Organisation, Durchführung und Kontrolle aller Aktivitäten, welche die Einführung, die Pflege, die Ablösung oder die Einstellung von Produkten betreffen. Ferner den Aufbau und Ausbau von Markenartikeln als Produktpersönlichkeiten, die Gestaltung des Programms aller Produkte in Breite und Tiefe sowie die Steuerung der vornehmlich internen Prozesse bis zu deren Marktreifung und zum Markterfolg. Die Darstellung dieser Inhalte erfolgt systematischanalytisch mit stetigem Blick auf den Praxistransfer. Dieser wird durch über 200 strukturierende Abbildungen und rund 140 erläuternde Markenund Firmenbeispiele unterlegt. Hinzu kommen ausführliche Literaturhinweise für die vertiefende Information zum Thema.
Somit ist dieser Band sowohl für das Studium als auch im Management nutzbar. Bei Studierenden handelt es sich vornehmlich um solche der BWL mit Schwerpunkt Marketing an wissenschaftlichen und anwendungsorientierten Hochschulen, aber auch in marktorientierten Studiengängen an anspruchsvollen Weiterbildungseinrichtungen wie VWA’en, IHK’en, BA’en etc. Ihnen werden umfangreiche Inhalte für Seminararbeiten, Fallstudien, zur Klausurvorbereitung und zum Berufseinstieg geboten.
Bei Managern ist an solche in Marketing-, Vertriebs- und Werbeabteilungen gedacht, sowohl als Up date bei schon länger zurückliegender Ausbildung wie auch als Informationsbasis für Wechsler aus anderen kaufmännischen Funktionen sowie Quereinsteiger ohne ökonomischen Ausbildungshintergrund. Ihnen allen werden Informationen zum Produktmanagement in großer Dichte und Tiefe geboten, die aufgrund ihrer praxisorientierten Auslegung die Übertragung auf die praktische Arbeit erlauben und dort zu besseren Entscheidungen führen.
Insofern ist der Boden für eine ertragreiche Nutzung der Leseinhalte bereitet. Der Autor wünscht Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, nunmehr viel Erfolg bei der Auswertung für Ihren persönlichen Weg.
Krefeld, im Februar 2016
Werner Pepels
Inhaltsübersicht
A. Neue Produkte am Markt einführen
1. Neuproduktkonzept
1.1 Innovation
1.2 Ideenfindung
1.3 Forschung und Entwicklung
1.4 Markterwartungen
1.5 Einführungsprozess
1.6 Produktbesonderheiten
2. Produkterfolgsfaktoren
2.1 Packung
2.2 Gewerbliche Schutzrechte
3. Wirtschaftlichkeitsrechnung
3.1 Budgetierung
3.2 Vorgangsorientierte Kostenrechnung
3.3 Break even-Analyse
3.4 Effizienzsteigerung
4. Überwachung im Produktmanagement
4.1 Produktmarketing-Controlling
4.2 Proaktive Gegensteuerung
B. Marken erfolgreich managen
1. Idee der Markentechnik
1.1 Darstellung
1.2 Bedeutung der Marke
1.3 Markenpersönlichkeit
1.4 Markenpositionierung
1.5 Markenereignisse
2. Markenarchitektur
2.1 Horizontale Markentypen
2.2 Vertikale Markentypen
2.3 Absenderbezogene Markentypen
3. Markenerfolgsfaktoren
3.1 Strategiebasis
3.2 Marktstellung
3.3 Marktstimulierung
3.4 Marktverhalten
3.5 Markterfassung
3.6 Strategiekombinationen
4. Markenführung
4.1 Markeneinführung
4.2 Abwendung von Markenschaden
5. Markenschutz
5.1 Markenwert
5.2 Markenangriffe
5.3 Schutzrechte an Marken
C. Produktprogramme planen und kontrollieren
1. Programmstruktur
2. Programmanalyse
2.1 Marktfeld-Abgrenzung
2.2 Einfache Analyseverfahren
2.3 Komplexe Analyseverfahren
2.4 Programmanalyse mittels Portfolios
3. Programmstrategie
3.1 Programmbreite
3.2 Programmtiefe
3.3 Programmbereinigung
4. Strategische Programmgestaltung
4.1 Programmgestaltungsziel
4.2 Bestimmung des Marktfelds
4.3 Wertkettengestaltung
4.4 Wettbewerbsposition
4.5 Wettbewerbsdynamik
4.6 Strategiebewertung
4.7 Produkt-Markt-Strategie
4.8 Marktmechanik
D. Strukturen und Prozesse implementieren
1.Strukturorganisation
1.1 Elemente der Organisation
1.2 Konfiguration der Organisation
1.3 Koordination der Organisation
1.4 Spezialisierung der Organisation
2. Prozessorganisation
2.1Prozessorientierung
2.2Produktionsverschlankung
2.3Produktionssteuerung
3.Qualitätspolitik
3.1Leitlinien
3.2Qualitätsproduktion
3.3Zertifizierung .
3.4Qualitätsauszeichnungen
4.Preispolitik
4.1 Bedeutung des Preises
4.2 Preis-Leistungs-Verhältnis
4.3 Beeinflussung der Kaufwahrscheinlichkeit
4.4 Wettbewerbsorientierte Preisgestaltung
4.5 Nachfrageorientierte Preisgestaltung
4.6 Betriebszielorientierte Preisgestaltung
4.7 Verringerung der Preistransparenz
4.8 Interne Steuerungsfunktion des Preises
4.9 Administrierte Preissetzung
Literaturhinweise
Stichwortverzeichnis
Über den Autor
Inhaltsverzeichnis
A. Neue Produkte am Markt einführen
1. Neuproduktkonzept
1.1 Innovation
1.1.1 Innovationsarten
1.1.2 Innovationsneigung
1.1.2.1 Pionier
1.1.2.2 Früher Folger
1.1.2.3 Modifikator
1.1.2.4 Nachzügler
1.2 Ideenfindung
1.2.1 Ideenquellen
1.2.2 Kreativitätstechniken
1.2.2.1 Anforderungen an Kreativität
1.2.2.2 Logisch-diskursive Verfahren
1.2.2.2.1 Morphologischer Kasten
1.2.2.2.2 Funktional-Analyse
1.2.2.2.3 Verwandte Verfahren
1.2.2.3 Intuitiv-laterale Verfahren
1.2.2.3.1 Brainstorming
1.2.2.3.2 Methode 6 3 5
1.2.2.3.3 Synektik
1.2.2.3.4 Bionik
1.2.2.3.5 Sonstige Verfahren
1.2.2.4 Systematische Verfahren
1.2.2.4.1 Eigenschaftsliste
1.2.2.4.2 Fragenkatalog
1.2.2.4.3 Mind Map/Metaplan
1.2.3 Ideenauswertung
1.3 Forschung und Entwicklung
1.3.1 Technischer Fortschritt
1.3.2 Bereiche des FuE-Managements
1.3.3 Technologieentwicklung
1.3.4 Technologielebenszyklus
1.3.5 Technologiebewertung
1.3.6 FuE-Portfolio-Analysen
1.3.7 Innovations-Positionen
1.4 Markterwartungen
1.4.1 Testverfahren
1.4.2 Absatzprognosen
1.4.2.1 Intuitive Prognoseverfahren
1.4.2.2 Systematische Prognoseverfahren
1.4.2.2.1 Grundlagen
1.4.2.2.2 Deskriptive Prognose
1.4.2.2.3 Analytische Prognose
1.5 Einführungsprozess
1.6 Produktbesonderheiten
1.6.1 Dienstleistungen
1.6.1.1 Begriffsabgrenzung
1.6.1.2 Besonderheiten
1.6.1.2.1 Immateralität
1.6.1.2.2 Externer Faktor
1.6.1.2.3 Individualität
1.6.1.3 Kundendienst
1.6.2 Industriegüter
1.6.2.1 Begriffsabgrenzung
1.6.2.2 Marktkennzeichen
1.6.2.3 Vermarktungsobjekte
1.6.2.3.1 Rohstoffe
1.6.2.3.2 Systeme
1.6.2.3.3 Anlagen
1.6.2.3.4 Produkte
1.6.2.3.5 Sonstige Marktarten
2. Produkterfolgsfaktoren
2.1 Packung
2.1.1 Begriffsabgrenzung
2.1.2 Packungsfunktionen
2.1.2.1 Rationalisierung
2.1.2.2 Kommunikation
2.1.2.3 Verwendungserleichterung
2.1.3 Packungsansprüche
2.1.4 Entsorgung
2.1.4.1 Kreislaufwirtschaft
2.1.4.2 Verpackungsverordnung
2.1.4.3 „Grüner Punkt“
2.2 Gewerbliche Schutzrechte
2.2.1 Schutzrechtspolitik
2.2.2 Patentschutz
2.2.3 Gebrauchsmusterschutz
2.2.4 Geschmacksmusterschutz
2.2.5 Urheberrechtsschutz und andere Schutzarten
2.2.6 Produzentenhaftung
2.2.6.1 Gewährleistungshaftung
2.2.6.2 Produkthaftung
2.2.7 Produktrückruf
2.2.7.1 Inhalte
2.2.7.2 Rückrufe speziell in der Automobilbranche
2.2.7.3 Sicherheitskommunikation
2.2.7.4 Rückrufdurchführung
2.2.7.5 Kommunikationsaktion
2.2.7.6 Rückrufkommunikation im Absatzkanal
3. Wirtschaftlichkeitsrechnung
3.1 Budgetierung
3.1.1 Budgetsystem
3.1.2 Analytische Verfahren
3.1.3 Nicht-analytische Verfahren
3.1.4 Rechenrichtung
3.1.5 Zeitperspektive und -dauer
3.1.6 Zero Base Budgeting
3.2 Vorgangsorientierte Kostenrechnung
3.2.1 Prozesskostenrechnung
3.2.1.1 Darstellung
3.2.1.2 Anwendung
3.2.2 Zielkostenrechnung
3.2.2.1 Darstellung
3.2.2.2 Anwendung
3.2.3 Lebenszykluskostenrechnung
3.2.4 Differenzzahlungsrechnung
3.2.5 Transaktionskostenrechnung
3.2.6 Deckungsbeitragsflussrechnung
3.3 Break even-Analyse
3.3.1 Darstellung
3.3.2 Bewertung
3.4 Effizienzsteigerung
3.4.1 Wertanalyse
3.4.2 Gemeinkosten-Wertanalyse
3.4.3 Benchmarking
3.4.3.1 Konzept
3.4.3.2 Arten
3.4.3.3 Umsetzung
4. Überwachung im Produktmanagement
4.1 Produktmarketing-Controlling
4.1.1 Inhalt
4.1.2 Element Planung
4.1.2.1 Netzplantechnik
4.1.2.2 Sonstige Planungstechniken
4.1.2.3 Optimierungsverfahren
4.1.3 Element Information
4.1.3.1 Informationsbasis
4.1.3.2 Datenbasierte Systeme
4.1.3.3 Wissensbasierte Systeme
4.1.4 Element Überprüfung
4.1.5 Element Kontrolle
4.1.5.1 Formen von Kennzahlen
4.1.5.2 Kennzahlenbeispiele
4.1.5.3 Kennzahlensysteme
4.1.5.4 Balanced Scorecard
4.2 Proaktive Gegensteuerung
4.2.1 Krisenbewusstsein
4.2.2 Prävention
4.2.3 Erfassung und Auswertung
B. Marken erfolgreich managen
1. Idee der Markentechnik
1.1 Darstellung
1.1.1 Markenphänomen
1.1.2 Definition
1.2 Bedeutung der Marke
1.2.1 Markeninhalte
1.2.2 Markeneigenschaften
1.3 Markenpersönlichkeit
1.4 Markenpositionierung
1.4.1 Verfahrensstufen
1.4.2 Positionsbestimmung
1.4.3 Positionierungsanlässe
1.4.4 Positionierungsrichtung
1.5 Markenereignisse
1.5.1 Markenlebenszyklus
1.5.2 Markenaktualisierung
1.5.3 Markenablösung
1.5.4 Markenverkauf
2. Markenarchitektur
2.1 Horizontale Markentypen
2.1.1 Markensegmentierung
2.1.1.1 Einzelmarke
2.1.1.2 Mehrmarken
2.1.2 Markendifferenzierung
2.1.2.1 Monomarke
2.1.2.2 Rangemarken
2.1.3 Markenanzahl
2.1.3.1 Solitärmarke
2.1.3.2 Multimarken
2.1.4 Markenidentität
2.1.4.1 Dachmarke
2.1.4.2 Singulärmarken
2.1.5 Kombinationen
2.2 Vertikale Markentypen
2.2.1 Erstmarke
2.2.2 Markenaufwertung
2.2.2.1 Premiummarke
2.2.2.2 Luxusmarke
2.2.3 Markenabwertung
2.2.3.1 Zweitmarke
2.2.3.2 Drittmarke
2.2.4 Gattungsware
2.3 Absenderbezogene Markentypen
2.3.1 Markenhalter
2.3.1.1 Herstellermarke
2.3.1.2 Handelsmarke
2.3.2 Markenumfang
2.3.2.1 Individualmarke
2.3.2.2 Kollektivmarke
2.3.3 Markenreichweite
2.3.3.1 Fertigproduktmarke
2.3.3.2 Vorproduktmarke
2.3.4 Markendiversifikation
2.3.4.1 Transfermarke
2.3.4.1.1 Hauptnutzung
2.3.4.1.2 Nebennutzung
2.3.4.2 Lizenzmarke
2.3.4.2.1 Begriff
2.3.4.2.2 Arten
2.3.4.2.3 Formen
2.3.4.2.4 Bewertung
2.3.4.2.5 Lizenzmittler
2.3.5 Markengebiet
2.3.5.1 Intranationale Verbreitung
2.3.5.2 Supranationale Verbreitung
2.3.6 Markenverbund
2.3.6.1 Systemmarke
2.3.6.2 Geschäftsstättenmarke
3. Markenerfolgsfaktoren
3.1 Strategiebasis
3.2 Marktstellung
3.2.1 Markenführer
3.2.2 Markenherausforderer
3.2.3 Markenmitläufer
3.2.4 Markennischenanbieter
3.3 Marktstimulierung
3.3.1 Markenpolarisierung
3.3.2 Präferenz-Position
3.3.3 Preis-Mengen-Position
3.4 Marktverhalten
3.4.1 Statische Sichtweise
3.4.2 Dynamische Sichtweise
3.5 Markterfassung
3.5.1 Dimensionen
3.5.2 Bewertung
3.6 Strategiekombinationen
4. Markenführung
4.1 Markeneinführung
4.1.1 Markierung von Produkten
4.1.2 Namensentwicklung
4.1.3 Branding-Probleme
4.2 Abwendung von Markenschaden
5. Markenschutz
5.1 Markenwert
5.1.1 Begriffsbestimmungen
5.1.2 Messkriterien
5.1.3 Darlegungsanlässe
5.1.4 Markenwertmodelle
5.1.4.1 Kommerzielle Messprodukte
5.1.4.2 Wissenschaftliche Ansätze
5.1.5 Markenstärkemodelle
5.1.5.1 Kommerzielle Messprodukte
5.1.5.2 Wissenschaftliche Ansätze
5.1.6 Kombinationsmodelle
5.1.6.1 Kommerzielle Messprodukte
5.1.6.2 Wissenschaftliche Ansätze
5.1.7 Markenkernprodukte
5.1.8 Kritische Würdigung
5.2 Markenangriffe
5.2.1 Piraterie
5.2.2 Spionage
5.2.3 Erpressung
5.3 Schutzrechte an Marken
5.3.1 Modalitäten
5.3.2 Entstehung
5.3.3 Markengesetz
5.3.4 Schutzrechtsmanagement
C. Produktprogramme planen und kontrollieren
1. Programmstruktur
2. Programmanalyse
2.1 Marktfeld-Abgrenzung
2.1.1 Kernkompetenz
2.1.2 Strategisches Geschäftsfeld
2.1.3 Geschäftsmodell
2.1.4 Strategische Geschäftseinheit
2.1.5 Branchen-Analyse
2.1.5.1 Lieferanten
2.1.5.2 Abnehmer
2.1.5.3 Substitutionsgutanbieter
2.1.5.4 Potenzielle Konkurrenten
2.1.5.5 Aktuelle Konkurrenten
2.2 Einfache Analyseverfahren
2.2.1 Struktur-Analyse
2.2.1.1 Umsatzanteil
2.2.1.2 Altersquerschnitt
2.2.2 Umfeld-Analyse
2.2.3 Ressourcen-Analyse
2.2.4 Potenzial-Analyse
2.2.5 Abweichungs-Analyse
2.2.6 Engpass-Analyse
2.2.7 Profit Pool-Diagramm
2.3 Komplexe Analyseverfahren
2.3.1 SPACE-Analyse
2.3.2 Wertketten-Analyse
2.3.3 Lebenszyklus-Analyse
2.3.3.1 Phasen
2.3.3.2 Bewertung
2.4 Programmanalyse mittels Portfolios
2.4.1 Portfolio-Vorläufer
2.4.1.1 Programmerfolgs-Portfolio
2.4.1.2 Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Portfolio
2.4.1.3 Risiken-Chancen-Schwächen-Stärken-Portfolio
2.4.2 Vier-Felder-Portfolio
2.4.2.1 Darstellung
2.4.2.2 Konsequenzen
2.4.2.3 Bewertung
2.4.3 Neun-Felder-Portfolio
2.4.3.1 Darstellung
2.4.3.2 Konsequenzen
2.4.3.3 Bewertung
2.4.4 Sonstige Portfolio-Ansätze
2.4.5 Gesamtbewertung
2.4.6 Ziel-Portfolio
2.4.7 Neues BCG-Portfolio
3. Programmstrategie
3.1 Programmbreite
3.1.1 Programmdiversifizierung
3.1.1.1 Diversifizierungsbegriff
3.1.1.2 Markteintrittsschranken
3.1.1.3 Homogene Diversifizierung
3.1.1.3.1 Horizontale Ausrichtung
3.1.1.3.2 Vertikale Ausrichtung
3.1.1.4 Heterogene Diversifizierung
3.1.2 Programmunifizierung
3.1.2.1 Inhalt
3.1.2.2 Marktaustrittsschranken
3.1.2.3 Größeneffekte der Produktion
3.1.2.3.1 Statischer Größeneffekt
3.1.2.3.2 Dynamischer Größeneffekt
3.1.2.3.3 Bewertung
3.1.2.4 Komplexität
3.1.2.5 Mass Customization
3.1.3 Programmumfang
3.2 Programmtiefe
3.2.1 Programmdifferenzierung
3.2.1.1 Marktsegmentierung
3.2.1.1.1 Inhalt
3.2.1.1.2 Segmentierungskriterien
3.2.1.1.3 Bewertung
3.2.1.2 Produktbündelung
3.2.2 Programmstandardisierung
3.2.2.1 Baukastenprinzip
3.2.2.2 Produktionsprogramm
3.2.2.3 Bewertung
3.3 Programmbereinigung
3.3.1 Programmaustausch
3.3.1.1 Innovation
3.3.1.1.1 Einführungsplanung
3.3.1.1.2 Entscheidungssituation
3.3.1.2 Elimination
3.3.1.2.1 Inhalt
3.3.1.2.2 Kriterien
3.3.1.2.3 Verbundeffekte
3.3.2 Programmvariation
3.3.2.1 Ausprägungen
3.3.2.2 Veränderungsrichtung
3.3.3 Programmkonstanz
3.3.3.1 Produktart
3.3.3.2 Produktform
3.3.3.3 Produktgrafik
3.3.3.4 Produktgeruch
3.3.3.5 Produktsound
4. Strategische Programmgestaltung
4.1 Programmgestaltungsziel
4.1.1 Formale Zieldimensionen
4.1.2 Materielle Zieldimensionen
4.1.2.1 Vision
4.1.2.2 Business Mission
4.1.2.3 Kulturelle Werte
4.1.2.3.1 Konstrukterklärung
4.1.2.3.2 Kritische Bewertung
4.1.2.3.3 Kultureller Wandel
Exkurs: Unternehmensleitsätze
4.1.3 Zielbildungsverfahren
4.1.3.1 Nutzwert-Analyse
4.1.3.2 AHP-Analyse
4.1.3.3 Netzwerk-Analyse
4.2 Bestimmung des Marktfelds
4.2.1 Strategische Lücke
4.2.1.1 Darstellung
4.2.1.2 Bewertung
4.2.2 Marktdurchdringung
4.2.3 Markterweiterung
4.2.4 Produkterweiterung
4.3 Wertkettengestaltung
4.3.1 Denkmodell der Wertkette
4.3.2 Gliederung der Wertkette
4.3.3 Verkürzung der Wertkette
4.3.4 Verlängerung der Wertkette
4.4 Wettbewerbsposition
4.4.1 Dimensionen und Optionen
4.4.2 Generalisierungsposition
4.4.3 Involvierungsposition
4.4.4 Individualisierungsposition
4.4.5 Spezialisierungsposition
4.5 Wettbewerbsdynamik
4.5.1 Strategische Gruppen
4.5.1.1 Konzept
4.5.1.2 Dominanz innerhalb der eigenen Strategischen Gruppe
4.5.1.3 Wechsel in eine günstigere Strategische Gruppe
4.5.1.4 Gründung einer neuen Strategischen Gruppe
4.5.1.5 Stärkung der eigenen Strategischen Gruppe
4.5.2 Outpacing-Konzept
4.5.3 Hyper Competition
4.5.4 Blue Ocean-Konzept
4.6 Strategiebewertung
4.6.1 Auswertungsverfahren
4.6.2 Erkenntnisse des PIMS-Projekts
4.6.2.1 Untersuchungsanlage
4.6.2.2 Schlüsselfaktoren
4.6.2.3 Haupterkenntnisse für bestehende Geschäftseinheiten
4.6.2.4 Haupterkenntnisse für neue Geschäftseinheiten
4.6.2.5 Haupterkenntnisse für Klein- und Mittelstand
4.6.2.6 Sonderauswertungen
4.6.2.7 Bewertung
4.7 Produkt-Markt-Strategie
4.7.1 Begriff lichkeiten
4.7.2 Gewinn- vs. Sicherheits-Präferenz
4.7.3 Chancen- vs. Risiken-Präferenz
4.7.4 Multinationale Multiprodukt-Unternehmen
4.7.5 Gestaltung des Programms
4.7.6 Programmoptimum
4.8 Marktmechanik
D. Strukturen und Prozesse implementieren
1. Strukturorganisation
1.1 Elemente der Organisation
1.2 Konfiguration der Organisation
1.2.1 Einlinienaufbau im Produktmanagement
1.2.2 Mehrlinienaufbau im Produktmanagement
1.2.3 Stablinienaufbau im Produktmanagement
1.2.4 Kreuzlinienaufbau im Produktmanagement
1.3 Koordination der Organisation
1.3.1 Teamausrichtung im Produktmanagement
1.3.2 Projektausrichtung im Produktmanagement
1.3.3 Zentralbereichsausrichtung im Produktmanagement
1.3.4 Gremienausrichtung im Produktmanagement
1.3.5 Reale Mischformen des Organisationsaufbaus
1.4 Spezialisierung der Organisation
1.4.1 Objektorientierung
1.4.2 Stellenplanung im Produktmanagement
2. Prozessorganisation
2.1 Prozessorientierung
2.1.1 Geschäftsprozesse
2.1.1.1 Element Prozesssteuerung
2.1.1.2 Element Kundenorientierung
2.1.2 Business Process Reengineering
2.2 Produktionsverschlankung
2.2.1 Ansatz
2.2.2 Maßnahmen
2.3 Produktionssteuerung
2.3.1 Fertigungsbegriffe
2.3.2 Fertigungsabläufe
3. Qualitätspolitik
3.1 Leitlinien
3.1.1 Qualitätsbegriff
3.1.2 Total Quality Management
3.1.2.1 Konzept
3.1.2.2 Umsetzung
3.2 Qualitätsproduktion
3.2.1 Qualitätszirkel
3.2.2 Quality Function Deployment
3.2.3 Statistische Mess- und Prüfverfahren
3.2.3.1 Statistische Versuchsplanung
3.2.3.2 Statistische Prozessregelung
3.2.3.3 Versuchsanlage
3.2.4 Fehlervermeidung
3.2.4.1 Null-Fehler-Produktion
3.2.4.2 Fehler-Eintritts- und -Einf luss-Analyse
3.2.4.3 Fehlerkosten
3.2.5 Qualitätswerkzeuge
3.2.6 Managementwerkzeuge
3.3 Zertifizierung
3.3.1 Intention der Qualitätsnormenreihe
3.3.2 Elemente der Zertifizierung
3.3.3 Vorgehen der Zertifizierung
3.3.4 Abweichungen
3.3.5 Beurteilung
3.3.6 Einteilung der DIN EN ISO-Normenreihe
3.3.6.1 Qualitätsnorm 9000:2015
3.3.6.2 Qualitätsnorm 9001:2015
3.3.6.3 Qualitätsnorm 9004:2009
3.4 Qualitätsauszeichnungen
4. Preispolitik
4.1 Bedeutung des Preises
4.2 Preis-Leistungs-Verhältnis
4.3 Beeinflussung der Kaufwahrscheinlichkeit
4.4 Wettbewerbsorientierte Preisgestaltung
4.4.1 Preiselastizitäten als Kenngrößen
4.4.2 Preisführerschaft und -folgerschaft
4.5 Nachfrageorientierte Preisgestaltung
4.5.1 Elemente des Preisinteresses
4.5.2 Hybrides Kaufverhalten
4.5.3 Nachfrage- und Einkommenseffekte
4.5.4 Kaufkraft als Preisbasis
4.6 Betriebszielorientierte Preisgestaltung
4.6.1 Elemente
4.6.2 Leitlinien im Zeitablauf
4.6.2.1 Preiskonstanz
4.6.2.1.1 Prämienpreissetzung
4.6.2.1.2 Diskontpreissetzung
4.6.2.2 Preisvariation
4.6.2.2.1 Penetrationspreissetzung
4.6.2.2.2 Abschöpfungspreissetzung
4.6.2.2.3 Aktionspreissetzung
4.6.3 Preisinnovation
4.7 Verringerung der Preistransparenz
4.7.1 Preislinien
4.7.2 Preisbaukästen
4.7.3 Preisbündel
4.7.4 Yield Management
4.8 Interne Steuerungsfunktion des Preises
4.8.1 Preispolitischer Ausgleich
4.8.2 Lenkpreise
4.8.3 Marktstörungen
4.9 Administrierte Preissetzung
Literaturhinweise
Stichwortverzeichnis
Über den Autor
Abbildungsverzeichnis
Abbildung A1:
Innovationsarten
Abbildung A2:
Innovationsneigung
Abbildung A3:
Kreativitätstechniken
Abbildung A4:
Morphologischer Kasten (Beispiel)
Abbildung A5:
Methode 6 3 5 (Beispiel)
Abbildung A6:
Ablauf einer Synektiksitzung
Abbildung A7:
Elemente des FuE-Managements
Abbildung A8:
Technologieentwicklung
Abbildung A9:
Technologie-Portfolio
Abbildung A10:
Innovations-Portfolio
Abbildung A11:
Testmarktauswertung (Beispiel)
Abbildung A12:
Intuitive Prognosen
Abbildung A13:
Ablauf der Delphi-Methode
Abbildung A14:
Ablauf der Szenario-Technik
Abbildung A15:
Elemente der Systematischen Prognose
Abbildung A16:
Prognosearten
Abbildung A17:
Verfahren der kurzfristigen Prognose
Abbildung A18:
Verfahren der langfristigen Prognose
Abbildung A19:
Verfahren der analytischen Prognose
Abbildung A20:
Kombinationsmöglichkeiten im Kundendienst
Abbildung A21:
Arten des Industriegeschäfts
Abbildung A22:
Packungsfunktionen
Abbildung A23:
„Grüner Punkt“
Abbildung A24:
Arten Gewerblicher Schutzrechte
Abbildung A25:
Schema der Produkthaftung
Abbildung A26:
Budgetierungsansätze
Abbildung A27:
Moderne Kostenrechnungsverfahren
Abbildung A28:
Kalkulationsvergleich
Abbildung A29:
Prinzip des Target Costings
Abbildung A30:
Ablauf des Target Costings
Abbildung A31:
Value Control Chart
Abbildung A32:
Break even-Analyse
[26]
Abbildung A33:
Schritte der Wertanalyse
Abbildung A34:
Formen des Externen Benchmarkings
Abbildung A35:
Ablauf des Benchmarkings
Abbildung A36:
Controlling-Module
Abbildung A37:
Elemente des Produktmarketing-Controllings
Abbildung A38:
Netzplantechniken
Abbildung A39:
Netzplan (Beispiel)
Abbildung A40:
Gantt-Diagramm (Balkendiagramm)
Abbildung A41:
Projektstrukturplan
Abbildung A42:
Projektablaufplan
Abbildung A43:
Prinzip der Simplex-Methode
Abbildung A44:
Du Pont-Kennzahlensystem
Abbildung A45:
ZVEI-Kennzahlensystem (stark vereinfacht)
Abbildung A46:
RL-Kennzahlensystem (stark vereinfacht)
Abbildung A47:
Perspektiven der Balanced Scorecard
Abbildung B1:
Markeninhalte
Abbildung B2:
Markeneigenschaften
Abbildung B3:
Elemente der Positionsbestimmung
Abbildung B4:
Markenereignisse
Abbildung B5:
Optionen der Markenstrategie
Abbildung B6:
Horizontale Markentypen (I)
Abbildung B7:
Horizontale Markentypen (II)
Abbildung B8:
Formen der Rangemarke
Abbildung B9:
Formen der Singulärmarke
Abbildung B10:
Beispiele horizontaler Markenarchitekturen
Abbildung B11:
Vertikale Markentypen (I)
Abbildung B12:
Vertikale Markentypen (II)
Abbildung B13:
Absenderbezogene Markentypen (I)
Abbildung B14:
Absenderbezogene Markentypen (II)
Abbildung B15:
Formen der Handelsmarke
Abbildung B16:
Formen der Kollektivmarke
Abbildung B17:
Formen der Vorproduktmarke
Abbildung B18:
Formen der Markendiversifikation
Abbildung B19:
Arten der Markenlizenzierung
Abbildung B20:
Anwendungen der Systemmarke
Abbildung B21:
Marktstellung
Abbildung B22:
Optionen des Markenherausforderers
Abbildung B23:
Porter-(U-)Kurve
[27]
Abbildung B24:
Marktstimulierung
Abbildung B25:
Marktverhalten
Abbildung B26:
Strategisches Spielbrett
Abbildung B27:
Markterfassung
Abbildung B28:
Konkurrenzvorteil
Abbildung B29:
Markenführung
Abbildung B30:
Ablauf einer Namensentwicklung
Abbildung B31:
Markenschutz
Abbildung B32:
Markenwert-Rankings international und national
Abbildung B33:
Übersicht Markenwertmodelle
Abbildung B34:
Markenangriffe
Abbildung C1:
Programmstruktur (I)
Abbildung C2:
Programmstruktur (II)
Abbildung C3:
Produktstruktur (III)
Abbildung C4:
Marktorientierung vs. Ressourcenorientierung
Abbildung C5:
Wettbewerbsvorteil-Kundennutzen-Matrix
Abbildung C6:
Kernkompetenz-Kriterien
Abbildung C7:
Ausgewählte Konzepte zur Abgrenzung des Relevanten Markts
Abbildung C8:
Markt-Netzwerk Schokoladeprodukte
Abbildung C9:
Elemente des Geschäftsmodells
Abbildung C10:
Elemente der Verhandlungsmacht
Abbildung C11:
Lieferantenmacht – Abnehmermacht
Abbildung C12:
Aktuelle Konkurrenzmacht – Potenzielle Konkurrenzmacht
Abbildung C13:
Umsatzanteils-Analyse
Abbildung C14:
Altersquerschnitt-Analyse
Abbildung C15:
Ressourcen-Analyse
Abbildung C16:
Potenzial-Analyse
Abbildung C17:
Abweichungs-Analyse
Abbildung C18:
Engpass-Analyse
Abbildung C19:
Profit Pool-Diagramm
Abbildung C20:
Schema der Space-Analyse
Abbildung C21:
Space-Analyse-Kreuz
Abbildung C22:
Schema der Wertschöpfungskette
Abbildung C23:
Produktlebenszyklus (I)
Abbildung C24:
Produktlebenszyklus (II)
Abbildung C25:
Programmerfolgs-Portfolio
Abbildung C26:
Stärken-Schwächen-Analyse
Abbildung C27:
Chancen-Analyse – Risiken-Analyse
[28]
Abbildung C28:
Prinzip der TOWS-Matrix
Abbildung C29:
Beispiel einer TOWS-Matrix
Abbildung C30:
Vier-Felder-Portfolio (I)
Abbildung C31:
Vier-Felder-Portfolio (II)
Abbildung C32:
Vier-Felder-Portfolio-Erweiterungen
Abbildung C33:
Relative Wettbewerbsstärke im Neun-Felder-Portfolio
Abbildung C34:
Marktattraktivität im Neun-Felder-Portfolio
Abbildung C35:
Neun-Felder-Portfolio (I)
Abbildung C36:
Neun-Felder-Portfolio (II)
Abbildung C37:
20-Felder-Portfolio
Abbildung C38:
Neues BCG-Portfolio
Abbildung C39:
Eisenhower-Matrix
Abbildung C40:
Diversifizierung (I)
Abbildung C41:
Diversifizierung (II)
Abbildung C42:
Marktbearbeitungspriorität
Abbildung C43:
Horizontale Diversifikation (Beispiel Handel)
Abbildung C44:
Vertikale Diversifikation (Beispiel Handel)
Abbildung C45:
Diagonale Diversifizierung (Beispiel Handel)
Abbildung C46:
Größeneffekte
Abbildung C47:
Statischer vs. dynamischer Größeneffekt
Abbildung C48:
Dynamische Größeneffekte
Abbildung C49:
Marktanteil und Größeneffekt
Abbildung C50:
Mass Customization
Abbildung C51:
Segmentationsvoraussetzungen
Abbildung C52:
Kombinationsmöglichkeiten der Produktbündelung
Abbildung C53:
Planungsarten
Abbildung C54:
Entscheidungssituationen
Abbildung C55:
Elemente des Risikomanagements
Abbildung C56:
Markterwartungen
Abbildung C57:
Marktrelationen
Abbildung C58:
Verbundeffekte
Abbildung C59:
Produkteigenschaften
Abbildung C60:
Definition von Zielen
Abbildung C61:
Eisberg-Modell der Kultur
Abbildung C62:
Prinzip der Nutzwert-Analyse
Abbildung C63:
Arbeitsschritte des AHP
Abbildung C64:
Mögliches Hierarchiemodell des AHP
Abbildung C65:
Netzwerk-Analyse (I)
[29]
Abbildung C66:
Netzwerk-Analyse (II)
Abbildung C67:
Strategische Lücke
Abbildung C68:
Marktdurchdringung (Optionen)
Abbildung C69:
Markterweiterung (Optionen)
Abbildung C70:
Produkterweiterung (Optionen)
Abbildung C71:
Wertkettenstruktur, -breite und -tiefe
Abbildung C72:
Optionen der Wertkettengestaltung (I)
Abbildung C73:
Optionen der Wertkettengestaltung (II)
Abbildung C74:
Wertkettenarchitektur
Abbildung C75:
Wettbewerbspositionsmatrix
Abbildung C76:
Zusammenhang der Wettbewerbspositionsmatrix
Abbildung C77:
Optionen der Strategischen Gruppe
Abbildung C78:
Outpacing-Konzept
Abbildung C79:
Value Map
Abbildung C80:
Hyper Competition-Kette
Abbildung C81:
Scoring-Verfahren auf Basis einer Risikoanalyse
Abbildung C82:
Strategieprofilbeispiel
Abbildung C83:
Prinzip des Capital Asset Pricing Model
Abbildung C84:
Cross Impact-Matrix
Abbildung C85:
Zusammenhang zwischen RMA und RPQ
Abbildung C86:
Produkt-Markt-Strategie
Abbildung D1:
Organisationsdimensionen
Abbildung D2:
Alternative Organisations-Konfigurationen
Abbildung D3:
Aufbau der Einlinienorganisation
Abbildung D4:
Aufbau der Mehrlinienorganisation
Abbildung D5:
Aufbau der Stab-Linienorganisation
Abbildung D6:
Aufbau der Kreuzlinien-(Matrix-)organisation
Abbildung D7:
Alternativen der Organisations-Koordination
Abbildung D8:
Aufbau der Teamorganisation
Abbildung D9:
Aufbau der Projektorganisation
Abbildung D10:
Aufbau der Zentralbereichsorganisation
Abbildung D11:
Aufbau der Gremienorganisation
Abbildung D12:
Mischform Funktionsorientierte Organisation (I)
Abbildung D13:
Mischform Produktorientierte Organisation
Abbildung D14:
Mischform Funktionsorientierte Organisation (II)
Abbildung D15:
Mischform Gebietsorientierte Organisation
Abbildung D16:
Mischform Funktionsorientierte Organisation (III)
Abbildung D17:
Mischform Kundenorientierte Organisation
[30]
Abbildung D18:
Organisationskombinationen
Abbildung D19:
Organisations-Spezialisierung im Marketing
Abbildung D20:
Gebietsorientierte Marketingorganisation
Abbildung D21:
Kundenorientierte Marketingorganisation
Abbildung D22:
Produktorientierte Marketingorganisation
Abbildung D23:
Inhalt Stellenbeschreibung ProduktmanagerIn
Abbildung D24:
Merkmale eines Geschäftsprozesses
Abbildung D25:
Elemente des Business Process Reengineering
Abbildung D26:
Kaizen und BPR
Abbildung D27:
Prozessleistungen
Abbildung D28:
Wirkungsgrad
Abbildung D29:
PCDA-Schema
Abbildung D30:
House of Quality-Konzept
Abbildung D31:
Vier Phasen des QFD
Abbildung D32:
Versuchsmethodiken
Abbildung D33:
Zusammenwirken in den Versuchsmethodiken
Abbildung D34:
Versuchsplanung (nach Shainin)
Abbildung D35:
Prozessstabilisierung
Abbildung D36:
Prozessstreuung
Abbildung D37:
Prinzip der Qualitätsverlustfunktion
Abbildung D38:
Qualitätswerkzeuge
Abbildung D39:
Zusammenwirken der Qualitätswerkzeuge
Abbildung D40:
Qualitätsregelkarte
Abbildung D41:
Ursache-Wirkungs-Diagramm
Abbildung D42:
Managementwerkzeuge
Abbildung D43:
Zusammenwirken der Managementwerkzeuge
Abbildung D44:
Akkreditierungssystem
Abbildung D45:
Hierarchie des Qualitätsmanagements
Abbildung D46:
Kriterienmodell des EfQM
Abbildung D47:
Preis-Leistungs-Matrix
Abbildung D48:
Preisgestaltungsorientierungen
Abbildung D49:
Determinanten der wettbewerbsorientierten Preisgestaltung
Abbildung D50:
Determinanten der nachfrageorientierten Preisgestaltung
Abbildung D51:
Determinanten der betriebszielorientierten Preisgestaltung
Abkürzungsverzeichnis
AFG
Alkoholfreie Getränke
AHP
Analytic Hierarchy Process
AIO
Attitudes, Interests, Opinions
AV
Audiovision
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BPR
Business Process Reengineering
BSC
Balanced Scorecard
B-t-B
Business to Business (Firmenkundengeschäft)
B-t-C
Business to Consumer (Privatkundengeschäft)
CAD
Computer Aided Design
CBA
Control Group before and after
CF
Cash-flow
CFROI
Cash-flow Return on Investment
CI
Corporate Identity
CIM
Computer Integrated Manufacturing
c.p.
ceteris paribus
Cw
Luftwiderstandsbeiwert
DCF
Discounted Cash-flow
DIN
Deutsche Industrie Norm
DoE
Design of Experiments
DSD
Duales System Deutschland
DSS
Decision Support System
EAN
Europäische Artikel Nummerierung
EAR
Elektro-Alt-Geräte
EBA
Experimental Group before and after
EDLP
Everyday Cow Price
EIS
Executive Information System
EN
Europäische Norm
ESS
Executive Support System
E-V
Einstellung-Verhalten
FFF
Film Funk Fernsehen
FMCG
Fast Moving Consumer Good
FuE
Forschung und Entwicklung
GE
Geldeinheit
GWB
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
Hrsg.
Herausgeber
IHK
Industrie- und Handelskammer
ISO
International Organisation for Standardization
J-i-T
Just in Time
KKP
Kundenkontaktprogramm
KKV
Komparativer Konkurrenz-Vorteil
[32] KMU
Klein- und Mittelunternehmen
KVP
Kontinuierlicher Verbesserungs-Prozess
LEH
Lebensmitteleinzelhandel
LNK
Lohnnebenkosten
LSP
Leitsätze zur Selbstkosten-Preisermittlung
MAIS
Marketing-Informations-System
MRS
Management Reporting System
OEM
Original Equipment Manufacturer (Erstausstatter)
OLAP
Online Analytical Processing
OTC
Over the Counter (nicht rezeptpflichtige Arzneimittel)
PIMS
Profit Impact of Market Strategies
PLQ
Preis-Leistungs-Quotient
PM
Produktmanager/in
POS
Point of Sale
PR
Public Relations
ProdSG
Produktsicherungsgesetz
QFD
Quality Function Deployment
ROI
Return on Investment
ROS
Return on Sales
SGE
Strategische Geschäftseinheit
SGF
Strategisches Geschäftsfeld
SPC
Statistical Process Control
SWOT
Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
TQM
Total Quality Management
UE
Unterhaltungselektronik
USP
Unique Selling Proposition
UWG
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
VO
Verpackungsverordnung
VOB
Verdingungsordnung für Bauleistungen
VPöA
Verordnung zur Preisermittlung bei öffentlichen Aufträgen
XPS
Expertensystem
Marken-/Firmenverzeichnis
3M
Effem
Accor
Eon
Aldi
Erganogoldpfeil
Alfa-Romeo
Ferrero
Apple
Fiat
Aspirin
Fielmann
Audi
Firestone
Aventis
Fischer-Werke
Avis
Fisher Price
Axel Springer-Verlag
Ford
Bahlsen
General Electric
Bang & Olufsen
Geo
Bauer-Verlag
Golf
Beiersdorf
Bild-Zeitung
GSK
Birkel
Henkel
Blend-a-med
Henkell
BMW
Hewlett-Packard
Boss
Hipp
Brau und Brunnen
Honda
Brother
Idee Kaffee
Cadbury
IKEA
Camel
Intel
Clausthaler
IWS
CMA
Jacobs Kaffee
Coke
Jil Sander
Colgate
Johnnie Walker
Conti-Reifen
Joop
Coop
Kiekert
Coppenrath & Wiese
Kodak
Corning Glas
Kraft Jacobs Suchard
Daimler-Chrysler
Lacoste
Deutsche Bahn
Langnese-Iglo
Deutsche Post
Lego
Disney
Lenor
Dole
Lidl
Douglas
Lipobay
Dr.Best
LMVH
Dr.Oetker
Mannesmann
Duplo
Mars
DuPont
Meister Proper
[34] Melitta
Schöller
Mercedes-Benz
Scout24
Microsoft
SEB
Milka
Sharp
Milupa
Siemens
Mon Cherie
Sixt
Motorpresse-Verlag
Smart
Natreen
SmithKline Beecham
Nestlé
S.Oliver
Nivea
Sony
Nixdorf
Swatch
Nokia
Tchibo
Pampers
Tempo
Pentium
Time Warner
Persil
Toyota
Pfizer
TUI
Porsche
Uhu
PPR
Unilever
Procter & Gamble
Uniroyal
Punica
UPS
Radeberger
Verpoorten
Red Bull
Viessmann
Reynold’s Tobacco
Virgin
Richemont
Volkswagen
Robert Bosch
Wal-Mart
Rolls Royce
Wick Medinait
Roncalli
Windows
RWE
Xerox
Ryan Air
Zara
A. Neue Produkte am Markt einführen
1.
Neuproduktkonzept
1.1
Innovation
Die Produktinnovation steht am Anfang absatzwirtschaftlicher Aktivitäten. Ohne ein objektiv oder subjektiv neues Angebot fehlt es an der Basis zur Vermarktung. Zugleich bewegt sich die Produktinnovation an der Schnittstelle zwischen betriebswirtschaftlicher und technischer Sichtweise.
Innovation ist allgemein die Durchsetzung neuer technischer, wirtschaftlicher, organisatorischer und sozialer Problemlösungen in Unternehmen und Markt, im Unterschied zur Invention als erstmaliger technischer Realisierung einer neuen Problemlösung und zur Technologie als Durchführung von (technischen) Prozessen. Im Folgenden werden die Innovationsarten und die Innovationsneigung näher betrachtet.
1.1.1
Innovationsarten
Es gibt vielfältige Möglichkeiten zur Rubrizierung von Arten der Innovation (siehe Abbildung A1). Nach dem Ausmaß der Innovation (wo ist es neu?) gibt es die:
Marktinnovation,
d. h. ein entsprechendes Angebot ist erstmals überhaupt am Markt verfügbar (absolute Innovation),
Brancheninnovation
, d. h. ein Angebot ist für die gesamte Branche neuartig und wird erstmalig real ausprobiert,
Unternehmensinnovation,
d. h. ein Angebot ist nur für das betreffende Unternehmen selbst neuartig, nicht aber für den Markt als solchen (relative Innovation).
Nach dem Inhalt der Innovation (was ist neu?) gibt es die
Produktinnovation,
d. h. es handelt sich um ein neues, vermarktungsfähiges Angebot, das am Markt absolut oder relativ neu ist,
Verfahrensinnovation,
d. h. es handelt sich um eine neue Methode zur Erstellung eines marktfähigen Angebots, die selbst nicht marktfähig ist.
Geschäftsmodellinnovation
, d. h. es wird eine neuartige Kombination aus Inputund Throughput-Faktoren gebildet wie etwa im Blue Ocean-Konzept.
Abbildung A1: Innovationsarten
Nach dem Stellenwert der Innovation (wie neu ist es?) wird unterschieden in die:
Elementarinnovation
der Grundlagenforschung anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse. Sie ist gekennzeichnet durch hohen Ressourcenaufwand, langfristige Amortisation, hohes Risiko, aber auch überproportionale Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.
Anwendungsinnovation
der Forschung anhand von Prototypen. Sie ist gekennzeichnet durch mittelhohen Ressourcenaufwand, mittelfristige Amortisation, mittleres Risiko und immerhin eine nennenswerte Wettbewerbsverbesserung.
Routineinnovation
der Anwendungstechnik anhand von Detailänderungen. Sie ist gekennzeichnet durch geringen Ressourcenaufwand, kurzfristige Amortisation, geringes Risiko und allenfalls hinreichende Wettbewerbssteigerung.
Eine weitere Unterscheidung betrifft die Herkunft der Innovation:
Bei einer
offenen
Innovation handelt es sich um eine solche, die den bewussten Import von Wissen von außerhalb in das Unternehmen hinein nutzt, um die In
[37]
novation zu beschleunigen. Man spricht von Open Innovation, die häufig mithilfe technologischer Plattformen im Internet zustande kommt.
Bei einer
geschlossenen
Innovation verlässt sich das Unternehmen auf die eigenen Ressourcen in Form von Primär- und Sekundärrecherchen aus betriebsinternen und -externen Quellen.
Bei einer
kollaborativen
Innovation arbeiten interne und externe Ideenquellen zusammen, um gemeinsam eine Innovation anzureichern. Der Rahmen wird vom Unternehmen gesteckt, Externe füllen diesen dann mit Ideen aus.
Unterscheidet man schließlich bei den Dimensionen der Technik und der Anwendung jeweils nach „vorhanden“ und „neu“, so ergeben sich folgende Kombinationen der Innovation:
Ist die Anwendung zwar vorhanden, die Technik hingegen neu, liegt eine (Ablösungs- oder)
Potenzialinnovation
vor.
Ist die Technik zwar vorhanden, die Anwendung hingegen neu, liegt eine (Inkremental- oder)
Umsetzungsinnovation
vor.
Sind sowohl Anwendung als auch Technik neu, liegt eine (Durchbruchs- oder)
Lateralinnovation
vor.
Sind sowohl Anwendung als auch Technik bereits vorhanden, handelt es sich um eine Verbesserung, der kein Innovationscharakter zukommt. Solche „Pseudoinnovationen“ sind jedoch weit verbreitet.
Was nun als Neuheit im Programm zu betrachten ist, ist letztlich ein Messproblem und abhängig davon, aus wessen Sicht man urteilt und welchen Anforderungsgrad man anlegt. Allgemeine Erfolgsindikatoren sind vor allem der relative, wahrgenommene Vorteil, den eine Innovation im Vergleich zu herkömmlichen Situationen oder Problemlösungen bietet, die Kompatibilität mit Wertvorstellungen, Erfahrungen und Bedürfnissen potenzieller Nutzer, die Komplexität zum Verständnis und Einsatz der Innovation sowie die Möglichkeit zum Test vor dem Kauf bzw. zur Beobachtung bei Anderen.
Je nach Anlass unterscheidet man den Technology Push als proaktive Suche nach Anwendungen vorhandenen technischen Wissens und den Demand Pull als Forderung des Marktes nach Problemlösungen durch Technik. Sozialinnovationen entstehen hingegen aus Veränderungen in den Rahmendaten des Unternehmens wie Recht, Politik, Ökologie etc. und veranlassen eine entsprechende Neuerung.
Die Innovation kann auf Faktenebene oder auf Wahrnehmungsebene erfolgen und hat jeweils eine (zumindest zeitweise) Alleinstellung (Out of Category-Position/USP) zum Ziel. Innovationsmarketing besteht dabei immer aus den beiden Komponenten der eigentlichen Erfindung (Invention) und deren Auswertung (Exploitation).
[38]
1.1.2
Innovationsneigung
Die Innovationsneigung drückt die Strategie eines adaptiven oder innovativen Vorgehens bei der Innovation aus. Zumeist werden zwei Typologien zugrunde gelegt, die aber viele Überschneidungen aufweisen, wie z. B. diejenigen von Ansoff/Stewart (First to the Market, Application Engineering, Me too) und von Maidique/Patch (First to Market, Second to Market, Later to Market, Latest to Market). In ähnlicher Weise kann nach aktivem und passivem Strategieverhalten in der zeitlichen Abfolge bzw. Strukturverhalten in der Art der Übernahme unterschieden werden. Es ergeben sich je nach Kombination verschiedene, prototypisch charakterisierbare Innovationsneigungen, so der Pionier, der frühe Folger, der Modifikator und der Nachzügler. Die Verweilzeit am Markt hängt dann dem Eintritts-Timing auch vom Austritts-Timing ab, sie ist sukzessiv abnehmend bei frühem Eintritt und spätem Austritt, spätem Eintritt und spätem Austritt, frühem Eintritt und frühem Austritt sowie spätem Eintritt und frühem Austritt (siehe Abbildung A2).
Abbildung A2: Innovationsneigung
1.1.2.1
Pionier
Der Innovationsführer im Original hält unablässig nach neuen Märkten und Produkten Ausschau und nimmt Chancen entschlossen wahr. Zur Philosophie dieser Unternehmen gehört es, Ansätze technischen Fortschritts unvermittelt im Programm umzusetzen und daraus Chancen für Wettbewerbsvorsprünge abzuleiten. Sie sind gekennzeichnet durch umfangreiche FuE, hohe Finanzstärke und Risikofreudigkeit.
Als Beispiel mag der Launch des Walkman durch Sony dienen. Dieser Gerätetyp schien zunächst keine Marktberechtigung zu haben, da er im Unterschied zu traditionellen Cassettenrecordern keine Aufnahmefunktion hatte und im Unter[39]schied zu herkömmlichen Stereoanlagen keine Lautsprecher. Sein Vorteil lag jedoch in den kompakten Abmessungen und der Portabilität. Getragen von aktiven Freizeittrends (Jogging, Power Walking, Cycling, Work out) ist das Risiko der Investition durch millionenfachen Absatz belohnt worden.
Als Marktpioniere sind u. a. zu nennen:
Anita Roddick (Body Shop), Fred Smith (Federal Express), Bill Gates (Microsoft), Michael Dell (Dell Computer), Ray Kroc (McDonald’s), Walt Disney (Disney Corp.), Sam Walton (Wal-Mart), Tom Monaghan (Domino’s Pizza), Akio Morita (Sony), Nicholas Hayek (Swatch), Gilbert Trigano (Club Mediterranée), Ted Turner (CNN), Richard Branson (Virgin), Simon Marks (Marks & Spencer), Luciano Benetton (Benetton), Charles Lazarus (Toys R Us), Colonel Sanders (Kentucky Fried Chicken), Ingvar Kamprad (Ikea), Phil Knight (Nike), Otto Beisheim (Metro), Reinhard Mohn (Bertelsmann).
Eines der innovativsten Unternehmen in Deutschland ist die Robert Bosch GmbH. Von ihr stammen allein im Bereich der Automobiltechnik so bahnbrechende Erfindungen wie elektrische Zündkernen, Starterautomatik, Scheinwerfer, Benzineinspritzung, Blei-Cadnium-Batterie, Hydraulik-Bremse, Airbag, Anti-Blockier-System, Antriebs-Schlupf-Regelung etc. Entsprechend ist Bosch der größte unabhängige Autozulieferer der Welt.
Pioniere machen oft die vielbeschriebene „Tellerwäscher“-Karrieren. So gründete Steve Jobs Apple Computer in der Garage seiner Eltern in Los Altos. Bill Hewlett und David Packard gründeten HP ihrerseits in einer Garage in Palo Alto. Der Servergigant Cisco startete im Wohnzimmer des Gründerehepaars. Und Jerry Wang und David Flo entwickelten die Suchmaschine Yahoo in ihrer Studentenbude.
Mercedes-Benz-Innovationen betreffen u. a. die Einzelradaufhängung (1931), die Sicherheitsfahrgastzelle (1959 durch Bela Barenyi), die Sicherheitslenkung (1967), das Anti-Blockier-System (1978 als ABS), den Airbag (1981), den Überrollbügen bei Cabrios (1989), das elektronische Stabilitäts-Programm (1995 als ESP), die aktive Fahrwerks-Steuerung (1999 als ASC), die Abstandsregulierung (2005), den Bremsassistenten (2005).
Die Chancen des Pioniers sind vor allem die Folgenden:
Am Anfang eines Innovationszyklus besteht noch kein direkter Konkurrenzeinfluss. Insofern bleibt der Innovator zumindest vorübergehend von den unliebsamen Konsequenzen des Wettbewerbs verschont.
Daraus resultieren preispolitische Spielräume, die sich meist als Abschöpfungspreispolitik materialisieren, die vorübergehend überdurchschnittliche Spannen (Produzentenrente) und schnellen Return on Investment ermöglichen.
Es besteht die Möglichkeit zur Etablierung eines dominanten Standards, für den jedoch eine rasche Diffusion von Neuerungen Voraussetzung ist. Zu denken ist
[40]
etwa an die, technisch unterlegene VHS-Systemnorm bei Video. Dies wirkt als Markteintrittsschranke für Nachfolger. Hinzu treten Gewerbliche Schutzrechte als Marktbarriere.
Die Mengensteigerung wiederum schafft durch einen Vorsprung auf der Erfahrungskurve langfristige Kostenvorteile. Dem liegt der bekannte, jedoch nicht unumstrittene, Boston-Effekt zugrunde (dynamische Größendegression). Hinzu kommen aber auch statische Größeneffekte.
Der frühe Eintritt in einem Markt schafft dort die längste Verweildauer und damit, zumindest potenziell, die Möglichkeit zum höchsten kumulierten Gewinn. Dieser resultiert aus dem Aufbau von Markt-Know-how und Kundenkontakten. Dadurch ist eine attraktive Produkt-/Marktposition einzunehmen.
Der Innovator hat oft Imagevorteile durch einen generellen Goodwill (Ruf als Pionier) in der Öffentlichkeit, weil, zumal bequemlichkeitsfördernde, Neuigkeiten emotional positiv besetzt sind.
Es gibt die Möglichkeit der Wahl des potenzialstärksten Absatzkanals und die Möglichkeit zu dessen Belegung.
Die Risiken des Pioniers sind hingegen folgende:
Er trägt als Schrittmacher immer die größte Ungewissheit über die weitere Marktentwicklung. Insofern bedarf es einer ausgeprägt hohen Risikoaffinität zur Einnahme dieser Rolle. Man kann keine fremden Vorbilder nutzen, etwa hinsichtlich der Abschätzung der Nachfragebedingungen.
Es besteht kontinuierlich die Gefahr von Technologieschüben, die Innovationsvorsprünge, und alle damit verbundenen hohen Aufwendungen, entwerten. Und dies wird angesichts zunehmend sprunghaften technischen Fortschritts immer wahrscheinlicher.
Um seine Vorteile zu nutzen, muss der Innovator eine vorübergehende Marktmonopolisierung durchsetzen. Dies sicherzustellen, hat hohe Markterschließungskosten zur Folge, da keine „Infrastruktur“ vorhanden ist. Die dabei entstehenden Kosten lassen die Gefahr des Überholens durch Niedrigkosten-Imitatoren, die sich die geschaffenen Rahmenbedingungen zu Nutze machen, entstehen.
Neuerungen sind definitionsgemäß mit höheren Risiken für Abnehmer verbunden als bestehende Angebote, insofern ist ein hoher Überzeugungsaufwand bei Kunden zu leisten, und zwar umso mehr, als je bedeutsamer die Neuerung von Abnehmern wahrgenommen wird. Dazu ist die Weckung latenter Bedürfnisse erforderlich.
Zur Marktreifung von Neuerungen ist die Mobilisierung hoher FuE-Aufwendungen erforderlich. Da zugleich der Payback ungewiss bleibt, hängt die Existenz des Innovators nicht selten vom Erfolg jeder einzelnen neuen Produktgeneration ab. Zudem besteht die Gefahr der Überalterung von Erstinvestitionen.
[41]
Das Auftreten von „Kinderkrankheiten“ am neuen Produkt/Prozess ist wahrscheinlich. Hinzu kommen Pionierkosten für Produktionserlaubnis, Auflagen, Kundenschulung, Infrastrukturaufbau, Ressourcenerschließung, Komplementärproduktentwicklung etc.
Die Markthistorie kennt zahlreiche Beispiele sowohl von erfolgreichen wie erfolglosen Pionieren. Erfolgreich waren u. a. Minolta mit der Autofocus-SLR-Kamera, Searle mit dem Süßstoff Nutrasweet, DuPont mit der Teflon-Beschichtung, P & G mit den Fertigwindeln Pampers (gegen Kimberley-Clark), Brita mit Wasserfiltern.
Erfolglos waren u. a. Xerox mit dem PC (gegen Apple), Hell mit dem Telefaxgerät, EMI mit der Computertomografie, De Havilland mit düsengetriebenen Flugzeugen.
Aber auch die Marktnachzügler sind sowohl durch Erfolg wie Misserfolg gekennzeichnet. Erfolgreich waren u. a. IBM mit dem Personal Computer (gegen Nixdorf), IBM beim Röntgenscanner (gegen Xerox), Samsung beim Mikrowellenherd (gegen Raytheon), Intel mit dem Mikroprozessorchip, Seiko mit der Quarzuhr, Matsushita mit dem Videorecorder-System VHS/1975 (gegen Sony), Sony bei der Spielekonsole (gegen Atari), Microsoft beim Web-Browser (gegen Netscape), Google bei der Web-Suchmaschine (gegen Lycos), Apple beim MP3-Player (gegen Diamond), Canon beim Laserdrucker (gegen Xerox), Samsung/Intel beim Flashspeicher (gegen Toshiba), Amazon beim e-Book-Reader (gegen Sony), Facebook beim Social Network (gegen Sixdegrees).
Erfolglos waren u. a. DEC mit Personal Computer, Sega mit Computerspielen, Coring bei Floatglas (gegen Pilkington), Kodak bei Sofortbildkameras (gegen Polaroid), Matsushita/Pioneer bei CD-Technik (gegen Sony).
Man darf aber auch nicht zu früh am Markt sein. Beredtes Beispiel dafür ist Siemens. So bringt Siemens 1997 das erste Handy mit Farb-Display auf den Markt, was vom Markt aber offensichtlich nicht als Vorteil erkannt wurde. Es folgte das erste Handy mit eingebautem MP3-Player (Typ SL 45), das allerdings auf wenig Nachfrage traf, da MP3 noch nicht verbreitet ist. 2001 präsentierte Siemens das erste Handy, das in eine Armbanduhr eingebaut ist, dieses wird aber gar nicht erst eingeführt. Auch das erste Handy mit Schiebemechanik für die Tastatur (Typ SL 10) wurde vom Markt noch nicht als Vorteil erkannt.
Ein erfolgreiches Beispiel einer Innovation ist der Energydrink Red Bull. Diese Produktkategorie wurde von Dietrich Mateschitz „erfunden“, der als Marketingmanager für P & G Zahnpflegeprodukte in Österreich in den 1980er Jahren viel in Asien unterwegs war. Dabei fiel ihm auf, dass seine Verhandlungspartner auch nach schier endlosen Sitzungen nicht zu ermüden schienen und eine enorme Konzentrationsspanne aufwiesen. Mateschitz erkannte, dass die in Asien weit verbreiteten Erfrischungsgetränke nicht nur der Durstlöschung dienten, sondern einen zusätzlichen Nutzen boten, der auch außerhalb Asiens einen großen Markt [42]haben dürfte. 1984 erwarb er vom thailändischen Getränkehersteller TC Pharmaceuticals die Lizenzrechte für die Vermarktung des Energy Drinks Krating Daeng (Roter Bulle auf thailändisch). 1987 wurde Red Bull nach Anpassung der Rezeptur und Entwicklung eines Vermarktungskonzepts in Österreich erfolgreich eingeführt. 1992 wurde als erster Auslandsmarkt Ungarn erschlossen. Heute ist Red Bull in 115 Ländern aktiv und hat 70 % Marktanteil bei Energy Drinks. Der Umsatz beträgt ca. 3,3 Mrd. €, das Marketingbudget macht knapp ein Drittel davon aus. Die Positionierung verspricht Belebung für Körper und Geist (Slogan: Red Bull verleiht Flüüügel).
Verbreitet ist die Ansicht einer First Mover Advantage, d. h. der zeitlich Erste am Markt hat einen eingebauten Wettbewerbsvorsprung, weil die Zeit ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor ist und geronnene Zeit nicht zurückgedreht werden kann, ein Zeitvorsprung also prinzipiell uneinholbar ist. Die Beispiele erfolgreicher Folger zeigen jedoch, dass dieser Automatismus stark in Zweifel zu ziehen ist. Es spielen wohl andere Faktoren außer der Zeit eine bedeutsame Rolle beim Markterfolg und der Pioniervorteil gilt nur unter bestimmten Voraussetzungen.
Ein Beispiel für eine First Mover Advantage Tchibo. In den 1970er Jahren lag Tchibo-Kaffee in den Supermarkt-Regalen wie heute die Kaffees von Jacobs oder Melitta. Kaffee gilt seit jeher als Zeigerware im Einzelhandel, anhand dieser seiner Kundschaft seine Preisgünstigkeit signalisierte. Tchibo überlegte, wie man aus der unmittelbaren Preisvergleichbarkeit, die auf Dauer kein vernünftiges Ertragsniveau zuließ, ausscheren konnte. Es entstand die Idee, einen neuen Absatzkanal zu eröffnen. Als chancenreich wurde ein solcher angesehen, der mit komplementären Produkten (Bedarfsverbund) zu tun hatte und eine Alleinstellung erlaubte. Man entschied sich für Bäckereien und bot diesen an, im Konsignationsgeschäft ergänzend zu ihren eigenen Brot- und Backwaren Tchibo-Kaffee zu verkaufen. Für Bäcker, die vorwiegend mit kleinteiligen Geldbeträgen zu tun haben, stellte Kaffee als werthaltige Ware eine interessante Ergänzung dar. Tchibo wählte in den Marktgebieten jeweils die attraktivsten Bäckereien aus und vereinbarte mit diesen die Distribution. Ein großer Wettbewerber zu dieser Zeit war Eduscho. Hier beobachtete man die Aktivitäten von Tchibo und befand diese für nachahmenswert. Allerdings verblieben Eduscho für die Distribution nur noch diejenigen Bäckereien, die Tchibo als nicht vorziehenswürdig verworfen hatte. Damit musste sich Eduscho als Second Mover mit einem weniger leistungsfähigen Distributionsnetz begnügen. Dieser Wettbewerbsnachteil war letztlich nicht auszugleichen, so dass Eduscho aufgeben musste und von Tchibo übernommen wurde. Der First Mover Tchibo bereinigte das Bäckereiennetz und reüssierte allein. Später wurden als Ausgleichsgeber zu Kaffee die Merchandising-Artikel eingeführt, die sich zeitweise großer Beliebtheit erfreuten. Seit dies trotz umfangreicher Bemühungen nicht mehr der Fall ist, droht das Geschäftsmodell allerdings zu kippen.
[43]
1.1.2.2
Früher Folger
Der Innovationsfolger durch Modifikation sucht formalistisch agierend systematisch nach der Adaptation von Neuerungen, ohne aber den ersten Schritt zur Umsetzung zu wagen. Möglicherweise auch, weil diese Anbieter selbst nicht forschungsintensiv genug sind, wohl aber entwicklungsstark. Sofern sich jedoch ein Innovator gefunden hat, beobachten sie dessen Markterfolg genau und übernehmen die Neuheit mit dem Ziel der optimierenden Veränderung. Dies ist für Unternehmen typisch, die visionären Neuerern zwar an Genialität unterlegen, jedoch an Kapitalkraft überlegen sind. Weil es daraufletztlich ankommt, haben es innovative Klein- und Mittelständler immer schwerer zu überleben.
Allerdings ist die Frühe Folger-Position nicht nur eine Erfolgsposition. So ist Xerox der eigentliche Erfinder einer komfortablen und funktionalen PC-Bedienung. Heute unerlässliche Features wie Mausführung, Druckeransteuerung, grafische Benutzeroberfläche und Netzwerkfähigkeit gehen eindeutig auf Entwicklungen von Xerox zurück. Allerdings zögerte das Unternehmen angesichts des zur damaligen Zeit (1973) unabsehbaren Siegeszugs des PC mit der nachdrücklichen Marktreifmachung dieser Ideen. So schlummerten diese Ansätze im Konzern, ohne konsequent zur Umsetzung zu gelangen. 1982 erfolgte dann eine Präsentation dieser Ideen vor Technik-Freaks im Silicon Valley, u. a. vor Steve Jobs, einem der Gründer von Apple. Er erkannte das riesige Potenzial dieser Ideen sofort und setzte sie rasch im ersten modernen Apple Computer 1984 (Macintosh) um. Daraus wurde eine wegweisende Produktlinie, die schließlich auch die Entwicklung in der „Wintel“-Gruppe stark beeinflusste. Als Xerox sich zur Umsetzung seiner Ideen entschloss, war der damals noch überschaubare Markt für PC’s aber bereits abgeschöpft. Die Produktion wurde eingestellt, bevor ihre Tragfähigkeit gesichert war. Heute ist Xerox im Bereich der Personal Computer nicht mehr präsent.
Die Chancen des Frühen Folgers sind vor allem folgende:
Er trägt ein weitaus geringeres Risiko als der Innovator, weil bereits Erkenntnisse aus dessen Marktpräsenz und ein erster Überblick über die Marktentwicklung vorliegen. Die Erfahrungen des Pioniers können insoweit genutzt werden.
Unter Umständen besteht noch die Möglichkeit zur Etablierung eines eigenen Standards, wenn die vorgestellten Standards nicht überzeugen und noch keine ausreichende Marktbreite erreicht haben (Beispiel VHS von Panasonic/Matsushita nach Betamax/U-matic von Sony).
Die Marktpositionen sind noch nicht verteilt, insofern ist gegenüber dem Pionier noch kein entscheidender Boden verloren, und die Karten können neu gemischt werden. Allerdings arbeitet die Zeit gegen den frühen Folger.
Der Lebenszyklus des Marktes steht noch am Anfang, das bedeutet (bei Erfolg) stark steigende Wachstumsraten, geringe Wettbewerbsintensität und die Durchsetzung von Prämienpreisen, also ein insgesamt angebotsförderndes Umfeld.
[44] Die Risiken des Frühen Folgers sind hingegen folgende:
Möglicherweise bestehen Markteintrittsbarrieren des Innovators, etwa durch Gewerbliche Schutzrechte, Etablierung eines Systemstandards oder rasche Erfahrungskurveneffekte. Dann müssen Umgehungsmöglichkeiten gefunden werden.
Es ist eine Strategieausrichtung am Innovator erforderlich, so dass nicht mehr unbedingt freie strategische Wahl im marketingpolitischen Mix besteht, sondern eine mehr oder minder große Abhängigkeit von diesem.
Es besteht die Notwendigkeit der Herausarbeitung eines eigenen komparativen Konkurrenzvorteils, da Nachfragern ansonsten kein Argument für die Angebotswahl offeriert werden kann, es sei denn, ein niedrigerer Preis. Dafür sollten günstigere Produktionsverfahren als beim Pionier vorliegen, die vor allem aus Synergieeffekten resultieren können.
Auf den Vorstoß des Innovators ist eine schnelle Reaktion erforderlich, da die Zeit für ihn arbeitet und eine Nachfolge durch andere Wettbewerber immer wahrscheinlicher wird, so dass die Position des Frühen Folgers bald vergeben ist.
Schließlich ist auch von einem baldigen Markteintritt weiterer Konkurrenten auszugehen, so dass die Zeitspanne zur Materialisierung von Marktvorteilen eng begrenzt bleibt. Insofern entsteht eine Zeitfalle, d. h. womöglich reicht die Zeit nicht, durch eine Produzentenrente die Aufwendungen der Marktreifmachung ausreichend zu alimentieren.
1.1.2.3
Modifikator
Der Innovationsführer durch Modifikation (Modifikator) kapriziert sich auf hohes Fachwissen und laufende Detailverbesserungen von Lösungen. Hierbei steht die kundenspezifische Umsetzung allgemeinen technischen Fortschritts im Fokus. Hohe Produktqualität erlaubt Marktsegmentierung und strenge Kostenkontrolle auskömmliche Rendite auch bei kleinen Stückzahlen.
Als Beispiel für eine erfolgreiche Modifikation können ViewCams, Camcorder mit großem Sucherdisplay, Anfang der 1990er Jahre dienen. Camcorder stießen vorher vor allem bei älteren Personen, wegen mangelnder Sehschärfe infolge des sehr kleinen Sucherfensters, und bei Frauen, wegen der Make up-Gefahr beim engen Anliegen der Suchermanschette am Auge, auf Ablehnung. Sharp, ein Anbieter mit damals sehr kleinem Marktanteil, suchte nach einer erfolgversprechenden Möglichkeit der Modifikation bisheriger Camcorder, welche die genannten Nachteile vermeidet und damit neue Zielgruppen für die Marke erschließt. Dies gelang durch den erstmaligen Einbau eines großen LCD-Bildschirms bei ansonsten unveränderten Camcorderfunktionen, der vom Gerät abgeklappt werden kann. Dies ermöglichte etwa älteren Personen eine große und klare Bildschirmdarstellung [45]der Aufnahmeobjekte und Frauen die Aufnahmekontrolle auf Distanz zum Auge. Da außerdem auch allen anderen Zielgruppen ein Bequemlichkeitsnutzen geboten werden konnte, entwickelte sich der Marktanteil von Sharp rapide nach oben. Allerdings hatten kurze Zeit danach alle Camcorder-Hersteller derartige View-Cams im Programm.
Die Chancen des Modifikators sind vor allem folgende:
Durch die Identifizierung und Besetzung von Marktnischen findet der Modifikator Schutz im hart umkämpften Markt, verbunden mit relativer Alleinstellung und der Möglichkeit zur Durchsetzung einer Preisprämie oder von sonstigen Spielräumen bei der Preisgestaltung.
Im Regelfall entstehen nur relativ geringe Entwicklungskosten, da viele Aufwendungen, vor allem solche der Grundlagenforschung, erspart werden können. Angewandte Forschung weist demgegenüber eine weitaus höhere Rentabilitätschance auf.
Der Modifikator geht weniger Risiko ein, weil er keine Durchbruchsinnovation vollzieht, sondern nur eine Inkrementalinnovation. Dadurch ist ein guter Kompromiss zwischen Innovationsnutzung und Begrenzung des Geschäftsrisikos erreichbar.
Es besteht die Chance, durch frühzeitiges Reagieren dem immer rascher einsetzenden Preisverfall an den Märkten zu entgehen. Denn wenn dieser einsetzt, kann der Modifikator sich schon wieder auf die nächste Neuerung stürzen.
Die Risiken des Modifikators sind hingegen folgende:
Zunächst sind die Markteintrittsbarrieren etablierter Anbieter zu überwinden. Dazu gehören vor allem Gewerbliche Schutzrechte mit Ausschlussfristen, die erst einmal zu umgehen sind.
Vor Kunden ist meist viel Überzeugungsaufwand notwendig, um Zusatznutzen zu verdeutlichen, die erst auf den zweiten Blick erkennbar und nutzenrelevant sind. Dafür aber gleich auf den ersten Blick einen nennenswerten Mehrpreis implizieren.
Es besteht die Gefahr, sich bei vielen Einzellösungen zu verzetteln, weil das Kernfeld des Markts durch den Innovator besetzt oder sogar geschützt ist. Die Effektivität dieser Strategie ist dann sehr in Zweifel zu ziehen.
Weiterhin besteht die Gefahr, Großanbieter anzulocken, die ein größeres als das seither ausgeschöpfte Potenzial hinter der Marktnische vermuten und Märkte selbst bei Fehlschlag mit ihrem Programm verstopfen.
[46]
1.1.2.4
Nachzügler
Der Innovationsfolger im (Original-)Nachbau (Kopist) reagiert nur aufgrund von der Umwelt mehr oder minder unausweichlich vorgegebener Änderungen nach bewährtem Muster. Diese Nachzügler machen sich den Input von Innovatoren zueigen und beuten diesen aus. Das traf etwa in den Anfängen des japanischen Wirtschaftswunders zu und gilt heute für andere fernöstliche Anbieter (Take off Markets). Dies beginnt mit dem simplen Abkupfern von Produktideen und der konsequenten Wertanalyse zur Einsparung von Gestehungskosten an verdeckten Stellen mit nicht sofort feststellbaren Folgen. Kommen kostengünstige Arbeitsbedingungen hinzu, ist der Anbieter in der Lage, auf den ersten Blick verwechslungsfähige Produkte gegenüber anderen signifikant billiger anzubieten. Dies endet in sklavischer Nachahmung, die oft Gewerbliche Schutzrechte missachtend Me too-Angebote präsentiert. In vielen Fällen geringen sozialen, persönlichen oder finanziellen Risikos reicht die gebotene Leistung tatsächlich auch aus.
Als Beispiel kann die Benutzeroberfläche Windows gelten. Sie imitiert die Ikonensteuerung des Apple-Betriebssystems und bietet damit auf MS-Rechnern annähernd dessen Bedienungskomfort, freilich erst mit erheblichem Time lag, dafür aber auch erheblich preisgünstiger.
Die Chancen des Nachzüglers sind vor allem folgende:
Dem Nachzügler entstehen erheblich niedrige FuE-Aufwendungen, wenn es nicht sogar zu einer reinrassigen Kopie des Originals kommt. Die ersparten Kosten können voll im Preisvorteil weitergegeben werden.
Die Anlehnung an Standards schafft Sicherheit für die Vermarktung durch ausgereifte Technik und hohen Verbreitungsgrad. Insofern ist die Gefahr von Fehlinvestitionen vergleichsweise geringer.
Das erforderliche Know-how kann ggf. zugekauft werden, so dass es letztlich weniger eine Frage des Erfindungsreichtums, sondern eher eine der Finanzkraft ist, ob ein Markt bearbeitet werden kann oder nicht.
Infolge des bereits fortgeschrittenen Lebenszyklus besteht eine geringere Unsicherheit über die weitere Marktentwicklung, da von einer üblicherweise vorzufindenden Projektion auszugehen ist.
Da bereits fortgeschrittene Produktversionen vermarktet werden, können Standardisierungspotenziale weitgehend ausgenutzt werden. Dies ermöglicht niedrigere Gestehungskosten.
Die Risiken des Nachzüglers sind hingegen folgende:
Späte Folger haben es mit bereits etablierten Konkurrenten zu tun, die darauf angewiesen sind, nach der risiko- und aufwandsreichen Startphase eines Marktes dort auch weiterhin erfolgreich zu bleiben, um einen angemessenen Return on Investment zu erreichen.
[47]
Es besteht die Notwendigkeit des Aufbrechens von Geschäftsbeziehungen, die sich im Zeitablauf zwischen bereits vorher marktpräsenten Unternehmen und ihren Kunden etabliert haben und zu Kauftreue und Markenloyalität führten.
Es besteht die Gefahr von Preiskämpfen, denn der Nachzügler wird und kann beinahe nurmehr durch niedrigere Preise zum Erfolg kommen, den aber auch die bestehenden Anbieter für ihren Absatz brauchen und deshalb ihrerseits mit Preisunterbietungen darauf reagieren.
Durch die bloße Imitation innovativer Lösungen kann es nicht zur Entstehung von eigenem technischen Know-how kommen, das wiederum Voraussetzung ist, eines Tages als Innovator aufzutreten.
Für den Fall, dass der Lebenszyklus schon zu weit fortgeschritten ist und die verbleibende Marktpräsenz nicht mehr ausreicht, einen genügenden Mittelrückfluss zu erwirtschaften, bleiben Fehlinvestitionen in Fertigungsanlagen.
Regelmäßig ergeben sich Imagenachteile, die aus minderer Bewertung der Leistung im Publikum resultieren. Inwieweit dies ausschlaggebend für Kaufentscheide ist, hängt von der jeweilig betroffenen Produktart ab.
1.2
Ideenfindung
Für die Findung neuer Produktideen bestehen vielfältige betriebsinterne wie -externe Ideenquellen. Insbesondere können Kreativitätstechniken eingesetzt werden, um Ideen zu generieren, die dann anschließend ausgewertet werden. Dabei ist vor allem an logisch-diskursive, intuitiv-laterale und systematische Verfahren zu denken.
1.2.1
Ideenquellen
Bereits betriebsintern können hervorragende Anregungen für Neuproduktideen generiert werden. Als Quellen dafür sind primär zu nennen:
Außendienst-/Kundendienstinfos, Geschäfts-/Vertriebsleitung, ehemalige Mitarbeiter von Marktbegleitern, Einkauf, Forschung und Entwicklung, Personalabteilung, Intranet, Kundendatenbanken, Lieferanten, Vertriebspartner, Kooperationspartner, Wertschöpfungspartner, betriebliches Vorschlagswesen.
Sekundär kommen hinzu:
Finanz-, Kosten- und Rechnungswesen, Produktion, Handelsvertreterberichte, Branchenstudien, Konkurrenzdateien, Marktanalysen, Marktforschungsdaten, Absatz-/Kundenstatistiken, Markt-/Konkurrenzanalysen, Verwendungsanalysen, Reports.
[48] Es kommt nur darauf an, diese und andere betriebsinterne Quellen sinnvoll und konstruktiv zu nutzen, was oft allerdings nur unzureichend geschieht.
Darüber hinaus gibt es auch aus betriebsexternen Quellen manche Anregung. In diesem Zusammenhang sind als primäre Quellen zu nennen:
Mitarbeiter von Marktbegleitern, Banken, Handelspartner, Marktforschungsinstitute, Branchenverbände, Werbeagenturen, Unternehmensberater, Kunden/Verwender, Marktstudien, Panels, Freunde/Bekannte, Geschäftspartner, Fachjournalisten, Tiefeninterviews, Testmarktstudien, Fokusgruppen, Open Innovation, Kundenbefragung, Scouts, Feedbacksysteme (Beschwerden etc.).
Sekundär kommen hinzu:
Branchenreports, Tagespresse/Firmenberichte/Anzeigen/Stellenanzeigen, Fachund Wirtschaftspresse, Konkurrenzpublikationen (Hauszeitschriften, Geschäftsberichte, Aktionärsbriefe etc.), Gebrauchsanweisungen, Prospekte/Kataloge, Preislisten, Internetauftritte, Hochschulen (Vorträge/Dissertationen), Messe-/ Ausstellungskataloge, Bank- und Börsenpublikationen, Veröffentlichungen von Kammern/Verbänden, Berichte wirtschaftswissenschaftlicher Institute, Bundesanzeiger, handelsgerichtliche Eintragungen, Branchenhandbücher, Patentanmeldungen, Hörfunk/Fernsehen, Presse, Vereine, Service-Clubs, Branchenverbände, Interessenverbände, Trendbücher, Szenariostudien, Delphistudien, Zukunftsforscher, Unternehmensberater, Fachexperten/Wissenschaftler, Internetsuchdienste, Themen-Plattformen (Blogs), Communities, Forschungsinstitute, technische Institute, soziokulturelle Institute, Newsletters, Ministerien, öffentliche Register, statistische Ämter, Nachrichtendienste, Branchendienste, Patentamt, Geschäftsverzeichnisse, Fachdatenbanken, Archive, Rating-Agenturen, Nachrichtendienste, Seminare, Kongresse, Symposien, Messen/Ausstellungen, Tagungen, Ideenbörsen, Foren, Gewerkschaften, Informationsdienste,
Allerdings bedarf es auch hierbei der Initiative zur Recherche und vor allem der Auswertung dieser Quellen, wobei für Information investiertes Geld in einer Wissensgesellschaft durchweg sehr gut angelegt ist. Jedoch reichen die daraus generierten Anregungen im Allgemeinen noch nicht aus, vielmehr ist die Anwendung spezieller Kreativitätstechniken zur Förderung der Ideenfindung erforderlich.
1.2.2
Kreativitätstechniken
1.2.2.1
Anforderungen an Kreativität
Kreativität ist allgemein die menschliche Fähigkeit, Produkte oder Ideen hervorzubringen, die in wesentlichen Merkmalen neu sind, und zwar im Einzelnen als vorstellungshaftes Denken, im Zusammenfügen von Gedanken, als Aufsummieren von bereits Bekanntem, durch Bilden neuer Muster und Kombinationen aus Erfahrungswissen, Übertragen bekannter Zusammenhänge auf neue Situationen und [49] Entdecken neuer Beziehungen. Basis dafür ist das laterale Denken, das gewohnte Rahmen verlässt, um neue Problemlösungen zu erreichen, herkömmliche Gedankenmuster mittels intuitiver Einfälle verändert und dadurch neue Möglichkeiten erkennt sowie viele Ideen in vielen Richtungen erzeugt, indem Intuition bewusst eingesetzt wird. Dabei wird die Ideensuche auch dann fortgesetzt, wenn schon viel versprechende Lösungsmöglichkeiten vorliegen. Auch zunächst abwegig erscheinende Lösungswege werden weiter verfolgt, um durch Analogien zu guten Lösungen zu kommen. Typisch sind in dieser Hinsicht ein sprunghaftes Vorgehen zur Bildung neuer Denkmuster und eine provokative Einstellung zur Generierung neuer Problemlösungen. Laterales (Quer-)Denken ist jedoch oftmals verpönt, weil logisches (vertikales) Denken in der Gesellschaft höher eingeschätzt wird.
Kreativität im Marketing soll nützliche und zielorientierte Ergebnisse liefern. Ohne perfekt und vollständig sein zu müssen, kann sie künstlerischer, wissenschaftlicher, prozesshafter oder methodischer Natur sein. Die Kreativität erfordert im Einzelnen Problemsensitivität, Gedächtnisaktivierung, geistige Beweglichkeit, Originalität, Neudefinitionsfähigkeit und Ausarbeitungsvermögen.
Hindernisse für Kreativität sind hingegen Blockaden vielfältiger Art, sie liegen vor allem im unnötig eingeengten Suchfeld, im routinisierten Verständnis der Problemauffassung, in eingeübten Mustern und Schubladendenken, in der Gewohnheit der Vernunftsbetonung und invariater, nur der Logik folgender Deutung. Weitere Sperren sind emotionaler, kultureller und intellektueller Art, Umwelt-, Ausdrucks- und Fantasiesperren. Bremsend wirken auch Gewohnheiten, Expertentum, Scheu und vorschnelle Bewertung. Diese kommen für gewöhnlich in den altbekannten „Killerphrasen“ zum Ausdruck wie:
Das mag zwar theoretisch richtig sein, aber …
So haben wir das noch nie gemacht.
Das ist unmodern so (oder modern, je nach Lage der Dinge).
Damit kommen Sie bei mir (im Haus) nicht durch.
Wollen Sie dafür die volle Verantwortung übernehmen?
Das ist doch seit langem bekannt (das hat sich über Jahrzehnte hinweg bewährt).
Dafür sind wir zu klein (dafür haben wir nicht genügend Personal).
Lassen Sie uns ein andermal darüber reden (dafür ist die Zeit noch nicht reif).
Das muss zunächst ein Ausschuss klären.
Die Kunden wollen das nicht (oder anders).
Das ist technisch nicht durchführbar (wenn das wirklich so einfach wäre, dann …).
Warten wir erst einmal ab, was Andere dazu sagen.
Dafür sind wir nicht zuständig (das bringt uns doch nicht voran).
[50]
Wenn es wirklich so gut wäre, warum hat es denn noch kein Anderer gemacht?
Sie wissen immer alles besser.
Ich als Experte kann Ihnen sagen, dass …
Dafür haben wir kein Geld übrig.
Seien Sie erst einmal ein paar Jahre hier, dann …
Derzeit laufen schon genug Projekte.
Zur Stimulierung kreativer Prozesse zur Ideenfindung für Neuprodukte wird eine Vielzahl verschiedenartiger Techniken vorgeschlagen. Es handelt sich insbesondere um logisch-diskursive, intuitiv-laterale und systematische Verfahren (siehe Abbildung A3).
Abbildung A3: Kreativitätstechniken
1.2.2.2
Logisch-diskursive Verfahren
Logisch-diskursive Verfahren zeichnen sich durch einen kombinatorischen Ansatz aus. Es handelt sich im Wesentlichen um den Morphologischen Kasten, die Funktional-Analyse und verwandte Verfahren.
[51]
1.2.2.2.1
Morphologischer Kasten
Die Morphologie ist die Aufgliederung eines Problems hinsichtlich aller Parameter und die Suche nach neuen Kombinationen vorhandener Teillösungen (Was!). Das Problem wird dabei in seine Problembestandteile zerlegt, die grafisch in einem Kasten untereinander angeordnet werden. Neben jedes Problemelement werden dann möglichst viele Lösungsmöglichkeiten geschrieben, deren Kombination verschiedene Lösungen des Gesamtproblems ergeben. Allerdings ist es oft schwierig, aus der großen Zahl der Kombinationsmöglichkeiten die Beste auszuwählen (siehe Abbildung A4).
Abbildung A4: Morphologischer Kasten (Beispiel)
[52] Die Methode ist zur Lösung nahezu aller Probleme geeignet. Die einzelnen Phasen lauten:
Genaue Beschreibung und Definition des Problems mit zweckmäßiger Verallgemeinerung,
Ermittlung der Parameter des Problems, der Aufgabenstellung, diese Faktoren werden in die Kopfspalte einer Matrix eingetragen,
Aufstellung des Morphologischen Kastens mit Eintragung aller Lösungsvorschläge für Problemparameter jeder Zeile der Matrix,
Auswahl und Bewertung aller möglichen Lösungen auf Grundlage eines geeigneten Bewertungsverfahrens,
Auswahl und Realisierung der besten Lösung.
Als organisatorische Voraussetzung soll dafür ein interdisziplinärer Arbeitskreis gelten, dessen Sitzungsdauer maximal eine Stunde beträgt, wobei die Gruppengröße maximal zehn Personen umfassen soll. Die Verallgemeinerung des Problems und die Kombinationen der Lösungsparameter führen zu überraschenden Ergebnissen. Die Suche wird auch nach der ersten befriedigenden Lösung fortgesetzt. Die Methode liefert zumindest eine große Anzahl von Optionen durch die Kombinationsmöglichkeiten. Dadurch besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass alle wesentlichen Aspekte des Problems erfasst werden. Zugleich ist damit aber auch ein hoher Zeit- und Kostenaufwand zur Durchführung verbunden (fünf Parameter mit je zehn Ausprägungen ergeben ca. 100.000 Lösungen).
Das Problem darf nicht zu eng abgesteckt werden. Auch ist die Bestimmung der Parameter oft schwierig (Hilfen sind Ablaufreihenfolge, „W“-Fragen, Systematik, Visualisierung etc.). Sie dürfen jedoch nicht korrelieren oder redundant sein.
Im Folgenden das Beispiel eines Morphologischen Kastens für eine Leseleuchte:
Bedarf (Parameter): Blendfreies Leuchten, Flexibilität, bequeme Bedienung, Abschaltautomatik, modernes Design.
Bedarfserfüllung (Ausprägungen):
blendfreies Leuchten durch Mattglasumhüllung, Vorsatzdiffusor, Streusieb etc., Flexibilität durch Teleskoparm, Metallfeder, Scherengelenk, biegsamen Kunststoff etc.,
bequeme Bedienung durch Infrarotsensor, Spracherkennung etc., modernes Design durch Chromausführung, Stabkonstruktion etc., Abschaltautomatik durch Timer, feste Abschaltzeit etc.
Über alle Parameter werden geeignet erscheinende Optionen kombiniert und zu einer Produktidee ausgeführt. So ist eine neue Leseleuchte etwa wie folgt denkbar:
Stabkonstruktion aus biegsamem Kunststoff, mit Streusieb, Infrarotsensor und Timer.
[53] Durch multiple Kombination entstehen so zahlreiche Ideen. Die Lösungsvorschläge werden nach Ende der Kreativphase durch Experten geprüft und bewertet. Die Sitzungsteilnehmer werden danach über das Ergebnis informiert.
Varianten des Morphologischen Kastens sind die:
Problemfeld-Darstellung.
Dabei wird, um ein Problem in seiner ganzen Ausdehnung untersuchen zu können, ohne die Übersicht zu verlieren, die Darstellung auf einzelne Problemfelder beschränkt.
Sequenzielle Morphologie.
Dabei wird zunächst für jeden Parameter eine Problemlösung ausgewählt, bevor man sich dem nächsten Parameter und der Auswahl einer Lösung für diesen zuwendet. Auch dadurch steigt die Übersichtlichkeit.
1.2.2.2.2
Funktional-Analyse
Die Funktional-Analyse betrifft die Aufgliederung eines Problems in Einzelfunktionen und die Suche nach denkbaren Alternativen jeder Funktionserfüllung (Wie!). Für jede einzelne Funktion werden dann Listen mit allen denkbaren und bekannten Funktionsträgern in einer Matrix zusammengestellt und für eine optimale Lösung kombiniert.
Im Folgenden das Beispiel einer Funktional-Analyse für einen neuen Baustellenbagger:
Funktionen: Leistungserzeugung, Leistungsübertragung, Drehmomentwandlung, Ortsveränderung, Manipulationswerkzeug, Manipulationsbewegung.
Funktionselemente:
Leistungserzeugung: durch Elektromotor, Ottomotor, Dieselmotor, Turbine, Hybridantrieb etc.,
Leistungsübertragung: durch Kupplung, Riementransmission, Hebel etc., Drehmomentwandlung: durch mechanisches Getriebe, hydraulisches Getriebe, elektrisches Getriebe etc.,
Ortsveränderung: durch Schienenräder, pneumatische Reifen, Raupen, Luftkissen etc.,
Manipulationswerkzeug: durch Löffel, Greifer, Haken etc.,
Manipulationsbewegung: durch Seilzug, Gestänge, Gewichte etc.
Über alle Funktionen werden nunmehr geeignet erscheinende Elemente zu einer Produktidee kombiniert. So kann ein neuer Baustellenbagger etwa durch folgende Elemente gekennzeichnet werden:
Turbinenantrieb mit Riementransmission und elektrischem Getriebe, Fortbewegung durch Luftkissen, Manipulation über Seilzug auf Greifer.
[54] Durch multiple Kombination ergeben sich wiederum zahlreiche Ideen. Diese werden nachher durch Experten selektiert und evaluiert.
1.2.2.2.3
Verwandte Verfahren
Von den zahlreichen weiteren Varianten logisch-diskursiver Verfahren seien an dieser Stelle noch folgende genannt:
Heuristik.
Dabei handelt es sich um die systematische Auswertung bereits zur Verfügung stehender Erfahrungen. So können durch Analogien aus bestehenden Problemlösungen wichtige Hinweise auf neue und ungewöhnliche Umsetzungen abgeleitet werden, die zudem einfach verfügbar sind.
Progressive Abstraktion.
Hierbei wird ein Problem in immer größeren Zusammenhängen betrachtet und auf die eigentliche Kernfrage bezogen (Fragestellung: Worum geht es eigentlich?). Mit jeder Stufe entfernt man sich zwar vom Ausgangsproblem, gewinnt aber zugleich auch neue Einsichten und damit Lösungsansätze.
KJ-
bzw.
NM-Methode
. Hier werden zu einer komplexen, bewusst ungenauen Problemstellung Anregungen gesammelt und auf Kärtchen geschrieben, die dann zu Oberbegriffen gruppiert werden. Zu diesen werden Analogien gesucht. Dies wird solange fortgesetzt, bis sich ein Problem deutlich abzeichnet, zu dem aus den bereits vorhandenen Anregungen oder durch Kombination zu neuen Anregungen eine Lösung gefunden werden kann.
Relevanzbaum.
Hier erfolgt die sukzessive Zerlegung eines Problems mit daran anschließender Alternativensuche zur Schwachstellenbeseitigung auf jeder Stufe der Beeinflussbarkeit. Dabei werden die Lösungsalternativen in geordneter Weise hierarchisch als Baumstruktur dargestellt, wobei vom übergeordneten Lösungsaspekt zu den jeweiligen untergeordneten Aspekten logisch fortgeschritten wird.
Ablaufanalyse.
Für ein Problem werden speziell die Verfahrensabläufe und der Informationsfluss analysiert, um Lösungen für Schwachstellen und Mängel in der vorgegebenen Aufgabenstellung entwickeln zu können.
Hypothesenmatrix.
Um Aussagen über Gemeinsamkeiten von ähnlichen Problemstellungen machen zu können, werden Fakten und Hypothesen über diese Problembereiche in einer Matrix gemeinsam ausgewertet. So kommt es zu einem ungewöhnlichen Transfer von Wissen.
[55]
1.2.2.3
Intuitiv-laterale Verfahren
Intuitiv-laterale Verfahren entsprechen gemeinhin als „typisch“ angesehenen Kreativitätstechniken. Es handelt sich im Wesentlichen um das Brainstorming, die Methode 6 3 5, die Synektik und Bionik sowie sonstige Verfahren.
1.2.2.3.1
Brainstorming
Das Klassische Brainstorming ist die spezielle Form einer Gruppensitzung, in der durch ungehemmte Diskussion mit fantasievollen Einfällen kreative Leistungen erbracht werden. Sie ist damit die wohl bekannteste Kreativitätstechnik und arbeitet nach dem Prinzip freier Assoziation. Menschen werden ermutigt, spontan eine große Anzahl von Ideen zu produzieren. Insofern kommen dafür eher Problemstellungen infrage, die wenig komplex, sondern klar definierbar sind. Dabei sind allerdings einige wenige Regeln zwingend einzuhalten:
Die Teilnehmer können und sollen ihrer Fantasie freien Lauflassen. Jede Anregung ist willkommen. Ideen sollen originell und neuartig sein (Freewheeling is welcomed!).
Ideenmenge geht vor Ideengüte. Es sollen möglichst viele Ideen erzeugt werden, auf die Qualität kommt es zunächst nicht an (Quantity is wanted!).
Es gibt keinerlei Urheberrechte. Die Ideen anderer Teilnehmer können und sollen aufgegriffen und weiterentwickelt werden. So kommt es zu Assoziationsketten (Combinations and Improvements are sought!).
Kritik oder Wertung sind während des Brainstorming streng verboten. Es kommt auf eine positive Einstellung gegenüber eigenen und fremden, selbst abstrus erscheinenden Ideen an (Criticism ruled out!).
Das Wissen mehrerer Personen wird damit zur Lösung eines Problems genutzt. Denkpsychologische Blockaden werden ausgeschaltet. Die Aufhebung gedanklich restriktiver Grenzen zum Problem erweitert die Lösungsvielfalt, und das Kommunikationsverhalten der Beteiligten wird gestrafft und demokratisiert. Unnötige Diskussionen werden vermieden.
Als organisatorische Voraussetzungen gelten folgende. Die optimale Teilnehmerzahl liegt erfahrungsgemäß zwischen fünf und acht Personen. Die Zusammensetzung der Gruppe sollte möglichst homogen hinsichtlich der hierarchischen Stufe und zugleich heterogen hinsichtlich Kenntnissen und Erfahrungen sein. Erforderlich ist die Auswahl eines Moderators, der die Gruppe an das Problem heranführt, auf die Einhaltung der Regeln achtet, stille Teilnehmer aktiviert, die Konzentration fördert, aber ansonsten sachlich zurückhaltend bleibt. Die Sitzungsdauer sollte 20 Minuten nicht unter- und 40 Minuten nicht überschreiten. Vor Beginn sind alle Gruppenmitglieder mit den Regeln vertraut zu machen. Die Aufzeichnung erfolgt durch Protokollant oder Tonträger. Auftraggeber und Aus[56]wertender sollen nicht in der Gruppe mitarbeiten. Zu einzelnen Lösungsvorschlägen werden ggf. später (fern-)mündliche Erläuterungen eingeholt. Die Lösungsvorschläge werden am Ende bewertet und klassifiziert. Das Ergebnis wird den Sitzungsteilnehmern mitgeteilt.
Wichtige Vorteile sind die geringen Kosten, die Kommunikationsforcierung, die motivierende Wirkung auf Teilnehmer, die Nutzung des Wissens mehrerer Personen, die Überwindung denkpsychologischer Blockaden, die große Lösungsvielfalt, die einfachen Regeln und die kurzfristige und einfache Durchführbarkeit. Wichtige Nachteile sind die evtl. Aufforderung zu überdrehten Ideen, die Risikoscheu in Gruppen, die Dominanz einzelner Teilnehmer, die Provozierung von Fachdiskussionen, der eher in gewohnten Bahnen verlaufende Inhalt, die Überwindung eines frühen „toten Punkts“, evtl. überlange Beiträge einzelner Teilnehmer und die schwierige Protokollierung.
Die bekanntesten Varianten des Brainstormings sind:
Anonymes Brainstorming
. Dies betrifft das Sammeln von Lösungsansätzen bereits vor der eigentlichen Problemlösungskonferenz. Dabei entfallen allerdings die wichtigen gruppendynamischen Prozesse der gegenseitigen Ideenanregung. Die Teilnehmer sollen dabei alle Einfälle auf Zettel aufschreiben. Der Sitzungsleiter trägt dann eine Idee nach der anderen vor und versucht mit der Gruppe, die Lösungsansätze zu brauchbaren Vorschlägen weiter zu entwickeln. Es können entsprechend mehr Personen teilnehmen, die Dauer der Sitzung kann länger sein.
Solo-Brainstorming
. Diese Technik ist auch in Einzelarbeit durchführbar, indem die Ideenanregung durch Situationen, Bilder, Stimmungen, Aktionen oder Reizwörter erzeugt wird. Dadurch ist ein weitaus höheres Maß an Flexibilität gegeben, allerdings auch eine womöglich geringere Effektivität.
Destruktiv-konstruktives Brainstorming