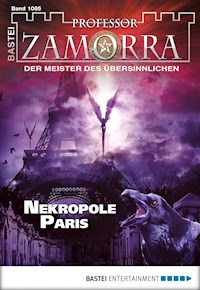
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
Etwas regte sich in dunklen Tiefen. Verstorbene drängten ans Licht.
Das Grab war ihnen nicht länger genug. Die Sehnsucht trieb sie nach Hause. Nach Hause, zu den Orten, wo sie gelebt, geliebt und das Zeitliche gesegnet hatten. Manche erst vor Tagen oder Wochen, andere schon vor Jahren und Jahrhunderten.
Ein schleichender Prozess, im Unsichtbaren begonnen, griff nach der sichtbaren Welt ... und damit nach Ahnungslosen, die es gewagt hatten, sich dort einzunisten, wo Tote die älteren Rechte besaßen.
Eine Metropole entartete zur Nekropole ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Nekropole Paris
Leserseite
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Verlagsleiter Romanhefte: Dr. Florian Marzin
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Arndt Drechsler
Datenkonvertierung E-Book: Blickpunkt Werbe- und Verlagsgesellschaft mbH, Satzstudio Potsdam
ISBN 978-3-7325-2494-5
www.bastei-entertainment.de
Nekropole Paris
von Adrian Doyle
Etwas regte sich in dunklen Tiefen. Verstorbene drängten ans Licht.
Das Grab war ihnen nicht länger genug. Die Sehnsucht trieb sie nach Hause. Nach Hause, zu den Orten, wo sie gelebt, geliebt und das Zeitliche gesegnet hatten. Manche erst vor Tagen oder Wochen, andere schon vor Jahren und Jahrhunderten.
Ein schleichender Prozess, im Unsichtbaren begonnen, griff nach der sichtbaren Welt … und damit nach Ahnungslosen, die es gewagt hatten, sich dort einzunisten, wo Tote die älteren Rechte besaßen.
Eine Metropole entartete zur Nekropole …
Paris16. Arrondissement
Théodore Artaud stellte den Trolley auf dem gefliesten Boden des Hausflurs ab und schob den Schlüssel in den schmucklosen Briefkasten, auf dem sein Name stand. Außer seinem gab es noch sechs andere Kästen gleicher Bauart für die anderen Mietparteien, unter anderem den kleinen Lotterie- und Tabakladen im Erdgeschoss, wo Artaud sich manchmal eine Zeitung kaufte.
Der Deckel fiel ihm entgegen, und mit ihm ein ganzer Schwung Briefkuverts und Werbeflyer, über die er sich wie üblich ärgerte. Über Kuverts und Flyer. Erstere enthielten, was man ihnen schon von außen ansehen konnte, mit hoher Wahrscheinlichkeit Rechnungen oder Zahlungsaufforderungen, und die Prospekte hätten gar nicht in seinem Kasten landen dürfen, weil schon seit Längerem ein Schild mit dem Hinweis Pas de publicité! – Keine Reklame! – unter dem Einwurfschlitz prangte.
Artaud war nicht einmal eine volle Woche weg gewesen, trotzdem nahm er wenig später einen ganzen Packen Briefe mit zu dem – genau wie Artaud selbst – in die Jahre gekommenen Gitteraufzug. Die bunten Flyer hatte er zuvor noch über die Kästen anderer Hausbewohner verteilt, von denen er in kaum einem Fall die Gesichter hinter den Namen, die darauf standen, kannte. Als freier Handelsvertreter hätte sich Artaud bei der herrschenden flauen Wirtschaftslage die großzügig geschnittene Wohnung im Dachgeschoss eigentlich gar nicht leisten können, nicht mehr zumindest, aber wenn ihm vor einem noch mehr graute als vor Rechnungen, dann vor einem Umzug.
Sein Arbeitsleben spielte sich zu mehr als siebzig Prozent in Verkehrsmitteln ab, Bahn, Bus oder Auto; er war ständig auf dem Weg zu potenziellen Klienten, deshalb war ihm ein Rückzugsort wie seine Wohnung beinahe heilig. Dort auch noch Hektik hineinzutragen, kam für ihn nicht infrage. Nur würde er sich bald etwas einfallen lassen müssen, um nicht vom Vermieter auf die Straße gesetzt zu werden. Die letzten zwei Monatsmieten war er säumig, und auch das jetzt hinter ihm liegende Klinkenputzen hatte nicht den erhofften Erfolg gebracht. Wenn ein Mensch in diesem Haus pleite war, dann Théodore Artaud, der daran aber, müde, wie er war, keinen Gedanken verschwenden wollte. Falls er im Vorratsschrank oder im Kühlschrank noch etwas fand, wollte er sich noch eine Kleinigkeit hinter die Kiemen schieben und sich dann für die nächsten zwölf Stunden ins Bett legen und erst einmal richtig ausschlafen. Je älter er wurde, umso mehr schlauchte ihn das Reisen kreuz und quer durch die Republik.
Quietschend setzte sich die Kabine in Bewegung, ruckelte immer einmal wieder verdächtig, schaffte es aber schließlich doch bis in den obersten Stock, wo Artaud ausstieg, die Gittertür sorgsam wieder hinter sich schloss, sodass der Fahrstuhl wieder gerufen werden konnte, und den Trolley hinter sich her zu seiner Wohnungstür zog.
Eine Minute später war er endlich drinnen und hatte Mantel und Schuhe ausgezogen. Die Wohnung war kalt und roch leicht miefig. In seiner Abwesenheit heizte Artaud nicht; ob das der Grund war, dass sich seit einiger Zeit in Bad, Küche und Schlafzimmer Schimmel an den Wänden gebildet hatte, wusste er nicht. Er hatte schon überlegt, dem Vermieter aufgrund dieser Beeinträchtigungen die Miete zu mindern, aber wie sollte man etwas mindern, das man ohnehin nicht bezahlte?
Er grinste schief. Auf dem Weg zum Kühlschrank blieb sein Blick kurz an dem Gasherd hängen. Das Backofenfach war groß genug, um sich mit dem Kopf hineinzulegen. Dann noch den Gashahn aufdrehen, ohne die Flamme zu zünden, und er wäre aller Sorgen ledig gewesen.
Das Problem war nur, dass er nicht nur chronisch pleite war, sondern auch noch feige. Freiwillig aus dem Leben zu scheiden, war für ihn keine Alternative.
Er öffnete die Kühlschranktür und war überrascht, wie gähnend leer es darin tatsächlich aussah. Sofort meldete sich sein Magen zu Wort. Das Knurren war nicht nur laut, sondern wurde auch von schmerzhaften Krämpfen begleitet. Artaud warf die Tür wieder ins Schloss und durchforstete als Nächstes die Hängeschränke, in denen er Konserven, Reis und Nudeln verstaute – wenn er Konserven, Reis und Nudeln im Haus hatte.
Dem war aber nicht so.
Die Mischung aus Erschöpfung und Hunger machte ihn aggressiv. Wäre seine Mutter nicht schon vor Jahren verstorben, hätte er sich überlegt, wieder zu ihr zu ziehen. Dann hätte es wenigstens jemanden gegeben, der sich freute, wenn er von anstrengender Reise zurückkam. Und Essen hätte auch auf dem Tisch gestanden, sogar sein Lieblingsessen.
Vielleicht hatte er ihr zu früh das Kissen aufs Gesicht gedrückt. Das Erbe hatte ihn fast ein ganzes Jahr lang über Wasser gehalten, ohne dass er seine Eigenständigkeit hatte aufgeben müssen. Aber im Endeffekt hätte er mehr davon gehabt, wenn sie ihre Witwenrente weiter bezogen und er regelmäßig etwas von ihr geschnorrt hätte. Sie hatte ihm nie etwas abschlagen können, nicht einmal in der Nacht, als er an ihr Bett getreten war und sie erstickt hatte. Irgendwie hatte sie ihn erkannt und daraufhin jede Gegenwehr eingestellt.
Das zumindest war das Bild, das Théodore Artaud seither nicht mehr los wurde. Nicht im Schlaf und nicht im Wachen.
Alles, was er bei seiner Suche fand, war eine entkorkte, noch halb volle Rotweinflasche, in der tote Fruchtfliegen schwammen, wie er sehen konnte, wenn er sie gegen das Licht hielt. Artaud war nicht wählerisch und wusste sich zu helfen. Er nahm die Kaffeekanne und legte einen Papierfilter in die Brühvorrichtung. Dann goss er den Rotwein in den Filter und wartete, bis die Flüssigkeit in der Kanne gelandet war. Zurück blieben Überreste zweifelhafter Herkunft; die Fliegen waren auch dabei.
Artaud füllte den Wein in ein bauchiges Stielglas und setzte sich damit vor den Fernseher. Als er das Gerät einschaltete, erhellte sich zwar die Mattscheibe, aber statt eines Bilds kam nur blaues Leuchten.
Ihm fiel ein, dass er die Beiträge für den Kabelanschluss auch schon seit Monaten nicht mehr überwiesen hatte. Offenbar mit der Konsequenz, dass der Anbieter nun reagiert hatte – weil Artaud nicht auf all die Mahnschreiben reagiert hatte.
Der Handelsvertreter setzte das Glas an die Lippen und trank es in einem Zug leer. Dass der Wein sauer war, störte ihn nicht. Im Zusammenspiel mit seiner Erschöpfung tat er seine Wirkung. Artaud fand nicht einmal mehr den Weg ins Bett, sondern legte sich lang auf die Couch und war Sekunden später eingeschlummert.
So hätte er viele Stunden durchschlafen können, aber etwas weckte ihn schon bald. Die Uhr über dem Fernseher zeigte wenige Minuten nach 2 Uhr früh, als er erschrocken auffuhr und zuerst gar nicht wusste, wo er war. Er hatte schon in so vielen billigen Absteigen übernachtet, und auf gewisse Weise sah eine wie die andere aus – und auch seine Wohnung unterschied sich nur marginal davon.
Dennoch erinnerte er sich, heimgekommen zu sein. Was ihm dadurch erleichtert wurde, dass das Licht im Wohnzimmer noch brannte, weil er vergessen hatte – oder nicht mehr in der Lage gewesen war –, es auszuknipsen (und weil die Stromgesellschaft es bislang versäumt hatte, ihm den Saft abzudrehen).
Artaud kämpfte den Schwindel nieder, der der abrupten Bewegung geschuldet war, mit der er sich aufgesetzt hatte. Nach einer Weile hörte der Raum auf, sich zu drehen. Aber er hörte nicht auf, zu ihm zu sprechen.
Zuerst schob Artaud es auf den Schlaftrunk, aber so betrunken war er dann doch nicht, glaubte er, um davon zu halluzinieren.
Die Leute im Zimmer beeindruckte seine Überzeugung nicht. Sie sprachen weiter miteinander, ihm kam es sogar vor, als würden sie sich über ihn unterhalten. Besonders tat sich dabei ein älterer Mann mit Vollbart hervor, dessen Reden ein einziger Wörterbrei war, der nicht einmal von den anderen Eindringlingen verstanden zu werden schien, weshalb er sie gestenreich untermalte. Sein Outfit erinnerte Artaud an alte Schwarz-Weiß-Fotos seines Großvaters. Und auch die anderen Gestalten, unter denen sich zwei Frauen unterschiedlichen Alters befanden, hätten ihrer Tracht nach in dessen Epoche gepasst.
Artaud setzte sich gerade auf und schlug schließlich mit der flachen Hand ungehalten auf den Tisch.
»Ruhe! Ihr habt hier nichts zu suchen! Wer hat euch hereingelassen? Verschwindet, bevor ich die Polizei rufe!«
Im Moment des Schlages schien die Szene zu erstarren. Totenstille hielt Einzug in den Raum. Théodore Artaud sträubten sich die Haare, weil ihm zum ersten Mal der Gedanke kam, einem ganz und gar unguten Geschehen beizuwohnen. Er hatte nie an Gespenster geglaubt, aber in diesem Moment war er drauf und dran, seine Meinung zu revidieren.
Unvermittelt richteten sich alle Blicke auf ihn. Die Augen des Brabblers schienen regelrecht zu glühen. Er saß auf einem Stuhl mit Armlehnen, den Artaud nicht kannte, so als hätte der vollbärtige Alte ihn sich selbst mitgebracht. Zornfunkelnd versuchte er, aufzustehen, sein Gewicht mit den Armen zu stemmen, aber auf einer Seite knickte er immer weg. Schließlich rutschte er einfach zu Boden, wälzte sich auf den Bauch und begann, auf Artaud zuzukriechen. Das Wimmern, das die Anstrengung begleitete, füllte mühelos den ganzen Raum. Es klang, als würden Geister weinen.
Théodore Artaud hielt es nicht länger in den eigenen vier Wänden. Er machte auf den Fersen kehrt und stürzte aus der Wohnung. Statt den Aufzug zu nehmen, was ihm zu lange dauerte, hastete er einfach die Treppe hinab. Auf seinem Weg drückte er auf jede Türklingel, an der er vorbei kam, und als er unten anlangte, hatten sich über ihm schon mehrere Türen geöffnet. Erboste Rufe drangen durch das Stiegenhaus.
Artaud stand am Ende der Treppe und bat mit sich überschlagender Stimme, die Polizei zu alarmieren, weil er in seiner Wohnung überfallen worden sei. Als er hinzufügte, dass die Verbrecher immer noch dort waren, schlugen Türen und drehten sich Schlüssel in Schlössern oder rasselten Sicherheitsketten, die eingeklinkt wurden.
Artaud konnte es niemandem verdenken. Im Erdgeschoss wohnte der Hausmeister, dessen Gehalt auf die Miete umgeschlagen wurde, was sie noch einmal verteuerte. Er trug nur Hose und Unterhemd und präsentierte seine Wampe mit ähnlichem Stolz wie jüngere Männer ihren Waschbrettbauch. In seinem Mundwinkel klemmte eine Kippe, und sein Blick war glasig. Ohne lange zu fackeln, grapschte er nach Artauds Arm und zerrte ihn in seine Wohnung. Mit dem Fuß kickte er die Tür hinter sich zu.
»Hier sind ‘se in Sicherheit«, nuschelte er. »Hab schon die Bullen verständigt.« Er wies in den Raum am Ende des Flures, wo ein niedriger Couchtisch zu sehen war, auf dem sich Fast-Food-Schachteln, Tüten sowie volle und leere Flaschen stapelten oder herumlagen. »Bierchen?«
Artaud hatte das Gefühl, von einem Albtraum in den nächsten zu rutschen. Trotzdem war er dankbar, untergekommen zu sein, und schon wenige Minuten später stoppten zwei Wagen mit wummernden Sirenen vor dem Haus.
***
Als die Polizisten in Artauds Wohnung nachschauten, fanden sie keine der von ihm beschriebenen Personen. Alles war so, wie Artaud es vor dem Zwischenfall in Erinnerung hatte.
»Saukalt hier, drehen Sie doch mal die Heizung auf«, sagte einer der Uniformierten. Sein Kollege warf ihm einen vielsagenden Blick zu, woraufhin offenbar auch er die Zeichen der Zeit verstand. Artaud überlegte kurz, ob er sich vor ihnen verteidigen sollte, aber ihm steckte noch zu sehr der Besuch der altmodisch gekleideten Fremden in den Knochen. »Sie müssen kurz vor Ihrer Ankunft verschwunden sein. Vielleicht über das Dach.«
»Übers Dach. Sagten Sie nicht, der eine hätte nur krabbeln, aber nicht gehen können?« Der Polizist trat ganz nah vor Artaud und sagte mit Blick auf die leere Rotweinflasche, die in der Küchenspüle stand: »Hauchen Sie mich mal an.«
»Ich bin nicht …«
»Machen Sie schon.«
Artauds Kopf färbte sich rot, aber er hauchte den Polizisten an, was einen neuerlichen vielsagenden Blick zur Folge hatte.
»Am besten legen Sie sich gleich, nachdem wir gegangen sind, ins Bett und schlafen sich aus. Ihre Personalien haben wir aufgenommen.«
»Sie wollen gehen?«
»Was sollten wir Ihrer Ansicht nach hier noch weiter tun?«
»Aber wenn sie zurückkommen …«
»Tun Sie einfach, als würden Sie sie nicht sehen. Das hilft. Morgen sieht die Welt wieder anders aus. Wann haben Sie das letzte Mal etwas gegessen?«
»Vor zwei Stunden«, log Artaud, weil es ihm peinlich war, einzugestehen, dass er nichts im Haus hatte.
Der Polizist ließ sich nicht anmerken, ob er es ihm abkaufte. Gemeinsam mit seinen Kollegen verließ er die Wohnung. An der Tür drehte er sich noch einmal um und sagte leise: »Wir haben alle schon schwierige Zeiten durchgemacht. Kopf hoch.« Er nickte ihm zu und folgte den anderen.
Artaud hörte, wie sich die Schritte über die Treppe entfernten. Auf jeder Etage hielten sie kurz inne, und das einsetzende Stimmengewirr verriet ihm, dass sie sich noch kurz mit den Leuten, die dort wohnten, unterhielten. Offenbar beruhigten sie sie, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hatte.
Fehlalarm.
Kaum waren die Beamten fort und Artaud wieder allein in seiner Wohnung, hörte er im Nebenraum Stühle rücken und ein Geräusch, als schabe etwas über den Boden.
Jemand kicherte gehässig, und dann legten sich eiskalte, sehnige Hände um seine Fußknöchel und begannen, ihn in den Boden zu ziehen.
***
Wenige Tage später
Suzanne Braque blendete die anderen Besucher des kleinen Museums aus und versenkte sich, wie schon viele Male davor, in den Anblick ihres Lieblingsgemäldes. Anders als die meisten ihrer Kommilitonen, mit denen die Kunststudentin sich unterhalten hatte, sprach die Dante-Barke sie um einiges mehr an als das Werk, mit dem Eugène Delacroix seinen Weltruhm begründet hatte: Die Freiheit führt das Volk, dessen Original im Louvre ausgestellt war, während das der Dante-Barke hier zu bewundern war.
Suzanne fand, dass es in dem fast familiären Ambiente dieses Hauses nahe der Kirche Saint-Sulpice, in dem der Maler auch tatsächlich seine letzten Lebensjahre verbracht hatte, sehr viel besser zur Entfaltung kam als in den riesigen Hallen des Louvre.
Das schwärmerische Leuchten in ihren Augen hätten sich manche junge Männer gewünscht, wenn sie Suzanne zu Uni-Feten, ins Kino oder zu einem Drink in eine der unzähligen Musik-Bars der Stadt einluden. Aber Suzanne hatte ihren Mister Right, der ihre Passionen – alle ihre Passionen – uneingeschränkt teilte, noch nicht gefunden. Und für ein schnelles Abenteuer war sie sich zu schade.
Wofür sie sich nicht immer liebte, aber mit etwas Abstand zu den ausgeschlagenen Gelegenheiten, die sich für eine hübsche junge Frau wie sie fast zwangsläufig ergaben, dann eben doch.
Als sie eine sachte Berührung an der Schulter spürte, schrak sie aus ihrer Versunkenheit auf und drehte sich ärgerlich um. Manchmal machten die unreifen Jungs in ihrem Semester solche Scherze. Diesmal jedoch nicht. Denn als sie sich umdrehte, stand hinter ihr gar keiner. Sie musste sich getäuscht haben.
Suzanne lächelte gequält und schob es auf ihr Lernen, das sie manchmal bis in die Morgenstunden wach hielt. Bei ihren Mitstudenten galt sie als Streberin, was ihr aber egal war. Sie selbst sah sich nicht so. Sie hatte sich lediglich Ziele im Leben gesetzt, von denen sie jedes bis zu einem bestimmten Alter erreichen wollte. Es würde nicht immer ganz exakt wie in ihrer Planung umsetzbar sein, aber eine ungefähre Einhaltung würde ihr schon genügen.
Heirat und eigene Kinder spielten in diesem Planspiel keine Rolle. Aber selbst wenn es einmal dazu käme, würde sie nie ihre Leidenschaften aufgeben. Sie brauchte Kunst so dringend wie andere Menschen die Luft zum Atmen. Oder wie ihre Mitbewohnerin Airelle, die ähnlich begeisterungsfähig war wie sie, nur eben auch um einiges bodenständiger, es ausgedrückt hätte: so dringend wie täglichen Sex.
Ihre wechselnden Männerbekanntschaften waren Legende. Aber sonst war sie ein liebes Ding.
»Mademoiselle, wir schließen gleich. Wenn Sie sich bitte etwas beeilen würden … und auch Sie dort, Madame, Monsieur …«
Die Stimme gehörte dem Museumswächter, mit dem sie eine ganz besondere platonische Liebe verband. Er war ein herzensguter Kerl, der wusste, wann er einen Studenten vor sich hatte, der mit seinem Geld haushalten musste und gerade einmal so über die Runden kam. Er akzeptierte die völlig zerknitterte Eintrittskarte, die sie bei ihrem allerersten Besuch bei ihm gekauft hatte, ließ sie sich jedes Mal zeigen, lächelte und winkte sie durch die Sperre.
Suzanne winkte Albert, so sein Name, lächelnd zu. Sie war heute später dran als sonst, aber ohne noch einen Blick auf die Szene zu werfen, die der »Göttlichen Komödie« des italienischen Dichters Dante Alighieri entnommen war. Für Suzanne war die darin thematisierte andauernde Auseinandersetzung zwischen Kaiser und Papstanhänger Sinnbild für religiös-weltliche Differenzen, die in ihrem eigenen Leben keine Rolle spielten. Für sie waren Abstammung und Glaube eines Menschen völlig nebensächlich, nur das, was man ihr entgegenbrachte, zählte. Um glücklich zu sein, durfte man sich keinen Dogmen unterwerfen. Mitfühlende Menschen wie Albert waren das, was das Leben lebenswert machte.
Im Hinausgehen zwinkerte sie ihm zu und fragte: »Das warst vorhin nicht zufällig du, der mir auf die Schulter tippte?«





























