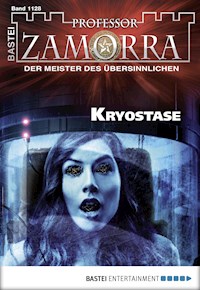
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
"Der Tod muss nicht das Ende sein."
Mit diesem Slogan wirbt CryoLife, eine Firma in Kanada, die es sich zur "Lebens"aufgabe gemacht hat, Verstorbene so zu konservieren, dass ihnen eines nicht allzu fernen Tages ein zweites Leben geschenkt werden kann - durch eine bis dahin fortgeschrittene Medizin.
Nicht Wenige greifen nach diesem letzten Hoffnungsstrohhalm, selbst ein Unsterblicher namens Dylan McMour.
Nicht für sich selbst jedoch, sondern für die Frau, die ihm alles bedeutet hat - und deren Tod er nicht verhindern konnte.
Genauso wenig wie ihr Verschwinden, nachdem er sie in die Obhut von CryoLife gegeben hat ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Kryostase
Leserseite
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Arndt Drechsler
Datenkonvertierung eBook: Blickpunkt Werbe- und Verlagsgesellschaft mbH, Satzstudio Potsdam
ISBN 978-3-7325-5168-2
www.bastei-entertainment.de
KRYOSTASE
Von Adrian Doyle
Der Traum vom Leben nach dem Tod ist alt, uralt.
Meist bezieht er sich auf eine Fortexistenz in jener Sphäre, in die die Seele dem Volksglauben nach einzieht; wenn es denn gut läuft, in den »Himmel« oder wenn nicht, in die »Hölle«.
Aber es gibt auch den Traum, das unterbrochene Leben nach einer Pausebiologischfortzuführen – in einer Zukunft, in der die Gebrechen, die den Körper umbrachten, geheilt und der Tote wiedererweckt werden kann.
Um das zu schaffen, muss man jedoch erst in diese wunderbare Zukunft gelangen.
Dieser Roman erzählt von einem solchen Versuch – und seinem Scheitern …
VergangenheitDie späten Sechziger
Ihre Hände zitterten, als sie die Haustür aufschloss.
Joséphine Gouillard musste den Schlüssel mehrere Male ansetzen, bevor sie es endlich schaffte. Ihr war, als würde sie unter ihrem tadellosen Bürodress nicht einfach nur schwitzen, sondern dampfen – was der Wahrheit wohl auch ziemlich nahe kam.
Der Arztbesuch hatte sie völlig aus der Bahn geworfen. Stärker, als sie es sich je hätte vorstellen können. Solange von ähnlich vernichtenden Diagnosen nur weitläufige Bekannte betroffen gewesen waren, hatte sie damit umgehen können.
Aber jetzt hatte sie es schwarz auf weiß bekommen: Die kreisenden Kopfschmerzen, die Schwindelanfälle und Phasen der Desorientierung der letzten Zeit hatten einen weit ernsteren Hintergrund, als sie es sich lange hatte glauben machen wollen. Ihr Hausarzt hatte sie an einen Spezialisten verwiesen, von dem ihr Kopf geröntgt worden war. Mit den Aufnahmen war sie zurück zu ihrem Arzt geschickt worden, damit er sie mit ihr besprechen sollte. Dass etwas Besorgniserregendes entdeckt worden war, hatte sich schon dem Mienenspiel und der Stimme des Überweisungsarztes entnehmen können. Trotzdem hatte Joséphine sich da noch im Griff gehabt. Die Tränen waren ihr erst bei Dr. Maupuiche aus den Augen geschossen, begleitet von einem hysterischen Heulkrampf. Der Arzt, der sie schon kannte und behandelte, seit sie der Pubertät entronnen war, hatte ihr ein Beruhigungsmittel spritzen müssen, dessen Wirkung aber offenbar bereits nachließ, wie die alleinstehende Frau mit einem Kloß im Hals feststellte.
Sofort wollte ein erneuter Panikschub sie überkommen.
Ich muss eine von den Pillen nehmen, die mir Maupuiche mitgegeben hat. Noch während sie die Tür hinter sich schloss, nestelte sie bereits an ihrer Handtasche und kramte die Arzneimittelpackung hervor, die der Arzt aus seinem »Giftschrank« geholt und ihr in die Hand gedrückt hatte, damit sie ohne Umweg über eine Apotheke direkt nach Hause gehen und sich ins Bett legen konnte. Die Tabletten waren so stark, dass sie nach Einnahme nicht auf den Straßenverkehr losgelassen werden durfte.
Joséphine riss die Tablettenpackung auf und drückte sich eine der unscheinbaren Pillen in die hohle Hand. Ohne etwas zu trinken, nur mit ihrem Speichel, schluckte sie sie und lauschte in sich, als könnte sie bereits die Wirkung spüren. Nach ein paar Sekunden rappelte sie sich auf, schloss und verriegelte die Wohnungstür und schleuderte die Pumps von den Füßen. Dabei bemerkte sie die Tagespost, die durch den Briefschlitz auf den Boden gefallen war. Sie bückte sich, pflückte alles auf und stakste anschließend auf wackligen Beinen ins Wohnzimmer, wo sie sich auf ihre Couch fallen ließ. Die rechte Hand umklammerte immer noch ihre Handtasche, die linke die Post. Beides legte sie neben sich, zwischen Hüfte und Sofalehne. In ihrem Schädel pochte es, als hätte sie eine Flasche Bourbon auf Ex ausgetrunken und sich danach beim Tennis ausgepowert.
Als sie die Augen schloss, war es, als würde sie einem schwarzen Abgrund entgegen fallen. Sie leistete keine Gegenwehr, wünschte fast, dass es tatsächlich so wäre und danach die Angst, die ihr die Kehle zuschnürte, für immer verschwinden würde.
Genau wie sie. Verschwinden – für immer.
Sie fiel in einen Halbschlaf, der aber höchstens eine halbe Stunde dauerte. Danach kochten die Emotionen wieder in ihr hoch. Sie konnte nicht länger liegen, ohne dass das unsichtbare Gewicht auf ihrer Brust unerträglich geworden wäre. Ruckartig fuhr sie in die Höhe und setzte sich auf. Dabei streifte sie die Papiere, die sie vom Boden unter dem Briefschlitz aufgelesen hatte. Ein Kuvert, das nach Behörde aussah (drauf gepfiffen!), ein mehrseitiger Prospekt eines Möbelhauses und zwei kleinformatige Flyer, von denen einer aussah wie diese Faltprospekte, die den Lieferdienst eines Thais, Italieners, Inders oder von wem auch immer anpriesen. Der zweite sah interessanter aus. Ungewöhnlich sogar. Hochglanz und keineswegs in einer billigen Druckerei hergestellt. Dahinter steckten ausgefuchste Könner. Die Abbildungen waren gestochen scharf und ansprechend, die Typographie erstklassig gewählt. Alles strahlte eine Souveränität aus, die jeden Impuls, den Flyer wieder beiseitezulegen, ohne seinen Inhalt zumindest überflogen zu haben, im Keim erstickte.
DER TOD MUSS NICHT DAS ENDE SEIN, titelte der Faltprospekt.
Joséphine erstarrte. Ein Hitzegefühl wanderte von einer Seite ihrer Bauchdecke zur anderen. Als würde jemand mit einer glühenden Nadel eine Linie ziehen. Von innen.
Die Redaktionsassistentin war nicht mehr zu bremsen, sog jedes gedruckte Wort in sich auf.
Erst auf der Rückseite, ganz am Ende und fast beiläufig waren Name und Anschrift des Dienstleisters aufgeführt. Plakativ war nur der Aufmacher-Satz. Danach folgten schlichte Eleganz und ein paar wenige, die Neugier weiter schürende Versprechungen.
Joséphine hielt den Flyer umklammert wie einen Rettungsring, der einem Ertrinkenden auf hoher See zugeworfen worden war. Ihre Gedanken überschlugen sich. Zum ersten Mal, seit sie Dr. Maupuiches Praxis verlassen hatte, konnte sie wieder richtig durchatmen.
Sie sah den Flyer zum ersten Mal – und hatte auch noch nie zuvor von einer Firma namens CryoLife gehört, deren Angebot bei ihr wie die Faust aufs Auge passte.
Als hätten sie gewusst, was ich heute erfahre. Schon vor mir gewusst. Und schnell jemanden vorbeigeschickt, um den Prospekt bei mir einzuwerfen.
Sie wusste, wie absurd diese Vorstellung war. Trotzdem ließ der Gedanke sie nicht mehr los, und ein paar Minuten später trat sie aus ihrer Wohnung und klingelte bei ihrem direkten Nachbarn.
Man konnte dem alten McAllister, einem Witwer vom alten Schlag, sicher manches vorwerfen, aber nicht, dass er launisch war. Nein, er war immer grantig. Freundlichkeit zählte nicht zum Repertoire seiner sozialen Umgangsformen, auch – oder gerade – seiner unmittelbaren Nachbarschaft gegenüber nicht.
Er öffnete seine Wohnungstür nur so weit, wie das Spiel seiner Sicherheitskette es zuließ. In dem entstandenen Spalt tauchte sein stoppelbärtiges Mausgesicht auf, und Joséphine glaubte, eine leichte Alkoholfahne zu riechen, was sie weder verwundert hätte noch interessierte.
»Ja?«, schnarrte McAllister.
»Haben Sie das auch bekommen?« Sie hielt ihm den Flyer entgegen.
Er beäugte ihn misstrauisch. »Was geht Sie an, was ich bekomme oder nicht bekomme?«
»Ich verschwinde sofort wieder. Sagen Sie mir nur das Eine: Kennen Sie diesen Prospekt? Steckte er auch zwischen Ihrer Post? Heute.«
Eine behaarte Hand schob sich durch den Spalt und gestikulierte ungeduldig. »Geben Sie her. Was ist das?«
Joséphine zögerte, händigte ihm den Flyer schließlich aber doch aus. Im schlimmsten Fall würde er ihn nicht mehr herausrücken und ihr die Tür vor der Nase zuschlagen. Aber sie hatte sich die Adresse unter dem Firmenlogo abfotografiert; es wäre also zu verkraften gewesen.
McAllister zog den Flyer nach innen und studierte ihn eine Weile. Schließlich warf er ihn durch den Schlitz nach draußen. Er flatterte neben Joséphine zu Boden. Und während sie sich danach bückte, hörte sie ihn schnauben: »Sind Sie noch bei Trost? Ich soll mich einfrieren lassen? Gehören Sie einer Sekte an? Lady, verschwinden Sie, bevor ich meinen Hund auf Sie hetze!«
Joséphine hatte nicht einmal gewusst, dass er einen Hund besaß. Zu hören war auch keiner. Eine leere Drohung, vermutete sie.
»Weder noch. Sie können machen, was Sie wollen. Ich will nur wissen, ob alle Häuser in der Straße ein solches Ding gekriegt haben oder …«
Die Tür knallte ins Schloss. Joséphine konnte nur mutmaßen, dass das wohl Nein bedeutete.
Seufzend wandte sie sich dem nächsten Haus zu. Hinter ihr begann es, fürchterlich zu bellen, aber wenn man genau hinhörte, glaubte man, Mister McAllister herauszuhören, wie er einen Hund zu imitieren versuchte.
Joséphine mochte Verschrobenheit bis zu einem gewissen Grad – den der alte Mann gerade eindeutig überschritt. Sie rümpfte die Nase und schellte bei den Jeremys, einer Bilderbuchfamilie, die erst seit ein paar Monaten in der Straße wohnte. Der Rasen vor dem Haus war übersät mit Kinderspielzeug. Auf der Veranda lagen zwei Fahrräder übereinander, als wären ihre Besitzer am liebsten gleich bis ins Haus gefahren.
Kinder.
Joséphine wartete darauf, dass die Wehmut nach ihr griff. Sie hatte sich immer Kinder gewünscht, aber irgendwie nie den passenden Mann für ihr Vorhaben gefunden. Und jetzt war es zu spät. Was ihr Unterbewusstsein bereits realisiert zu haben schien, denn die Verbitterung darüber, keinen eigenen Nachwuchs zu haben, blieb, anders als sonst, vollkommen aus.
Was eine neue Art von Bitterkeit sprießen ließ.
Sie biss die Zähne zusammen, schellte erneut. Endlich näherten sich kleine, wuselnde Schritte. Erst ging die Innentür auf, dann wurde die Fliegentür aufgestoßen. Ein kleines Mädchen stand auf der Schwelle. Acht oder neun. Das Gesicht schien nur aus Sommersprossen zu bestehen.
»Gretchen – richtig? Ist deine Mom oder dein Dad da?«
Gretchen lutschte verlegen am Daumen. Hinter ihr tauchte ihr Ebenbild in älter und größer auf.
»Ja, bitte?«
»Ich wohne schräg gegenüber.« Joséphine zeigte in die Richtung.
Die Frau nickte, blieb aber verhalten, als erwarte sie eine Beschwerde wegen der Kinder, die, wie Joséphine wusste, den lieben langen Tag die Straße rauf und runter tobten.
»Was kann ich für Sie tun?«
Joséphine wiederholte, was sie bereits den alten McAllister gefragt hatte. Der Flyer wechselte erneut den Betrachter.
Ms Jeremy prüfte den Prospekt kritisch von beiden Seiten, dann reichte sie ihn kopfschüttelnd zurück. »Nie gesehen. Eine Sekte?«
Für einen Moment war Joséphine verblüfft, aus ihrem Mund den gleichen Verdacht zu hören wie kurz zuvor von McAllister. »Ich weiß nicht. Es war in meiner Post. Ich wollte nur wissen, ob es eine allgemeine Wurfsendung ist oder …«
»Oder was? Interessieren Sie sich etwa dafür?« Misses Jeremy musterte sie kritisch. Dann lachte sie schallend auf. »Entschuldigen Sie. Das war nur ein Scherz. Sie sind noch viel zu jung, um sich Gedanken über den Tod zu machen.«
Bis vor wenigen Stunden hätte Joséphine ihr zugestimmt. Aber jetzt …
Ich sterbe. Sie sieht es nicht, aber ich bin schon so gut wie tot. Gottseidank sieht sie es nicht.
Gretchen zupfte ungeduldig am Hosenbein ihrer Mom. »Hab Hunger. Will einen Keks.«
»Nein, wir essen gleich. Geh schon mal rein. Ich komme gleich nach.«
Joséphine nahm es als Rauswurf. »Schon gut. Es hat mich nur interessiert. So was sieht man sonst nur in abgedrehten Filmen. Oder liest davon in Romanen, die wenig mit der Wirklichkeit zu tun haben.«
Sie ließ Ms Jeremy stehen und winkte im Gehen, ohne sich noch einmal umzudrehen. Erst zwanzig Schritte später blickte sie verstohlen über die Schulter. Ihre Nachbarin stand immer noch vor der Tür und sah ihr mit gerunzelter Stirn nach. Offenbar hatte Joséphines Auftritt auf sie ebenso bizarr gewirkt, wie Joséphine ihn selbst empfand.
Ich mache mich zum Gespött der Leute.
Der Gedanke berührte sie zu ihrem eigenen Erstaunen nur oberflächlich. Angesichts der viel größeren Klemme, in der sie steckte, handelte es sich dabei um nichts von wirklicher Bedeutung.
Sie arbeitete drei weitere Hausnummern ab, und am Ende bestand kaum noch ein Zweifel, dass sie eine der handverlesenen Empfänger des CryoLife-Flyers war, wenn nicht sogar die einzige.
Joséphine sah sich in ihrem Anfangsverdacht bestätigt – ohne jedoch eine Antwort auf die Frage zu finden, warum ausgerechnet sie ins »Visier« der mehr als ungewöhnlichen Propaganda hatte geraten können. Hätte sie den Flyer im Wartezimmer ihres Arztes gesehen oder wäre sie von Dr. Maupuiche – als allerletzte Möglichkeit quasi – darauf angesprochen worden, ihren Körper nach dem Tod in einem Eistank versenken zu lassen, hätte sie damit umgehen können. Aber die zeitliche Nähe zwischen dem Erhalt des Todesurteils und dem Erhalt speziell dieses Flyers überstieg ihre Bereitschaft, an einen bloßen Zufall zu glauben.
Ihr kam es im Gegenteil so vor, als wollte sie jemand mit der Nase auf ein abstruses Verfahren stoßen, das sie zwar nicht vor dem Tod bewahren konnte, ihr aber angeblich die Chance eröffnete, irgendwann in der Zukunft, wenn die Medizin fortschrittlich genug wäre, von ihrer tödlichen Krankheit geheilt zu werden und in ein zweites Leben zu entlassen. Was voraussetzte, dass es bis dahin auch Mittel und Wege geben würde, ihren schockgefrosteten Körper – denn darauf lief es hinaus – in der Weise wiederzubeleben, dass das ihm innewohnende Bewusstsein ebenfalls »aufgetaut« und noch mit dem übereinstimmen würde, das gegenwärtig den Ton angab.
Meins. Es geht nicht um irgendeine »neue« Joséphine, die dann erwachte, sondern immer noch um die, die sich gerade hoffnungslos in ihrer Nachbarschaft blamiert hat.
So konnte man es sehen, wenn einem die Meinung anderer über sich noch wichtig war. Aber Joséphine war dabei, solche Hemmschwellen abzubauen. Sie musste egoistischer werden, um ihre letzten Tage in Würde und mit so vielen Glücksmomenten wie nur irgend möglich ausfüllen zu können.
Aber zuerst galt es, einen Anruf zu tätigen, der ihr fast schwerer fiel, als das Ertragen der Diagnose.
Sie kehrte in ihr schmuckes Häuschen zurück, das längst nicht abbezahlt war und bald einen neuen Besitzer haben würde, steckte ihren Zeigefinger in die Wählscheibe des Telefons und rief ihren Vater an.
»Hallo, Dad«, sagte sie gepresst, als sich seine Stimme meldete. »Du wolltest wissen, was bei der Untersuchung herauskam. Ich habe keine guten Nachrichten. Ein Tumor im Stammhirn. Inoperabel. Ich werde sterben, Dad. Der Arzt gibt mir keine zwei Wochen mehr.«
***
»… keine zwei Wochen mehr …«
Während Eugene Gouillard den Männern zusah, wie sie die letzten Verbindungen zu den Maschinen kappten, an den Josi, wie er seine erst 25-jährige Tochter liebevoll nannte, angeschlossen gewesen war, solange ihr Körper den Kampf gegen die Krankheit noch nicht aufgegeben hatte, musste er unwillkürlich an den Moment vor drei Wochen denken, als sein kleines Mädchen ihn angerufen und über die niederschmetternde Diagnose informiert hatte.
Gouillard hatte im Garten seines kleinen Häuschens gearbeitet, das er allein bewohnte. Josis Mum war früh bei einem Autounfall ums Leben gekommen und hatte noch nicht einmal ihre Einschulung erleben dürfen. Großgezogen hatte Eugene Gouillard seine Tochter zunächst mithilfe der eigenen Mutter, die sofort ihre Unterstützung angeboten hatte, weil auch sie unter allen Umständen hatte vermeiden wollen, dass ihnen das Mädchen vom Amt genommen und in eine Pflegefamilie gesteckt würde.
»Wir kriegen das hin, Junge«, hatte die alte Dame, selbst Witwe, im Brustton der Überzeugung erklärt – und Wort gehalten.
Sie hatten es hinbekommen.
In den ersten Jahren war es nicht leicht gewesen, aber letztlich hatte es der Bindung zwischen Vater und Tochter nur gutgetan, dass sie gegenseitig auf sich aufgepasst hatten. In Josis Teenager-Zeit war ihre Oma dann auch gestorben, und es hatte noch einmal eine Krise zu bewältigen gegeben. Aber alles in allem hatten sie auch das gemeistert und den neuerlichen Verlust einigermaßen weggesteckt.
Als Nächstes bin ich dran, hatte Gouillard ohne jede Koketterie geglaubt. Er hatte die Fünfzig erst knapp überschritten, doch der Fairness halber hätte es auch so kommen müssen. Aber seit wann war das Leben fair? Oder der, der die Hand über alles hielt. Im Grunde hätte ich es wissen müssen.
Gouillard hatte keine Tränen mehr, so oft hatte er in den letzten Tagen neben Josi ausgeharrt, ihre abgemagerte Hand gehalten und sich die Seele aus dem Leib geheult, wenn sie ihn aus ihren geschundenen Augen nur stumm angeblickt hatte.
Da war ihr Sprachzentrum schon so stark beeinträchtigt gewesen, dass sie kein verständliches Wort mehr herausgebracht hatte. Und so hatte er für sie mitgeredet. Geredet und geredet und geredet, als könnte er dabei vergessen, wohin sie unaufhaltsam steuerte – wie ein winziges Boot, das von der Strömung erfasst auf Stromschnellen zuraste, die es unweigerlich zum Kentern bringen mussten.





























