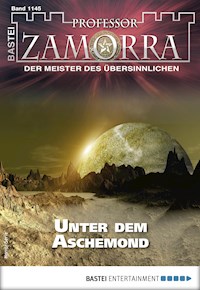
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
Das Unheil erreichte Château Montagne in den Morgenstunden eines der letzten Märztage, kurz vor Sonnenaufgang.
In den Grundfesten des tausendjährigen Gemäuers begann es zu rumoren wie in den Eingeweiden einer Monstrosität. Als Zamorra davon erwachte, umspannte eine Gänsehaut seinen Körper, die sich anfühlte, als hätte man ihn in zu enge Kleidung gezwängt.
Auf dem Nachttisch neben ihm leuchtete das dort abgelegte Amulett - seine mächtigste Waffe im Kampf gegen die Hölle - so grell und unheilvoll auf, als hätte es sich in jene Sonne zurückverwandelt, aus der es dereinst erschaffen worden war.
Als die magische Sonne im Gewölbe von Château Montagne erlischt, verschmelzen Vergangenheit und Gegenwart auf unheilvolle Weise.
Zamorra wird zu einem aberwitzigen Trip durch Raum und Zeit gezwungen, an einen Ort, der unmittelbar vor der Vernichtung steht.
Der Name: Krakatau. Die Zeit: August 1883
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Unter dem Aschemond
Leserseite
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: diversepixel / shutterstock
Datenkonvertierung eBook: Blickpunkt Werbe- und Verlagsgesellschaft mbH, Satzstudio Potsdam
ISBN 978-3-7325-6297-8
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Unter dem Aschemond
von Adrian Doyle
Das Unheil erreicht Château Montagne in den Morgenstunden eines der letzten Märztage, kurz vor Sonnenaufgang.
Warnende Vorzeichen hat es gegeben, aber sie wurden nicht verstanden, und so gerät ein Prozess in Gang, dessen Folgen unabsehbar sind.
In den Grundfesten des tausendjährigen Gemäuers beginnt es zu rumoren wie in den Eingeweiden einer Monstrosität. Als Zamorra davon erwacht, umspannt seinen Körper eine Gänsehaut, die sich anfühlt, als hätte man ihn in zu enge Kleidung gezwängt.
Auf dem Nachttisch neben ihm leuchtet das dort abgelegte Amulett – seine mächtigste Waffe im Kampf gegen die Hölle – so grell und unheilvoll auf, als hätte es sich in jene Sonne zurückverwandelt, aus der es dereinst erschaffen wurde.
Wenige Stunden zuvor
Die ersten warmen Sonnenstrahlen des Jahres lockten die Bewohner der Region ins Freie, in die Gärten ihrer Häuser oder auf die Spazierwege zu beiden Seiten der Loire, deren breites Band sich unterhalb von Château Montagne schlängelte. Kaum eine Wolke trübte den wie gemalt über der pittoresk anmutenden Landschaft leuchtenden Himmel. Mensch und Tier atmeten nach dem rekordverdächtig nassen und dunklen Winter, der endlich hinter ihnen lag, auf.
Das Wetter kann es uns nie recht machen. Eigentlich müssten wir uns Homo Sapiens malivolus nennen – der ewig Unzufriedene, kokettierte Nicole Duval mit den eigenen Unzulänglichkeiten, während sie mit einem von Madame Claire frisch aufgebrühten Kaffee durch den idyllischen Schlossgarten schlenderte und sich an dem zu entdeckenden, frisch knospenden Leben erfreute, das bald seine Blüten- und Blätterpracht entfalten würden. An Tagen wie diesen, wenn das Thermometer erstmals wieder die 20-Grad-Marke kratzte, war es leicht, die trübseligen Gedanken und Gefühle zu verbannen, die den Gefahren der zurückliegenden Wochen geschuldet waren. So vieles war auf sie eingestürmt. Mehr – viel mehr – als ein normaler Mensch hätte ertragen können. Aber vielleicht war das der Preis, den der, der sich entschieden hatte, aus der Normalität auszubrechen und sogar seine Sterblichkeit – im biologischen Sinne zumindest – hinter sich zu lassen, bereit sein musste zu zahlen. Im Leben war nichts umsonst zu bekommen, erst recht nicht im ewigen.
Seit Nicole und Zamorra aus der Quelle des Lebens getrunken hatten, war der Alterungsprozess ihrer Zellen zum Stillstand gekommen. Ein Geschenk, das Nicole im Allgemeinen durchaus zu schätzen wusste, bewahrte es ihr doch ihre Attraktivität; etwas, worauf sie schon vorher stolz gewesen war und für das sie auch immer bereit gewesen war, etwas zu tun. Aber manchmal fragte sie sich auch, wie es wäre, in dem fast greisen Körper zu wohnen, den die Natur ihr, wäre die Unsterblichkeit nicht »dazwischengekommen«, eigentlich zugedacht hatte.
Und noch etwas ging ihr dann durch den Kopf: Wäre sie geistig so frisch und jugendlich geblieben, wie es jetzt der Fall war, wenn ihr äußeres Erscheinungsbild seine Ansehnlichkeit nach und nach eingebüßt hätte und sie mit der gleichen Anhäufung von Fältchen und Wehwehchen gestraft worden wäre wie die breite Masse, die nicht das Glück hatte, auf magische Weise in Bestform »konserviert« zu werden.
Körper und Geist waren eng miteinander verflochten. So, wie man sagte, in einem gesunden Körper wohne ein gesunder Geist, gab es Beispiele zuhauf, dass in einem alten, kränklichen Körper auch ein in vielerlei Hinsicht gehandicapter Verstand wohnen konnte.
Konnte.
Nicht zwangsläufig musste.
Nicole kannte glücklicherweise auch beeindruckende Gegenbeispiele. Dennoch: Die Gefahr, physisch und psychisch nachzulassen, war real. Wahrscheinlich musste man als Normalsterblicher permanent daran arbeiten, sich seine Neugier zu bewahren. Sich auch unangenehmen Herausforderungen stellen. Probleme anpacken, statt sich von ihnen niederdrücken zu lassen.
Also im Grunde nichts anderes, als wir so machen. Sie lächelte versonnen und nahm einen Schluck Kaffee, bevor sie ihren Weg am noch abgedeckten Pool vorbei fortsetzte und einfach die viel zu seltene Ruhe genoss.
Bis … ja, bis ihre Entspannung einen Knacks erfuhr.
Weil in ihr ein ganzer Chor von geisterhaften Stimmen laut wurde. Nicht laut im tatsächlichen Sinn, denn sie machten sich telepathisch bemerkbar. Aber die Not war ihnen genauso anzumerken, als würden reale Münder in unmittelbarer Nähe zu schreien beginnen.
Nicole verschüttete vor Schreck fast die Hälfte ihres noch nicht getrunkenen Kaffees, weil sie sofort den Ursprung des Stimmengewirrs erkannte.
Die Varnen!
Wann war es je passiert, dass sie den Kontakt zu ihr gesucht hatten? Bislang waren die Kommunikationsversuche immer von Nicole ausgegangen; und nicht immer hatte sie bei den magischen Pflanzen im Keller des Schlosses entsprechend Gehör gefunden. In dieser Hinsicht waren sie eigen. Mehr als das.
Für einen Moment wurde der Druck in ihrem Schädel so heftig, als wollte er zerspringen. Erst als sie signalisierte, verstanden zu haben und bereit zu sein, sich zu den Regenbogenblumen zu begeben, um mit ihnen in Verbindung zu treten, schwächte der Ruf zu einem erträglichen Hintergrundrauschen ab.
Aber bevor sie sich zu einer überstürzten Handlung hinreißen ließ, die sie möglicherweise hätte bereuen müssen, wollte sie sich absichern. Und so lenkte sie ihre Schritte nicht sofort in den Bereich, der sich unter dem Château bis tief in den Berg hinein erstreckte, sondern suchte den Mann auf, dem sie zu jeder Zeit und unter allen Umständen ihr Leben anvertraut hätte. Den Mann, der ihr dieses Leben schon unzählige Male gerettet hatte – so wie sie ihm.
***
»Und du bist sicher, dass es keine Sinnestäuschung war?«
»Du meinst, ob ich es mir nur eingebildet habe?« Nicole war nicht beleidigt, es war eine berechtigte Frage. »Ich werde mir gleich Gewissheit verschaffen. Ich wollte nur nicht zu ihnen gehen, ohne dass du Bescheid weißt.«
»Das war richtig.«
Sie nickte. »So sehe ich es auch. Die bisherigen Kontakte waren durchaus zwiespältiger Natur. Es gab Momente, da kamen sie mir fast wie Attacken vor. Aber das liegt, vermute ich, an der generellen Fremdheit dieser Lebensform.«
Er erhob sich von seinem Schreibtischstuhl im Arbeitszimmer des Châteaus. Der Nervenzentrale, wie er es bisweilen nannte. Hier liefen alle Fäden zusammen. Von hier aus wurden weltweit Mediensondierungen durchgeführt, um auf Machenschaften der Schwarzblütigen aufmerksam zu werden; möglichst so frühzeitig darauf zu stoßen, dass ihre Pläne noch vereitelt werden konnten. Aber in der Regel konnten sie nur noch Scherben zusammenkehren, Bedrohungen eindämmen. Geschehenes ungeschehen zu machen, hätte es anderer Mittel bedurft, die nur schwerlich mit ihrer Vorstellung von Moral – oder schlicht ihrem Gewissen – vereinbar gewesen wären.
In Extremfällen hatten sie diese Grenze auch schon mal überschritten …
… und oft genug bereuen müssen.
»Ich denke, es wird das Beste sein, wenn ich mitkomme.«
»Wenn du hier abkömmlich bist.« In ihren Augen tanzten farbige Pünktchen, während sie sich ein spöttisches Lächeln verkniff.
»Nichts, was nicht warten könnte – im Gegensatz zu dir.«
»Das wollte ich hören.«
Sie begaben sich auf direktem Weg in die unterirdischen Gefilde, die noch so manches Geheimnis wahrten. Und selbst bei Dingen, die seit Langem als bekannt galten, konnte man sich, wie gerade die Regenbogenblumen bewiesen, nicht sicher sein, irgendwann auf Aspekte zu stoßen, die dazu führten, dass man sie in ganz neuem Licht betrachten musste.
Lange Zeit waren die Regenbogenblumen und die bei ihnen befindliche Miniatursonne einfach auf ihre Funktionen reduziert und nicht weiter erforscht worden. Die wahre Bedeutung der seltsamen Blumen hatte sich erst nach und nach erschlossen.
Das Umdenken hatte erst kürzlich begonnen, als die Kolonie magischer Gewächse beinahe vernichtet worden wäre – und als selbst die bis dahin untadelig und fehlerfrei arbeitende Miniatursonne mit mysteriösen Kurzaussetzern auf sich aufmerksam gemacht hatte.
In jüngster Zeit hatte es keine Ausfälle mehr gegeben, weder bei den Pflanzen noch bei der künstlichen Sonne unter der Gewölbedecke.
Der Ruf, der Nicole jetzt ereilt hatte und als dessen Quelle sie die Blumen identifiziert zu haben meinte, gab Anlass zu neuer Sorge.
Regenbogenblumen-Kolonien waren im Laufe der Zeit an unterschiedlichsten Plätzen auf der Erde und selbst auf fernen Planeten entdeckt worden. Einzigartig an der schlosseigenen Kolonie war ihre unterirdische Unterbringung – und die Existenz einer, so schien es zumindest, eigenes für sie installierten Kunstsonne.
Und einzigartig scheint auch zu sein, dachte Zamorra, während sie die letzten Meter zur Kolonie zurücklegten, dass ›unsere‹ Blumen mit Intelligenz behaftet sind – ganz im Gegensatz zu ihren Artgenossen an anderen – oberirdischen – Standorten, die einfach nur ›Gebrauchsobjekte‹ sind.
Über die Gründe dafür, warum ausgerechnet diese Kolonie vom Verstand geküsst war, hatten sie schon vielfach spekuliert, ohne zu einem hieb- und stichfesten Ergebnis zu gelangen. Allerdings favorisierten sie die Idee, dass die Miniatursonne – die Strahlung, die sie verbreitete – damit zu tun haben könnte.
Zamorra erinnerte sich mit Schmunzeln an Nicoles Frage in diesem Zusammenhang: »Meinst du, wir beide würden auch schlauer, wenn wir unsere Schlafzimmer ins Blumen-Gewölbe verlegen würden?«
Und an seine trockene Gegenfrage: »Noch schlauer?«
Seit einiger Zeit dachte er über eine ganz spezielle Mission nach, der er sich widmen könnte, um dem Rätsel um die genaue Herkunft von Blumen und Sonne auf die Schliche zu kommen. Wenn er Merlins Zeitringe nähme, den, mit dem man in die Vergangenheit reisen konnte, und den, um wieder zurückzukehren, könnte er sich bei entsprechender Geduld und einem noch nicht absehbaren Aufwand stückchenweise nach dorthin vorpirschen, wo das Geheimnis seinen Anfang genommen hatte.
Oder aber – doch dafür hätte es der Kooperation mit den Regenbogenblumen selbst bedurft – die lebenden Transmitter hätten sie gezielt dorthin versetzt, wo die Pflanzung ihren Anfang genommen hatte.
Solange sich die Kommunikation mit den Varnen aber so schwierig gestaltete, wie es bisher der Fall gewesen war, konnte an diese eigentlich simple Methode, das Rätsel zu lüften, nicht gedacht werden.
Zamorra wagte es kaum zu hoffen, aber vielleicht markierte der heutige Tag ja eine entscheidende Wende in ihrem Verhältnis zu den Varnen. Der ergangene Ruf an Nicole jedenfalls ließ es denkbar erscheinen, dass ein Durchbruch in Verständigungsfragen gelingen könnte.
»Sie wollen etwas von dir – oder uns«, sagte er kurz vor Betreten des Gewölbes. »Was immer es ist, verkneife dir vorschnelle Zusagen. Verlange eine Gegenleistung.«
»Und was genau schwebt dir da vor?«
»Spontan fielen mir gleich zwei Dinge ein, bei deren Klärungsversuch sie uns immer wieder haben auflaufen lassen. Die eine Sache betrifft die Kunstsonne und was sie über ihre Entstehung beziehungsweise ihre Erschaffer wissen.«
Nicole blickte skeptisch, nickte aber. »Und die andere?«
»Dylan. Seit er ihre Transportdienste in Anspruch nahm, um von hier wegzukommen, ist er verschollen. An dem Ort, zu dem sie ihn versetzt haben wollen, kam er nach unseren Recherchen nie an. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie wirklich nicht wissen, wo er herauskam, ist aber so verschwindend gering, dass wir beide es ihnen nie ernsthaft abgekauft haben. Oder?«
Sie nickte.
»Bislang hatten wir kein Druckmittel, es doch noch aus ihnen herauszukitzeln«, fuhr er fort. »Aber vielleicht ändert sich das, wenn du ihnen gleich Gehör schenkst. Es muss schon einen triftigen Grund haben, wenn sie sich so vehement in Erinnerung rufen. Die Gelegenheit sollten wir nicht ungenutzt verstreichen lassen, was meinst du?«
***
Dylan McMour, ihr schottischer Freund und Mitstreiter – und ein weiterer Ausnahmefall, dem es gelungen war, aus der Quelle des Lebens zu trinken und dadurch die relative Unsterblichkeit zu erlangen –, hatte vor Monaten die große Liebe seines Lebens verloren, seine Verlobte Nadja Bulkis. Sie war in den Wirren um die Entstehung ÄONs umgekommen, genau wie andere lieb gewonnene Freunde, Nele Großkreutz etwa.
Den Verlust seiner Verlobten hatte Dylan nur schwer verkraftet und sich eine Auszeit nehmen wollen. Dass der ewige Kampf gegen die Höllenmächte mitunter zermürbende Ausmaße annahm, war nicht neu. Auch nicht für den Schotten, der alle Höhen und Tiefen, die ein Mensch überhaupt durchlaufen konnte, tatsächlich durchlaufen hatte. Aber selbst für einen Burschen mit Nehmerqualitäten wie ihn konnte irgendwann ein Tropfen ein Fass des Erträglichen zum Überlaufen bringen, und Nadjas Verlust war offenbar dieser berühmte Tropfen gewesen.
Ihr schottischer Freund hatte sich mit dem Versprechen verabschiedet, sich zu melden, sobald er ein wenig Abstand gewonnen hatte. Irgendwann, so sein Credo, wollte er seine Krise überwunden haben und ihnen in ihrem Kampf, der auch sein Kampf war, wieder beistehen.
Aber sein angekündigter Abschied hatte im Nachhinein einen Makel erhalten, weil sich schnell herausstellte, dass er sein eigentliches Ziel – Nordamerika, Florida – nie erreicht hatte. Zumindest hatte in Tendyke’s Home, seiner ersten Reiseetappe, wo ebenfalls eine Kolonie der »Transmitterblumen« existierte, niemand etwas von seiner Ankunft bemerkt, und es gab nicht den geringsten Anlass, diese Aussage anzuzweifeln.
Auf Nachfrage – einer jener schwierigen Versuche seitens Nicoles, mit den Varnen in einen telepathischen Austausch zu treten – hatten die Regenbogenblumen stur und fest behauptet, Dylan wie gewünscht in Florida abgeliefert zu haben.
Theoretisch war es zwar möglich, dass der mit allen Wassern gewaschene Freund zwar auf dem Anwesen von Robert Tendyke angekommen war, sich dort aber nicht zu erkennen gegeben, sondern klammheimlich davongestohlen hatte. Aber erstens gab es dafür keinen nachvollziehbaren Grund, da er ja ohnehin angekündigt hatte, sich von dort aus fürs Erste absetzen zu wollen und dabei kein konkretes Ziel ins Auge gefasst zu haben. Und zweitens war das Gelände von einem Elektrozaun im Stile eines Hochsicherheitstraktes umgeben, der ein Verlassen schon prinzipiell schwierig, ein unbemerktes Verlassen sogar fast unmöglich machte.
Die an allen relevanten Stellen angebrachten Überwachungskameras jedenfalls hatten keinen Ankömmling registriert. Und auch niemanden, der – in welcher Weise auch immer – die Umzäunung überwunden hatte. Dylan hätte schon komplett unsichtbar sein müssen, um überhaupt keine Spur zu hinterlassen. Und selbst Unsichtbarkeit hätte nicht erklärt, wie er den Zaun passiert haben sollte, ohne wenigstens eine kurzzeitige und im Nachhinein rekonstruierbare Störung hervorzurufen.
Das ungeklärte Schicksal Dylan McMours also war die eine Sache, die Nicole ein weiteres Mal und mit größerem Nachdruck ansprechen wollte. Die andere betraf die Identität derer, die vor einer bislang nicht bestimmbaren Zeitspanne die Kolonie von Regenbogenblumen im Keller des Schlosses angepflanzt hatte – und es nicht versäumt hatte, den Pflanzen einen mehr als adäquaten Ersatz für natürliches Sonnenlicht zu hinterlassen.
***
»Hört ihr mich? Ich bin da.«
Sie hatte mit Zamorra verabredet, das, was sie den Varnen zu sagen hatte, nicht nur geistig, sondern auch gesprochen zu übermitteln, sodass er daraus erste Schlüsse ziehen konnte. Er selbst verfügte zwar ebenfalls über latent vorhandene telepathische Fähigkeiten, aber aus unbekannten Gründen hatten sie ihn nie befähigt, selbst eine Verbindung zu den intelligenten Gewächsen herzustellen. Was möglicherweise daran lag, dass die Varnen bestimmten, wen sie an sich heranließen und wen nicht.
An Nicole schienen sie einen Narren gefressen zu haben, wenngleich ihr bisheriges Verhältnis nicht immer unproblematisch verlaufen war. Es gab Licht und Schatten.
»Da …«, echote es in ihrem Kopf, ohne dass eine Veränderung am äußeren Erscheinungsbild der Regenbogenblumen bemerkbar gewesen wäre.
Nicole nickte Zamorra zu, um ihm verstehen zu geben, dass die Verbindung im Aufbau begriffen war. Dann schloss sie konzentriert die Augen.
Sofort hatte sie das Gefühl, in ein leuchtendes Knäuel zu fallen, das die sichtbar gemachten elektrischen Ströme in einem Gehirn zeigte. Die myriadenfach miteinander verknoteten Energiefäden dominierten die Sphäre, zu der Nicole Zugang erhielt; sie symbolisierten die geistige Vernetzung der Pflanzen untereinander. Jede Einzelne war ein Baustein des Kollektivs, das stets mit einer »Stimme« zu Nicole sprach, ohne dass sie bislang hatte klären können, ob die Intelligenz der Blumen an ihr hiesiges, geballtes Auftreten gebunden war – oder ob ein losgelöstes und anderswohin gebrachtes Exemplar noch über ein eigenständiges Denkvermögen verfügte. Mit anderen Worten, ob es sich um vollwertige Individuen handelte, die sich ihrer engen Gemeinschaft lediglich unterordneten – oder um ein »Gehirn«, das nur in seiner Gesamtheit mit Bewusstsein und Intellekt glänzen konnte.
»Was ist so dringend, dass ihr mich gerufen habt?«
»Gerufen?« Wieder fast ein Echo ihrer eigenen Worte und Gedanken – aber mit einem Fragezeichen versehen.
Dann, nach einer Pause: »Wir haben nicht gerufen. Warum sollten wir?«
Nicole hatte mit vielem gerechnet, aber nicht damit, dass sie es leugneten.
Sie war – auch jetzt noch – sicher, dass die Varnen der Quell des Rufs





























