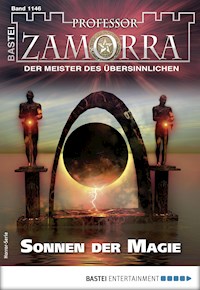
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
Wird es Artimus van Zant gelingen, Zamorras Spur aufzunehmen und ihn von dort, wohin das magische Phänomen im Gewölbe der Regenbogenblumen ihn entführt hat, wieder zurückzuholen?
Wo ist Zamorra überhaupt gestrandet? Wer verbirgt sich hinter der ominösen Macht, deren Sendbote ihn in der Fremde "willkommen" heißt - um den Preis des Dhyarras, die letzte Zamorra noch verbliebene Waffe, nachdem Merlins Stern bereits seinen Besitzer gewechselt hat?
Die Antworten auf diese und weitere Fragen verraten wir Ihnen im nächsten Band.
Denn das Reich der Asche hält noch mehr böse Überraschungen bereit. Eng damit verknüpft sind die Sonnen der Magie ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Sonnen der Magie
Leserseite
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Catmando / shutterstock
Datenkonvertierung eBook: Blickpunkt Werbe- und Verlagsgesellschaft mbH, Satzstudio Potsdam
ISBN 978-3-7325-6388-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Sonnen der Magie
von Adrian Doyle
Sundastraße, Indischer Ozean, 1883
»Nein, bitte«, hörte er sie flüstern. »Verlange das nicht von mir. Ich bin einem anderen versprochen. Wie könnte ich da …«
Ihre Stimme, anrührender als jeder Gesang, verstummte. Weil ihre Augen, ihre Bewegungen, ihr Atem anderes verhießen, als ihre Worte es vorschoben.
Noch einmal steigerte sich die Hitze, die der Trank in Dylan entfacht hatte. Und er erkannte, dass das fremde Feuer in ihm nur mit anderem Feuer gelöscht werden konnte. Dem, das in derGesandtenbrannte.
Und so vereinigte sich, nachdem seine Fesseln gefallen waren, Feuer mit Feuer, Rausch mit Rausch zu nie erlebter Ekstase. Der das böse Erwachen auf dem Fuß folgte.
Nicht nur für ihn, den Eindringling aus der Fremde …
Die Szene verfolgte ihn bis in die Lähmung seiner Ohnmacht hinein:
Hier das puppenstubenkleine Dorf, auf das er bei seinem Inselmarsch gestoßen war, mit seinen absurd winzigen Bewohnern, die Lebendigkeit vorgaukelten, wo keine war. Keine echte zumindest. Und im Hintergrund der unheilschwer thronende Vulkankegel, der, wie der Zeitreisende wusste, das Eiland in Kürze verschlingen würde.
Ungemach drohte auch dem Mann aus der Zukunft selbst, der jedoch bezweifelte, dass es in seinem Fall mit bloßem Sterben abgetan sein würde. Das, wovon er auf Krakatoa überwältigt worden war, hatte ihn schon bei früherer Gelegenheit wissen lassen, dass es Schlimmeres gab als den schnöden Tod. Damals, im bitterkalten Sommer 1816, in den verwinkelten Gassen von London, wo die von einem schrecklichen Gott beseelte Asche wütete …
Beseelte Asche.
Ein ohrenbetäubender Lärm brachte die Mauern der Abschottung um seinen Geist zum Einsturz.
Dylan McMours Augen sprangen auf, aber er brauchte eine Weile, bis er begriff, woher der Lärm rührte, der ihn wachgerüttelt hatte. Kein Geringerer als er selbst brüllte so fürchterlich und verzweifelt, dass es in seinem Schädel wie in einem knöchernen Resonanzkörper dröhnte.
Einem Reflex folgend wollte er seine Faust gegen den Mund pressen, als gäbe es keine andere Möglichkeit, dem eigenen Geplärr einen Riegel vorzuschieben. Dabei musste er feststellen, dass das nicht möglich war.
Weil er an ein Gestell gefesselt war, das keine andere Bewegung gestattete als die des Kopfes, der sich nach wie vor nach links oder rechts drehen ließ.
Während er dies auch tat, beschlich den Schotten der absurde Glaube, dass sogar eine Drehung um 180 Grad – vielleicht sogar um volle 360 – möglich gewesen wäre. Aber austesten wollte er es nicht. Dylan hätte dem Tod nicht über so lange Zeit wieder und wieder ein Schnippchen schlagen können, wäre er der erstbesten aberwitzigen Versuchung erlegen, jede Grenze zu überschreiten, die einem Menschen von der Natur vorgegeben war. Solchen Hochmut hätte selbst ein »Unsterblicher« wie er teuer bezahlt, davon war er überzeugt. Auch jetzt.
Seine Unsterblichkeit war eine relative, was nichts anderes hieß, als dass sein Körper aufgehört hatte, zu altern. Grobe Gewalt hingegen konnte seine Existenz auch in diesem Zustand »lebendiger Konservierung« jederzeit beenden. Was hieß, dass er sich mit allen Mitteln gegen Versuche, ihm das Leben zu nehmen, zur Wehr setzen musste; und mit allen Mitteln bedeutete in diesem Fall, auch Mittel einzusetzen, über die nur wenige verfügten, weil sie mit besonderem Zauber behaftet waren. Mit Magie, die nur ein paar Auserwählte besaßen und damit umzugehen verstanden.
Der Tattooreif!
Sein Blick streifte die Faust entlang, die er sich auf die Lippen drückte. Es war seine Rechte, und unmittelbar darüber, am Handgelenk und ein gutes Stück weit den Unterarm hinauf, umschloss das sein Fleisch, woran er sofort denken musste. Weil es das Einzige war, was er einer massiven Attacke von Wesen aus dem Reich der Dunkelheit und des Bösen überhaupt entgegensetzen konnte.
Im ersten Moment durchströmte ihn Erleichterung, als er sah, dass der Tattooreif noch an Ort und Stelle war. Allerdings … wirkte er anders als gewohnt auf den Schotten. Normalerweise bildete er damit ein »Gesamtkunstwerk«. Sobald er das Band aus unbekanntem Stoff anlegte, war es für andere untrennbar mit ihm verbunden. Kein Außenstehender vermochte den Reif wieder zu entfernen. Nur er, Dylan, konnte das.
Und wahrscheinlich war das der einzige Grund, weshalb es noch an ihm haftete.
Die Erinnerung kehrte in jedem entsetzlichen Detail zurück.
Das »Dorf« auf der Lichtung, auf das er gestoßen war, nachdem er den Strand verlassen hatte, wo Cornelis Janszoon, der Kapitän der ULYSSES, dem Schiff, das Dylan zu dieser Insel nahe Java geschippert hatte, mit seinen Männern zurückgeblieben war. Er selbst hatte den Vulkan aufsuchen und dort nach Spuren des Ungeheuerlichen forschen wollen, mit dem es London vor Jahrzehnten zu tun bekommen hatte.
Und tatsächlich hatte er eine Spur gefunden.
Oder hat sie mich gefunden?
Konnte es Zufall sein, dass das Dorf mit den aus Asche geformten Menschennachbildungen exakt auf dem Weg zu finden war, den Dylan eingeschlagen hatte, um zum Vulkan zu gelangen. Sprach nicht vielmehr alles dafür, dass jemand es dort platziert hatte? Als Falle?
In die ich einfältiger Narr auch prompt getappt bin.
Nach all der langen Zeit und dem Schatz an Erfahrungen, den er hatte horten können, verblüffte es ihn immer wieder, wie leicht er Situationen oder Personen auf den Leim ging. Aber vielleicht war das schlicht und ergreifend die Natur des Menschen: dass er fehlbar blieb, ganz egal, wie viele Lebensjahre er letztlich auf Erden verbrachte und wie viel Weisheit er daraus zu ziehen versuchte.
Im Grunde keine unsympathische Vorstellung, in Dylans Lage jedoch auch überhaupt nicht tröstlich.
Wo zur Hölle bin ich?
Die Dunkelheit war über den tropischen Wald hereingebrochen. Am sternenreichen Firmament glitzerte ein Meer von Sternen, das im Zusammenspiel mit dem vollen Mond Helligkeit streute, an die das Auge sich aber erst gewöhnen musste.
Dass Dylan die Gestirne sehen konnte, obwohl er von Wänden umgeben war, lag daran, dass das, was er zunächst für eine Hütte gehalten hatte, über kein Dach verfügte. Die Holzpfähle, die ins Erdreich gerammt waren, bildeten lediglich eine kreisrund angelegte Palisade, in der sich eine Türöffnung ausmachen ließ.
Der Schotte fühlte sich sofort an das Miniaturdorf erinnert, von dem aus er angegriffen worden war. Die Bauten dort hatten genauso ausgesehen.
Wenn jetzt noch eines der Aschefigürchen auftaucht, will ich mir gar nicht ausmalen, was das bedeutet. Für mich bedeutet.
Noch tat er als Sarkasmus ab, wovor sein Verstand ihn warnte.
Aber dann trat tatsächlich jemand durch die Tür und bewegte sich mit raubtierhafter Geschmeidigkeit auf ihn zu. Den Umrissen nach eine Frau, nackt fast, und – wie sich im Nähertreten offenbarte – vom Kopf bis zu den Zehen mit mehliger Asche bestäubt.
***
Dylans Kehle entrang sich ein Stöhnen. Nein, dachte er, von einer Panik überwältigt, die ihm neu war. Aber neu wäre auch gewesen, was ihm beim Anblick der Aschefrau durch den Kopf spukte: nämlich dass er von dem, was ihn überwältigt und in die Bewusstlosigkeit geschmettert hatte, geschrumpft worden sein könnte.
Geschrumpft!
Genau danach sah es tatsächlich aus: Als hätte ein perfider Zauber ihn seiner wahren Größe beraubt und zu einer kaum noch zwanzig Zentimeter hohen »Figur« mutieren lassen, die sich in die Umgebung, in die er gebannt worden war, nun nahezu perfekt einfügte. Ein weiteres Püppchen in einem Puppendorf, aus Asche gebacken.
Nur dass ihm offenkundig, im Gegensatz zu den anderen »Figuren« ein höchst limitierter Status zufiel: als Gefangener. Gefesselt an eine Konstruktion, die ihm so gut wie keinen Bewegungsspielraum ließ.
Dylan versuchte, den Tattooreif zu aktivieren und sich so Respekt zu verschaffen. Bei der Gestalt, die sich vor ihm aufbaute.
Schon vor der Ohnmacht hatte das magiegeladene Band ihn nicht schützen können, nicht vor der Aschelawine, die über ihn gekommen war, um ihn zu verschlingen.
Und auch jetzt erwies sich die Waffe als nutzlos. Sie verriet nicht einmal, ob sein geistiger Befehl sie überhaupt erreichte.
Dylan fluchte in sich hinein.
Die barbusige Erscheinung hielt etwas in den Händen. Ein becherartiges Gefäß, in dem gleichen Grau gehalten wie die Eingeborene selbst.
Die Asche, deren unheilvoller Spur Dylan gefolgt war, um zu verhindern, dass sie jemals wieder zu einer Gefahr für die Welt werden konnte.
Nun hatte diese Asche – beziehungsweise die Macht, die in ihr wohnte – den Spieß umgedreht und mit geradezu spielerischer Leichtigkeit ihn unschädlich gemacht.
Als hätte sie all die Jahre nur auf mein Erscheinen gewartet.
Schon in der ersten Nacht, die die ULYSSES vor Krakatoa ankerte, war ein Überfall von einer Art erfolgt, die ihm verraten hatte, wie begründet seine Sorge war, dass sich in diesen Gefilden eine Gefahr eingenistet hatte, von der der Rest der Welt entweder nichts ahnte oder sie unterschätzte.
Beides traf auf ihn nicht zu.
Und dennoch hat sie mich ausgetrickst. Ich bin ihr wie ein blutiger Anfänger auf den Leim gegangen. Und wenn kein Wunder geschieht, wird sie mich ausweiden wie ein Stück Vieh. Ausschlachten.
In London hatte der dortige Asche-Spuk Bilder in ihm entstehen lassen, über die ihm vermittelt worden war, was genau die beseelten Partikel so unwiderstehlich und wertvoll an ihm fanden. Nicht sein Fleisch, seine Hülle – sich dies einzuverleiben hätte eher den Gelüsten eines niederen Dämons entsprochen. Nein, zweifellos hatte die Seele der Asche das an ihm erkannt und für sich beanspruchen wollen. Für sie war das, was ihn über das Körperliche hinaus durchtränkte, ein Alleinstellungsmerkmal. Im 19. Jahrhundert belief sich die Erdbevölkerung auf eine knappe Milliarde; von diesen jetzt lebenden Menschen war Dylan nur eine einzige Person bekannt, die vom Wasser der Quelle des Lebens gekostet und deren Zauber in sich gespeichert hatte.
Ich.
Einer von einer Milliarde.
An mir konnte sie nicht vorbei. Wenn mehr als purer Instinkt in ihr schlummert – und dafür gibt es Anzeichen –, wird sie sich diesen Leckerbissen nicht entgehen lassen.
Sie. Er rätselte mehr denn je, wer »sie« denn nun eigentlich war und wie es dazu hatte kommen können, dass ein Wesen von dieser Machtfülle sich über etwas so Abstruses wie Asche definierte … artikulierte … manifestierte.
Erneut versuchte er, den Tattooreif dazu zu bewegen ihm beizuspringen, sich dem Gegner – seiner Manifestation – entgegenzustellen.
Aber das Band um seinen Arm schwieg, als hätte eine unüberwindbare Lähmung Besitz von ihm ergriffen. Oder als wäre es genauso gefesselt wie sein Träger – nur auf unsichtbare Weise.
»Ambil dan minum!«
Dylan zuckte zusammen. Er beherrschte ein paar Brocken Malaiisch, und die Worte, die er hörte, schienen dieser Sprache zu entstammen. Minum bedeutete Trinken. Offenbar handelte es sich bei dem, was die Lippen der Unbekannten verließ, um die Aufforderung an ihn, seinen Durst zu stillen.
Selbst konnte er nicht nach dem Becher greifen. Aber das war auch nicht nötig. Das Mondlicht umfloss die unbekannte Schönheit wie eine Aura, die durch die Reflexion des fahlen Glanzes auf der »Schminke« entstand, die jeden Quadratzoll ihrer sichtbaren Haut bedeckte. Ganz nah trat die Frau an Dylan heran und hielt ihm den mitgebrachten Becher an den Mund.
Wollte es zumindest. Aber Dylan drehte abwehrend den Kopf zur Seite. Ein kurzer Blick in das Gefäß hatte genügt, um ihm das, das darin gluckste, abspenstig zu machen. Was auch immer es war, Wasser, das man bedenkenlos trinken konnte, sah anders aus. Nein, in dem Becher schwappte etwas Brackiges, und schon der Geruch weckte Ekel.
»Verschwinde! Weg! Lass mich!«
In ihren Augen glomm eine Empörung, die an Fanatismus grenzte. Aber immerhin waren es Augen, nicht nur eine Verdichtung von Ascheteilchen, die seinen ursprünglichen Verdacht untermauert hätte, unter sie geraten zu sein – unter die Aschefigürchen, die ein Scheinleben auf der Waldlichtung führten.
Nein, entschied Dylan. Sie ist aus Fleisch und Blut. Wie ich. Nur dass das Aschekleid offenbar zu ihrer Kultur gehört, ihrem Glauben … was immer sie treibt.
Ihre gespreizte freie Hand schnappte nach seinem Gesicht, drückte mit Daumen und Fingerspitzen so unwiderstehlich in seine Wangen, dass Ober- und Unterkiefer auseinander gezwungen wurden und der Schotte gleichzeitig daran gehindert wurde, sich weiter gegen den Becher zu sträuben. In der stählernen Klammer musste er ohne eine Chance auf Gegenwehr erdulden, dass die brackige Flüssigkeit in seine Kehle rann. Er versuchte sie auszuspeien, aber ihm fehlte die Kraft. Er musste sich entscheiden, ob er zulassen wollte, dass der zähflüssige Trank ihm in die Atemwege gelangte – oder ob er es hinter sich brachte, ohne daran zu ersticken. Indem er alles schluckte, was ihm eingeflößt wurde. Und danach wieder Atem schöpfte … Luft … Leben …
Schon der erste Schluck brachte Erleichterung in einer Form, mit der er nicht gerechnet hatte. Jeder Widerstand erlahmte, und er beobachtete sich selbst schaudernd dabei, wie er das, was ihm verabreicht wurde, mit einem Mal genoss. Wie er süchtig nach jedem einzelnen Tropfen wurde, der sich seinen Weg in ihn bahnte; in Regionen, die eigentlich anderem vorbehalten waren als bloßer Verdauung. In seinem Kopf bildeten sich Hitze und Euphorie und eine unstillbare Gier nach … Nähe. Nach der Nähe von dem, was ihn in London noch abgestoßen und mit unnennbarem Grauen erfüllt hatte.
Hier, in der Heimat des Gottes, war es anders. Der Trank öffnete Dylan die Augen. Die Nacht wurde zum Tag.
Und nicht nur sein Denken, seine Wahrnehmung, seine Sehnsucht wandelten sich. Auch mit der Gesandten, die den Becher, kaum dass er geleert war, wieder wegzog, ging eine Veränderung vonstatten.
Er hörte ihren Seufzer. Er sah das Staunen in ihrem fein geschnittenen Gesicht, aus dem die Feindseligkeit sich verabschiedet hatte.
»Nein, bitte«, hörte er sie flüstern. »Verlange das nicht von mir, Vatermutter. Ich bin einem anderen versprochen. Wie könnte ich da …«
Ihre Stimme, anrührender als jeder Gesang, verstummte. Weil ihre Augen, ihre Bewegungen, ihr Atem anderes verhießen, als ihre Worte es vorschoben.
Noch einmal steigerte sich die Hitze, die der Trank in Dylan entfacht hatte. Und er erkannte, dass das fremde Feuer in ihm nur mit anderem Feuer gelöscht werden konnte. Dem, das in der Gesandten brannte.
Und so vereinigte sich, nachdem seine Fesseln gefallen waren, Feuer mit Feuer, Rausch mit Rausch zu nie erlebter Ekstase. Der das böse Erwachen auf dem Fuß folgte.
Nicht nur für den Eindringling aus der Fremde.
***
GegenwartChâteau Montagne
Die Krisensitzung fand im Arbeitszimmer statt, dem Ort, an dem die logistischen Fäden innerhalb des Schlosses zusammenliefen. Die Nervenzentrale, wie Zamorra den Raum zuweilen auch nannte.
Im Moment konnte er das nicht. Weil er nicht da war. Weil er als verschollen galt, seit sich Ungeheuerliches mitten im Herzen des Widerstands manifestiert hatte. Des Widerstands gegen die Mächte der Hölle und anderes übersinnlich Böses, das Menschen zu knechten, zu verstümmeln und zu töten trachtete – seit Jahrtausenden. Und stets im Geheimen, sodass der Öffentlichkeit nie hieb- und stichfeste Beweise zugänglich geworden waren, dass es Dämonen, Vampire, Werwölfe, Hexen und andere Ausgeburten der Finsternis tatsächlich gab.
Je aufgeklärter und wissender der Mensch sich fühlte, desto leichteres Spiel hatte das Höllengeschmeiß, wurde es doch von Medien und vermeintlich unbestechlicher Wissenschaft immer mehr ins Reich der Fantasie und des Aberglaubens abgedrängt. Je mehr Bücher über all die Spielarten des Grauens geschrieben, je mehr Filme gedreht wurden, umso mehr wurden wohlige Schauer bedient und Urinstinkte betäubt, die in bestimmten Situationen hätten Alarm schlagen müssen, wodurch manches Unglück vielleicht hätte verhindert werden können.
Die Zivilisation hatte der Menschheit in früheren Zeiten Schutz vor Nachstellungen aus dem Schattenreich geboten, bis zu einem gewissen Grad jedenfalls, aber die Errungenschaften der Neuzeit – Internet, Traumfabriken, Drogenkonsum – hatten dies ins Gegenteil verkehrt und eine Generation hervorgebracht, die fast wehr- und schutzlos gegen die Heimtücke derer war, die nur ihr Bestes wollten: ihr Blut, ihr Leben, ihre Seele!
Die in der Zentrale Versammelten bildeten die Ausnahme von dieser Regel. Aber ihre Zahl war verschwindend klein – und aktuell sogar noch mehr dezimiert worden.
»Wie sieht es aus, Artimus? Die schonungslose Wahrheit! Gibt es auch nur einen Funken Hoffnung, dass wir ihn jemals wiedersehen? Dass wir seinen Aufenthaltsort lokalisieren können? Oder …«, Nicole Duval biss sich auf die Unterlippe, »… oder auch nur zu verstehen, was dort unten vor sich geht«?
Dort unten, das war der Keller des Schlosses, ein seit jeher geheimnisumwitterter Bereich, in dem auch das Kuppelgewölbe mit der Regenbogenblumen-Kolonie lag; eine unterirdische Enklave, die erst Jahre nach Inbesitznahme des Châteaus entdeckt worden war.
Sowohl die dort ansässigen magischen Blumen, unter deren Blüten man sich nur stellen musste, um sich an andere, von ihnen bevölkerte Standorte versetzen zu können, als auch die künstliche Sonne, die in gut fünfzehn Metern Höhe unter der Decke des kuppelartigen Raumes schwebte, waren, so stellte sich nun heraus, viel zu lang als »geschenkter Gaul« betrachtet worden, dem man, wie der Volksmund sagte, »nicht ins Maul schauen« sollte.
Aber genau darin lag die Crux.
Hätten wir die Dinge früher hinterfragt und geforscht, wer eigentlich die Blumen und ihre lebenserhaltende Miniatursonne hier untergebracht hat, wäre uns vielleicht viel erspart geblieben.
Vielleicht hätte dann auch Zamorras Verschwinden verhindert werden können.
Artimus van Zant, der alte Freund und ganz nebenbei auch fähigste Wissenschaftler von Tendyke Industries, wohin sich Nicole in der Hoffnung auf Unterstützung gewandt hatte, suchte gar nicht erst nach Ausflüchten.





























