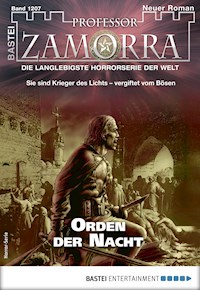
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
Die große Sternen-Saga geht weiter:
Der auf gespenstische Weise entstandene Riss im Boden war für Emeric Rifaud, den Agenten der französischen Section Spéciale, einmal mehr Beleg dafür, wie die Welt, in der er lebte, wirklich gestrickt war. Dass es noch eine Ebene neben der sichtbaren gab, unberechenbar und magisch.
Der Eingang in die Unterwelt, vor dem er Position bezogen hatte, war gut drei Meter lang und anderthalb Meter breit. Wie tief er ging, war aufgrund eines magischen Phänomens durch Augenschein nicht zu erkennen. Die Ränder jedenfalls vermittelten den Eindruck, als hätte eine gigantische Axt mit Brachialgewalt eine Kerbe in den Wüstenlack des Nazca-Plateaus geschlagen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 136
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Orden der Nacht
Leserseite
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Sandobal
Datenkonvertierung eBook: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7517-0128-0
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Orden der Nacht
von Adrian Doyle
Cahuáchi, Peru
um Christi Geburt
Muyal wälzte sich am Boden, schrie und stöhnte wie toll.
Mit jedem Herzschlag wurden die Entgleisungen der Gesalbten ärger. Aus den Wunden, die sie sich zufügte, trat Blut und besudelte den heiligen Grund.
Schließlich aber gelang es Noíl, der Mütterlichen, das Mädchen, das kurz vor der Weihe stand, zu bändigen und dem Toben Einhalt zu gebieten.
Muyals Widerstand erlahmte, aber immer noch atemlos keuchte sie die Worte, die alles veränderten.
Alles.
»Hier! Hier müssen wir graben! Hört doch die Stimmen – wie sie nach uns rufen …!«
Noíl winkte die Priesterinnen herbei, die sich in ihrer Begleitung befanden, und befahl ihnen, die Gesalbte zurück zum Tempel zu führen. Muyal ließ es widerstandslos mit sich geschehen, der Blick immer noch entrückt und Schaumbläschen auf den Lippen.
Kaum waren sie Noíls Blicken entschwunden, sank die Mütterliche an eben jener Stelle auf die Knie, welche von Muyal mit deren Blute benetzt worden war, und zwar auf ganz wundersame Weise. Die Hohepriesterin erkannte in den feuchtdunklen Flecken, die sich im Staub gebildet hatten, mehr als ein zufälliges Muster. Und so erschauderte sie, weil es ihr der Beweis schien, dass nur die Wahrhaftigen – so nannte ihr Volk die Schöpfer aller Dinge – durch die junge Anwärterin gesprochen haben konnten.
Als würde auch ihre Hand von den Lenkern der Welt geführt, zog sie den Priesterstab aus dem Gürtel ihres Kleides und drückte die knöcherne Spitze in jenen Blutstropfen, der ihr als Erstes ins Auge fiel. In der Folge ergab sie sich erneut der leitenden Hand der Wahrhaftigen und zog Linien von Tropfen zu Tropfen. So entstand ganz allmählich das Bildnis eines gezackten Sonnenkranzes.
Die Sonne war die wahrhaftigste unter den Elementen der der Schöpfung.
Kaum wurde ihr dies gewahr, konnte Noíl nicht anders, als sich tief hinabzubeugen und die Stirn gegen die Zeichnung zu pressen.
Als sich sengende Hitze in ihre Haut zu brennen begann, musste sie dem Impuls widerstehen, sich zurückzuziehen. Die Wahrhaftigen durfte man nicht erzürnen, und so hielt sie aus – über die Grenze des Erträglichen hinaus. Sie verlor das Bewusstsein.
Aber nicht lange, dann kam sie wieder zu sich und fand sich am Boden liegend wieder. Da sie die anderen geheißen hatte, vorauszugehen, war niemand bei ihr, und einen schrecklichen Moment lang fühlte die Mütterliche, die sich stets um die Ihren gesorgt hatte, sich von allen und allem verlassen.
Von den Stimmen, die Muyal beschrieben hatte, vernahm sie selbst immer noch nichts, nicht den leisesten Seufzer, aber die Zeichnung, die sie in den Wüstenlack gekratzt hatte, gemahnte sie daran, dass auch sie zu den Auserwählten gehörte, die Gnade vor den Augen der Wahrhaftigen gefunden hatte.
Nur schwer konnte Noíl sich von dem Ort der Gnade lösen.
Leichtfüßig wie lange nicht mehr eilte sie den Weg zurück, den sie sommers wie winters beschritten, um den Wahrhaftigen nahe zu sein. Ihrer Überzeugung nach wohnten sie im Hohen Himmel zwischen den Lichtern.
Aber was, fragte sich die Hohepriesterin der Paracas, während sie sich der Bruchkante des Plateaus und dem uralten Pfad näherte, der hinab ins Tal führte, wenn wir uns all die Zeit geirrt haben? Wenn die, die uns lenken, strafen oder beschenken, gar nicht in den Wolken leben, sondern …
Sie erbebte.
… tief unter unseren Füßen?
Außer Atem erreichte sie den Tempel, wo Muyal ihr ängstlich und erwartungsvoll zugleich entgegenblickte. Auch die anderen wirkten verstört, konnten den Blick nicht von Noíls Stirn wenden.
»Ihr Zeichen!«, keuchte die Gesalbte, und es sah aus, als wollte sie erneut in den Taumel verfallen, mit dem alles begonnen hatte.
Noch bevor die Hohepriesterin zu Muyal trat, verlangte sie nach einem Spiegel, der ihr in Windeseile gebracht wurde. Die herbeieilende Dienerin stolperte auf den letzten Schritten, als wollte ihr Körper verhindern, dass die Gläserne Wahrheit, wie Spiegel auch hießen, sein Ziel erreichte.
Noíl aber zögerte nicht, das Stigma zu schauen, das sich in ihre Haut gebrannt hatte. Es entsprach ganz und gar der Zeichnung, die sie durch das Verbinden der Blutstropfen geschaffen hatte, nur dass es klein genug war, um auf ihrer Stirn Platz zu finden.
Es pulsierte im Rhythmus ihres Herzens.
Bei Muyal angelangt, legte Noíl die Hände auf die Schultern der Gesalbten, die scheu zu ihr aufblickte.
Muyal konnte nicht aufhören, das Mal anzustarren, das wie eine frische Wunde auf der Stirn der Hohepriesterin prangte.
Als wäre sie gebrandmarkt worden.
»Herrin«, flüsterte Muyal. »Wer hat Euch das angetan? Doch nicht etwa … ich in meinem Wahn?«
»Du? Nein! Es war der Gnadenort selbst, der mich zeichnete?«
»Gnadenort?«, echote Muyal.
»Wo sie mit deiner Zunge zu uns sprachen. Die Wahrhaftigen, die uns das Leben schenkten, wofür wir ihnen ewig dankbar sein müssen!«
Noch am gleichen Tag kehrten die Bewohner der Siedlung auf das Plateau zurück und begannen den Boden an der Stelle abzutragen, die Muyal in Raserei hatte verfallen lassen und von der Hohepriesterin gekennzeichnet worden war.
Es zeigte sich, wie trügerisch der Fels dort war.
Mehr als eine armdicke Platte, die im Nachhinein wie ein aufgesetzter Deckel wirkte, gab es nicht zu beseitigen. Dahinter warteten Stufen, fingerdick mit Staub bedeckt, die weiter führten, als das Licht der Fackeln, die über die Öffnung gehalten wurden, zu leuchten vermochte.
Mit jeder Stufe, die Muyal weiter in die Tiefe stieg, erfuhr sie mehr über das Schicksal, das die Macht im Fels ihr und den Ihren zugedacht hatte. Das Fremde, das dort hauste, bar jeglicher Moral und jeden Mitleids …
☆☆☆
Mehr als tausend Jahre später
In der Weißen Finsternis
Kelan führte sein Schwert gegen das Bein des Angreifers, der aus nichts anderem als taudicken Strichen zu bestehen schien. Aus von dunklem Zauber erweckten Linien, die bei ihrer Ankunft noch als bloße Furchen den Boden des Plateaus überzogen hatten, dann aber …
… dann aber von etwas dazu gebracht wurden, sich vom Untergrund zu lösen, zu erheben und uns Rechtschaffenen entgegenzuwerfen!
Als gestaltgewordene Verdammnis, die alles übertraf, womit sich Ordensritter auf ihrer Jagd nach den Höllensternen je konfrontiert gesehen hatten.
Das hier spottete jeder Beschreibung. Nur der pervertierte Verstand eines Armageddonjüngers konnte dergleichen ersinnen.
Armageddonjünger. Ein Begriff wie ein Fanal, schwang in ihm doch alles mit, was die Streiter des Ordens unermüdlich dazu antrieb, das eigene Leben geringer zu schätzen als das, wovor sie die Welt durch ihren Einsatz und Kampf bewahren konnten: die Herrschaft des absolut Bösen.
Höllensterne hieß der Orden die Wurzel allen Übels nicht ohne Grund. Denn wo sonst als in den schwefeligen Klüften von Satans Reich hätte dergleichen seinen Ursprung haben können?
Kelans ungestümer Hieb durchtrennte die Gliedmaße des Vogelwesens, das groß wie eine Karavelle war.
Der Kontakt zwischen der Klinge und dem Körper des Ungetüms hatte mit nichts Ähnlichkeit, was Kelan jemals mit seinem Schwert berührt oder gar durchtrennt hatte. Und gewiss empfanden auch seine Begleiter dies so, von denen er Ives aus den Augenwinkeln gewahrte, wie er auch sein Stahl ins »Fleisch« des spukhaften Dings bohrte, das sie daran zu hindern versuchte, zu dem, der es lenkte, vorzudringen.
In den Schwertern der Ordensritter pulsierte die Magie der Amulette, die sie mit sich trugen – erbeutete und geläuterte Höllensterne –, und jeder damit geführte Streich hätte Mauern zum Einsturz gebracht.
Im Unterschied zu den Armageddonjüngern aber setzten die Ordensritter ihre Machtwerkzeuge uneigennützig ein. Ihnen ging es einzig darum, Schaden abzuwenden, nicht anzurichten. Oberste Priorität hatte dabei, Unschuldige – zumindest so weit es ging – aus Konflikten herauszuhalten und deren Leben zu schonen. Unglücklicherweise schreckten manche Tyrannen nicht einmal davor zurück, lebende Schutzwälle aus Geknechteten um sich herum zu errichten und deren Tod bei den Schlachten gegen die Ordensritter billigend in Kauf zu nehmen.
Als Kelans Klinge mit dem Skelett des Ungeheuers in Berührung kam, war es, als würde er sie in einen Gewitterblitz halten.
Und während Kelan noch glaubte, von der zornigen fremden Magie, die ihnen entgegenbrandete, zerrissen zu werden, erreichte die Situation um ihn herum die nächste Eskalationsstufe, die damit begann, dass wenige Schritte von ihm entfernt Thibaut, sein Freund und Mentor, dahingemetzelt wurde.
☆☆☆
Ein Krallennagel der Vogelmonstrosität, die sich aus dem Wüstensand erhoben hatte, durchbohrte den Harnisch des älteren Ritters, als bestünde die Panzerung aus nichts als dünnem Pergament. Gleichzeitig schien das Schlachtengetümmel einzufrieren – etwa so lange, wie Kelan der Atem stockte und in seiner Brust ein so sengender Schmerz wühlte, als hätte nicht Thibaut, sondern er den tödlichen Dorn empfangen.
Der ungläubige Blick des Mannes, der schon Kelans Vater ein treuer Freund und Wegbegleiter gewesen war, brannte sich unauslöschlich in das Bewusstsein des Jungritters ein. Zeitlebens würde der Ausdruck auf dem Gesicht des Sterbenden – diese Mischung aus ungläubigem Staunen und Entsetzen – ihn verfolgen.
Für die Dauer eines Herzschlags schienen selbst die Winde zum Erliegen zu kommen.
Mit ihren Rössern hatte der siebenköpfige Reitertross das Hochplateau erreicht, und mehr als einmal hatten sie während des Aufstiegs über die schmalen, sich windenden Pfade einen Absturz nur um Haaresbreite verhindern können.
Nachdem sie in Marseille an Bord gegangen und losgesegelt waren, hatten sie nach Wochen schließlich die Gestade dieses namenlosen Eilands erreicht, waren vor Anker gegangen und drei Tagesritte später hier angelangt … wo sie nun auf denkbar tückische Weise attackiert wurden.
Ihr Gegner war im Besitz eines der magischen Kleinode, die zu entschärfen der Orden einst gegründet worden war. Und bis zum Erreichen des hochgelegenen Plateaus hatte keiner der Beteiligten ernsthaft in Erwägung gezogen, dass ihre Mission scheitern könnte. Bei früheren Einsätzen hatte der Orden – damals noch mangels einschlägiger Erfahrung – Niederlagen gegen das gestaltgewordene Böse hinnehmen müssen, teils, weil man sich zu siegessicher geglaubt und deshalb zu geringen Aufwand betrieben hatte.
Aber bei ihrem Vorstoß in die Weiße Finsternis war für Hochmut kein Platz gewesen. Sie hatten sich bemüht, sich auf alle Unwägbarkeiten einzustellen, den Gegner nicht zu unterschätzen.
Und doch wurden sie kalt erwischt.
Regelrecht überrumpelt.
Denn dem Vogelriesen aus taudicken Strichen, dessen Kralle Thibaut soeben aufgespießt hatte, wohnte etwas inne, das nicht vorhersehbar gewesen war. Für niemanden. Ein Zauber, der sich grundlegend von dem Kraftstrom unterschied, der den eigenen Sternen innewohnte und von ihnen entfesselt werden konnte.
Und eben diese Fremdheit war es, die Thibaut zum Verhängnis geworden war und deren lähmende Aura Kelan selbst auf die Distanz zu erspüren vermochte, Sie hing der Kreatur an, die gegen sie ins Feld zog.
In dem Moment, als Thibauts Augen erloschen, endete auch die scheinbare Erstarrung, von der das Geschehen befallen worden schien. Und das Strichungeheuer machte ungehemmt damit weiter, womit es ohnehin nur scheinbar aufgehört hatte. Seine Blutgier war noch lange nicht gestillt.
Ohne den aufgespießten Leichnam abzuschütteln, setzte es seinen Weg fort und hackte als Nächstes mit dem übergroßen Schnabel auf einen der Ritter ein, die nicht weichen wollten, natürlich nicht – auf Ives.
Hilflos sah Kelan mit an, wie die Schnabelspitze nicht nur den Helm des Ritters spaltete, sondern auch den Schädel darunter. Gräuliche Flüssigkeit, gemischt mit Blut, spritzte nach allen Seiten, und das Letzte, was Ives Lippen verließ, war ein Gurgeln, als rinne ihm das eigene Blut die Kehle hinab.
Als das Ungetüm den Schnabel zurückzog, fiel der Ritter seines Halts beraubt in den Staub, wo er noch eine kurze Weile zuckte und zitterte, als weigere das Leben sich, seinen Körper zu verlassen, obwohl sein Gehirn sich in Brei verwandelt hatte.
Mehr noch als es der Bestie heimzuzahlen, verspürte Kelan den unbändigen Wunsch zu dem Gefährten zu eilen und ihm mit dem eigenen Schwert den Gnadenstoß zu versetzen, damit er von den Qualen, die er litt, erlöst würde. Aber daran war nicht zu denken. Weil der Vogelriese weiter wütete. Weiter auf diese brachial-bizarre Art und Weise tötete, der die Ritter nichts entgegenzusetzen hatten.
WARUM NICHT?!
Nicht einmal an dem Tag, an dem die Reiter in sein Dorf gekommen waren und er als Junge von acht Jahren mit anhören musste, dass sein geliebter Vater, der ehrenwerte Guillaume, im Kampf gefallen war, hatte er sich hilfloser als jetzt gefühlt.
Weil er es nicht verstand.
Seine Getreuen und er waren keine wehrlosen Figuren auf einem Spielbrett; ein jeder von ihnen trug ein Artefakt solcher Stärke bei sich, dass das, was gerade geschah, über das Grauen hinaus, das es schürte, auch absolut widersinnig und unbegreiflich war.
Und das war es, was ihn fast um den Verstand brachte. Der Tod als solcher schreckte ihn nicht, solange damit ein Quäntchen Nutzen für die, die zurückblieben, verbunden war. Aber dieses sinnlose Abschlachten, das ihnen allen hier in der Fremde nicht nur drohte, sondern soeben widerfuhr, brachte ihn in einem Maße aus der Fassung, dass er nur einen Bruchteil seiner Fähigkeiten abrufen konnte.
Und auch wenn er ahnte, dass genau das mit dem Auftauchen der Vogelbestie bezweckt wurde, konnte er es nicht in der Weise für sich umsetzen, dass ihm ein Ausweg aus der Misere eingefallen wäre.
Der nächste Kamerad und Kampfgefährte fiel. Diesmal war es Raphaël, ein weiterer der Ritter, die Thibaut auf so vielen Missionen begleitet und Siege mit ihm errungen hatten.
Aber die Verdienste von einst zählten nicht angesichts dieses Albtraums, der sie fast beiläufig ihrer Kräfte und Möglichkeiten beraubte, sodass sie hingemetzelt wurden, ohne sich wirklich zur Wehr setzen zu können!
Was – geht – hier – vor sich?!?
Noch war Kelan selbst von der Bestie unbehelligt geblieben, aber deren Bewegungen ließen vermuten, dass sich dies ändern würde …
… und schon kam der Schnabel, der bereits Ives zum Verhängnis geworden war, wie von einem Katapult abgefeuert auf den Jungritter zugerast. Er wollte ausweichen, sich seitwärts auf den Boden werfen, aber er stand nur wie angewurzelt da, als sehne er sich insgeheim nach dem Todesstoß, als hieße er ihn im Grunde seines Herzens willkommen.
Doch statt aufgespießt zu werden wie die Ritter vor ihm, fühlte er sich aus seinem Körper herausgerissen, herausgedroschen, sodass er das Schlachtfeld plötzlich aus luftiger Höhe betrachtete; gerade so, als wäre er selbst zu einem Vogel geworden, wenn auch nicht zu einem solch monströsen wie der, der sie so kalt erwischt hatte.
Kelan schien über dem Geschehen zu kreisen und es mit einer Schärfe zu überblicken, wie sie seine menschliche Sehschärfe um ein Vielfaches übertraf!
Was passierte mit ihm? Hatte er bereits den Todesstoß einer Kralle oder des Schnabels empfangen und war dies nun Teil jenes unwiderruflichen Sterbeprozesses, von dem noch niemand wiedergekehrt wäre, um zu berichten, was genau dabei passierte?
Herr, erbarme dich meiner! Er sandte ein Stoßgebet zum Himmel, in dem er sich … bereits befand? In den er zumindest unterwegs war, um gleich seinem Schöpfer gegenüberzutreten, wie die Prediger es verhießen?
Er suchte dort unten in der Landschaft nach sich, erwartete, sich gefallen am Boden liegen zu sehen, die Augen gebrochen dorthin gerichtet, wo etwas von ihm sich nun befand, vielleicht noch kurz ausharrend, weil der Abschied von der Hülle, die ihm so lange als Gefäß für Geist und Seele gedient hatte, allzu schwerfiel, allzu schmerzlich war und er ihn auch jetzt noch nicht wahrhaben wollte …
Was er tatsächlich sah und fand, stellte seinen Verstand auf die nächste harte Probe: Dort unten stand er aufrecht in genau der Haltung, an die er sich erinnerte; in dem Moment, da er den Schwerstreich gegen das Ungetüm geführt hatte, das …
… wo war?
Er verstand nicht, warum sich die Fläche unter ihm leergefegt präsentierte, jedenfalls, was die Monstrosität anging, von der sie attackiert worden waren.
Und er verstand noch weniger, dass neben ihm, der dort statuenhaft verharrte, sechs andere Gestalten – jede einzelne unverwechselbar, unverkennbar – Scheingefechte gegen Gegner führten, die nicht existierten.
Was ihn jedoch ebenso in Erstaunen versetzte, das waren die monströsen Zeichnungen, die sich unter ihm erstreckten und in den Boden eingemeißelt schienen. Sie waren nur aus der Luft als solche zu erkennen und …
Er hatte keine Muße, sich weitere Gedanken über sie machen, zu sehr zog ihn das Kampfgeschehen in den Bann.
Wobei …
… von Kampf keine Rede mehr sein konnte.
Wild entschlossen durchschnitten die Klingen von Ives, Mathis, Raphaël, Louis, Adrien und Thibaut die Luft und nichts anderes, während die silbernen Scheiben vor ihrer Brust in einem so abseitigen Lichte glommen, wie Kelan es noch nie erlebt hatte. Aber auch ihn selbst tauchte sein Amulett in solch düsterem Glanz, dass jede Kerbe, jede Pore seines Gesichts überdeutlich hervortrat.
Er verstand nicht, was hier vor sich ging.





























