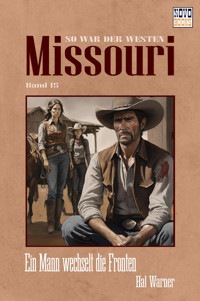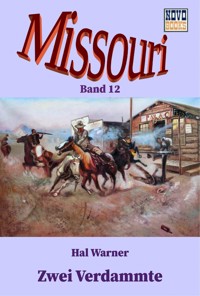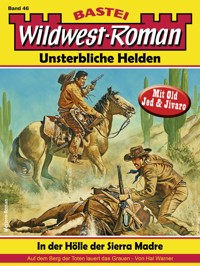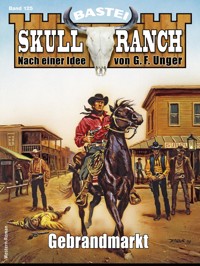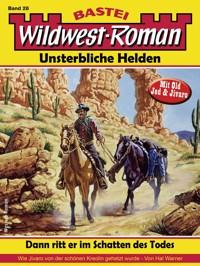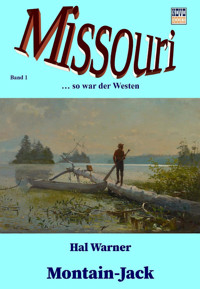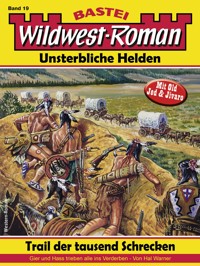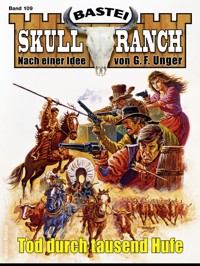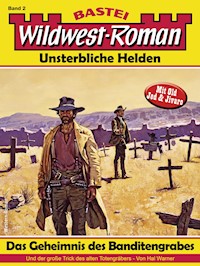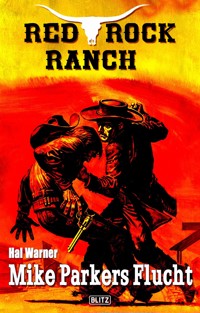
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Red Rock Ranch
- Sprache: Deutsch
Mike Parkers Flucht Sein Name ist Mike Parker. Ein Mann ohne dunkle Vergangenheit, wie es scheint. Die Menschen schätzen seine Hilfsbereitschaft. Doch Parker trägt ein dunkles Geheimnis mit sich. Als US-Marshal Clay Taylor einen flüchtigen Postkutschenräuber sucht, begegnet er Mike Parker. Vieles deutet darauf hin, dass Parker der Gesuchte ist, doch der entzieht sich der Verhaftung. Clay nimmt die Verfolgung auf. Unter falschem Verdacht Big John Taylor, sein Sohn Billy und zwei Cowboys der Red Rock Ranch werden verdächtigt, einen Überfall begangen zu haben. Ein übereifriger Hilfsmarshal aus Lordsburg sperrt sie ein und will sie hängen sehen, denn es hat Tote bei dem Überfall gegeben. Die Bewohner werden aufgehetzt. Die Lage der Gefangenen spitzt sich zu.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
IN DIESER REIHE BISHER ERSCHIENEN
MIKE PARKERS FLUCHT
RED ROCK RANCH
BUCH 4
HAL WARNER
Dieses Buch gehört zu unseren exklusiven Sammler-Editionen
und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.
In unserem Shop ist dieser Roman auch als E-Book lieferbar.
Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt. Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.
Copyright © 2022 Blitz Verlag, eine Marke der Silberscore Beteiligungs GmbH, Mühlsteig 10, A-6633 Biberwier
Redaktion: Alfred Wallon
Titelbild: Mario Heyer
Umschlaggestaltung: Mario Heyer
Vignette: iStock.com/iatsun
Satz: Gero Reimer
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 978-3-95719-342-1
4604
INHALT
Mike Parkers Flucht
Unter falschem Verdacht
Anmerkung
Hal Warner
Mike Parkers Flucht
Der bullige Mann mit den tiefliegenden Augen hielt seinen Braunen so jäh zurück, dass das Pferd seines Begleiters gegen ihn prallte.
„Was ist?“, fragte der nachkommende Reiter ungehalten.
„Sieh dort hinüber, Muff!“ Der Bullige wies mit der ausgestreckten Hand zu einer größeren Waldinsel, die etwa hundert Yards von der Poststraße lag.
Der bärtige Muff wandte den Kopf und blickte in die angegebene Richtung. Sofort stach ihm etwas Rotes in die Augen. Es war der lange Rock einer Frau, die mit zwei kleinen Kindern nach Beeren suchte.
„Eine Mexikanerin“, sagte Muff grinsend.
„Richtig, Sonny. Von hier aus gesehen, sieht sie nicht übel aus. Was hältst du davon, wenn wir sie uns aus der Nähe betrachten?“
„Keine schlechte Idee, Mort.“
Die beiden Reiter trieben ihre Pferde von der Poststraße und ritten querfeldein auf den Waldstreifen zu.
Noch hatten sie nicht die Hälfte des Weges zurück-gelegt, da wurde die Mexikanerin auf sie aufmerksam. Sie hörte den Hufschlag, fuhr herum und erblickte die Reiter. Instinktiv spürte sie, dass ihr von den beiden Gefahr drohte. Sie ließ den Korb mit den Beeren fallen, schaute sich nach ihren Kindern um und rief: „Anita! Pepito! Kommt zu mir! Schnell!“
Als die Kinder heran waren, nahm die Frau sie an der Hand und floh mit ihnen in den Wald. Es war die einzige Fluchtmöglichkeit, denn der Rückweg nach Tucson war durch die Reiter versperrt.
Doch auch der Wald bot keinen ausreichenden Schutz. Die Bäume standen zu weit auseinander, die Sicht reichte ziemlich weit. Außerdem kam die Frau mit den kleinen Kindern nur langsam voran.
Schon hörte sie dicht in ihrem Rücken das Stampfen von Pferdehufen. Die beiden Männer waren in den Wald eingedrungen und trieben ihre Tiere schonungslos durch das Unterholz.
„Da vorn ist sie!“, schrie der eine heiser. „Mehr nach links, Mort!“
Der Frau trat Angstschweiß auf die Stirn. Ohne sich zu besinnen, zog sie die Kinder hinter sich her in ein Brombeergestrüpp. Ihr weiter Rock verfing sich an den dornigen Ranken, doch sie riss sich los und hetzte weiter.
Der Hufschlag kam näher. Die Reiter erreichten bereits die Brombeersträucher und jagten ihre Pferde hinein. Krachend brachen die Büsche. Eines der Pferde schnaubte.
Die Frau wusste, dass es kein Entkommen gab. Die dreijährige Anita stolperte jetzt, zerkratzte sich die Knie und begann zu brüllen. Auch der Junge weinte. Da tauchte eine kleine Lichtung auf. Dahinter kamen wieder Bäume. Aber es war zwecklos, die Flucht fortzusetzen. Keuchend blieb die Frau stehen, legte ihre Arme schützend um die Kinder und starrte in das Gestrüpp, das sich raschelnd bewegte.
Schon brachen die beiden Reiter aus den Büschen. Sie grinsten höhnisch, als sie ihr Wild vor sich sahen, und zügelten die Pferde. Der Bärtige gab einen überraschten Pfiff von sich.
„Hübsch, wirklich hübsch“, sagte er. „Nach so etwas haben wir in Madisons Saloon vergeblich gesucht.“
„Ich habe sie zuerst gesehen“, brummte der bullige Mort. Er schwang sich aus dem Sattel, trat näher und betrachtete die schlanke, etwa fünfundzwanzig Jahre alte Mexikanerin mit einem triebhaften Grinsen.
„Na, Honey“, sagte er heiser. „Hast du denn wirklich geglaubt, dass du gegen uns einen Wettlauf gewinnen kannst?“
Die Frau schwieg. Sie wusste, was die Kerle von ihr wollten. Noch immer atemlos, blickte sie gehetzt um sich. Ihr hübsches Gesicht war unnatürlich bleich.
„Du sprichst wohl nicht mit jedem?“, fuhr der Bullige fort. Er blickte auf die weinenden Kinder, dann drehte er sich nach Muff um, der ebenfalls vom Pferd gestiegen war. „Die Bälger stören mich. Bring sie zur Seite und pass auf, dass sie nicht weglaufen!“
Der Bärtige näherte sich und streckte die Hände nach den Kindern aus.
„Rühr sie nicht an!“, zischte da die Mexikanerin mit funkelnden Augen.
Muff lachte nur und griff trotzdem nach den Kindern, die sich verzweifelt schreiend an ihre Mutter klammerten. Brutal riss er sie von ihr los. Die Frau wollte sich auf Muff stürzen, aber Mort hielt sie zurück.
„Nur nicht wild werden, kleine Katze!“, rief er grinsend. „Deinen Kleinen geschieht nichts.“
Nach diesen Worten riss er sie an sich. Sie roch seinen nach Schnaps stinkenden Atem und spürte -unbeschreiblichen Ekel. Krampfhaft drehte sie den Kopf zur Seite. Doch Mort fasste sie am Kinn und zwang sie, ihm das Gesicht zuzuwenden. Sein Zeigefinger war dicht an ihrem Mund, und sie biss in ihrer Verzweiflung zu.
Mort ließ mit einem wütenden Knurren los und stieß die Frau zurück. Sie prallte mit dem Rücken gegen einen Baumstamm. Langes, schwarzes Haar fiel über ihre Schulter. Mort packte sie daran und versetzte ihr mit der freien Rechten eine Ohrfeige.
„Verdammtes Biest!“, zischte er. „Versuch das nicht noch mal!“
Die Frau schrie auf. Auch die Kinder in den Brombeersträuchern schrien aus Leibeskräften. Erst als Pepito von Muff eine Ohrfeige bekam, verstummte er aus Angst vor weiteren Schlägen.
Mort hatte die Mexikanerin zu Boden geworfen. Sie schrie abermals gellend auf.
„Schrei nur“, sagte der Schurke höhnisch. „Hier hört dich ja doch niemand.“ Er schnallte seinen Waffengurt ab und warf ihn hinter sich. Dann packte er die Frau an der Schulter und wollte ihr die Bluse zerreißen.
„Halt!“, ertönte da eine scharfe Stimme. „Nimm die Pfoten von ihr, du Lump, oder ich jage dir eine Kugel in den Kopf!“
* * *
Morts Kopf ruckte herum. Betroffen starrte er auf den blonden Mann, der in seiner Nähe neben einem Baum stand und mit einem Gewehr auf ihn zielte. Sein Gesicht verzerrte sich vor Wut.
„Steh auf und nimm die Hände hoch!“, fuhr der Blonde fort.
Mort ließ die Mexikanerin los, blieb jedoch am Boden kauern und schielte nach seinem Revolvergurt.
„Greif lieber nicht danach!“, sagte der Blonde. „Ich brauche nur abzudrücken!“
„Wenn er schießt, bekommt er von mir eine Kugel!“, rief da Muff.
Der junge Mann blickte eine Sekunde lang zu den Sträuchern hinüber und gab so Mort eine Chance. Mit einer Schnelligkeit, die man dem bulligen Mann nie zugetraut hätte, hechtete er auf den Gurt zu, bekam ihn zu fassen und sprang hinter einen Wurzelstock.
„Wenn hier einer in den Himmel langt, bist du es!“, meldete sich in den Brombeersträuchern wieder Muff. „Und ich würde es bald tun! Oder soll ich dem Bengel hier die Kehle durchschneiden?“
„Der Mann hat meine Kinder in der Gewalt!“, rief die Mexikanerfrau. Sie hatte sich erhoben, zitterte aber am ganzen Körper.
Der entsetzte Schrei eines Knaben ließ den Blonden nicht daran zweifeln, dass Muff tatsächlich ein Messer gezogen hatte. Deshalb ließ er sein Gewehr fallen und hob beide Arme.
„So ist es recht“, meinte Mort, der sich nun hinter seiner Deckung aufrichtete. „Und nun rühr dich nicht!“
Der Bursche verharrte reglos. Er wusste, dass ihn auch der andere Mann im Visier hatte. Wütend über seine Unvorsichtigkeit, lauschte er den in seinem Rücken nahenden Schritten.
Plötzlich krachte etwas hart auf seinen Hinterkopf nieder. Er stieß ungewollt ein Ächzen aus und brach in die Knie. Feurige Kreise umnebelten seinen Blick, dann wurde jäh alles dunkel um ihn.
„Der ist für eine Weile versorgt“, knurrte Mort. Er wirbelte seinen Colt, mit dem er zugeschlagen hatte, um den Finger und schaute seinem Kumpan entgegen, der aus den Sträuchern kam und die Kinder vor sich her stieß.
„Da haben wir noch einmal Glück gehabt“, sagte Muff mit einem Blick auf den Bewusstlosen.
Der Bullige nickte. „Ja, das hatten wir. Der Kerl hätte uns eine Menge Ärger bringen können.“
„Was jetzt?“ Muff zeigte mit dem Kinn auf die Mexikanerin, deren Augen Funken zu sprühen schienen. Aber ihr Gesicht verriet auch Angst. Anita und Pepito waren zu ihr gelaufen und klammerten sich an ihr fest.
„Ach was“, brummte Mort. „Mir ist die Lust auf eine Abwechslung vergangen.“
„Dann weg von hier, ehe noch jemand vorbeikommt!“
Die beiden Schurken liefen zu ihren Pferden, sprangen in die Sättel und jagten davon, ohne sich noch einmal umzublicken.
* * *
Als der Blonde wieder zu sich kam, kniete die Frau neben ihm. Ihr Gesicht war besorgt.
„Tut mir leid“, ächzte er. „Ich ...“
„Mir ist nichts geschehen“, unterbrach ihn die Mexikanerin lächelnd. „Die Kerle sind fort. Und das verdanke ich Ihnen.“
Der Bursche wirkte erleichtert. Er setzte sich auf und betastete seinen schmerzenden Kopf. Als er die Finger zurückzog, waren sie voll Blut.
„Sie haben eine Platzwunde“, erklärte die Frau. „Tut mir leid, dass Ihnen meinetwegen so übel mitgespielt wurde.“
„Ach, so schlimm ist es doch nicht.“ Er versuchte jetzt ein Grinsen. „Hauptsache, ich bin im richtigen Augenblick gekommen. Mein Name ist übrigens Mike Parker.“
„Ich heiße Rosita Gomez. Das hier…“ Sie wies auf Anita und Pepito, die den fremden Mann neugierig anblickten. „Das sind meine Kinder. Los, sagt Mister Parker Guten Tag!“
Die Kinder grüßten artig, wenn auch ziemlich scheu.
„Wie alt bist du denn?“, fragte Mike Parker den Jungen.
„Sechs Jahre“, antwortete Pepito. Er sprach tadellos Englisch.
„Wir wohnen in der Stadt“, sagte Rosita Gomez. „Wenn Sie mitkommen, werde ich mich um Ihre Wunde kümmern, Mister Parker.“
Mike antwortete nicht, sondern erhob sich und ging, noch etwas benommen und unsicher zu der Stelle, wo die Pferde von Mort und Muff gestanden hatten. Forschend beugte er sich über die Spuren.
„Die beiden sind nach Norden geritten“, sagte die Frau. „Es waren Fremde. So schnell werden sie sich nun nicht mehr in diese Gegend wagen.“
„Diese Schufte!“, erwiderte Mike. „Schade, dass ich sie nicht überwältigen konnte. Weit können sie aber noch nicht gekommen sein.“
„Sie dürfen sie nicht verfolgen!“, rief Rosita Gomez. „Denken Sie an Ihre Wunde!“
Mike nickte. Er wusste selbst, dass er jetzt nicht in der Lage war, viel zu unternehmen. Er hatte gewaltige Kopfschmerzen, und jede schnelle Bewegung rief Übelkeit hervor.
„Vielleicht treffe ich die Halunken später mal irgendwo“, sagte er. „Dann zahle ich es ihnen zurück. Was Sie betrifft, sollten Sie nicht ohne Schutz in den Wald gehen.“
„Ich muss es tun“, entgegnete die junge Mexikanerin mit einem Anflug von Bitterkeit. „Im Wald wachsen Beeren und Pilze. Wir sind darauf angewiesen.“
„Haben Sie denn keinen Mann, der für euch sorgt?“
„Felipe ist vor zwei Jahren ums Leben gekommen. Bei einer Schießerei, an der er völlig unbeteiligt war. Seitdem sind wir allein.“
„Das tut mir leid. Entschuldigen Sie, dass ich danach gefragt habe.“
„Ich bin bereits darüber hinweggekommen. Meine Kinder brauchen mich. Ich habe nie viel Zeit, über das Vergangene nachzudenken.“ Die Witwe schien ihre Erinnerungen mit Gewalt fortzuwischen, denn plötzlich stahl sich wieder ein Lächeln in ihr hübsches Gesicht. „Kommen Sie nun mit oder nicht?“
Mike Parker nickte grinsend. „Ich muss nur mein Pferd holen. Es dauert nicht lange.“ Nach diesen Worten verschwand er im Wald.
Wenige Minuten später kam er zurück und führte jetzt eine Rappstute am Zügel. Das Tier trug einen Sattel, eine Packtasche und eine Deckenrolle.
„Ich hatte in der Nähe gelagert“, sagte Mike, während er sein Gewehr vom Boden aufhob und in den Sattelschuh steckte. „Von dem Platz aus habe ich Ihren Hilferuf gehört.“ Er lächelte der Mexikanerin zu und wandte sich dann an Pepito. „Willst du auf dem Pferd sitzen, Junge?“
Das Bürschchen strahlte. „Gern, Mister!“
Mike hob Pepito in den Sattel und trug ihm auf, sich gut festzuhalten. Dann nahm er die Stute am Zügel. Rosita Gomez griff nach der Hand von Anita, deren paus-bäckiges Gesicht mit Beerensaft verschmiert war.
„Gehen wir“, sagte sie. „Nach Tucson ist es nicht weit.“
* * *
Rosita Gomez’ Haus lag am Nordrand der Stadt. Es war wie die übrigen Mexikanerhäuser aus Adobe gebaut, unterschied sich jedoch deutlich durch seinen verwitterten Anstrich.
„Hier finden Sie Platz für Ihr Pferd“, sagte die Frau und wies auf den kleinen, teilweise schon eingestürzten Stall, der dem Haus angeschlossen war.
Mike Parker half Pepito aus dem Sattel und führte die Stute in den offenen Unterstand. Er sattelte sie ab, löste die Packtasche und zog das Gewehr aus dem Scabbard. Dann folgte er der Witwe in das Haus.
Das Innere des Gebäudes war sauber, aber unsagbar ärmlich. Primitive Möbel, schmucklose Wände, nicht die geringste Annehmlichkeit. Offenbar mangelte es hier an allem.
„Ich habe viel verkaufen müssen“, sagte die Frau, die Mikes Blick zu deuten verstand, wie entschuldigend. „Zuerst unseren Maulesel, dann alles andere, was wir entbehren konnten.“
„Und wovon leben Sie jetzt?“
Rosita zuckte die Schultern. „Hin und wieder unterstützen uns Nachbarn. Aber die haben auch nicht viel.“
„Dann werde ich Ihnen helfen.“ Mike stellte sein Gepäck zu Boden, griff unter das Hemd und holte einen Geldbeutel hervor, dem er eine Banknote entnahm. „Hier“, sagte er grinsend. „Kaufen Sie dafür Lebens-mittel ein.“
„Das sind ja zehn Dollar“, erwiderte die Frau. „Nein, Mister Parker, das kann ich nicht.
„Und ob!“, unterbrach sie Mike. „Sie haben mir doch versprochen, meine Wunde zu behandeln.“
„Schon, aber ...“
„Kein Aber, Mrs. Gomez. Wenn ich mich von einem Arzt behandeln lasse, kostet mich das auch Geld. Sie aber haben es nötiger. Also nehmen Sie!“
Die Frau griff zögernd nach dem Geldschein und betrachtete ihn von beiden Seiten. Dann sagte sie beschämt: „Vielen Dank, Mister! Wir sind wirklich in Not. Pepito wird in den Store laufen. Ich werde ihm aufschreiben, was wir brauchen.“
Sie stellte rasch eine Liste zusammen und gab sie Pepito. Der Junge steckte die Zehn-Dollar-Note sorgfältig wie einen Schatz in die Tasche seiner mit vielen Flicken besetzten Hose, dann lief er mit der Liste in der Hand aus dem Haus.
Mike hatte sich auf einen Stuhl gesetzt. Rosita ging in einen Nebenraum und kam mit einer kleinen Flasche zurück, in der sich ein dunkler Inhalt befand.
„Das ist Schnaps aus Heilkräutern“, sagte sie. „Trinken Sie die Hälfte. Den Rest werde ich zum Reinigen Ihrer Wunde verwenden.“
Mike nahm gehorsam einen kräftigen Schluck und reichte die Flasche zurück. Anschließend untersuchte die Mexikanerin seine Wunde. Es war ein fingerlanger Riss, der heftig geblutet hatte.
Mikes strohblonde Haare waren mit dem geronnenen Blut verkrustet. Rosita nahm kurz entschlossen eine Schere zur Hand und schnitt ihm ein paar Haarsträhnen ab. Dann griff sie nach der Flasche mit dem selbstgebrauten Kräuterschnaps.
„Jetzt wird es brennen“, meinte sie.
Mike verbiss den Schmerz und hielt still.
Als schließlich ein sauberes Tuch als Verband um seinen Kopf lag, kam Pepito zurück. Er hatte nichts bei sich als die Liste. Sein schmales Jungengesicht wirkte traurig und enttäuscht.
„Wo sind die Lebensmittel? Hast du etwa das Geld verloren?“, rief seine Mutter bestürzt.
„Mister Madison hat es mir abgenommen“, berichtete Pepito mit weinerlicher Stimme. „Er hat gesagt, wir hätten jetzt noch immer acht Dollar Schulden. Bevor die nicht bezahlt sind, bekommen wir nichts.“
„Dieser Unmensch!“, rief Rosita Gomez. Sie war den Tränen nahe.
Mike Parker aber lachte. „Nehmen Sie die Geschichte doch nicht tragisch. Pepito wird eben noch einmal in den Store laufen. Mit neuem Geld.“ Er sagte es, zog abermals seinen Geldbeutel hervor und entnahm ihm diesmal zwei grüne Zehn-Dollar-Scheine. „Hier, Mrs. Gomez. Das reicht für die Schulden und für die Dinge, die Sie auf die Liste geschrieben haben.“
„Das kann ich nicht annehmen“, entgegnete Rosita errötend.
„Doch! Tun Sie es ruhig. Ich habe genug Geld.“
Rosita blickte auf die Banknoten, die ihr Mike auffordernd entgegenhielt, und dann in sein freundlich lächelndes Gesicht. „Wie kommen Sie dazu, uns so großzügig zu helfen?“
„Fragen Sie nicht! Nehmen Sie das Geld!“ Er lachte so unbeschwert, dass Rosita nicht im Entferntesten daran dachte, Mike Parker könnte irgendwelche Hinter-gedanken haben.
„Ich werde Ihnen das Geld nie zurückzahlen können“, sagte sie.
„Das lassen Sie ruhig meine Sorge sein. Es ist mir eine Freude, Ihnen helfen zu können. Ihre Kinder sollen nicht hungern, nur weil ein geiziger Storebesitzer kein Herz für Notleidende hat.“
Da nahm die junge Frau die Geldscheine an sich.
* * *
Über Tucson spannte sich der Himmel wie ein mit Brillan-ten übersätes Tuch. Die Hitze des Tages war verflogen, doch die Luft war immer noch schwül. Die Mauern der flachen Adobebauten speicherten die Wärme und gaben sie erst im Laufe der Nacht wieder ab.
In vielen Häusern brannte noch Licht. Trüber Schein fiel auf die breite Mainstreet, die Clay Taylor entlang schritt. Der junge Marshal machte, wenn er sich in der Stadt befand, um diese Zeit stets einen Rundgang. Meistens war es sein letzter, es sei denn, es waren gerade fremde Reiter hier, die Grund zu der Befürchtung gaben, dass es zu Zwischenfällen kommen könnte.
Heute war alles friedlich. Das Tingeln einer Mandoline unterstrich noch diesen Eindruck. Ein Mexikaner spielte auf ihr und sang dazu ein schwermütiges Lied. Zwischendurch waren aus einem Stall die Schreie eines Maulesels zu hören.
Es waren Geräusche, die zu dieser Stadt passten.
Clay Taylor blieb hin und wieder stehen, spähte wachsam in dunkle Hofeinfahrten und bewegte sich weiter. Als er am Office von Wells Fargo vorüberkam, wurde er angerufen.
„Hallo, Marshal! Haben Sie ein paar Minuten Zeit?“
Der breitschultrige Marshal drehte den Kopf und sah Bill Shaddle in der erhellten Tür stehen.
„Hallo, Bill!“, gab er zurück. „Was gibt’s?“
„Interessante Sache“, antwortete der schlaksige Wells Fargo-Agent in seiner schnoddrigen Sprechweise. „Kommen Sie ’rein!“
Clay folgte Shaddle in das Büro, in dem hinter verhangenen Fenstern eine Kerosinlampe brannte. Auf einem grün gestrichenen Tisch lagen Postsäcke, viele Briefe und gebündeltes Geld. Shaddle griff nach drei Scheinen, die lose obenauf lagen, und sagte:
„Hab’ eben ’ne tolle Entdeckung gemacht, Marshal. Sehen Sie sich diese Scheine an! Sie stammen aus der Beute von dem Überfall, den so ’n Kerl vor ein paar Wochen auf eine Postkutsche verübt hat!“
„Was Sie nicht sagen! Sie meinen die Sache, die in der Nähe von Phoenix passiert ist?“
„Genau! Es waren fast dreitausend Dollar, die dem Halunken in die Hände gefallen sind.“
Clay Taylor nahm dem Agenten die Banknoten aus der Hand und hielt sie gegen das Licht. Es waren -gewöhnliche Zehn-Dollar-Scheine, die keinerlei Kennzeichen aufwiesen.
„Wie haben Sie herausbekommen, dass dieses Geld aus dem Postraub stammt?“, fragte Clay, wieder an Bill Shaddle gewandt, der erregt an seinen Ärmelschonern zupfte.
„Durch diese Liste.“ Shaddle zeigte dem Marshal ein Blatt Papier, auf dem mehrere Zahlenkolonnen standen. „Unsere Gesellschaft macht sich Sorgen, seit es immer wieder zu Überfällen kommt. Zuerst war westlich von Flagstaff die Geschichte mit dem ausgeraubten Expressreiter, dann wurde in der Gegend von Prescott eine Kutsche ausgeplündert. Deshalb bekamen wir den Auftrag, vor jeder Geldsendung die Nummern aller großen Scheine zu notieren. Nachdem der Räuber abermals zugeschlagen hatte, hat mir der Agent in Phoenix von seiner Liste eine Abschrift geschickt, damit ich alle Geldscheine überprüfe, die in meine Hände gelangen. Das habe ich auch vorhin getan, als ich die Post fertiggemacht habe, die morgen abgehen soll. Dabei sind mir diese Zehner aufgefallen. Hier, Marshal, überzeugen Sie sich selbst! Die Nummern auf den Geldscheinen stimmen mit denen auf der Liste überein!“
Clay sah, dass Shaddle drei der mehrstelligen Zahlen auf der Liste rot angekreuzt hatte. Er verglich sie mit denen, die auf die Banknoten gedruckt waren.
„Tatsächlich!“, sagte er. „Von wem haben Sie das Geld?“
„Von Ed Madison. Er hat es gegen Abend zu mir gebracht, damit es seinem Lieferanten in Phoenix geschickt wird.“
Clay Taylor nagte auf der Lippe. „Teufel“, sagte er dann, „es wäre möglich, dass der Posträuber in der Stadt war oder vielleicht sogar noch hier ist. Und wenn schon nicht er selbst, dann auf alle Fälle der Mann, dem er die Zehner gegeben hat. Er wird sich hoffentlich an den Kerl erinnern und mir eine brauchbare Beschreibung geben können.“
„Dieser Posträuber muss ein ganz abgebrühter Schuft sein“, meinte Bill Shaddle. „Im Alleingang sogar Kutschen zu überfallen, ist doch wirklich ein starkes Stück.“
Der Marshal nickte. „Kann ich die drei Scheine mitnehmen, Bill?“
„Selbstverständlich. Ich hoffe, dass sie Ihnen bei Ihren Nachforschungen behilflich sein werden.“
Clay schob die Geldscheine in die Tasche, verabschiedete sich und ging zur Tür. An der Schwelle drehte er sich noch einmal um und sagte ernst: „Vielleicht ist der Räuber wirklich in der Stadt. Er könnte sich für Ihr Office interessieren. Schließen Sie also die Tür ab und lassen Sie niemand ’rein, den Sie nicht kennen.“
„Werde ich machen“, versprach der Agent.
* * *
Clay Taylor trat in die Nacht hinaus. Ein Windstoß fegte durch die Straße, ohne Kühlung zu bringen. Er wirbelte nur den Staub auf. Clay kniff die Augen zusammen und ging zu Ed Madisons General Store. Was er in Erfahrung gebracht hatte, erschien ihm so wichtig, dass er Madison trotz der späten Stunde noch einen Besuch abstatten wollte.
Im Store war noch Licht. Clay spähte durch das offene Fenster und sah Madison emsig in den Regalen hantieren. Die Glatze des untersetzten Mannes spiegelte im Schein einer rußenden Lampe.
„Madison!“, rief Clay.
Der Ladenbesitzer fuhr herum und starrte zum Fenster. „Wer ist da?“, fragte er forschend.
„Das Auge des Gesetzes“, antwortete Clay und lachte.
„Ach, du bist es!“ Madison kam mit der Lampe in der Hand näher und leuchtete auf den Marshal, dessen Abzeichen an der Brust zu funkeln begann. „Brauchst du Tabak, Clay?“
„Nein, heute kannst du mit mir kein Geschäft mehr machen. Ich muss dringend mit dir reden.“
„So, bei der Arbeit willst du mich aufhalten? Na, wenn es schon sein muss ...“ Madison verschwand vom Fenster und entfernte den Balken, der innen vor der Tür lag. Dann öffnete er und brummte: „Los, komm ’rein!“ Clay Taylor betrat den nach allem möglichen riechenden Ladenraum. Er wartete, bis die Tür wieder geschlossen war, dann holte er die verdächtigen Banknoten aus der Tasche.
„Die hat mir eben Bill Shaddle gegeben“, erklärte er. „Shaddle hat den Beweis, dass dieses Geld zur Beute vom letzten Postraub gehört.“
Madison starrte Clay über seinen Kneifer hinweg forschend an. „Warum erzählst du das ausgerechnet mir?“
„Weil Shaddle die Scheine von dir hat.“
„Was? Zum Teufel, du glaubst doch nicht, dass ...“
„Du brauchst nicht zu erschrecken“, unterbrach Clay grinsend. „Dich halte ich ja nicht für den Räuber.“
„Wäre ja noch schöner!“ Ed Madison schnaufte heftig, dann fragte er besorgt: „Willst du die dreißig Dollar zu meinem Nachteil beschlagnahmen?“
„Zu deiner Beruhigung: Nein. Aber du sollst mir sagen, wer bei dir in letzter Zeit mit Zehnern bezahlt hat.“ Der Storebesitzer dachte nach und antwortete schließlich: „Da es sich gleich um drei solche Scheine handelt, kann es nur Rosita Gomez gewesen sein.“
„Die Witwe mit den kleinen Kindern? Woher soll die dreißig Dollar haben? Die ganze Stadt weiß, dass Geld bei ihr so rar ist wie die Wasserlöcher in der Wüste.“
„Seit heute hat sie aber welches. Sie hat zuerst ihren Jungen mit einem Schein geschickt, kurz darauf kam sie selbst mit den zwei anderen.“
„Seltsam“, murmelte Clay. „Hoffentlich ist die Frau in keine schlimme Sache verwickelt. Ich werde morgen gleich zu ihr gehen und sie ausfragen.“
* * *
Als Mike Parker erwachte, war es bereits hell. Der lange Schlaf hatte ihm gutgetan. Er war bei frischen Kräften und spürte auch keine Kopfschmerzen mehr. Gähnend richtete er sich im Bett auf und blickte sich in der kleinen Kammer des Adobehauses um.
Durch das schadhafte Dach fielen dünne Lichtbahnen herein. Die Farbe an den Wänden blätterte ab. Auch das Fenster und die Tür waren in einem schlechten Zustand. Hier hätte schon längst jemand Hand anlegen müssen.
Nebenan hörte Mike die Stimmen der Kinder. Sie liefen herum und fragten ihre Mutter nach dem fremden, freundlichen Onkel. Mike lächelte. Er schwang sich über die Bettkante, ging zum Waschtisch in der Ecke und füllte die Schüssel mit Wasser aus dem Krug. Im Spiegel an der Wand sah er sein jugendliches Gesicht. Es wirkte offen und gutmütig. Die blauen Augen besaßen einen träumerischen Ausdruck. Mike wusch sich und schabte den spärlichen Bart von den Wangen. Dann kleidete er sich an und ging in die Küche.
„Morning!“, sagte er grinsend. „Wie ich sehe, bin ich als Letzter aus den Federn gekrochen.“
Rosita Gomez wandte ihm lächelnd das vom Herdfeuer gerötete Gesicht zu. „Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen, Mister Parker.“
„Sogar ausgezeichnet. Ein Bett ist eben doch etwas anderes als ein hartes Lager unter freiem Himmel.“
„Setzen Sie sich! Ihr Frühstück ist gleich fertig.“
„Ich will nur nach meinem Pferd sehen.“
„Das habe ich schon versorgt. Das heißt, Pepito hat ihm Futter gegeben.“
„Vielen Dank, Pepito! Als Belohnung darfst du heute wieder reiten.“ Mike nickte dem erfreut grinsenden Jungen freundlich zu und setzte sich an den Tisch.
Wenig später stellte Rosita das Frühstück vor ihn hin. Sie kam ihm dabei so nahe, dass er den zarten Duft ihres Körpers verspürte. Wie hübsch sie eigentlich ist, dachte er. Waren die Männer in Tucson denn blind?
„Mehr Zucker?“, fragte jetzt Rosita zum zweiten Mal.
Mike fuhr hoch und blickte die junge Witwe errötend an. „Nein, danke.“
Sie wünschte ihm Guten Appetit und entfernte sich zum Herd. Als er gegessen hatte, kam sie wieder zum Tisch und räumte das Geschirr ab.
„Wann wollen Sie weiter?“, fragte sie dabei.
„Hm, eigentlich habe ich es gar nicht eilig“, antwortete Mike. „Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gern noch ein paar Tage bleiben. Selbstverständlich würde ich mich dafür nützlich machen.“
„Ist das Ihr Ernst?“
„Ich würde es sonst nicht sagen.“
Die Mexikanerin wirkte erfreut. „Sie können bleiben, so lange Sie wollen. Die Kammer steht zu Ihrer Verfügung. Aber Sie werden sicher etwas Besseres gewohnt sein.“
„Sagen Sie das nicht. Mir ist es lange Zeit verdammt dreckig gegangen. Der Kaffee war übrigens ausgezeichnet.“
„Gracias!“, entgegnete sie lächelnd. Sie schaute ihm zu, wie er sich eine Zigarette anzündete und wartete, bis er wieder zu sprechen begann.
„Dass hier nicht alles so ist, wie es sein sollte, ist nicht Ihre Schuld“, sagte er. „Aber das Haus wird bald anders aussehen. Ich werde zuerst das Dach in Angriff nehmen, dann ...“
Ein Klopfen an der Tür ließ Mike Parker verstummen. Er wechselte einen kurzen Blick mit Rosita, die daraufhin eine Aufforderung zum Eintreten rief.
Clay Taylor betrat das Haus. Er tippte an seinen Hut und grüßte höflich.
„Guten Morgen, Marshal!“, sagte die Witwe erstaunt. „Was führt Sie zu mir?“
„Ich muss Ihnen eine Frage stellen.“ Clay unterzog den Fremden, der am Küchentisch saß und die kleine Anita auf den Knien schaukelte, einem prüfenden Blick, dann schaute er wieder die Frau an. „Woher haben Sie das Geld, mit dem Sie gestern bei Madison eingekauft haben?“
„Das habe ich ihr gegeben“, sagte Mike, ehe Rosita antworten konnte, grinsend.
„Und woher haben Sie es?“ Clays Blick war sehr streng und forschend geworden.
„Ich habe es beim Pokern gewonnen.“
„Hier in Tucson?“
„Ach wo. Es war in Phoenix. Wird jetzt drei Wochen her sein. Warum, ist etwas nicht in Ordnung mit dem Geld?“
„Es stammt aus einem Postraub!“ Rosita Gomez erschrak über diese Mitteilung ein wenig. Mike Parker aber zeigte sich lediglich überrascht.
„Was Sie nicht sagen!“, entfuhr es ihm. „Hoffentlich bringen Sie mich damit nicht in Verbindung.“
Clay musterte mit ernster Miene den Burschen, der ihn harmlos anblickte. Er musste zugeben, dass ihm Mike Parker sehr gut gefiel. Nein, so sah kein Post-räuber aus.
„Ich muss allen Spuren nachgehen, die mich zu dem Täter führen könnten“, erwiderte Clay. „Ich bitte Sie daher, mir ehrlich auf alle Fragen zu antworten.“
„Dagegen habe ich nichts, Marshal. Was also wollen Sie wissen?“
„Zunächst einmal, ob Sie noch mehr Geldscheine besitzen, die bei dem Überfall erbeutet worden sind.“
Mike zeigte Clay Taylor bereitwillig seinen Geld-beutel. Darin befanden sich mehrere Fünf-Dollar-Noten und ziemlich viel Kleingeld.
„Das ist alles, was ich habe, Marshal.“
„Wie sah der Mann aus, von dem Sie das Geld gewonnen haben?“
„War ein ziemlich verwegener Kerl. Groß, dunkel, etwa dreißig Jahre alt.“
„Keine besonderen Kennzeichen?“
„Möglicherweise hat er am Kinn eine Narbe. So genau habe ich das wegen seiner langen Bartstoppeln nicht gesehen. Aber ich dachte mir gleich, dass mit dem Kerl nicht alles stimmt. Ich habe nur mit ihm gepokert, weil er geprahlt hat, dass ihn niemand schlagen kann.“
„Haben Sie eine Ahnung, wo er sich jetzt aufhalten könnte?“
„Leider nein. Ich habe ihn nach dem Spiel aus den Augen verloren.“
Clay war enttäuscht. Die heiße Spur, in die er alle Hoffnungen gesetzt hatte, taugte also doch nichts. Er bedankte sich für die Auskunft und verließ nach kurzem Gruß das Haus.
* * *
Mike blieb bei der Witwe und half ihr nach Kräften. Bald war das Haus nicht wiederzuerkennen. Alles war ausgebessert und mit einem frischen Anstrich versehen. Außerdem hatte Mike um das kleine Grundstück einen Zaun errichtet und den Stall vergrößert, so dass Rosita etwas Kleinvieh halten konnte, das von Mikes Geld angeschafft worden war. Von tristen Zuständen und von Not und Sorge konnte hier keine Rede mehr sein.
Die mexikanischen Nachbarn, die anfangs mit argwöhnischen Augen auf Rosita geblickt hatten, weil sie einen Fremden ins Haus nahm, wechselten rasch ihre Gesinnung. Sie sahen, was Mike für die Witwe tat und wie sie unter seinen Fittichen auflebte. Und sie merkten, dass er auch die Kinder gernhatte und für sie sorgte, als wenn es seine eigenen wären. Mike Parker war offenbar ein anständiger, äußerst arbeitsamer Bursche.
Da ihm alles so gut von der Hand ging, ersuchten ihn viele um seine Hilfe. Und Mike sagte nie nein. Er half hier einen Brunnen graben, baute dort einen Hühnerstall oder reparierte ein Scheunendach oder einen beschädigten Wagen. Er half stets in selbstloser Weise und hatte für jeden ein freundliches Wort. So wuchs seine Beliebtheit in Tucson von Tag zu Tag.
Pepito und die kleine Anita hatten ihm schnell ihre Zuneigung geschenkt. Besonders der Junge, dem Mike das Reiten beibrachte, betrachtete ihn längst als neuen Vater.
Einmal, als Pepito auf einen Baum geklettert war, kam er mit zerfetzter Hose nach Hause. Der Schaden war so groß, dass er nicht mehr behoben werden konnte.
„Es war seine einzige Hose“, stieß Rosita mit einem tiefen Seufzer hervor.
„Macht nichts“, sagte Mike grinsend. „Wir kaufen eine neue.“
Sie duzten sich jetzt. Rosita warf ihm oft einen zärtlichen Blick zu. Aber auch Mike fand Gefallen an der jungen, schlanken Frau, die nicht älter als er selbst war. Sie kamen sich näher.
Eines Abends, als sie zusammen einen Spaziergang in die nächste Umgebung der Stadt machten, küsste er sie zum ersten Mal. Sie erwiderte den Kuss so glutvoll und leidenschaftlich, wie es nur eine Mexikanerin vermochte.
„Ich habe nie geglaubt, dass das Leben wieder so schön sein kann“, sagte sie dann, ein wenig außer Atem geraten. „Ich liebe dich, Mike!“
„Ich liebe dich auch, Rosita! Du bist eine wunderbare Frau!“
Sie schaute ihn zärtlich an und schmiegte sich an ihn. „Das Schicksal hat dich mir in den Weg geführt, Mike. Wirst du für immer bei mir bleiben?“
„Ich verspreche es dir!“, antwortete Mike Parker feierlich. „Ich möchte dich heiraten, Rosita. Wann wollen wir unsere Verlobung feiern?“
„Am Sonnabend. Da werden die Mexikaner in Tucson eine Fiesta veranstalten. Du bist als Ehrengast eingeladen.“
Mike lächelte. „Ich freue mich auf das Fest, Rosita. Du sollst tanzen und fröhlich sein. Und du wirst das schönste Kleid tragen, das in der Stadt aufzutreiben ist.“
* * *
Der Samstag begann mit viel Trubel und Lärm. Schon am Morgen ertönte lautstarke Musik, das Knallen von Feuerwerkskörpern und das Lachen fröhlicher Menschen.
Clay Taylor wusste aus Erfahrung, dass es durch solche Fiestas nur selten Ärger gab. Die mexikanische Bevölkerung von Tucson wollte weiter nichts, als sich vergnügen und für ein paar Stunden den zumeist ziemlich eintönigen und armseligen Alltag vergessen. Deshalb blieb Clay am Vormittag in seinem Office. Er saß hinter dem Schreibtisch und musterte die Post, die mit der letzten Kutsche gekommen und von Bill Shaddle herübergebracht worden war.
Gleich obenauf lag ein Brief, der ihn mächtig interessierte. Als Absender war nämlich der Provostmarshal von Phoenix angegeben. Clay öffnete den versiegelten Umschlag und entnahm ihm ein Papier, das sich beim Auseinanderfalten als Steckbrief entpuppte.
„Posträuber gesucht!“, stand in fetten Lettern als Überschrift. Darunter war in Druckschrift zu lesen: