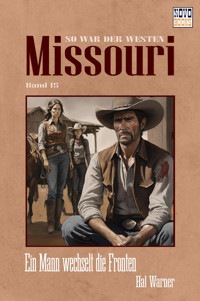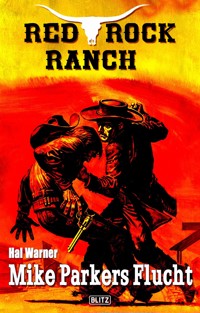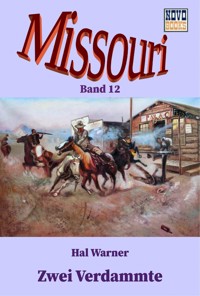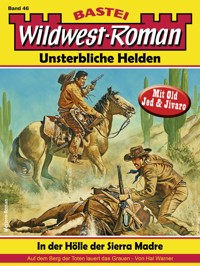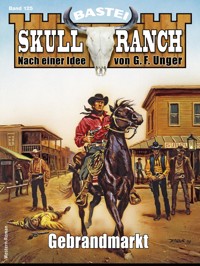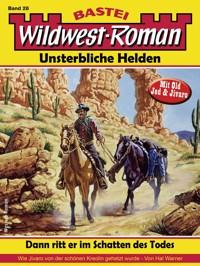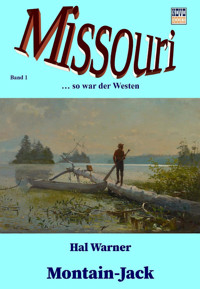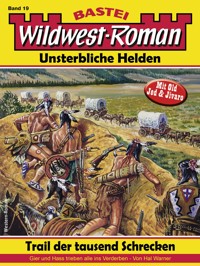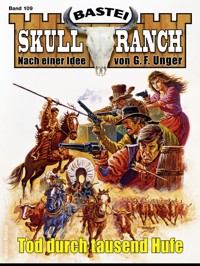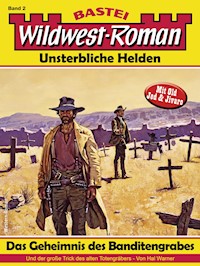1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Wildwest-Roman – Unsterbliche Helden
- Sprache: Deutsch
Mit hartem Pochen bohrte sich der gefiederte Pfeil in eine knorrige Kiefer. Jivaro und sein Gefährte Old Jed zügelten jäh die Pferde. Sie wussten, was der Pfeil bedeutete: Bis hierher und nicht weiter! Und wer die Aufforderung nicht befolgte, würde schon in wenigen Sekunden ein toter Mann sein. Aber Jivaro wollte den weiten Weg in die Apacheberge nicht umsonst geritten sein. Die Roten hatten die hübsche Santina geraubt, und er wollte die junge Frau aus ihren Klauen befreien. Dafür war er sogar bereit, für Santina durch die Hölle zu gehen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Für Santina durch die Hölle
Vorschau
Impressum
Für Santina durch die Hölle
Von Hal Warner
Mit hartem Pochen bohrte sich der gefiederte Pfeil in eine knorrige Kiefer.
Jivaro und sein Gefährte Old Jed zügelten jäh die Pferde.
Sie wussten, was der Pfeil bedeutete: BIS HIERHER UND NICHT WEITER!
Und wer die Aufforderung nicht befolgte, würde schon in wenigen Sekunden ein toter Mann sein.
Aber Jivaro wollte den weiten Weg in die Apachenberge nicht umsonst geritten sein. Die Roten hatten die hübsche Santina geraubt, und er wollte die junge Frau aus ihren Klauen befreien. Jivaro war daher bereit, für Santina durch die Hölle zu gehen ...
Der von vier staubbedeckten Maultieren gezogene Wagen wirkte verloren in der weiten Landschaft. Töpfe und Pfannen, mit denen das von Planen überspannte Gefährt behängt war, klapperten bei jeder Radumdrehung. Auf dem Bock saß Old Jed, der alte Totengräber.
Jivaro ritt auf seinem Cayuse-Hengst neben dem Wagen her. Der indianerhafte Mann hatte seinen Hut tief in die Stirn gezogen, damit seine Augen geschützt waren gegen die Strahlen der nach Westen wandernden Sonne. Nicht mehr lange, und der gleißende Feuerball würde die Spitzen der westwärts aufragenden Berge erreicht haben.
Es waren die Chiricahua Mountains. Rechts davon, ein Stück weiter entfernt, reckten sich die Dos Cabezas in den wolkenlosen Himmel.
Dazwischen verlief der gewundene, steinige Trail, der mit Schlaglöchern übersät war.
Es war der Weg zum Apachen-Pass.
Kein Mensch außer den beiden Freunden war an diesem Tag unterwegs. Das dachten sie jedenfalls schon die ganze Zeit. Niemand war ihnen in den langen, heißen Stunden begegnet, und es hatte sie bis jetzt auch kein Reiter überholt.
Die Gegend wurde nach Möglichkeit gemieden, seit die Chiricahua-Apachen wieder auf dem Kriegspfad waren.
Auch Jivaro und Old Jed war nicht besonders wohl in ihrer Haut. Das umso mehr, als sie den verwegenen Entschluss gefasst hatten, Häuptling Shacito und seinen Kriegern einen Besuch abzustatten.
Jetzt geriet der Wagen in eine Bodenrinne und stürzte fast um. Alles unter der Plane flog durcheinander. Jed Hawkins wurde fast vom Bock geschleudert. Fluchend hielt er sich am Sitzgeländer fest und zügelte dann die Mulis.
»Diese Fahrerei macht mich noch krank«, schimpfte er. »Verdammt, auf was hab ich mich da eingelassen?«
Jivaro zügelte sein Pferd und grinste. Er war ein sehniger Mann mit dunklen, fast schwarzen Haaren und einem markanten Gesicht, in dem nun die weißen Zähne blitzten.
»Nimm es mit Humor«, sagte er. »Wenn wir die Sache überleben, haben wir jeder tausend Bucks in der Tasche. Ich denke, wir legen eine kleine Rast ein.«
Die Maultiere hatten wirklich eine Pause nötig. Sie sahen müde aus und mussten schon den halben Nachmittag immer wieder angetrieben werden. Sollten sie bis zum Abend durchhalten, brauchten sie mehr Schonung.
»Und wenn wir die Sache nicht überleben, brauchen wir kein Geld mehr, meinst du?«, brummte Old Jed und spuckte durch eine Zahnlücke aus.
Er traf Anstalten, vom Bock zu steigen, wobei ihm sein um zwei Nummern zu großer Zylinder vom Kopf zu rutschen drohte. Am Boden angelangt, schob er das verbeulte Ding wieder zurecht und fuhr sich mit den Fingern der linken Hand durch den struppigen Graubart. Die schreiend rote Jacke hatte er der Hitze wegen aufgeknöpft, ebenso das buntgemusterte Hemd, das er darunter trug. Eine gelb und schwarz gestreifte Röhrenhose vervollständigte seine merkwürdige Kleidung.
»Wirklich komisch siehst du aus«, lachte Jivaro. Er war aus dem Sattel geglitten und musterte den Alten, der sich schnaufend gegen das linke Vorderrad lehnte.
»Ich weiß, ich weiß«, bekam Jivaro bestätigt. »Ich komme mir ja selbst wie eine Vogelscheuche vor. Aber wenn die Chiricahuas glauben sollen, dass ich ein Trader bin, muss ich mich eben in einem solchen Aufzug bewegen. Wie lange, schätzt du, werden wir bis zu Shacitos Apacheria jetzt noch brauchen?«
»Zwei Tage ungefähr. Am Pass werden wir ja schon morgen sein. Dann aber kommt das beschwerlichste Stück. Ich bin gespannt, wie nahe uns die Rothäute an ihre Felsenfestung heranlassen werden.«
Old Jed wollte etwas erwidern, doch die Worte blieben ihm in der Kehle – stecken.
Schüsse fielen in den Ausläufern der Berge, höchstens eine Meile entfernt. Gewehrschüsse, deren peitschendes Knallen sich durch die Echos vervielfachte.
Die zwei ungleichen Freunde lauschten überrascht.
Nach einer heftigen Salve wurde es wieder still. Nur der Widerhall der Schüsse war noch zu hören, bis auch er in der Ferne versiegte.
»Holy smoke, was war das?«, stieß Jed Hawkins hervor.
»Weiß der Teufel. Wahrscheinlich sind ein paar Weiße von Apachen überfallen worden«, meinte Jivaro und sprang wieder in den Sattel. Er war entschlossen, die Sache auszukundschaften.
»Bleib hier!«, rief der Alte. »Was geht das uns an?«
Er jagte in die Richtung, in der geschossen worden war. Ob sie haargenau stimmte, wusste er natürlich nicht, denn in den Bergen wurde man ständig durch Echos irritiert.
Nach einer halben Meile hielt Jivaro sein Pferd etwas zurück, damit er vom Hämmern der Hufe nicht verraten wurde. Er befand sich dicht vor einem kleinen, spärlich mit Büschen bewachsenen Randberg, hinter dem die Schießerei stattgefunden haben musste.
Am Fuß des langgestreckten Bergrückens zügelte er den Cayusen, glitt aus dem Sattel, befestigte die Zügelenden an einem Fettholzstrauch und zog seine Winchester aus dem Scabbard. Dann kletterte er den Hang hinauf.
Noch hatte er den Kamm nicht erreicht, als er ein Pferd wiehern hörte. Sofort wurde Jivaro noch wachsamer. Mit schussbereitem Gewehr legte er das letzte Stück zur Anhöhe zurück und lief oben geduckt zwischen den brusthohen Büschen entlang.
Zwanzig Yards weiter stockte jäh sein Schritt. Im nächsten Augenblick duckte er sich.
Einen Steinwurf weit unter ihm war ein Wasserloch. Ein fast kreisrunder Tümpel, um den herum einige Büsche standen. Der Himmel spiegelte sich im Wasser und täuschte so eine bläuliche Färbung vor.
Drei Apachen lagen am Ufer auf dem sonnendurchglühten Boden, niedergestreckt von den Kugeln ihrer Gegner, die sie hier überfallen haben mussten.
Nein, nicht die Indianer konnten den Kampf begonnen haben, sondern die drei verkommen aussehenden Weißen mussten es gewesen sein, die sich gerade bei ihren Opfern zu schaffen machten.
Die Apachen hatten eine junge Squaw bei sich gehabt, die den Weißen lebend in die Hände gefallen war. An den Armen gefesselt, hockte sie am Boden. Ein vierschrötiger Mann mit angeschlagenem Gewehr hielt sie in Schach.
Ein fetter Kerl mit rötlichem Bart ließ soeben etwas Schwarzes in einem ledernen Sack verschwinden. Jivaro konnte gerade noch erkennen, dass es Haare waren. Der Skalp eines der drei toten Apachen!
»Skalpjäger«, murmelte er verächtlich.
Der Dritte im Bunde sah wie ein verschlagener Fuchs aus. Er führte soeben die Pferde der Bande ans Wasser, während die Mustangs der Apachen, von den Schüssen verschreckt, ein Stück abseits standen.
Dass die Pferde der Weißen noch nicht getrunken hatten, war ein weiterer Beweis dafür, dass die Indianer zuerst an diesem Platz gewesen waren. Und sie hatten keine Chance zur Gegenwehr gehabt. Für Jivaro gab es keinen Zweifel daran, dass die Apachen heimtückisch aus dem Hinterhalt niedergemetzelt worden waren.
Die unangenehm kratzende Stimme des Rotbärtigen schallte jetzt zu Jivaro herauf.
»So, das hätten wir!«, rief er, während er den Ledersack zuband. »Diese Skalps werden uns wieder eine schöne Stange Geld einbringen. Vor allem bei den Mexikanern, wenn wir uns die Mühe machen, nach Sonora zu reiten. Die geben hundert Silberpesos für das Stück. Mit denen, die wir schon gehabt haben, macht das ...«
»Zum Teufel, fang jetzt bloß nicht zu rechnen an!«, unterbrach ihn der Vierschrötige, der die Indianerin bewachte. »Lass uns lieber ans Vergnügen denken, Jaques! An den Spaß mit dieser Kleinen. Sie ist gar nicht so übel, schätze ich. Willst du darum knobeln, wer sie zuerst bekommt?«
»Das bin sowieso ich!«, erwiderte der Rotbärtige und lachte. »Dieses Recht steht mir zu als Boss unserer Firma. Knobeln kannst du meinetwegen mit Hank. Aber das hat auch noch Zeit, denke ich. Wir wollen uns erst einen anderen Platz suchen.«
»Du willst hier nicht bleiben?«, fragte der dritte Kumpan, der die Pferde tränkte. »Warum nicht, verdammt?«
»Weil wir unerwarteten Besuch kriegen könnten, wenn wir hier lagern. Es ist nicht ausgeschlossen, dass noch mehr so rotes Gesindel durch die Gegend streift. Unsere Schüsse könnten wirklich gehört worden sein.«
»Ja, du hast recht«, gab der andere zu. »Überraschen lassen wollen wir uns nicht.«
»Eben.« Der Rotbärtige schulterte den Sack mit den Skalpen und ging damit zu den Pferden.
Jivaro entsicherte die Winchester.
Ihm war klar, was die Schufte vorhatten. Sie wollten die Indianerin mitnehmen und sich eine Nacht lang mit ihr vergnügen, um sie hinterher ebenfalls umzubringen und auch ihr den Skalp zu nehmen, damit er blanke Dollars oder Silberpesos brachte. Für jene Leute, die Skalpe kauften, zählte es ja nicht, ob sie von einer Squaw oder einem Krieger stammten. Hauptsache, es war ein Apachenskalp.
Auch Jivaro war kein Freund der Apachen. Diese Skalpjäger hätten ihn normalerweise nicht weiter interessiert. Aber die junge Indianerin, die den Kerlen hilflos ausgeliefert war, rührte ihn. Und so beschloss er, den drei Halunken den Spaß zu verderben.
Wortlos feuerte er die Winchester ab und sah im Tümpel das Wasser aufspritzen.
Für die Skalpjäger war es, als hätte in ihrer Nähe eine Bombe eingeschlagen. Erschrocken fuhren sie herum. Ihre Hände schnellten zu den Waffen. Suchend spähten sie umher.
»Hier bin ich!«, rief Jivaro, der sein Gewehr blitzschnell durchgeladen hatte. »Aber lasst besser die Pfoten von den Eisen! Ich würde bestimmt schneller sein!«
Der Vierschrötige, der seine Springfield bereits in den Fäusten gehalten hatte, feuerte trotzdem. Um zwei Handbreiten pfiff die Kugel an Jivaro vorbei.
Jivaro schoss erneut. Und diesmal war es kein Warnschuss mehr.
Der Skalpjäger stieß einen rauen Schrei aus. Er taumelte rückwärts und stürzte, wobei er fast auf die Indianerin fiel.
Seine Kumpane erstarrten in der Bewegung. Fassungslos starrten sie auf den Vierschrötigen, der neben der Squaw liegen blieb und sich nicht mehr rührte.
Dann flogen ihre Blicke zur Anhöhe hinauf, wo Jivaro in Deckung kauerte.
»Verflucht, warum hast du unseren Freund erschossen?«, rief der Rotbärtige wütend. »Du bist doch kein Apache?«
»Nein, ich bin Jivaro, das Halbblut!«, rief Jivaro zurück. »Und es gefällt mir nicht, dass ihr das Mädchen verschleppen wollt. Ich bin dagegen, dass ihr es missbrauchen und dann ebenfalls ermorden wollt, um auch ihren Skalp verkaufen zu können!«
»Wer einen Apachen umbringt, tut ein gutes Werk«, entgegnete der Rotbärtige nach kurzer Schweigepause. »Das ist doch Gelichter, das man ausrotten muss! Verdammt, was regst du dich so auf wegen dieser Squaw?«
»Du hast doch nicht wirklich vor, sie uns wegzunehmen?«, fügte der andere Skalpjäger finster hinzu.
Er schien zu überlegen, ob es eine Chance für ihn gab, riskierte aber nichts.
»Die Squaw bleibt hier!«, verkündete Jivaro hart. »Ihr könnt nur euren Freund mitnehmen. Verfrachtet ihn auf sein Pferd und schert euch zum Teufel! Los, macht schon! Ihr habt genau zwei Minuten. Wen ich dann von euch noch sehe, der bekommt eine Kugel!«
Die beiden Skalpjäger nahmen die Drohung ernst. Ohne Zeit zu verlieren, packten sie ihren toten Kumpan und hoben ihn auf eines der Pferde. Anschließend saßen sie selbst auf.
»Du wirst noch an uns denken!«, schnarrte der Rotbärtige hassvoll. »Das verspreche ich dir, Mann!«
»Verschwindet!«, rief Jivaro.
Da ritten sie davon. Jivaro blickte ihnen wachsam nach, bis sie in einer Senke untertauchten.
Er wusste, er hatte sich in ihnen zwei Todfeinde gemacht.
Die Indianerin hatte sich nicht von der Stelle gerührt. In unveränderter Haltung hockte sie am Boden und blickte Jivaro entgegen, der zu Fuß zum Wasserloch herabkam.
Sie war noch sehr jung und trug ein fransenverziertes Kalikokleid, das an der Seite ein Stück aufgerissen war. Sie musste sich gewehrt haben, als die Skalpjäger sie überwältigt hatten. Um ihren Hals lag eine Kette aus Glasperlen. Ihre braunen Beine waren nackt bis auf die halbhohen Mokassins.
In ihrem breitwangigen Gesicht war weder Furcht noch Erleichterung zu erkennen. Eher abwartend blickten die dunklen Augen. Die junge Apachin wusste wohl nicht, was sie von dem Halbblut zu halten hatte.
»Hallo, Schwester!«, rief ihr Jivaro im Apachendialekt zu, den er einigermaßen gut beherrschte. »Du brauchst vor mir keine Angst zu haben. Ich will dir nur helfen.«
Die Squaw antwortete nicht. Sie schaute zu ihren skalpierten Stammesbrüdern hinüber und musterte dann wieder Jivaro, der sein Messer aus dem Gürtel zog, sich über sie beugte und ihre Fesseln zerschnitt.
»Wie heißt du?«, fragte er.
»Winame«, kam es zögernd aus ihrem Mund.
Mehr Fragen wollte sie nicht beantworten. Sie stand entweder unter einem Schock oder war misstrauisch.
Aber sie weinte nicht eine einzige Träne, obwohl sie der Tod ihrer Gefährten sehr zu treffen schien.
Es war wohl eine friedliche Gruppe gewesen, die sich an dem Tümpel lediglich mit Wasser versorgen wollte. Keiner der toten Apachen trug Kriegsbemalung. Da sie alle drei dem Mädchen ähnlich sahen, wie Jivaro feststellen konnte, richtete er erneut das Wort an Winame.
»Bist du mit ihnen verwandt?«, fragte er.
Da nickte die junge Squaw.
»Mein Vater, meine Brüder«, sagte sie und zeigte erregt auf die Toten. »Die Weißaugen haben sie aus dem Hinterhalt erschossen. Heimtückisch wie der Wolf, haben sie da oben zwischen den Felsen gelauert.«
»Es tut mir leid«, murmelte Jivaro. »Aber ich konnte nicht früher hier sein. Gehört ihr zu Shacitos Stamm?«
Da wurde das Gesicht der jungen Squaw wieder verschlossen. Sie starrte vor sich hin.
Jivaro überragte sie fast um zwei Köpfe. Begütigend legte er ihr die Hand auf die Schulter und spürte, wie sie zusammenzuckte. Doch sie wich ihm nicht aus.
»Du willst sicher nicht, dass die Toten hier liegen bleiben«, sagte er ruhig. »Mitnehmen aber kannst du sie nicht. Wir werden einen Platz suchen, wo wir sie begraben können.«
Er schaute sich suchend um und entdeckte im Hang eine Höhle, die ihm groß genug erschien, um die Leichen der drei Erschossenen aufzunehmen.
Einen nach dem andern zog er die Toten zu der Höhle, legte sie hinein und wälzte ein paar große Steinbrocken vor die Öffnung, um die Raubtiere abzuhalten.
Danach fing er einen der Mustangs ein.
»Komm!«, rief er Winame zu. »Wir wollen weg von hier!«
Sie stand noch immer dort, wo sie sich erhoben hatte, nachdem er ihre Fesseln durchschnitt. Jetzt aber setzte sie sich zögernd in Bewegung.
Sie nahm den Mustang am Zügelstrick und führte ihn hinter Jivaro her den Hang hinauf.
Oben angekommen, konnten sie das staubige Band der Poststraße sehen, auf der sich das Maultiergespann näherte.
»Das ist mein Freund Old Jed«, klärte Jivaro die Indianerin auf. »Er will mit den Apachen Handel treiben. Ja, wir sind zu deinem Stamm unterwegs. Da wir aber nicht genau wissen, wo die Apacheria liegt, trifft es sich gut, dass wir uns begegnet sind. Du bist doch bereit, uns den Weg zu zeigen?«
Winame gab keine Antwort. Ohne seine Frage zu wiederholen, stieg Jivaro am Osthang zu seinem Pferd hinunter, wobei er die Indianerin nicht aus den Augen ließ. Sie versuchte jedoch nicht, auf ihren Mustang zu springen, um die Flucht zu ergreifen, sondern stieg erst auf, als auch er sich in den Sattel schwang.
Gemeinsam ritten sie über das raue Gelände auf den schwankenden Wagen zu.
Old Jed war nach einiger Wartezeit langsam weitergefahren, in Sorge um Jivaro, der sich nicht hatte zurückhalten lassen. Er wusste zwar, dass Jivaro sehr gut auf sich aufpassen konnte, aber es fiel ihm nun doch ein Stein vom Herzen, als er ihn unversehrt wieder auftauchen sah. Erleichtert schob er seine alte Rifle, die griffbereit auf seinen Knien gelegen hatte, wieder unter die Sitzbank.
Dort, wo die Straße an einem Nadelfelsen vorbeiführte, trafen die beiden Freunde aufeinander. Jed Hawkins brachte die Maultiere zum Halten.
»Hey, wen hast du denn da mitgebracht?«, rief er und betrachtete die junge Indianerin, die sich in Jivaros Begleitung befand. »Das ist doch eine Apache!«
Jivaro, der seinen Cayusen ebenfalls gezügelt hatte, nickte.
»Sie heißt Winame.«
»Ein hübsches Ding. Nur ein wenig verschreckt sieht sie aus. Was ist geschehen?«
»Skalpjäger«, sagte Jivaro und berichtete von dem Überfall am Wasserloch.
»Nur sie hat das Blutbad überlebt«, schloss er. »Und wir können ihre Rettung als mächtiges Glück bezeichnen, schätze ich.«
»Du meinst, die Apachen werden uns jetzt freundlicher gesinnt sein?«
»Ja, genau das will ich damit sagen, Jed. Es wird uns mächtig weiterhelfen, dass wir jemandem von Shacitos Stamm das Leben gerettet haben. Unsere Chancen, den Skalp zu behalten, sind unerwartet gestiegen.«
»Hoffen wir, dass du recht hast«, meinte Old Jed. »Ich hab jedenfalls noch nie gehört, dass Apachen etwas wie Dankbarkeit kennen. Also, dann ziehen wir jetzt weiter. Ein oder zwei Meilen schaffen wir heute noch.«
Rumpelnd und scheppernd setzte sich der Wagen wieder in Bewegung. Jivaro ritt ihm mit der Indianerin voraus.
In den Ausläufen der Berge schlugen sie am Abend ihr Lager auf. Es war ein versteckt liegender Platz, der sich notfalls gut verteidigen ließ.
Trotzdem machten sie nur ein kleines Feuer, das gerade ausreichte, um das Nachtmahl zu kochen. Jivaro und Old Jed wollten mit dem Flammenschein nicht die rachsüchtigen Skalpjäger anlocken.