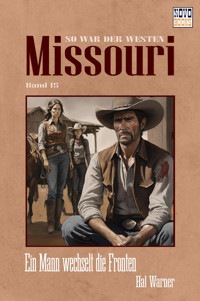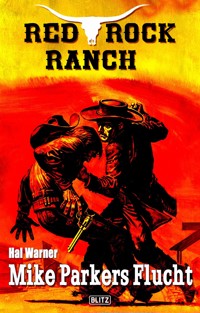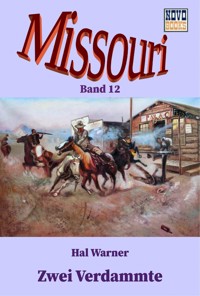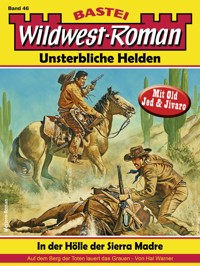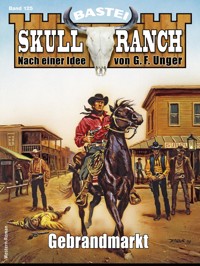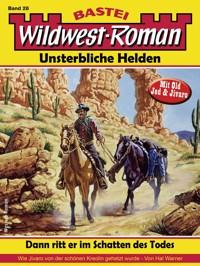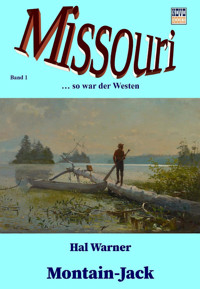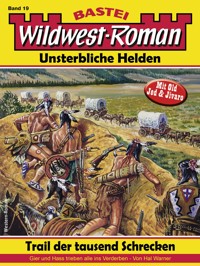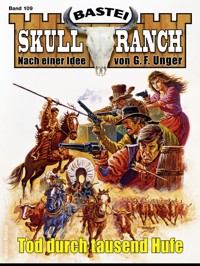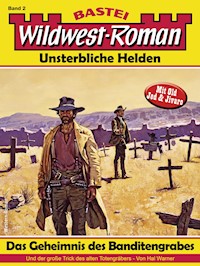1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Wildwest-Roman – Unsterbliche Helden
- Sprache: Deutsch
Zu Tausenden fallen sie in den Nächten über die Rinder auf den Weiden im Pecos-Land her: Blutsaugende Vampirfledermäuse, die mit ihren winzigen, aber auch messerscharfen Zähnen immer wieder Rinder töten. Und dann folgt jene unheilvolle Nacht, in der ein Mensch, ein junger Cowboy Opfer dieser Blutsauger wird.
Niemand weiß einen Rat - bis Jivaro, das Halbblut kommt. Er führt die Männer in eine Felslandschaft, in der sich der Schlupfwinkel der mörderischen Vampirfledermäuse befindet.
Von diesem Augenblick an überschlagen sich die Ereignisse. El Sapo und seine mexikanischen Bandoleros erscheinen plötzlich auf der Bildfläche. Und im Gepäck haben sie nichts als den Tod ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Wo der Tod regiert
Vorschau
Impressum
Wo der Todregiert
Von Hal Warner
Zu Tausenden fallen sie in den Nächten über die Rinder auf den Weiden im Pecos-Land her: Blutsaugende Vampirfledermäuse, deren winzigen, messerscharfen Zähnen Nacht für Nacht mehrere Rinder zum Opfer fallen.
Aber dann kommt jene unheilvolle Nacht, in der ein junger Cowboy das Opfer dieser winzigen Blutsauger wird.
Niemand weiß einen Rat – doch da kommt Jivaro, das Halbblut. Er führt die Männer in eine Felsenwildnis, in der sich der Schlupfwinkel der mörderischen Vampirfledermäuse befindet. Von diesem Augenblick an überschlagen sich die Ereignisse. El Sapo ist mit seinen mexikanischen Bandoleros gekommen. Von jetzt an feiert der Tod mörderische Triumphe ...
Die lautlosen Mörder der Nacht mussten ihn im Schlaf überrascht haben. Genau an der Stelle, wo sie ihn fanden, als sie in der Morgendämmerung den Hang herabkamen.
Das Feuer in der Senke war längst erloschen. Daneben lag die reglose Gestalt. Die Kleidung des Mannes war voll Blut. Ebenso der Boden, das Gras um ihn, das er mit seinem Lebenssaft befleckt hatte.
Jäh zügelten die drei Cowboys ihre Pferde und blickten erschrocken auf ihren Gefährten, sahen an seinem Körper die zahlreichen Wunden, die Bissmale der Vampirfledermäuse.
»Ronny – Allmächtiger!«, stieß Laredo hervor, der falkenäugige Vormann der Tumble-C-Ranch.
Ronny Lester reagierte nicht darauf. Erst als Laredo aus dem Sattel sprang, sich über ihn beugte und nach seiner Schulter griff, öffnete er die matten, glasigen Augen.
»Schlafen!«, brachte er mühsam über die blutleeren Lippen. »Lass mich schlafen! Ich bin – so müde ...«
Sein Gesicht sah erschreckend bleich aus. Er atmete nur noch langsam, war bereits mehr tot als lebendig. Die gefürchteten Blattnasen, die in diesem Land nahe der mexikanischen Grenze mit der Nacht kamen und verschwanden, hatten ihn ausgesogen, durch ihre Bisse fast verbluten lassen.
Nicht weit von ihm entfernt lag unter einem Baum sein Pferd. Ebenfalls in einer Blutlache, und das Fell übersät mit rotglänzenden Flecken.
Das Tier stieß ein klägliches Wiehern aus und wollte aufspringen, hatte aber nicht mehr die Kraft dazu. Krampfhaft stemmten sich die Vorderhufe in den Boden, der Schweif schlug ins Gras. Es kam im Kreuz nicht mehr hoch. Und während es sich mit einem dumpfen Stöhnen noch bemühte, knickten ihm auch die Vorderbeine weg, und es fiel schwer auf die Erde. Seine blutigen Flanken zitterten. Schaum stand vor seinem aufgerissenen Maul, aus dem die lechzende Zunge hing. Dann brachen ihm die Augen.
Das Pferd war tot.
Ronny Lester lebte noch. Aber es war ungewiss, ob man noch etwas für ihn tun konnte. Er hatte schon zu viel Blut verloren – und er verlor noch immer welches. Unaufhaltsam tropfte es aus seinen Wunden, wie kleine Brunnen, die nicht versiegen wollten.
Ratlos schauten die Männer sich an. Sie konnten sich denken, wie es passiert war. Ronny, der bei den Rindern Nachtwache hatte, musste seine Pflichten vernachlässigt haben und am Feuer eingenickt sein. Das war ihm zum Verhängnis geworden. Wer in dieser Gegend nachts im Freien schlief, ohne dass ein anderer auf ihn aufpasste, setzte sich immer einer tödlichen Gefahr aus.
»Gebt mir meine Feldflasche!«, befahl der Vormann.
Einer der Cowboys brachte sie ihm, und Laredo hielt sie Ronny Lester an den Mund. Der Bursche trank, fühlte sich danach aber kaum frischer.
»Schlafen!«, stammelte er nur wieder. Er schien gar nicht zu begreifen, was mit ihm los war. Er war quasi nicht mehr bei Sinnen.
»Das kannst du unterwegs«, sagte Laredo. »Du wirst jetzt mit mir zum Doc reiten. Komm, Freddy, hilf mir!«
Zu zweit brachten sie Lester in die Höhe. Sie mussten ihn stützen, weil er sonst sofort wieder umgefallen wäre. Und er schleifte die Beine nach, als sie ihn zu einem der Pferde schleppten.
»Im Sattel halten kann er sich nicht, fürchte ich«, meinte Freddy. »Wir müssen ihn festbinden.«
Sie hoben Ronny aufs Pferd, legten ihn quer über den Sattel. Laredo nahm sein Lasso und band ihn auf dem Tier fest. Aber davon merkte Ronny schon gar nichts mehr, weil er ohnmächtig geworden war.
»Du schwingst dich zu Ben aufs Pferd und reitest mit ihm zur Ranch!«, rief Laredo und sprang in den Sattel. »Sagt dem Boss Bescheid.«
Nach diesen Worten jagte er aus der Senke, das Pferd mit Ronny Lester im Schlepptau. Keine Zeit war zu verlieren, wenn es für den Burschen noch eine Rettung geben sollte.
Laredo wusste in diesem Augenblick noch nicht, dass er den Wettlauf mit dem Tod nicht gewinnen konnte.
»Es war nichts mehr zu machen«, sagte der Doc bekümmert und hob dabei die mageren Schultern. »Als Ihr Vormann ihn brachte, war er ja fast schon verblutet. Tut mir wirklich leid, Mr. Connery.«
»Schon gut, Doc. Ich bin überzeugt, Sie haben getan, was Sie konnten«, entgegnete der Rancher, der den weißhaarigen Doc um Haupteslänge überragte. »Darf ich den Toten noch mal sehen?«
»Aber sicher, Mr. Connery.« Der Doc führte den Rancher in einen kleinen Raum neben seiner Ordination, wo auf einer Bahre die mit weißem Laken verhüllte Gestalt lag. Er zog das Laken ein Stück zur Seite.
Ein fahles, durchsichtig wirkendes Gesicht kam zum Vorschein. Ein Gesicht mit spitzer Nase und bläulichen Lippen und mit Augen, die tief in ihren Höhlen lagen. Mark Connery räusperte sich unbehaglich.
»Das soll Ronny Lester sein? Der Mann ist ja kaum noch wiederzuerkennen. Einfach schrecklich, nicht wahr?«
»Ja, das kann man wohl sagen.« Doc Sheppard nickte und zog das Laken wieder über die Leiche. »Er hat keinen Tropfen Blut mehr in sich. Was ihm die Fledermäuse nicht ausgesaugt haben, ist ihm später noch aus dem Körper gelaufen. Wahrlich kein schöner Tod.«
Connery schüttelte fassungslos den Kopf.
»Wie ist es nur möglich, dass ein Mensch nichts spürt, wenn ein ganzer Schwarm von Fledermäusen über ihn herfällt? Dass er einfach weiterschläft, bis es zu spät ist?«
»Es gibt nur eine Erklärung«, meinte der Doc. »Es muss im Speichel dieser Tiere ein unbekannter Stoff enthalten sein, der das Schmerzempfinden an den gebissenen Stellen auslöscht. Zugleich hebt dieser chemische Speichel die Gerinnung des Blutes auf. Es fließt wie Wasser, strömt mit jedem Pulsschlag. Das macht den Biss dieser Blutsauger so gefährlich. Selbst wenn ihr Opfer, sei es ein Mensch oder ein Tier, die ihm abgezapften Blutmengen noch verkraften sollte, ist es meistens verloren, weil es hinterher verblutet. Im Fall von Ronny Lester standen die Chancen ganz besonders schlecht.«
Mark Connery presste hart die Lippen aufeinander. Er war ein Mann mittleren Alters, der aus Missouri stammte. Groß, breit und knorrig wie ein alter Baum. Sein dunkles, noch immer dichtes Haar war stark angegraut. Er trug einen buschigen Schnurrbart. Seine Kleidung war abgescheuert, und seine Hände verrieten, dass er selbst mindestens zwei Cowboys ersetzte. An der rechten Seite trug er in einem offenen Holster einen schweren Fünfundvierziger-Colt.
»Ausrotten müsste man diese verfluchten Viecher!«, knurrte er. »Jetzt bringen sie auch schon Menschen um! Nein, das kann nicht so weitergehen.«
»Sie haben völlig recht«, pflichtete der Doc ihm bei. »Diese Blattnasen sind die Pest in diesem Land. Aber es ist schwer, ihnen beizukommen, weil sie am Tag nicht aufzufinden sind. Da verstecken sie sich in Felsenlöchern oder hängen in dichtem Baumgeäst. Wir werden wohl weiterhin mit ihnen leben müssen.«
»Oder durch sie sterben, wenn es nicht doch gelingt, sie zu vernichten. Kein Mensch draußen auf der Weide ist nachts vor ihnen sicher. Erst recht kein Rind. Wissen Sie, wie viele Verluste ich bereits hatte? Na, ich will jetzt nicht darüber reden«, meinte Connery im Hinblick auf den Toten. »Sondern lieber dafür sorgen, dass der Junge eine anständige Beerdigung bekommt.«
Wenig später verließ er das Haus des Doc, bestieg draußen seinen Hengst und ritt über die Plaza von Mesilla.
Staub wallte unter den Hufen. Über der kleinen Stadt am Rio Grande stand jetzt hoch die Sonne und ließ die weißen Adobehäuser leuchten. Nur wenige Menschen waren zu sehen. Es war so heiß, dass sich sogar die Hunde in schattige Winkel verkrochen hatten und den Reiter nicht ankläfften.
Connerys Ranch lag etliche Meilen weiter westlich. Er hatte sie erst vor einigen Monaten gekauft, nachdem ihr früherer Besitzer ums Leben gekommen war. Connery war also ziemlich neu in der Gegend. Und er hatte nicht gewusst, was ihn hier erwarten würde. Kein Mensch hatte ihn vor der Geißel dieses Landes gewarnt. Niemand hatte ihm gesagt, dass die Vampirfledermäuse die Rinderzucht fast unmöglich machten, weil sie so überhandgenommen hatten. Es verging keine Nacht, in der er nicht mehrere Stück Vieh verlor. Es gab keinen Morgen, an dem man nicht tote oder verendende Tiere fand.
Und nun war durch die blutgierigen Fledermäuse auch noch einer seiner Cowboys ums Leben gekommen.
Mark Connerys Miene war sehr ernst, als er Maffitts Saloon betrat, vor dem er den Hengst angebunden hatte. Er ließ die Flügel der knarrenden Schwingtür los und steuerte die Theke an.
Im Schankraum war es angenehm kühl. Mehrere Augenpaare blickten ihm in dem Dämmerlicht, auf das sich seine Augen erst einstellen mussten, entgegen und musterten ihn neugierig. Er lehnte sich wortlos an den Tresen.
»Ein kühles Bier, Mr. Connery?«, fragte der Salooner.
Der Rancher nickte. Maffitt griff lächelnd nach einem Glas und zapfte Bier.
»Wie steht es um Ronny Lester?«, erkundigte er sich dabei.
»Er ist tot.«
»So.« Maffitt stellte das gefüllte Glas vor den Rancher auf die Theke. »Ist er also gestorben? Das war wohl zu erwarten, schätze ich. Wen die Blattnasen erwischen, ist meistens verloren. Ich sage Ihnen, das sind Geschöpfe des Teufels.«
Mark Connery griff nach dem Bierglas und trank. Er behielt es danach in der Hand, wischte sich den Schnurrbart und schaute Maffitt an, der ihm gegenüber stehengeblieben war.
»Geschöpfe des Teufels. Ja, das ist das richtige Wort«, meinte er. »Denn nur der Teufel mag wissen, wo die verfluchten Biester herkommen. Was haben wir doch schon nach ihren Schlupfwinkeln gesucht! Es ist offenbar unmöglich, sie aufzustöbern. Sie sind einfach da, sobald es dunkel wird, und in der Morgendämmerung sind sie wieder spurlos verschwunden. Es ist wie verhext.« Der Rancher seufzte und trank erneut von seinem Bier.
Brent Maffitt wischte mit einem Lappen über die Theke, um einen gar nicht vorhandenen Fleck zu entfernen.
»Tja, Sie haben recht«, sagte er. »Das ist wirklich so eine Sache mit diesen Fledermäusen. Nachts sieht man sie überall am Himmel, und am Tag scheint es, als ob sie gar nicht existieren. Eigentlich hat es sie hier immer schon gegeben. So schlimm wie jetzt war es aber noch nie. Nein, wirklich nicht, verdammt noch mal! Meinen Sie, dass es am Wetter liegt, dass sie sich so stark vermehren?«
»Keine Ahnung, Maffitt. Ich weiß nur, dass sie mich noch ruinieren werden, wenn nicht bald was geschieht. Irgendwie muss es den Blutsaugern an den Kragen gehen, und das gründlich! Meine Leute erledigen zwar manchmal einen mit Hackblei, wenn sie in der Nacht umherflattern, aber das nützt nicht viel. Für jede Blattnase, die wir umbringen, tauchen zehn andere auf. Man muss sie alle erwischen. Restlos, verstehen Sie?«
»Ja.« Maffitt nickte. »Aber um diese schädliche Brut vertilgen zu können, müssten Sie ihre Verstecke kennen. So lange das nicht der Fall ist ...«
»... bleibt es bei dem Vorsatz«, unterbrach der Rancher unwirsch. »Ja, ich weiß. So lange kann nichts unternommen werden. So lange muss ich weiterhin jeden Morgen die toten Rinder zählen und damit rechnen, dass es vielleicht noch einen von meinen Leuten erwischt. O verflucht!«
In grimmiger Wut schüttete Connery das restliche Bier in sich hinein, stellte das Glas hart auf die Theke zurück und verkündete impulsiv:
»Tausend Dollar würde ich demjenigen bezahlen, der den Schlupfwinkel der Blattnasen ausfindig macht! Ja, das wäre mir die Sache wert. Gib mir noch ein Bier, Maffitt!«
Während der Salooner das Glas nachfüllte, erhob sich von einem der Tische im Hintergrund des Schankraums ein junger, dunkelhaariger Mann und trat neben Connery an die Theke.
»Kann ich Sie beim Wort nehmen, Rancher?«, fragte er.
Mark Connery wandte überrascht den Kopf und blickte auf den Mann, der ebenso groß war wie er, wenn auch bedeutend schlanker. Ruhig und forschend ruhten dessen dunkle Augen auf seinem Gesicht.
»Natürlich«, sagte Connery. »Was ich verspreche, halte ich auch. Aber – aber Sie wollen doch nicht behaupten ... Eh, wer sind Sie überhaupt?«
»Mein Name ist Jivaro. Einfach Jivaro, Mr. Connery. Ich hab von meinem Platz aus gehört, wie Sie sich mit dem Salooner unterhielten. Ihnen machen die Blattnasen Sorgen. Und mir nicht weniger mein leerer Geldbeutel. Ich könnte die tausend Bucks wirklich gut brauchen.«
»Die können Sie sich jederzeit verdienen«, brummte Connery. »Wie jeder andere hier auch. Wenn Sie die Schlafplätze der Vampirfledermäuse finden ...«
»Wer sagt denn, dass ich sie erst suchen muss?«, unterbrach ihn Jivaro grinsend.
»Sie kennen sie bereits?« Der Rancher blickte zweifelnd.
»Ja, Mr. Connery. Ja, ich weiß, wo sich diese niedlichen Tierchen tagsüber versteckt halten.«
»Wo?«
Jivaro lachte so, dass seine Zähne blitzten. Er hatte eine sehnige Gestalt und bewegte sich geschmeidig wie ein Raubtier. Sicher konnte er mit seinem tiefhängenden Colt ausgezeichnet umgehen und war auch im Nahkampf ein gefährlicher Gegner. Er hatte etwas Wildes, Verwegenes an sich. Sein gutgeschnittenes Gesicht mit den leicht vorspringenden Backenknochen war dunkel wie bei einem Halbblut. Und das war er wohl auch.
»Das erfahren Sie erst, wenn ich mir sicher sein kann, dass ich die tausend Dollar auch wirklich kriege«, sagte er. »Sie würden das Geld ja auch nicht herausrücken, ohne zu wissen, ob es sich lohnt, nehme ich an.«
»Stimmt. Sie sind wirklich nicht dumm, Jivaro.« Connery lächelte knapp. »Also, Sie kriegen die Prämie, wenn Sie mir den richtigen Platz persönlich zeigen. Das sage ich hier vor mehreren Zeugen.«
»Die ich allesamt kaum kenne. Machen wir es schriftlich.«
»Gut. Maffitt, geben Sie uns Schreibzeug!«
Der Salooner brachte ein Stück Papier und einen Bleistift, während sich die anwesenden Gäste von ihren Plätzen erhoben und neugierig nähertraten.
Connery wollte schon zu schreiben beginnen, ließ den Bleistift aber wieder sinken und hob den Kopf.
»Tausend Dollar sind viel Geld«, sagte er. »Ich will Sie nicht dafür bezahlen, dass Sie mich zu einem Platz führen, an dem es dann vielleicht ein Dutzend von diesen Blattnasen gibt. Es müsste sich schon auszahlen, mein Freund.«
»Das wird es, verlassen Sie sich darauf«, entgegnete Jivaro. »An dem Platz, von dem ich rede, gibt es so viele, dass man sie nicht zählen kann. Es ist bestimmt eine Wagenladung voll.«
»Well, dann schreibe ich, dass es eine Wagenladung sein muss.«
»Geht in Ordnung, Mr. Connery.«
Wenig später steckte Jivaro den vom Rancher unterschriebenen Vertrag in die Tasche.
»Okay«, sagte er grinsend. »Das Geld ist mir sicher, und Ihnen die Fledermäuse. Wenn Sie wollen, können wir ihnen schon morgen den Garaus machen.«
»Noch lieber wäre es mir, wenn wir das noch heute könnten.«
»Dazu ist es zu spät. Wir müssen zu weit reiten, um es schaffen zu können, bevor es dunkel wird. Nein, heute wird nichts mehr daraus.«
»Gut, dann morgen. Aber jetzt sagen Sie mir endlich, wo diese verdammten Mistviecher zu finden sind!«
»Schon mal vom Devils Hat gehört?«
»Nein.«
»Aber ich!«, rief Maffitt. »Das ist ein Bergkegel am Ostrand der Potrillos. Dort sollen die Fledermäuse sein?«
»Ja, dort sind sie. Dorthin müssen wir, Rancher«, sagte Jivaro. »Ich kenne den Weg.«
Connery nickte.
»Okay, ich verlasse mich auf Sie. Jetzt trinken wir zusammen einen Whisky.«
Es war um die Mittagszeit, als sich die vier Reiter den Potrillo Mountains näherten. Als gleißender Feuerball stand die Sonne über den gezackten Berggipfeln, und die heiße Luft schien stillzustehen.
Mark Connery hatte zwei Leute mitgenommen. Den jungen Cowboy Reddy und den alten, erfahrenen Panhandle-Bill. Die beiden waren gut bewaffnet.
An der Seite des Ranchers ritt Jivaro, der am Vorabend mit auf die Tumble-C gekommen war und dort übernachtet hatte. Er saß auf einem stämmigen, recht zäh wirkenden Cayusen.
Hart pochten die Hufe. Rötlicher Staub wirbelte vom steinigen Boden auf und hing hinter den Reitern noch eine ganze Weile in der Luft.
Sie hatten das fruchtbare Weideland längst hinter sich gelassen. Hier war ödes Felsengebiet, trocken und verkarstet, beinahe wüstenhaft. Nur wenige graugrüne Buschinseln gab es zwischen den sonnengebleichten Felsen. Da und dort standen Kakteen oder Yuccas mit ihren dolchartigen Blättern.
Die Männer sprachen unterwegs nur wenig. Aber sie alle – mit Ausnahme von Jivaro – fieberten dem Moment entgegen, da sie den langgesuchten Schlupfwinkel der blutgierigen Fledermäuse vor sich sehen würden. Am meisten Mark Connery, der durch diese Plage schon so großen Schaden erlitten hatte.
Schließlich tauchte vor den Männern ein klotziger Tafelberg auf, der in seiner Form wie ein riesiger Hut aussah. Düster und bedrohlich ragte er in den azurblauen, wolkenlosen Himmel. Halden von Geröll umgaben ihn, und darauf wucherte Gestrüpp.
»Das ist er wohl?«, fragte Mark Connery.
»Ja, das ist der Devils Hat«, bestätigte Jivaro. »Wir sind gleich am Ziel und haben dann genügend Zeit, um auch die letzte Blattnase unschädlich zu machen. Ihre Rinder werden nächste Nacht bereits ihre Ruhe vor ihnen haben.«
Im Näherreiten sahen sie nun alle die dunklen Höhlen im Fels. Wie es schien, war der ganze Berg von tiefen Löchern durchzogen, von denen das größte wie ein überdimensionales Tor aussah. Schwarz und bedrohlich gähnte es den vier Reitern entgegen.
»Da oben ist es«, sagte Jivaro und streckte die Hand aus. »Da müssen wir hinauf.«
Sie zügelten auf der Westseite des riesigen Sandsteinfelsens am Fuß der Geröllhalde ihre Pferde und rutschten aus den Sätteln, machten die Zügelenden fest und wischten sich erst mal den Schweiß vom Gesicht.
»Da oben also«, sagte Mark Connery und setzte seinen Hut wieder auf. Seine Augen schweiften die Halde hinauf, zu dem dunklen Schlund, der mitten in die Hölle zu führen schien. »Donnerwetter, das ist wirklich der ideale Platz für dieses Gezücht. Hätte ich den Berg früher gekannt, würde ich hier bestimmt nachgesehen haben. Aber so weit südlich haben wir nie gesucht.«
Jivaro hatte einen Schluck aus seiner Feldflasche genommen. Nun verschraubte er sie wieder und hängte sie ans Sattelhorn zurück. Er nickte dem Rancher zu.