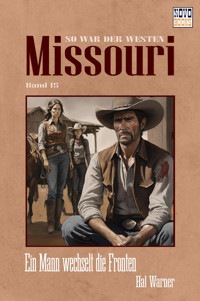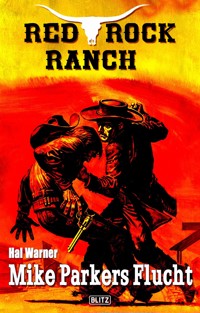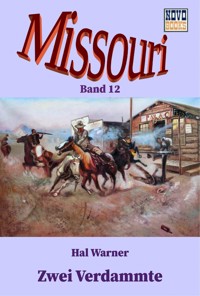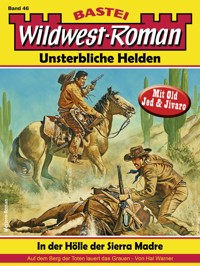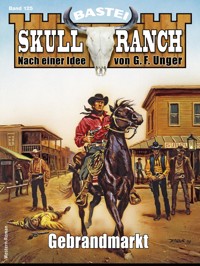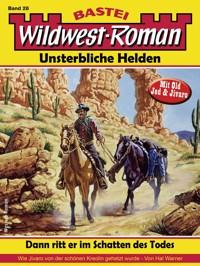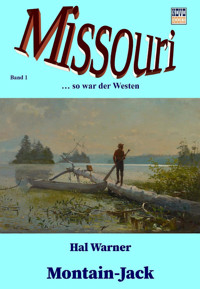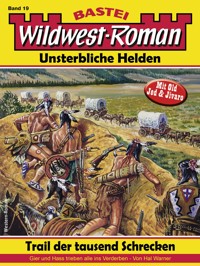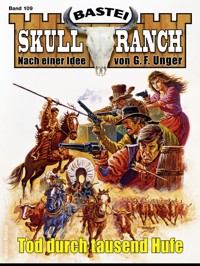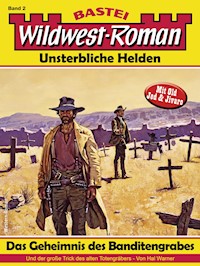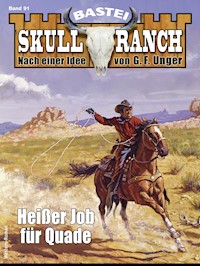
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Skull Ranch
- Sprache: Deutsch
Golden City, die Goldgräberstadt in den Bergen Colorados, wird von Schlägertrupps und Revolvermännern terrorisiert. Seit Jube Ballanger die Amüsierbetriebe der Stadt kontrolliert, sieht sich Marshal Rockwell einer steigenden Woge der Gewalt gegenüber. Diebstähle, Betrügereien und Überfälle sind längst an der Tagesordnung, und vor einigen Tagen wurde Rockwells Deputy von Unbekannten auf offener Straße erschossen.
Der Marshal von Golden City sieht nur noch eine Chance, mit Ballanger abzurechnen: Chet Quade, der Vormann von der Skull-Ranch, muss den Stern nehmen und kämpfen...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Heißer Job für Quade
Vorschau
Impressum
Heißer Job für Quade
von Hal Warner
Golden City, die Goldgräberstadt in den Bergen Colorados, wird von Schlägertrupps und Revolvermännern terrorisiert. Seit Jube Ballanger die Amüsierbetriebe der Stadt kontrolliert, sieht sich Marshal Rockwell einer steigenden Woge der Gewalt gegenüber. Diebstähle, Betrügereien und Überfälle sind längst an der Tagesordnung, und vor einigen Tagen wurde Rockwells Deputy von Unbekannten auf offener Straße erschossen.
Der Marshal von Golden City sieht nur noch eine Chance, mit Ballanger abzurechnen: Chet Quade, der Vormann von der Skull-Ranch, muss den Stern nehmen und kämpfen ...
Als Chet Quade die Büsche am Ufer des kleinen Sees erreicht, stockt jäh sein Schritt. Überrascht blickt er auf das dunkelhaarige Mädchen, das ein Stück weiter draußen im Wasser schwimmt, auf dessen Oberfläche sich das goldene Licht der sinkenden Sonne spiegelt.
Es ist Mary-Lou, die Tochter des Skull-Ranchers John Morgan. Chet hat nicht gewusst, dass sie hier badet. Der Vormann der Skull-Ranch kam erst vor einer Viertelstunde von der Weide zurück, und es war ein heißer und sehr anstrengender Tag, an dem er mächtig schwitzen musste.
Deshalb sehnt auch er sich jetzt nach einem erfrischenden Bad. Und er sieht keinen Grund, seinen Plan zu ändern.
Mary-Lou hat ihn noch nicht bemerkt. Die Weidenbüsche verdecken Chet und gewähren ihm gleichzeitig einen recht guten Ausblick.
Aber sie achtet auch gar nicht auf das Ufer, sondern gibt sich dem Schwimmvergnügen hin. Sie taucht unter, kommt wieder hoch und krault ein Stück. Dann wirft sie sich auf den Rücken und paddelt mit den Händen nach rückwärts durch die klaren Fluten.
Chet sieht ihr lachend zu, schlüpft dabei aber bereits aus seinen Stiefeln. Er ist ein großgewachsener Mann, dessen Gesicht braun ist von der Sonne. Nicht viel heller ist sein Oberkörper, was ersichtlich wird, als er schließlich auch sein Hemd auszieht. Unter seiner Haut spielen die Muskeln.
In der Nähe liegen die Kleider von Mary-Lou. Sorgfältig zusammengelegt. Chet lässt die seinen einfach zu Boden fallen und wirft seinen Hut obendrauf.
Dann tritt er durch eine Lücke zwischen den Büschen und springt ebenfalls ins Wasser. Mit kräftigen Armbewegungen teilt er es und schwimmt dabei auf das Mädchen zu, das nun auf ihn aufmerksam wird.
»He, was tust du hier?«, ruft sie ihm erschrocken zu.
»Ich bade«, antwortet Chet. »Das Wasser ist prächtig, nicht wahr?«
Lou kreischt auf, als sie erkennt, dass er nicht ans Abschwenken denkt, sondern sie zu erreichen trachtet.
Sie ist sehr hübsch. Ihre großen Augen sind dunkelblau. Nasse, pechschwarze Haarsträhnen umrahmen ihr rassiges Gesicht. Sie bewegt sich auf der Stelle und hält wachsam nach Chet Ausschau.
»Bleib mir vom Leib, du Frechdachs! Du kannst dir doch denken, dass ich nackt bin!«
»Keine Sorge, das bin ich auch«, gibt Chet zurück. »Jedenfalls beinahe. Oder hast du gedacht, ich würde mit den Stiefeln schwimmen gehen?«
Er ist ihr bereits ziemlich nahegekommen. Nur noch wenige Längen, und er wird sie erreicht haben. Und obwohl Mary-Lou sehr gern in seiner Nähe ist, so hat sie jetzt doch etwas dagegen, mit ihm allein zu sein. Sie wirft sich herum und schwimmt ihm davon.
Chet folgt ihr. Er ist im Gegensatz zu den meisten anderen Cowboys ein ausgezeichneter Schwimmer. Männer, die im Sattel zu Hause sind, haben meist sogar eine ausgeprägte Scheu vor dem nassen Element. Nicht so Chet Quade, der ehemalige Revolvermann, der eine Comanchen-Squaw als Großmutter hatte. Er fühlt sich auch im Wasser recht wohl und bewegt sich darin mit erstaunlicher Sicherheit.
Bald holt er Mary-Lou ein, erwischt sie mit einer Hand an den Zehen und hört sie erneut kreischen. Er lässt sie wieder los, überholt sie und umkreist sie dann wie ein Hai sein Opfer, wobei er übermütig lacht, dass seine weißen Zähne blitzen.
»Gleich hab ich dich!«, scherzt er.
»Und dann zieh ich dich in die Tiefe und fresse dich auf!«
»Komm, lass das!«, ruft Mary-Lou. »Veranstalten wir lieber ein Wettschwimmen.«
»Geht in Ordnung, Mädchen. Was bekommt der Gewinner?«
»Ich geb' dir einen Kuss, wenn du vor mir das andere Ufer erreichst.«
»Die Wette gilt, Mary-Lou.«
Sie lacht nur und schwimmt an ihm vorbei auf die Seemitte zu.
»Du, ich nehm' dich beim Wort!«
Schon setzt er ihr nach. Und er holt sie bald wieder ein und schwimmt ein Stück an ihrer Seite. Dann lässt er sie zurück.
Er ist sicher, dass er gewinnen wird. Ohne große Mühe. Deshalb strengt er sich auch gar nicht besonders an, sondern gibt Mary-Lou die Gelegenheit, das Tempo zu halten. Erst im letzten Augenblick will er ihr davonschwimmen, um sich den Sieg zu sichern.
Chet erreicht die Mitte des Sees. Wo bleibt Mary-Lou? Sie hätte ihn eigentlich einholen müssen. Forschend schaut er sich nach ihr um.
Er kann sie nicht sehen, hört sie auch nicht. Er entdeckt sie erst, als er im Wasser eine Wendung macht.
Sie ist umgekehrt, zurückgeschwommen. Sie hat ihn überlistet.
»Na, warte!«, ruft er ihr nach. »Ich kriege dich schon!«
Obwohl ihr Vorsprung ziemlich groß ist, gelingt es ihm doch, sie vor dem Ufer einzuholen. An einer Stelle, wo das Wasser noch einigermaßen tief ist. Es bedeckt Mary-Lou, die nun aufgibt und sich auf den sandigen Grund stellt, bis zu den Brüsten.
Chet blickt ihr in die Augen. Sie lächelt ihn an, ist etwas außer Atem. Wassertropfen glänzen auf ihren Schultern.
»Das war aber gar nicht fair«, sagt er mit gespieltem Vorwurf.
Mary-Lou sagt gar nichts. Sie schließt jetzt die Augen. Denn sie wartet darauf, dass Chet sie küssen wird.
Und er nimmt sie in die Arme und zieht sie an sich, wobei ihre Lippen sich finden.
Wer weiß, wann sie sich wieder getrennt hätten, würde nicht plötzlich jemand Chets Namen gerufen haben.
Sie hören es beide und fahren erschrocken auseinander.
»He, Chet, wo steckst du denn, du verdammter Bursche?«, ertönt es da von neuem. Der Stimme nach muss es Doc Smoky sein, der alte Ranchkoch.
Und da bricht er auch schon wie ein angeschweißter Eber durch die Uferbüsche. Mary-Lou taucht im Wasser unter und schwimmt zur Seite weg, während Chet zum Ufer watet, über das sich bereits die Dämmerung legt.
»Ach, hier bist du!«, ruft Doc Smoky, als er den Vormann erspäht. »Ich hab dich überall gesucht!«
»Hol dich doch der Teufel!«, knurrt Chet. »Was willst du?«
»Ich will gar nichts von dir. Aber ein Mann aus Golden City ist hier«, antwortet der Koch, der einen alten Lederhut trägt. Sein verwittertes Gesicht sieht wie eine Landkarte aus, auf der eine Menge tiefer Gräben eingezeichnet sind. »Er sagt, er hat einen Brief für dich. Es ist anscheinend eine wichtige Sache.«
Chet steigt aus dem Wasser, schiebt den Oldtimer zur Seite und greift nach seinem Hemd.
»Einen Brief?«
»Ja, Chet, einen Brief. Von Marshal Rockwell. Der Bursche ist wie ein Wilder geritten. Also, zieh dich schon an!«
»Tue ich vielleicht etwas anderes? Los, verschwinde! Ich komme gleich nach.«
Doc Smoky blickt den indianerhaften Vormann schief an. »Du bist nicht gerade freundlich.«
»Du hast mich auch beim Baden gestört.«
»Baden – pah!« Doch Smoky verzieht verächtlich den Mund und stiefelt davon.
Chet kleidet sich fertig an und blickt nochmals nach Mary-Lou, die noch immer im See herumschwimmt, in den jetzt ein Schwarm Wildenten einfällt. Dann geht auch er zu den nahen Ranchgebäuden hinüber.
Der Mann, von dem Doc Smoky gesprochen hat, wartet schon auf ihn. Er sitzt auf der Veranda auf einem Flechtstuhl, von dem er sich jetzt erhebt. Sein Pferd, schaumbedeckt und abgetrieben, steht auf dem Hof. Chet wirft einen kurzen Blick auf das Tier und geht zum Haus, aus dem John Morgan kommt, steigt die paar Stufen hinauf und tritt vor den Besucher.
Es ist ein vielleicht vierzigjähriger, mittelgroßer Mann, der die einfache Kleidung der Goldgräber trägt.
»Ich bin Chet Quade«, sagt der Vormann der Skull und streckt ihm die Hand hin. »Sie haben einen Brief für mich?«
»Ja.« Der Mann nickt und nimmt Chets Hand. »Ich heiße Lanner. Der Marshal schickt mich.«
Er greift in seine innere Rocktasche und bringt einen verschlossenen Umschlag zum Vorschein, den er Chet übergibt.
»Mir wollte er den Brief nicht geben«, sagt John Morgan, der Boss der Skull-Ranch. Er sieht seinen jungen Vormann erwartungsvoll an.
Chet reißt den Umschlag auf und entnimmt ihm ein Stück Papier, auf dem nur wenige Zeilen stehen. Das letzte Tageslicht reicht gerade aus, um sie entziffern zu können.
»Hallo, Chet!
Hier in der Stadt ist wieder einmal der Teufel los. Ich sehe mich außerstande, allein Ordnung zu schaffen, und brauche daher Deine Hilfe. Komme möglichst sofort!
George Rockwell, Marshal«
Chet runzelt die Stirn. Er lässt den Brief sinken, schaut nachdenklich vor sich hin. Er ist, was in diesem Land nur wenige wissen, Marshal für besondere Aufgaben. Als solcher unterstützt er hin und wieder Marshal Rockwell, der ihn aber nie wegen einer Kleinigkeit ruft, sondern nur, wenn es dafür einen triftigen Grund gibt.
»Was ist los, Chet?«, erkundigt sich der Rancher. John Morgan ist groß, hager und sehnig und hat rauchgraue Augen, die forschend auf seinem Vormann ruhen.
»Ich muss weg. Nach Golden City. Dort scheint es drunter und drüber zu gehen. So ist es doch, oder?«
Seine Frage gilt Lanner, der nickt.
»Ja, Mr. Quade. Es ist sehr schlimm.«
»Well, ich komme mit Ihnen. Wir reiten morgen früh. Sie können, wenn Sie wollen, im Bunkhaus übernachten.«
Der alte Planwagen steht am Rande von Golden City. Daneben brennt ein kleines Feuer, an dem zwei Männer und eine Frau sitzen.
Die Rendalls. Genauer gesagt, der grauhaarige Jonas und seine Frau sowie ihr Sohn Dick, der einundzwanzig und damit schon erwachsen ist. Im Wagen unterhalten sich noch seine zwei bedeutend jüngeren Brüder.
Jonas Rendall raucht seine Pfeife. Das Feuer knistert. Dunkle Schatten zucken über die rötlich erhellte Wagenplane. Auch die Gesichter werden rot beleuchtet. In der Nähe stehen sechs magere Mulis in einer Seilkoppel.
Man hat gegessen. Bohnen mit etwas Fleisch. Morgen wird es nur noch Bohnen geben. Übermorgen auch die nicht mehr.
Ann Rendall weiß es. Sie macht sich Sorgen. Ihr verhärmtes Gesicht ist sehr ernst.
Sie hebt jetzt lauschend den Kopf, denn in der zu nächtlichem Leben erwachten Goldgräberstadt klingt wüster Lärm auf. Brüllende Stimmen, Flüche. Dann fallen Schüsse.
Die Siedlerfrau in dem schäbigen Kattunkleid blickt ihren Mann an, der ebenfalls lauscht. Die wilden, Gewalttätigkeit verratenden Geräusche ängstigen sie.
»Da sind sich wohl wieder mal ein paar Kerle in die Haare geraten«, meint Dick und sieht nach, ob noch Kaffee in der Kanne ist.
Sein Vater nickt nur und schweigt.
Seine Mutter erhebt sich und räumt das Essgeschirr zusammen, das sie vor einer Weile gesäubert hat.
»Es gefällt mir gar nicht, dass Sue in diesem Saloon arbeitet«, sagt sie dabei.
»Mir auch nicht«, brummt Jonas. »Ich war von Anfang an dagegen. Aber wir müssen froh sein, dass sie ihn hat, diesen Job. Wenigstens eine von uns, die jetzt ein paar Dollars verdient.«
Die Frau seufzt. Sie weiß nur zu gut, wie recht Jonas hat. Nein, sie können auf das Geld, das ihre Tochter bekommt, auf keinen Fall verzichten. Sie brauchen es, um frische Lebensmittel zu kaufen. Sind darauf angewiesen, wenn sie in wenigen Tagen nicht hungern wollen. Und es geht ihr dabei gar nicht um sich selbst, sondern um Benny und Fred, die eigentlich noch zur Schule müssten. Dass sie nichts mehr zu essen haben, ist das, wovor Ann Rendall am meisten Angst hat.
»Es ist ja nur vorübergehend«, fährt Jonas fort. »Bis ich oder Dick etwas gefunden haben. Wir werden es morgen wieder versuchen.«
»Und wenn wieder nichts ist?«
»Irgendwas wird sich schon finden«, ist Jonas zuversichtlich. »meinst du nicht auch, Dick?«
»Klar, Pa. Es gibt ja einige Minen, in denen wir noch gar nicht gefragt haben.«
»Man wird euch dort dasselbe sagen, was ihr in den anderen Minen zu hören bekommen habt«, meint Ann und trägt den Kochtopf und die Zinnteller zum Wagen, dessen Rückwand heruntergeklappt ist. Sie schiebt das Geschirr seitlich über die Ladefläche.
»Schlaft endlich!«, ruft sie in den Wagen. »Ich will jetzt nichts mehr hören!«
Dick hat sich den letzten Kaffee eingeschenkt und trinkt ihn in kleinen Schlucken. Sein Vater klopft die Pfeife aus.
Die Schüsse sind verstummt. Man hört jetzt nur noch Rufe. Anscheinend hat es einen Toten gegeben. Trotzdem spielt irgendwo Musik. In Golden City wird zur selben Zeit gefeiert und gestorben.
Ann kommt zum Feuer zurück, setzt sich aber nicht mehr. Sie ist eine große, hagere Frau, deren eingefallenes Gesicht ziemlich blass ist.
Sie war schwer krank, wurde vor zwei Monaten plötzlich von einem seltsamen Fieber befallen, von dem sie sich noch immer nicht ganz erholt hat.
Dieses Fieber war auch der Grund, warum die Rendalls den großen Treck, mit dem sie nach Westen unterwegs waren, verlassen haben. In Santa Fé sind sie zurückgeblieben, wo sie ihr letztes Geld für einen Arzt verbrauchten und darüber hinaus alle persönlichen Habseligkeiten verkauften. Arbeit konnten die Männer dort nicht finden, und es gab, als es Mrs. Rendall wieder etwas besser ging, auch keinen Anschluss mehr an einen anderen Treck, weil in diesem Jahr alle Wagenzüge, die nach Kalifornien wollten, schon durch waren, um noch vor dem Winter über die Berge zu kommen. Sie hätten auch den anderen Treck nicht mehr einholen können, wären nur Gefahr gelaufen, vom Schnee überrascht oder von wilden Indianern überfallen und umgebracht zu werden.
In Santa Fé aber konnten sie ohne Geld und ohne Job nicht bleiben. Sie waren schon ziemlich entmutigt, als sie zufällig von Colorado hörten und den zahlreichen Gold- und Silberminen, die es hier gab. Arbeit sollte es hier geben; es strömten viele hierher. So hatten sich auch die Rendalls auf den Weg in die Berge von Colorado gemacht, mit der Hoffnung auf einen Job und der Absicht, hier zu überwintern. Im nächsten Frühjahr wollten sie wieder in Santa Fé sein, um sich dort einem Auswandererzug ins »gelobte Land« anzuschließen.
Mittlerweile sind sie eine Woche in Golden City, doch an ihrer tristen Lage hat sich noch nicht viel geändert.
»Nein, ihr werdet wieder nichts finden«, sagt Ann Rendall.
Jonas schiebt mit dem Fuß ein Stück Holz ins Feuer; glühende Funken stieben empor.
»Ich hoffe doch. Wenn nicht, können wir noch immer die Mulis verkaufen.«
»Dann sitzen wir hier fest«, gab Dick zu bedenken.
»Wir werden neue kaufen, sobald wir wieder Geld haben. Irgendwann bekommen wir ganz sicher einen Job. Sue muss jedenfalls bald mit der Saloonarbeit aufhören.«
»Die Mulis werden nicht verkauft«, entgegnete Dick. »Schon gar nicht alle.«
Er trinkt seinen Kaffee aus und erhebt sich, dehnt und streckt seine schlanke Gestalt. Er ist ziemlich groß, jedenfalls größer als sein Vater.
»Wie spät mag es sein?«
»So um zehn herum wahrscheinlich«, antwortet Jonas. Er besitzt seit Santa Fé auch keine Uhr mehr.
»Dann geh ich jetzt in die Stadt rein und warte auf Sue.«
Ann blickt ihn an. »Bist du nicht zu früh dran? Sie macht doch erst gegen Mitternacht Schluss.«
»Besser zu früh, als zu spät, Ma.«
»Stimmt«, fügt Jonas hinzu. »Geh nur, Dick. Und sieh zu, dass du mit niemandem Streit bekommst.«
»Keine Sorge. – Also dann, gute Nacht, Ma!«, verabschiedet sich Dick von seiner Mutter. Seinem Vater, der bei seiner Rückkehr bestimmt noch am Feuer sitzen wird, nickt er nur zu.
Dann springt er über die Wagendeichsel und verschwindet in der Dunkelheit.
Er will auch heute wieder seine Schwester abholen, um zu verhindern, dass ihr irgendwelche Kerle nachstellen und sie belästigen.
Jonas blickt ihm nach und sagt dann. »Er hat recht, Ann.«
»Womit?«
»Dass wir die Mulis behalten müssen. Zumindest vier davon.«
»Ja.« Ann nickt und hält sich die Hand vor den Mund.
»Du gähnst ja.«
»Ich bin auch müde.«
»Dann geh doch schlafen.«
»Wird das Beste sein.«
Wenig später klettert die Frau über eine Kiste in den Wagen, in dem sie neben Sue und den beiden Jungen ihren Schlafplatz hat. Nur Jonas und Dick schlafen im Freien; für sie ist im Wagen nicht genug Platz.
Jonas stopft seine Pfeife neu und steckt sie mit einem glimmenden Ast wieder in Brand.
Im Wagen hört er noch seine Frau rumoren. Funken fliegen über den Lagerplatz, tanzen wie Glühwürmchen, verglimmen, werden durch neue ersetzt.
Jonas Rendall raucht und grübelt nach. Sue, denkt er. Nein, es ist nicht gut, dass sie in diesem verdammten Saloon arbeitet. Auch nicht, wenn sie nur in der Küche hilft. Sie hört und sieht nichts Gescheites. Sie wird außerdem erst neunzehn.
Weniger Sorgen würde er sich machen, wäre seine Tochter hässlich.
Doch das ist sie nicht. Sie zieht die Blicke der Männer an. Die Kerle sind hinter ihr her. Das hat sich bereits gezeigt, als sie mit dem Treck unterwegs waren.
Doch im Treck hat Ordnung geherrscht, war Disziplin vorhanden. Dort hätte kein Mann gewagt, sich irgendwelche Frechheiten herauszunehmen, denn es passte einer auf den anderen auf.
Hier ist das anders. In dieser lasterhaften Stadt tut jeder, was er will. Hier herrscht auch großer Frauenmangel. Die wenigen biederen Farmer- oder Handwerkerfrauen leben zurückgezogen, und die meisten anderen taugen nicht viel.
Nein, Jonas Rendall hat kein gutes Gefühl. Er spürt instinktiv, dass es nicht gut ausgehen kann, wenn Sue noch länger in diesen Saloon geht. Denn er traut vor allem dem Mann nicht, dem Sue ihren Job verdankt.
Diesem Rico Cassada, der ihnen seine Hilfe anbot, als sie in einem Store einen Sack Bohnen kaufen wollten und feststellen mussten, dass ihr Geld auch dafür nicht mehr reichte. Cassada hat erst Sue gemustert und dann lächelnd in die Tasche gegriffen und Geld herausgeholt, um ihnen die nötige Summe zu borgen, was Jonas trotz ihrer Notlage zuerst ablehnen wollte.