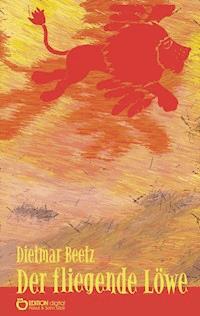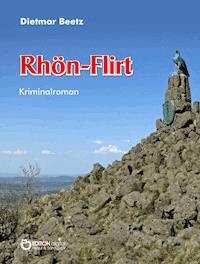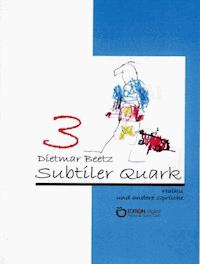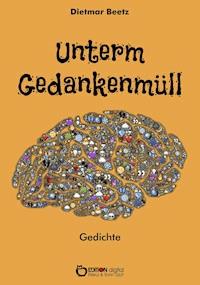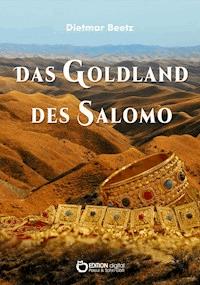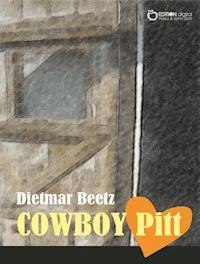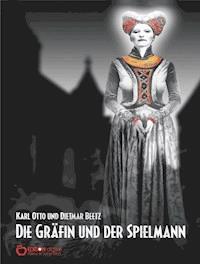6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Nino hat den Hubschrauber gehört. Auch die Schüsse. Wenig später sieht er die tote Nashornmutter. Neben ihr das Junge. Nino ist entschlossen, das Nashornkalb zu schützen. Und das Wunder geschieht: Rhino vertraut ihm. Aber was soll aus ihm werden? Allein kann er im Busch nicht überleben. Ist der märchenhafte Vorschlag die Lösung, Rhino auf eine weite Reise ins ferne Europa zu schicken – mit Nino als Begleiter? INHALT: Die Riesenlibelle Heuschreckenernte Abgehackt Ein harter Tag Im Nacken die Nacht Heilkräuterbrei Bis zum Ngori Ein Weißhaariger mit Brille Unter Verdacht Unglaublich Ein märchenhaftes Versprechen Die Nashorn-Lenkung Geister-Tamtam Ein bisschen Schumm-Schumm In der Hauptstadt Die Nacht vor dem Flug In letzter Minute Tunnel mit Klappe Weißer auf gewirbelter Sand Wie Früchte am Baum Feiertage Ohne Festtagsgesicht Abschied?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum
Dietmar Beetz
Rhinos Reise
ISBN 978-3-95655-195-6 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1996 im Erika Klopp Verlag GmbH, München.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2014 EDITION digital® Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Die Riesenlibelle
Es war Vorweihnachtszeit, also während des Hochsommers im südlichen Afrika. Seit Wochen zogen wieder und wieder bauchige Wolken heran und übergossen Hügel und Täler, Busch und Grasland mit kostbarem Nass. Überall sprossen Gräser, blühten Blumen, glitzerten Tümpel und Bäche.
In dieser Zeit des Überflusses, da Tiere und Menschen auflebten, war auch Unheil unterwegs. Es kam eines Morgens mit der Sonne und flog wie eine riesige Libelle über die Hügel. Dabei brummte es wie ein giftiges Insekt.
Die Tiere, die ästen oder tranken, sich suhlten oder balgten, all die Antilopen, Affen, Warzenschweine, erstarrten, lauschten und spähten. Sogar der Löwe, der unter einer breitkronigen Schirmakazie gedöst hatte, hob den Kopf und warf einen argwöhnischen Blick zum Himmel.
Nur Mutter Samtlippe ließ sich nicht stören. Sie widmete sich seit Mitternacht mit Rhino, ihrem Kälbchen, dem Frühstück. Rhino war anderthalb Jahre alt und nach Meinung seiner tonnenschweren Mama ein wenig untergewichtig. Er wog knapp vier Zentner, sodass Mutter Samtlippe sich veranlasst sah, ihn des Öfteren anzustupsen.
»Iss, Kleiner! Du musst groß und kräftig werden, denn wenn die Regenzeit vorbei ist und die Dürre anfängt, wird auch für uns das Futter knapp.«
Rhino hatte gleich anderen Tieren den Flug der Riesenlibelle verfolgt. Eben war sie mit schwirrenden Flügeln hinter einem Hügel verschwunden, und da ein paar Antilopen wieder zu äsen begannen, neigte auch Rhino den massigen Kopf.
Wie die Gräser und Kräuter dufteten! Und erst der Geschmack! Mutter Samtlippe hatte wahrscheinlich recht, wenn sie drängte, soviel wie möglich zu futtern.
An diesem Morgen aber sollte das Frühstück bald ein jähes Ende finden. Die Riesenlibelle, die in der Sprache der Menschen »Helikopter« heißt, hatte offenbar hinter jenem Hügel gewendet und kam nun über die Kuppe zurück.
Wieder sicherten die Tiere, und als jetzt der Helikopter in eine Kurve ging und auf die Schirmakazie zuhielt, sprang der Löwe, dem das Dösen vermutlich vergangen war, auf und in langen Sätzen davon.
Die Antilopen, die Affen, die Warzenschweine, sie alle flüchteten, die einen da-, die anderen dorthin. Die beiden Schmalnasen im Helikopter, die herabstarrten, schienen eine Weile nicht zu wissen, wem sie folgen sollten, und schwenkten ab.
Auch Mutter Samtlippe und Rhino hatten sich in Bewegung gesetzt. Obwohl sie es trotz ihrer wuchtigen Leiber beim Rennen selbst mit den leichtfüßigen Antilopen aufzunehmen vermochten, trabte die Nashorn-Mutter nur wenige Schritte.
»Bleib!«, befahl sie. »Wir Nashörner werden doch nicht vor so einem Schwirrding davonlaufen! Wir Nashörner haben nichts auf der Welt zu fürchten.«
Rhino kannte das. In den Märchen, die seine Mutter erzählte, im Unterricht, den sie ihm gab, überall waren Rhinozerosse stark und überlegen. Sie hatten keine ernst zu nehmenden Feinde, keine außer den Zweibeinern, von denen manche, wie Mutter wusste, mitunter geschlichen kamen, leise, in großer Zahl und bewaffnet mit spitzen Wurfstangen oder mit Rohren, die plötzlich knallten und eine Antilope oder einen Löwen, bisweilen auch ein Nashorn, verletzten oder gar tot zu Boden streckten.
»Vor denen nimm dich in acht!«, hatte Mutter Samtlippe mehr als einmal gesagt. »Zweibeiner können selbst uns gefährlich werden. Sobald du von ihnen Witterung kriegst, schon beim leisesten Hauch ihrer schweißigen Haut heißt’s: verduften!«
Diese Belehrungen gingen Rhino jetzt durch den Kopf, doch wie angespannt er auch witterte und spähte, an dem Schwirrding, das sich wieder näherte, konnte er nichts Gefährliches entdecken. Das roch weder nach Zweibeinerhaut, noch kam es lautlos geschlichen. Im Gegenteil, es rückte lauter als ein Gewitter heran und peitschte Gras und Gebüsch wie ein Sturm. Und nun - nun verharrte es, flog nicht weiter, hing schwirrend und dröhnend in der Luft, ganz in der Nähe von Rhino und Mutter Samtlippe, die unschlüssig hochäugte.
Was hielt sie hier? Etwa Neugier? Hatte sie alle Vorsicht vergessen?
Jetzt rief sie etwas, das Rhino bei dem Lärm nicht verstand, aber als Aufforderung zum Verduften begriff. Und während er folgte, bemerkte er aus den Augenwinkeln, wie im Leib der Helikopter-Libelle eine Öffnung entstand und ein Rohr herausgeschoben wurde.
Heuschreckenernte
Die Schüsse hörte auch Nino, ein zwölfjähriger Afrikaner vom Stamme der Tawana.
Er war seit der Frühe unterwegs. Mit ihm Vater und Mutter, seine vier Geschwister, drei Onkel, fünf Tanten und achtzehn Vettern und Basen. Sie hatten kurz vor Sonnenaufgang, als die Macht der bösen Geister schon gebrochen war, ihr Dorf verlassen, auf dem Kopf Bündel zusammengerollter Ledersäcke und leere Kalebassen. Die Männer trugen außerdem gewohnheitsmäßig ihre Waffen: Jagdmesser, Wurfspeere, Bogen und Köcher voller Pfeile. Onkel Yoyo hatte seine uralte Flinte dabei.
Im Dorf zurückgeblieben waren bloß die Alten und Gebrechlichen der Großfamilie. Selbst Bebe, Ninos jüngste Schwester, machte den Ausflug mit - bei Mutter im Tragetuch.
Es sollte nur eine kurze Reise werden, ein Abstecher ins Wildreservat jenseits des Ngori-Baches. Dorthin war gestern Abend, wie Onkel Yoyo auf einem Streifzug beobachtet haben wollte, ein Heuschreckenschwarm geflogen. Nun beabsichtigte die Sippe, sozusagen Heuschrecken zu ernten.Seit Regenzeit war, gab es zwar reichlich Kräuter und Knollen beim Dorf, auf den Feldern wuchsen Mais und Maniok, Bohnen, Bataten und Erdnüsse, und außerdem lief manchmal ein Perlhuhn oder gar eine Gazelle vor die Pfeilspitzen oder vor Yoyos Flinte. Heuschrecken aber, auf einem Blech über dem Feuer geröstet, waren und blieben ein Festtagsschmaus, eine höchst nahrhafte Delikatesse.
Vorausgesetzt, man fand einen Schwarm und scheute nicht die Mühe, die geflügelte Speise aufzuklauben und heimzuschleppen.
»Und du hast sie wirklich hier gesehen?«, erkundigte sich Vater bereits zum zweiten Mal.
»Ja doch!«, erwiderte Onkel Yoyo gekränkt. »Hier zwischen den Hügeln. Beim letzten Tageslicht.«
»Und es war ein Heuschreckenschwarm, nicht etwa eine Regenwolke?«
»Na, hör mal!«
Sie standen, Erwachsene und Kinder beieinander, am Fuße eines Hügels und blickten ein wenig ratlos in die Runde. Seit sie den Ngori-Bach, der zu einem Fluss angeschwollen war, durchwatet hatten, war die Sonne spürbar gestiegen. Und noch immer fand sich kein Hinweis auf einen Heuschreckenschwarm, der über Nacht gerastet hätte. Weder ein kahl gefressener Flecken noch irgendwelche Nachzügler aus der Millionenschar.
Weitersuchen oder umkehren, um vor der Mittagshitze nach Möglichkeit wieder daheim zu sein? Vielleicht hatte sich Yoyo geirrt. Außerdem war der Aufenthalt im Wildreservat eine gewagte Sache. Wie sollten sie dem Wildhüter beweisen, dass sie gar nicht die Absicht hatten zu jagen?
Nino sah, dass Vater - bei diesem Ausflug wie auch sonst im Dorf das Oberhaupt - zu überlegen schien, und in der Stille, die aufgekommen war, hörte er plötzlich ein Geräusch. Es klang wie Insektengebrumm, das sich rasch näherte und bald wieder entfernte.
Der Heuschreckenschwarm?
Auch Tante Yami nahm das offenbar an, doch Yoyo schüttelte den Kopf. »Ein Flugzeug«, sagte er. »Einer dieser verdammten Helikopter.«
»Von der Reservatsverwaltung?«, fragte Yami besorgt.
»Unsinn«, versetzte Yoyo. »Wahrscheinlich sind es Touristen.«
Und Vater fügte beruhigend, zugleich aber erbittert hinzu: »Irgendwelche Schmalnasen, Leute mit sehr viel Geld.«
Unterdessen war der Helikopter, den Nino auch unter dem Namen »Hubschrauber« kannte, weder herangekommen noch davongeflogen. Er schien hinter den Hügeln zu kreisen oder hin und her zu tanzen, denn sein Lärm drang mal lauter, mal gedämpfter zu ihnen. Was dort wohl los war?
Die Kinder hatten während des Marsches miteinander gescherzt und dann wie Nino die Ohren gespitzt. Ein paar von ihnen schickten sich jetzt an, in Richtung des Helikoptergebrumms davonzuschleichen.
»Hiergeblieben!«, befahl Ninos Vater.
Onkel Yoyo setzte zu einem Widerspruch an, doch im nächsten Moment brach er ab und horchte wie alle anderen.
In die Helikoptergeräusche hatte sich härterer Lärm gemischt, ein Knattern, einmal, nun wieder.
»Schüsse«, stieß Vater hervor.
»Salven aus einer Maschinenpistole«, sagte Onkel Yoyo.
Niemand rührte sich. Alle lauschten.
Und dann war das Geknatter vorbei. Eine Weile hörte man noch das Lärmen des Helikopters, bis es - nach einem letzten Anschwellen - leiser wurde und schließlich verstummte.
Nino hatte sich mitsamt seinen Angehörigen in Bewegung gesetzt, zögernd erst, geduckt. Nun liefen sie, die Tragelasten, die sie während der Rast abgenommen hatten, wieder auf dem Kopf, entschlossen und rasch hügelauf und hügelab, Nino und einige seiner Vettern und Basen ein Stück voraus.
Auf einer Anhöhe stockten die Kinder. Vor ihnen in einer Senke - ein Tier, offenbar ein Nashorn. Und daneben ein zweites, kleines, das jetzt einen Laut ausstieß, einen jammervollen Schrei.
Abgehackt
Als Nino und die anderen Kinder die Senke erreichten, hatten sich bereits die ersten Geier bei Mutter Samtlippe niedergelassen. Von den Zweibeinern gestört, flogen sie ein Stück beiseite, blieben aber in der Nähe, die nackten Hälse gereckt.
Bald tauchten am Himmel weitere Aasvögel auf und begannen zu kreisen.
Die Kinder waren wenige Schritte vor der Nashornkuh stehengeblieben, unfähig, näher heranzugehen. Sie schwiegen, in den schweißglänzenden Gesichtern Erschrecken und Furcht.
Auch die Erwachsenen, die herankamen, verharrten kopfschüttelnd in einiger Entfernung. Betroffen sahen sie auf das massige Tier, das mit zerfetztem Brustkorb und verstümmeltem, blutverschmiertem Kopf auf der Seite lag. Und manchmal streifte ihr Blick mitleidig das Junge, das neben seiner Mutter stand, zitternd, verletzt, und von Zeit zu Zeit klagend schrie.
»Diese Teufel!« Onkel Yoyo hatte als erster die Sprache wiedergefunden.
Vater nickte. »Und alles nur wegen der Hörner.«
Nino schaute ihn fragend an.
»Sie haben sie abgehackt«, erklärte er. »Das vordere große und das kleinere dahinter. Sie werden sie fortbringen, heimlich, weit weg in ein Land, das Japan heißt, oder nach Hongkong, Taiwan oder Singapur. Dort kriegen sie viel Geld dafür, sehr viel Geld.«
»Für das Horn von der Nashorn-Nase?«
»Genau. Es wird zu einem Pulver verarbeitet, zu einer Arznei, und teuer verkauft. Man verspricht sich Kraft davon.«
»Kraft?«, fragte Nino ungläubig.
»Ja doch«, bestätigte Vater, und Onkel Yoyo fügte grinsend hinzu: »Kraft für alte Männer, die Kraft junger Bullen.«
Einige kicherten.
Inzwischen waren die meisten näher an den Kadaver herangetreten, und dann umstanden alle das tote Nashorn und das Junge, das an einer Flanke - vermutlich durch einen Streifschuss - verwundet worden war.
Abgehackt, ging es Nino durch den Kopf. Ein großes, kräftiges Tier, die Mutter des Jungen, umgebracht - und der Leichnam liegen gelassen, den Geiern zum Fraß.
»Wir müssen es wegschaffen«, sagte Onkel Yoyo.
»Und die Heuschrecken?«, wandte eine der Frauen ein.
»Heuschrecken! Als wäre dieser Fleischberg nicht viel mehr wert als Säcke voller Heuschrecken!«
»Und die Reservatsverwaltung?«
Dazu schwieg der Onkel, und alle blickten zu Vater, dem Oberhaupt.
Eine Weile war nur der Schrei eines Geiers zu hören.
»Yoyo hat recht«, sagte Vater, sich räuspernd. »Wir sollten den Kadaver zerteilen und heimschleppen. Vielleicht haben wir Glück und bleiben unbehelligt. Oder können wenigstens beweisen, dass uns keine Schuld trifft, dass wir nicht geschossen haben. Auf alle Fälle wäre es dumm, das kostbare Fleisch den Geiern zu überlassen oder den Hyänen.«
Ein harter Tag
Es wurde für alle, auch für die Alten und Gebrechlichen im Dorf, ein harter Tag. Die meisten Erwachsenen und Kinder, die auf die tote Nashornkuh gestoßen waren, mussten noch fünfmal den Weg zum Dorf beziehungsweise zur Senke zurücklegen, dreimal mit schweren Fleischpaketen auf dem Kopf. Jedes Mal ging es durch die schlammigen, brusthohen Fluten des Ngori und die ganze Zeit unter einer Sonne, die herabstach, die Luft aufheizte und die Fleischbrocken zum Lockmittel für Fliegenschwärme machte.
Während die Träger unterwegs waren, wurde der schwindende Fleischberg in der Senke von Onkel Yoyo und einem Gehilfen zerteilt und bewacht - und der wachsende Fleischberg im Dorf von den Alten und Gebrechlichen in Streifen geschnitten, gesalzen und auf Büschen, Zäunen, Dachvorsprüngen zum Dörren aufgehängt. Gehörige Portionen wanderten gleich in Kochkessel neben den Hütten. Nach der zweiten Tour, als die Hitze alles Leben beinah erstickte, konnten sich die Träger seit Langem wieder einmal satt essen an weichem, saftigem Fleisch.Tante Yami nahm für Onkel Yoyo und für den Gehilfen ordentliche Portionen mit.
Auch Nino hatte gleich seinen Vettern und Basen fleißig geschleppt und sich im Schatten eines Schutzdaches gestärkt. Dabei war ihm das Schicksal der Nashornkuh - und mehr noch das ihres Jungen - nicht aus dem Kopf gegangen.
»Was wird mit dem Kleinen?«, erkundigte er sich bei Onkel Yoyo, der beschäftigt war und die Frage überhörte.
Die anderen in der Nähe wirkten gleichfalls abgelenkt. Doch Yoyos Gehilfe, ein älterer Vetter, schärfte gerade an einem Stein sein Messer. Er blickte von dem jungen Rhinozeros, das sich noch immer in der Senke aufhielt, zu Nino, prüfte mit dem Daumen die Schneide und grinste dabei.
Seitdem wurde Nino von diesem Grinsen verfolgt. Sich vorzustellen, dass Yoyo und der Gehilfe die Messer wetzten und dem jungen Nashorn zu Leibe rückten ... Oder dass Hyänen, Schakale oder Löwen das verwundete, geschwächte Tier anfielen, sich auf Rhino stürzten ...
»He! Pass doch auf!«
Nino war Humbo, seinem Freund, vor einer Wasserrinne auf die Ferse getreten. Er murmelte eine Entschuldigung, rückte seine Fleischlast zurecht und stapfte weiter.
»Was hast du bloß?«, erkundigte sich Humbo. »Etwa Magendrücken, weil du zuviel gegessen hast?«
»Unsinn«, erwiderte Nino, und nach kurzem Zögern verriet er: »Ich mache mir Gedanken wegen dem jungen verwundeten Nashorn.«
»Na und? Willst du’s etwa gesund pflegen?«
Es hörte sich spöttisch an, und Nino entgegnete nichts, zumal Humbo hinzufügte: »Deine Sorgen möchte ich haben! Ich wär schon froh, wenn wir die Schlepperei endlich hinter uns hätten.«
Auch Nino war müde, und als er seinen zweiten Fleischpacken ablegen konnte, atmete er auf.
Noch einmal zurück zu der Senke und noch einmal mit einem Brocken heim! Und dann, nach dieser dritten Tour?
Es ging bereits auf den Abend zu, und der übliche Regen hatte eingesetzt. Zwar goss es nicht mehr wie vor Tagen oder gar vor Wochen, aber die Nässe überall und die Schwüle, die noch zugenommen hatte, erschwerten jeden Schritt.
»Beeilt euch, damit wir fertig sind, eh’s dunkel ist!«, rief Tante Yami Humbo und Nino zu, als sie ihr und anderen Frauen begegneten.
»Beeilt euch!«, äffte Humbo sie nach. »Als ob wir trödeln würden!«
Dennoch beschleunigten die beiden den Schritt, vor allem getrieben von der Furcht vor den bösen Geistern der Nacht.
In der Senke befand sich, wie Nino von der Anhöhe aus sofort erkannte, noch immer das verwundete Nashornjunge. Es stand, wo es bereits vorhin gestanden hatte. Im Regen schien es erstarrt - ein Anblick, der Nino plötzlich mit brennendem Mitleid erfüllte.
Im Übrigen war die Arbeit in der Senke offenbar größtenteils getan. Yoyo und sein Gehilfe hatten die Rhinozeroskuh samt den Knochen zerteilt, und beim Näherkommen sah Nino, dass gerade die letzten Traglasten für seinen Vater und für ein paar andere Träger vorbereitet wurden.
»Da hätten wir auch daheimbleiben können«, sagte Humbo.
Nino entgegnete nichts; dazu war er jetzt zu aufgeregt. Er wusste zwar, dass er etwas unternehmen musste, nicht aber, wie er es anfangen sollte.
»Na bitte«, rief Yoyo, als die beiden Jungen die Senke erreicht hatten. »Da kommt ja Verstärkung. Am besten, ich teile die beiden größten Packen noch einmal.«
»Lieber nicht«, erwiderte Nino schnell. »Ich habe was anderes zu tun. Ich muss mich um das verwundete Nashorn kümmern.«
»Du allein - jetzt, wo’s gleich Nacht ist?« Und dann wandte sich Yoyo an Ninos Vater. »Was sagst denn du dazu?«
Im Nacken die Nacht
Als es dunkel wurde, ließen sich auch die Geier, die zuletzt über der Senke gekreist hatten, nieder. Vorher waren sie abwechselnd aufgeflogen oder gelandet, sodass ständig einige von ihnen mit gebreiteten Schwingen und gekrümmten Krallen am hitzeflirrenden oder regentrüben Himmel geschwebt hatten. Nun, da das tote Nashorn abtransportiert worden war, wollten sie offenbar im Schutze der Nacht Rhino, dem verwundeten Nashornkalb, zu Leibe rücken.
Der Regen hatte inzwischen aufgehört, doch das dürre Holz, das sich fand, war feucht, und auch sonst ergaben sich Schwierigkeiten, ein Feuer zu entfachen.
Vater hatte Nino sein Feuerzeug, eine Kostbarkeit, überlassen. »Nimm! Und geh vorsichtig damit um!«
Das war für Nino mehr als höchstes Lob, und als er den eingefetteten, wasserdichten Lederbeutel mit der umgebauten Patronenhülse in der Hand hielt, empfand er Stolz wie selten zuvor.
Überhaupt hatte sich Vater großartig verhalten.
»Nino ist alt genug, schon zwölf«, hatte er zu Onkel Yoyo gesagt. »Soll er zeigen, was in ihm steckt.«
Die Umstehenden, vor allem Humbo, krausten die Stirn, und Yoyo gab zu bedenken: »Aber bei Nacht, allein, und bloß für ein Nashorn ...«
»Bloß?«, erwiderte Vater fragend. »Nashörner, Elefanten, selbst Löwen - alle Tiere in Busch und Savanne sind uns Tawana wie Brüder und Schwestern. Außerdem verdanken wir der Mutter dieses Jungen Fleisch im Überfluss. Willst du’s denen, die sie niedergemetzelt haben, etwa gleichtun und ihr Junges den Geiern und Hyänen ausliefern? Ohne Hilfe wäre es verloren, unerfahren und schutzbedürftig, wie es noch ist.«
Dem konnte Onkel Yoyo nichts entgegensetzen, und so blickte er nun Humbo, seinen ältesten Sohn, düster an.
»Ich bleib auch hier«, sagte Humbo zögernd.
»Gut - ihr zwei«, lobte Ninos Vater, und dann überreichte er Nino das Feuerzeug.
Plötzlich wollten auch die anderen Erwachsenen den beiden etwas geben, und sei’s nur einen Ratschlag. Onkel Yoyo, schweigsam und sichtlich besorgt, erwog anscheinend sogar, seine Flinte dazulassen.
»Das ist nichts für Kinder«, entschied Ninos Vater. »Außerdem, wie stehen wir da, wenn die Wildhüter die beiden mit einem Gewehr antreffen?«
So kam es, dass Humbo und Nino unbewaffnet zurückblieben, ausgestattet mit nichts als dem Feuerzeug, das in den Händen von Nino zwar Funken von sich gab, aber nicht zum Brennen zu bringen war.