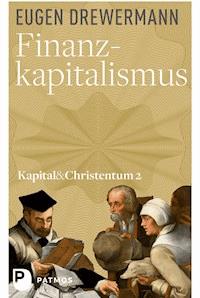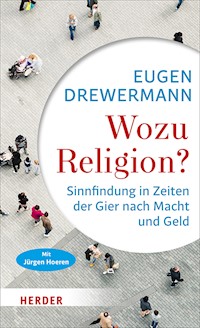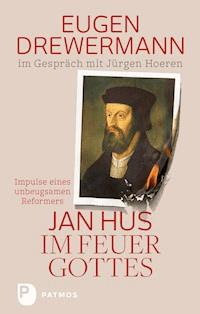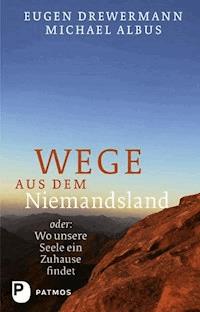Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Strafrecht & Christentum
- Sprache: Deutsch
Was gut und böse ist, besagen die Gesetze, die entweder Gott, ein historischer Herrscher oder der Wille des Volkes festgelegt haben. Wer gegen die Gesetze verstößt, macht sich schuldig, wird haftbar gemacht und bestraft. Völlig anders lautet die Botschaft des Jesus von Nazareth vom gütigen Gott und vom Vertrauen in dessen absolute Vergebensbereitschaft. Eugen Drewermann unternimmt einen kulturhistorischen Durchgang durch die Straf- und Rechtsvorstellungen von den frühen Kulturen in Mesopotamien bis zu den Germanen, Karolingern und Staufern im europäischen Mittelalter. Und er zeigt auf, wie das Kreuz ein Mahnmal Jesu gegen diese Gewalt nach innen wie nach außen ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1130
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eugen Drewermann
Richtet nicht!
Strafrecht & Christentum Band 1: Vergangene Gegenwart
Mit zahlreichen Abbildungen und Registern
Patmos Verlag
Inhalt
»Ans Kreuz mit ihm« (Joh 19,14) oder: Ändert die Welt
I) »Strafe muß sein« – Strafe als Normenkontrolle bei Tieren
1) Das Anstoßnehmen
2) Macht- und Rangstreitigkeiten
3) Vom alten und vom neuen Menschen
II) Strafen kann nur, wer die Macht dazu besitzt
1) Strafformen in verschiedenen Gesellschaften
2) Der Staat als Gründung göttlicher Gewalt
Mesopotamien
Ägypten
Induskulturen, minoische und mykenische Kultur
China
Die neue Welt: Süd- und Mittelamerika
Die Inka
Die Maya
Die Azteken
3) Grenzmarken staatlichen Besitzanspruches
III) Der Souverän als Urheber der Strafe
1) Crimen laesae maiestatis – Wer sich vergeht, beleidigt die Autorität
a) Rechtsvorstellungen im Zweistromland
b) Rechtsvorstellungen am Nil
c) Rechtsvorstellungen im Alten Griechenland
d) Rechtsvorstellungen im Alten Rom
e) Rechtsvorstellungen im Alten Israel
α) Geschichtlicher Werdegang
ß) Die literarischen Quellen
γ) Gerichtswesen und Prozeßrecht
δ) Einzelentscheidungen
f) Das Kreuz – ein Mahnmal Jesu gegen die Gewalt nach innen wie nach außen
IV) Strafen in staatlicher Gewalt als inszenierte Grausamkeit
1) Strafende Gewalt in der Antike
a) Mesopotamien in neuassyrischer Zeit
b) Meder und Perser
c) Griechen
d) Römer
2) Strafende Gewalt in der Spätantike
a) Das Christentum und das Kreuz oder: Das Kreuz mit dem Christentum –augustinusund die konstantinsche Wende
b) Theodosius und Justinian
3) Strafende Gewalt im Mittelalter
a) Macht oder Mitleid –friedrich nietzsche zur Entscheidung
b) Germanisches Recht
c) Von den Karolingern zu den Staufern
α) Die Karolinger
ß) Sachsen (Ottonen) und Salier
γ) Die Staufer (im Umfeld der Nationalstaaten England und Frankreich)
Die Konstitutionen von Melfi
Literaturverzeichnis
Register der Autorinnen und Autoren
Register der Personen in Geschichte und Mythos
Bildnachweis
Anmerkungen
Bildtafelteil
Über den Autor
Über das Buch
Impressum
Hinweise des Verlags
Wiederum sah ich alles Unrecht an,
das unter der Sonne geschieht,
und siehe, da waren Tränen derer,
die Unrecht litten und keinen Tröster hatten.
Und die ihnen Gewalt antaten,
waren zu mächtig,
sodaß sie keinen Tröster hatten.
Pred 4,1
Siehst du, wie im Lande der Arme Unrecht leidet
und Recht und Gerechtigkeit
zum Raub geworden sind,
dann wundere dich nicht darüber;
denn ein Hoher schützt den andern,
und noch Höhere sind über beiden.
Pred 5,7
quia curare volo,
non accusare –
denn ich will heilen,
nicht anklagen.
Augustinus
Für meinen verstorbenen Freund,
Michael Longard,
Gefängnisseelsorger in Berlin.
Eugen Drewermann
»Ans Kreuz mit ihm« (Joh 19,14) oder: Ändert die Welt
Die ihn hingerichtet sehen wollten, wähnten sich im Recht. Sie glaubten, damit Gott zu dienen. Ihrem Gott, im Gegensatz zu seinem. Der Unterschied war eklatant; er stellte sich in ihren Augen dar als Wahl zwischen Recht und Ordnung oder Anarchie und Chaos, zwischen Gerechtigkeit vor dem Gesetz oder Großzügigkeit nach eigenem Ermessen, zwischen einem verbindlichen Regelwerk für alle oder einem Freibrief individueller Ausnahmen von Fall zu Fall. In seinen Augen war es eine Wahl zwischen Gesetz und Gnade, zwischen Verurteilen und Verstehen, zwischen Strafen und Vergeben. Was gilt? Was sollte gelten?
An dieser Frage schieden sich und scheiden sich damals wie heute die Geister; doch ist sie’s wirklich wert, die eigene Existenz dafür aufs Spiel zu setzen? Der Mann, auf den das Christentum sich gründet, meinte: Unbedingt! Denn woraus lebt ein Mensch? Er braucht den Atemwind der Freiheit; er läßt sich nicht einengen in den Fesseln fertiger Reglements und gußeiserner Satzungen; er darf die eigene Verantwortung nicht delegieren an ein Netzwerk fremder Anordnungen und Verordnungen. »Durch sein Leiden und Sterben am Kreuz hat er die Welt erlöst«, lehrt das christliche Glaubensbekenntnis.
In der Tat: Erlösen wollte Jesus die Menschen seiner Zeit und aller Zeit von einer Welt der Angst und Schuldgefühle, der Nicht-Berechtigtheit und steten Leistungsforderung, der Abgelehntheit und der Selbstpreisgabe, der Außenlenkung und Entfremdung, der Doppelbödigkeit und Unaufrichtigkeit, mit einem Wort: von der Tragik und dem Unglück jenes Grundgefühls, nicht sein zu dürfen außer durch die prompte Einhaltung bestimmter sozialer Normen und durch die Darbringung gesellschaftlichen Nutzens. In Jesu Nähe sollten Menschen sich zum Dasein zugelassen fühlen, als akzeptiert, erwünscht, gemocht; in seinen Worten sollten sie etwas vernehmen, das die umgebende Natur in der Stringenz ihrer Gesetze ihnen ebenso wenig sagen kann wie die Gesellschaft und Kultur, der sie entstammen: »Du bist, weil ich dich liebe; nur diese Liebe ist der hinreichende Grund dafür, daß es dich gibt; alle ursächlichen Zusammenhänge der Natur bedingen allenfalls gewisse unerläßliche Voraussetzungen deines Daseins, dich aber liebe ich bedingungslos und absolut dafür, daß es dich gibt, einfach weil es dich gibt. Dies sei daher fortan dein Selbstgefühl: In meiner Liebe lebst du leicht und unbelastet, befreit von allen Selbstvorwürfen und Infragestellungen.« Die Stimme, die so spricht, jenseits aller Natur, jenseits jeder Gesellschaft, ist selber absolut und unbedingt, sie ist in Jesu Mund die Stimme Gottes.
Ein solches Wort des Göttlichen zu jedem Menschen wollte Jesus sein; in seiner Art zu leben und zu wirken trachtete er es zu verkörpern; wo er war, bildete sich eine Stätte von Vertrauen und Geborgenheit, und seine Worte, seine Hände legten sich begütigend und lindernd auf den Kummer und das Leid der Seele wie des Körpers all der Menschen, die sich an ihn wandten. Denn dies war seine feste Überzeugung: Menschen können nur richtig leben im Einklang mit sich selbst. Wie denn soll stimmen, was sie tun, wenn sie sich selber nicht gehören? Wenn sie sich selbst kaum kennen, weil sie nie sein durften, was ihnen innerlich entsprochen hätte? Wenn sie sich zu verhalten hatten entsprechend den Verhältnissen, die sie wie schicksalhaft umgaben? Eine gestohlene Kindheit, ein erpreßtes Erwachsenseinmüssen, ein Zerrissensein zwischen Sehnsucht und Zwang, – auf der Flucht hinein in die Nötigungen der anderen, auf der Flucht zugleich weg von den Überforderungen der anderen, nirgends zu Hause, nicht draußen, nicht drinnen … Zu solchen sprach Jesus, sie sollten kommen zu ihm, denn was er ihnen bringe, sei leicht zu tragen und beglückend (Mt 11,28–30)1. Für diese Ausgesetzten und Ausgeplünderten trat Jesus ein. Denn in der Leere ihres Herzens fand er das notvolle Verlangen nach jener unbedingten Liebe, die nur in Gott wohnt, jenseits dieser Welt, doch unentbehrlich, um inmitten dieser Welt sich selbst zu finden und nicht wieder zu verlieren. Im Namen Gottes glaubte Jesus unendlich viel mehr an jeden Einzelnen, der zu ihm kam, als dieser an sich selber jemals hätte glauben können. Für ihn ging es nicht anders: Er wurde radikal. Er wurde revolutionär.
Denn so sah er die Welt: nicht länger aus der Sicht der Arrivierten und Etablierten, sondern aus der Perspektive der Entfremdeten und Ausgestoßenen, der sich Verlierenden und Fallengelassenen, der Verirrten und Verwirrten. Auf dem Bodensatz jeglicher menschlichen Not entdeckte er die so oft verleugnete, oft gar verbotene Notwendigkeit der Gnade. Und gerade dieser Glaube an eine Güte, grundlos, von Grund auf, den Abgrund unter unseren Füßen schließend, erwies sich als gefährlich für die Grundsätze der bürgerlichen Ordnung. Der Konflikt war notwendig; er ließ sich nicht vermeiden.
Verankert in der Tradition von Ethik und Jurisprudenz, stützt sich das Weltbild aller ordentlichen, angepaßten Bürger auf zwei einfach scheinende Gewißheiten: 1) der Mensch ist frei, zu wählen zwischen Gut und Böse; und 2) was gut und böse ist, besagen die Gesetze, die entweder Gott (Jahwe am Sinai, Allah im Koran), ein göttlicher Kulturheros (Osiris, Gilgamesch, Prometheus), ein Herrscher in geschichtlichen Zeiten (Hammurapi, Solon, Lykurg, Augustus, Karl der Große, Napoleon) oder der Wille des Volkes (Kleisthenes um 508 v. Chr., die Bill of Rights 1776) festgelegt und öffentlich zu wissen kundgetan haben. Diese Gesetze regeln das Zusammenleben aller, die sich der jeweiligen Gemeinschaft (der Religion, des Staates, der Kultur) zugehörig fühlen; wer gegen sie verstößt, fügt der Gemeinschaft und der sie tragenden Autorität (des Gottes, des Herrschers, der Verfassung) Schaden zu; deswegen steht er in der Pflicht, den entstandenen Schaden entsprechend seiner Größe wiedergutzumachen. Da er als Täter für frei gilt, hat er bewußt und willentlich in der Wahl zwischen Gut und Böse sich offenbar für das Böse entschieden; deswegen ist er nicht nur haftbar für die Folgen seines Tuns, er ist vor allem schuldig als Urheber seiner Tat; nach Maßgabe des Rechts gehört er dafür bestraft. Gesetze, die sich straffrei übertreten lassen, besitzen keinerlei Rechtswirksamkeit; in Geltung sind sie nur als strafbewehrt, und um so strenger muß die festgelegte Strafe ausfallen, als das Gesetz, das übertreten wurde, an Bedeutsamkeit besitzt.
Einander gegenüber stehen also die einzuhaltenden Bestimmungen der Gesetzesvorschriften und das Tun des Straftäters, und aus dieser Beziehung ergibt sich mit der Schwere der Schuld auch die Schwere der Strafe. Die Göttin der Gerechtigkeit trägt (seit dem 16. Jh.) eine Augenbinde: sie achtet nicht auf die Person des Täters, sie wägt auf ihrer Waage das Gewicht der Schuld, und sie verhängt mit ihrem Schwert die Strafe, sie zu ahnden. Sie selber ist, will dieses Bild besagen, von allem subjektiven Urteil unabhängig; sie achtet nicht des Standes und der Wertschätzung des Täters in der öffentlichen Meinung, sie ist allein am Richtspruch des Gesetzeswortlauts interessiert; sie ist als objektiv, universell und unanfechtbar zu erachten.
Mit dieser Ansicht von »Gerechtigkeit« beruhigt sich das Bewußtsein des loyalen Bürgers. Doch genau gegen diese selbstverständlich scheinende political correctness der öffentlichen Meinung und des veröffentlichten Staatsgesetzes richtet sich die Grundeinstellung und die Praxis Jesu, und zwar nicht als das Ergebnis staatspolitischer und rechtsphilosophischer Theorien, sondern auf Grund einer simplen menschlichen Evidenz: Gesetze, die nichts weiter als das äußere Verhalten regeln, können allenfalls ein Stück weit die Symptome der Verstörung im Herzen eines Menschen eindämmen, sie werden der Krankheit tief drinnen niemals Herr werden. Vor allem: wenn wirklich, wie man es in Israel glaubt, der Gott vom Sinai die 613 Gesetze des Moses erlassen hat, so liefe es auf ein schlimmes Mißverständnis hinaus, sie rein äußerlich zu nehmen. Gott schaut nicht auf die Hände, sondern in das Herz des Menschen, und was er sagt, läßt sich allein von innen her begreifen. Deshalb formuliert der Mann aus Nazareth in den berühmten Antinomien der Bergpredigt (Mt 5,21–48)2 sein »Ich aber sage euch« gegen das äußere Gebotsverständnis der Gesetzeslehrer. »Du sollst nicht morden!« – heißt es da zum Beispiel (Mt 5,21). Doch wann beginnt man, einen Menschen umzubringen? Man kann es tun mit Messer und mit Gift, doch was im Vorlauf einer solchen Tat staut sich an Haßgefühlen auf, an Verachtung, an Verwünschungen? Wie geht man mit den eigenen Aggressionen um? – Oder: »Du sollst nicht ehebrechen!« (Mt 5,27) Was ist zu tun, wenn die Verbundenheit eines Paares nach und nach zerfasert und die Gefühle sich umherschweifend auf Wanderschaft begeben? Nur wer im eigenen Herzen Ordnung schafft, kann auch nach außen Ordnung halten. Ordnung im Inneren jedoch kann man nicht mit Gesetzen und mit Strafandrohungen erzwingen, sie kann nur reifen in der Einheit eines Menschen mit sich selbst.
»Wenn euere Vorstellung von Gerechtigkeit sich nicht vollkommen unterscheidet von den Vorstellungen der Thorajuristen, werdet ihr niemals in die Wahrheit Gottes (ins ›Himmelreich‹) eintreten«, erklärte deshalb Jesus (Mt 5,20)3. Es geht nicht darum, im Namen des Rechts recht zu haben und zu behalten gegen den anderen; was sich von Gott her im »Gesetz« ausspricht, ist die Beauftragung, der Not des anderen hilfreich gerecht zu werden. Denn davon war der Mann aus Nazareth im eigentlichen überzeugt: hilfreich für den am Boden Liegenden ist nicht ein Gott der Strafe – ein solcher kann einen Gefallenen nur vollends bis zum Staub erniedrigen –, aufrichten kann einen solchen allein der Zuspruch einer unbedingten Güte, die ihn versteht und mit ihm geht.
An dieser Stelle ging der Weg, den Jesus einschlug, in die genaue Gegenrichtung zu den Mahnreden seines prophetischen Lehrmeisters Johannes des Täufers am Jordan. Auch dieser suchte die Einhaltung der göttlichen Gesetze zu verinnerlichen, doch geschah das bei ihm in Form eines ethischen Rigorismus im Schatten drohender Gerichtsvisionen: Gott wird, so seine Botschaft, unnachsichtig strafen einen jeden, der sein Leben nicht dramatisch ändert. Ein willentlich abgerungenes Rechtverhalten in Angst und Askese war das, was der Täufer als »Umkehr« verstand. Ganz anders Jesus. Als er sich im Jordan taufen ließ, erzählt die Legende (Mk 1,9–11)4, sah er den Himmel offen, und er hörte eine Stimme zu ihm sagen: »Du bist doch mein Sohn.«
Jeremia hatte so gedacht, als er von der Notwendigkeit eines Neuen Bundes sprach, den Gott mit seinem Volke schließen müsse (Jer 31,31–34)5: solange seine Gesetze nur in Stein gemeißelt in der Bundeslade lägen, blieben sie den Menschen äußerlich, ein Ausdruck furchteinflößender Gewalt und einzuhalten nur in dem Gefüge von Gewohnheit und Gehorsam. Was der Prophet im 6. Jh. v. Chr. als Einsicht aus dem Untergang Jerusalems gewann, läßt sich vor allem psychologisch gut verstehen: Ein Zustand bloßer Heteronomie und Autoritätsabhängigkeit läßt Menschen nicht mit sich zusammenwachsen, er schafft überhaupt erst die Gegensätze und Konflikte zwischen Müssen und Mögen, zwischen Kultur und Natur, zwischen Überich und Es, denen mit dem Zwang eines in sich zerspaltenen moralischen Willens nicht beizukommen ist. Eine Frömmigkeitsform der Einschüchterung und des Schuldvorwurfs tut nicht gut, sie macht krank, sie verschärft den Widerspruch von außen und innen, statt ihn zu lösen; sie erschafft ein unglückliches Bewußtsein zwischen Selbstverachtung und Selbstüberhebung, zwischen Strafangst und Stolz, zwischen Frustration und Perfektionsstreben. Um den Menschen mit sich selber zu versöhnen, muß Gott innerlich, im Herzen des Menschen, sich als »Verbündeter« erweisen, das heißt, er muß unmittelbar zugänglich sein, nicht erst erreichbar in den gelehrten Expertisen der Gesetzesinterpreten; er muß als persönlich ansprechbar empfunden werden, und diese persönliche Begegnung zwischen Gott und Mensch darf nicht delegierbar sein an den komplizierten Instanzenzug behördlicher Institutionen. Vor Gott sollte die Eigenständigkeit und Mündigkeit des Einzelnen bestärkt werden, statt daß Gott selber die Funktion der Außenlenkung und der Unterwerfung übernähme. Die zentrale Zuversicht des Jeremia, das Grundkonzept des Neuen Bundes, lautete: Gott straft nicht länger, um sein Volk zu züchtigen, Gott wird vergeben alle Schuld (Jer 31,34). Er wird geduldig und begleitend mit uns gehen. Und niemals wird er jemanden verloren geben. »Kann denn«, wird wenig später der Zweite Jesaja in gleichem Sinne sprechen, »eine Mutter ihrer Kinder vergessen? Und könnte eine Mutter ihrer Kinder vergessen, – ich, Gott, vergesse dein nimmer!« (Jes 49,15)
In die Fußstapfen dieser Propheten eines Gottes der Güte trat mit Entschiedenheit Jesus, als er das Vertrauen in die absolute Vergebensbereitschaft in den Mittelpunkt seiner öffentlichen Verkündigung stellte. »Kehrt um« (Mk 1,15)6 – damit verband er nicht länger mehr im Sinn des Täufers strengste Selbstkontrolle in genauer Einhaltung der göttlichen Gesetze, sondern eine Umformung der gesamten Lebensausrichtung von Angst in Geborgenheit, von steter Selbstrechtfertigung durch Opfervorleistungen in die ruhige Zuversicht, vor Gott von Grund auf akzeptiert zu sein, von der furchtsamen Hörigkeit auf den genauen Wortlaut der Gesetzesvorschriften in eine kreative Menschlichkeit im Umgang miteinander. Solange Menschen die Erfüllung äußerer Verordnungen für die Grundlage ihrer Daseinsberechtigung nehmen, werden sie alle Gefühle und Handlungen daraufhin befragen, ob sie mit bestimmten Anordnungen und Handlungen übereinstimmen oder von ihnen abweichen. Nicht wer der Mensch an ihrer Seite ist und wie er sich befindet, steht zur Debatte, sondern allein die Frage stellt sich, wie das, was jemand tut, gesetzlich als geboten oder als verboten zu betrachten ist.
Jede menschliche Beziehung reduziert sich in einer Gesetzesreligion auf diesen verengten Bewertungsmechanismus, und ebenso in der Wahrnehmung gewisser Verfehlungen im Rahmen der bürgerlichen Gesellschaft. Die Beurteilung des beobachtbaren Tuns entsprechend den Regularien aus Ethik und Justiz steht da im Vordergrund, und die Frage nach dem Täter tritt dahinter weitgehend zurück. Der Mensch, der je nach seiner Tat beurteilt wird, ist selber nur noch durch das Okular des vorwerfbaren Fehlverhaltens zu betrachten.
Das aber wurde nun zur Frage Jesu, was wir wirklich wollen: helfen oder verurteilen. Wollen wir über den anderen den Stab brechen, so können wir uns zweifelsohne als die Guten im Kontrast zu jenem Bösen von Grund auf nur bestätigt fühlen: indem wir ihn verurteilen, wenden wir uns von ihm ab und versichern uns gegenseitig, von diesem Verurteilten so weit als denkbar verschieden zu sein. Vor allem: wenn es die Gesetze Gottes sind, nach denen ein solches Urteil zu fällen ist, wird aus Gott selber nach Maßgabe seiner Gerechtigkeit der Trennungsgrund der absoluten Einteilung der Menschen in die Guten und die Bösen. Doch kann das, darf das wirklich sein?
Nach Jesu Meinung sollten wir uns nicht von Menschen, die schuldig geworden sind, abwenden; abkehren sollten wir uns vielmehr von der gesamten Denkweise, die uns gebietet, nach göttlichen Geboten übereinander zu Gericht zu sitzen. Nicht verurteilen sollten wir die Schuldiggewordenen, sondern ihnen beistehen. Denn das allein sei es, was Gott wirklich gebiete. Alle Gebote sonst seien so viel wie die Symptomzusammenstellungen möglicher Erkrankungen, ein diagnostisches Kompendium, um klar zu sehen, woran jemand leidet, ein erster Anhaltspunkt also, entsprechend seinem Leiden seinen Schmerz zu lindern. Vom Strafen sollten wir zum Heilen finden. Das war zentral des Nazareners Botschaft. Doch derart umzudenken ist nicht einfach.
Gewisse Denkschablonen zur Bewertung menschlichen Verhaltens sind allgemein verbreitet und tief eingebürgert; insbesondere in Gesellschaften göttlichen Rechts gelten sie religiös als sakrosankt; in ihnen ist Gott, sein Gesetz und das Zusammenleben »seines« Volkes miteinander sachidentisch. Es kam von daher einem Sakrileg, dem schlimmsten aller denkbaren Verbrechen, gleich, wenn Jesus diese Einheit von Volk und Frömmigkeit, von Staat und Religion, von Moralgesetz und Gottesdienst im Umgang miteinander aufhob. Das gesamte bürgerliche Leben stellte seine Einsicht auf den Kopf, daß vor Gott die so beliebte Einteilung in Gute und in Böse nicht länger mehr in Geltung stehen kann. »Gott läßt die Sonne aufgehen über Gute und Böse, und er läßt es regnen über Gerechte und Ungerechte« (Mt 5,45).7 Das waren seine Worte. Die Stacheldrahtverhaue und Gefängnismauern, die Menschen zwischen Freund und Feind und zwischen Bürger und Verbrecher zum Zwecke der verordneten Gerechtigkeit errichten, sind demnach hinfällig unter dem weiten Himmel Gottes, der allen Atem schenkt und Leben gibt. Die Wolken, die dort droben ziehen, die Sterne, die am Himmel wandeln, kennen nicht die Barrieren, die uns die Angst und Enge unseres Herzens als Schutzwall vor einander zu bauen anempfehlen. Sie niederzureißen im Vertrauen auf die Güte Gottes ist das einzige »Gebot«, das in Wahrheit aus all den Gesetzen Gottes spricht. »Liebe Gott mit allen Kräften deiner Seele, und so geh’ auf den Menschen an deiner Seite zu« (Mk 12,30; Lk 10,27).8 Ein ähnlicher Gedanke findet sich zeitgleich wohl auch bei Rabbi Hillel, doch da diskutierte man, wer denn »der Nächste« sei, den es zu lieben gelte, – ist das der Volksgenosse oder auch ein Nicht-Israelit, ein Samariter par exemple oder gar ein Heide, etwa ein Römer, der schon durch seinen Aufenthalt in Israel den Boden des Gott geweihten Landes verunreinigt?
Keiner der jüdischen Gesetzeslehrer hätte es entfernt auch nur gewagt, den Sperrzaun der Gesetze selber zu durchbrechen, um der Not der Menschen aufzuhelfen. Religion nicht länger mehr als Ethik und als Staats- und Strafgesetz, sondern als Suspension des Ethischen, als Aufhebung des Strafgesetzbuches zugunsten einer hilfsbereiten Suche nach all den Verlorenen, nur so schien Jesus Rettung möglich. – Eigentlich ist diese Wahrheit evident.
Stimmt es denn überhaupt, daß Menschen, die nach Gesetzesmaßstab Böses tun, auch wirklich Böses wollen, – daß sie mithin auch böse sind? Kein Zweifel, was Menschen Menschen antun, kann entsetzlich sein in seiner Grausamkeit, in seiner Hinterhältigkeit, in seiner absichtsvollen Zufügung von Qual und sinnloser Zerstörung; doch alles Böse, das geschieht, hat tiefliegende Ursachen, und wer sich da hineingräbt, dem zerbricht bei seiner Untertagearbeit mit Hacke und mit Schaufel alsbald der leicht geschwungene Richtstock der gesetzlichen Bewertung. Er trifft dort drunten, in den Gebirgsverwerfungen der Seele, unfehlbar Jeremia wieder, so wie Jesus ihn verstand: »Gut«, mithin zur Güte fähig, wird ein Mensch niemals durch Aburteilen und Abstrafen; zum Gutsein reift ein Mensch allein heran in einer Güte, die ihn zweifelsfrei, bedingungslos und nicht-ambivalent umfängt und die sogar in seiner Schuld sich inniger womöglich noch mit ihm verbunden fühlt denn weniger. »Strafe« – das ist, wenn ein Kind spürt, daß es der Mutter weh getan oder ihr Kummer bereitet hat; dann ist es, wie wenn Wolken sich vor die Sonne schöben und es spürbar kühler wird; Strafe – das ist eine Eintrübung der ungetrübten Einheit, die ein jedes Kind im Grunde mit seiner Mutter sucht. Solche Strafen dienen allein der Klarstellung und der Bekräftigung der Spielregeln, die fairerweise im Zusammenleben gelten. Ein Kind, das diese Regeln wie mit Absicht stört, ist selbst gestört, und diese Störung gilt es zu erkennen und geduldig durchzugehen. Daraus folgt das Entscheidende: Wer Unrecht tut, braucht mehr an Liebe, nicht ein Mehr an Strafe.
Was Jesus mit dieser seiner Ansicht aufhob, weil er es für unbrauchbar, ja, schädlich hielt, war das Prinzip der Entsprechung von Lohn und Verdienst einerseits sowie von Bestrafung und Vergehen andererseits9. In der Kulturgeschichte der Menschen ist dieser Schritt einzigartig, ein absolutes Spezifikum und Charakteristikum der Botschaft Jesu, das einen Vorläufer – neben Jeremia! – allenfalls in dem griechischen Weisen Sokrates findet10. Ihn verurteilten im Jahre 399 die Richter von Athen wegen eines vergleichsweise ähnlichen Verbrechens zum Tode; auch er hatte mit seiner Auffassung von Gut und Böse mittelbar die Strafjustiz in Frage gestellt. Denn er lehrte, daß es besser sei, Unrecht zu erleiden als Unrecht zu tun11. Wenn es so steht, bestraft jemand, der Unrecht tut, letztlich sich selber; sein Opfer, recht verstanden, muß deshalb keine Wiedergutmachung einklagen, denn das Leid, das sich der Übeltäter selbst zufügt, wiegt schwerer als der Schmerz, den er dem anderen zufügt.
Das paradoxe Theorem des Sokrates machte das uralte Prinzip der Strafjustiz logischerweise obsolet und machte seinen Urheber zu einem Staatsfeind Nummer eins. Jesus argumentierte nicht philosophisch, sondern religiös: Wie könnte Gott denn jemanden, den er doch selbst ins Dasein rief, verloren geben? Er müßte sich dann eingestehen, in seiner eigenen Schöpfung ein Gescheiterter zu sein. Dergleichen ist nicht vorstellbar. Wer Gott verstehen will, meinte Jesus, der sollte ihn sich nach Art eines Hirten vorstellen, der, wenn er abends merkt, daß ihm von seiner Herde wieder mal ein Tier abhanden kam, es suchen geht und, wenn er’s findet, auf seinen Armen zu den anderen zurückträgt (Lk 15,1–5)12. Niemals wird so ein Hirte glauben, daß sein Schaf sich absichtlich verlaufen habe, – es hat sich verirrt, es hat den Kontakt zu den anderen verloren, das ist alles; »Verlorenheit« meint in der Hirtensprache des Hebräischen genau das, was die Theologen »Sünde« nennen, »Verzweiflung« gibt im Deutschen das Gemeinte wohl am besten wieder13.
Ein einziges solches Wort bereits verändert alles. Wer von »Vergehen«, »Sünde« oder »Schuld« spricht, verbleibt noch immer in dem Rahmen des Moralischen und des Justiziablen: jemand hat freiwillig Böses verübt, er ist dafür verantwortlich, er kann und muß die Richtung seines Willens ändern, und um ihm das zu zeigen, gilt es, in aller Schärfe die Bestimmungen des Strafgesetzbuches in Anwendung zu bringen. Ganz anders jetzt: Einem »Verlorenen« oder »Verzweifelten« ist nicht mit Vorschriften und Paragraphen beizukommen; was er braucht, ist jemand, der, wie im Gleichnis Jesu, den Weg mit ihm noch einmal nachgeht, auf dem er sich verloren hat. So macht es Gott mit uns, und so sollten auch wir es machen im Umgang mit den Straffälliggewordenen. Was Jesus damit fordert, ist nichts Geringeres als die Beseitigung der allerorten üblichen Praktik, Menschen moralisch zu bemessen und juristisch abzustrafen.
Was umgekehrt ihm unter dem »Reich Gottes« vorschwebte, ergibt sich wie von selber aus der Einsicht in die Gründe des sogenannten Bösen im Herzen eines Menschen. Sie alle haben ihre Ursache in dem Gefühl, als Person nicht, wie notwendig, geliebt zu sein, und sie lassen sich nur beseitigen, indem man sie in allen Negativerfahrungen nach und nach widerlegt. Das »Böse« läßt sich nur beseitigen, indem man es in einer therapeutischen Grundhaltung durcharbeitet oder, besser, überliebt.
Wie das geschehen kann, erläutert Jesus in der Bergpredigt (Mt 5 – 7). Sie wäre gänzlich falsch verstanden, wenn man in ihr, wie es gemeinhin wohl geschieht, eine Art Überethik – ganz im Sinne einer johanneischen Gesetzesradikalisierung – sehen wollte; sie ist in Wirklichkeit das Gegenteil zu aller Ethik, indem sie schildert, wie das Dasein sich verwandelt, wenn es, statt wie bisher von Angst, nunmehr von Zuversicht geprägt wird: es heilt dann wie von einer seelischen Erkrankung, die anders das gesamte Leben in Unentrinnbarkeit gefangen hielte und oft genug sich auch in körperlichen Phänomenen niederschlagen müßte14.
Gerade so interpretiert der Evangelist Matthäus die Worte Jesu, die er in der »Bergpredigt« zusammengestellt hat und die er umrahmt mit einem zweifachen Hinweis: zum einen auf all die Kranken, die von weither sich zu Füßen Jesu versammeln (Mt 4,23–24)15, und zum anderen auf die Kette von Heilungen, die sich ereignen, als er vom Berg, der wie ein zweiter Sinai ist, herabsteigt zu den Menschen, die in ihrer Not seiner bedürfen (Mt 8,1–4; 8,5–13; 8,14–17)16; an die Stelle furchtsamer Gesetzesstrenge tritt eine Haltung, die den Menschen gut tut und die sie therapeutisch bis in all die psychisch und psychosomatisch bedingten Krankheitsformen der Angst hinein hilfreich und heilsam umgreift. Wer Menschen verstehen und begleiten will, muß aufhören, ihnen ihr Unheil und ihr Unglück, ihr Scheitern und ihr Zerbrechen moralisch auch noch vorzuwerfen und gerichtlich bloßzustellen.
Es ist diese sozusagen ärztliche (»erlösende«) Einstellung, die sich unmittelbar aus dem unbedingten Vertrauen in die Güte Gottes ergibt: So wie das ganze Dasein des Menschen in seinen Händen liegt, so wird es auch in aller Schuld darin geborgen bleiben. Entgegen dem Urteilsspruch der strafenden Gerechtigkeit spricht Gott über denjenigen, der sich vergangen hat, das Wort, das es in keinem Codex von Gesetzen geben kann: das Wort des Freispruchs, der Vergebung, der neu sich öffnenden Ermöglichung zum Weiterleben, – der Kraft, im Angesicht der Fehlerhaftigkeit und Unvollkommenheit des Daseins überhaupt dies Leben anzunehmen.
Daß Gott vergibt, bedingungslos, weil er um unsere Schwachheit weiß, ist die zentrale Überzeugung der gesamten Botschaft Jesu. »Alles mußt du uns vergeben, weil wir sonst nicht leben könnten«, – so müßte man die Vater-unser-Bitte wohl umschreiben (Mt 6,12)17. Und gleichzeitig folgt daraus die unbedingte Bereitschaft, auch untereinander alle Schulden zu vergeben. Wer weiß, daß er nur existiert, weil ihm alles vergeben wurde, der kann nicht, wie der Schalksknecht in dem Gleichnis Jesu (Mt 18,21–35)18, dem anderen für läppische Beträge an die Gurgel gehen. »Gerecht« ist das Prinzip der Vergebung nicht, es ist im Gegenteil so viel wie ein systematisierter Betrug, wie eine Urkundenfälschung in der Buchführung von Soll und Haben, doch es ist unsere einzig verbleibende Rettung, sollte Gott mit uns ins Gericht gehen, wie Jesus in dem Gleichnis vom ungetreuen Verwalter zum Schrecken aller rechtgesinnten Thorajuristen verdeutlicht (Lk 16,1–9)19.
Und nicht allein aus der Stellung vor Gott, auch aus dem Verhältnis zueinander ergibt sich die Notwendigkeit der Vergebung. Jene gesetzestreue Spaltung der Menschen in die Guten und die Bösen ist, gelinde gesagt, ein grandioser Selbstbetrug, denn schon im Wurzelwerk der eigenen Motive ist untrennbar das eine mit dem anderen verflochten. Die Saat auf den Halmen vom Unkraut zu säubern, ist ein terroristisches Programm umfassender Zerstörung, das Jesus seinen Jüngern ausdrücklich untersagt (Mt 13,24–30)20.
Doch die Neigung gerade der »Guten« scheint unausrottbar, ihr ungütiges Gutsein darin auszuleben, daß sie die eigenen Fehler gnadenlos in anderen bekämpfen möchten. Um sich nicht selbst zu hassen, verschieben sie die Aggressionen ihrer verinnerlichten Strafinstanzen auf ihre Gegner, bei denen sie überscharf wahrnehmen, was sie bei sich selber zu sehen tunlichst vermeiden. Den »Splitter im Auge« des anderen herauszuziehen, erspart die Mühe, sich um den »Balken« im eigenen Auge zu kümmern (Mt 7,3–5)21. Steckt nicht in all der Selbstgewißheit des Strafens diese Selbstberuhigung des inneren Zwiespalts in der eigenen Seele? Statt das »Böse« in sich selber zu integrieren und zu einer geschlossenen Persönlichkeit heranzuwachsen, setzt eine projektive Verfolgungsjagd ein, die sozial wie politisch die Zerspaltenheit untereinander in immer fatalere Konsequenzen treibt. »Richtet ihr überhaupt nicht«, dieser Satz, auf den die Bergpredigt wie auf ihren abschließenden Höhepunkt hinausläuft (Mt 7,1–2)22, bietet die einzig denkbare Rettung aus dem selbstgeschaffenen Dilemma aller Strafjustiz.
Was Jesus damit allerdings riskiert, liegt auf der Hand. Er hebt, wie er betont, den Sinn der Gesetze nicht auf, er schafft vielmehr überhaupt erst die Voraussetzung dafür, daß Menschen auch in moralisch-juridischem Sinne sich normengerecht verhalten, also von innen her »gut« sein können (Mt 5,17–18)23; aber der Vorwurf der Anklage, das vernichtende Urteil über das Gesamtkonzept seiner Art von Gottesverkündigung meldet sich augenblicklich auf seiten der Schriftgelehrten und der Sadduzäer zur Stelle. Das Markus-Evangelium ist gerade erst drei Kapitel alt, da steht es den politischen wie religiösen Instanzen fest: er muß verrückt sein oder vom Teufel besessen, er gehört, mit einem Wort, in die geschlossene Abteilung einer Psychiatrie oder aber gleich auf den Scheiterhaufen (Mk 3,6.21–22)24. Auch Jesus selber erklärt, daß das, was er bringt, eine radikale Neuerung darstellt, die sich nicht durch Flickschusterei mit dem Althergebrachten verbinden läßt (Mk 2,21–22)25, eine Revolution, nicht des gewaltsamen Umsturzes, sondern eines ebenso sanften wie folgenschweren Umdenkens.
Wer irgend beginnt, die Welt zu sehen mit Jesu Augen, dem erscheint hohl und morsch, was da so prall und prachtvoll zwischen Thron und Tempel, zwischen Herrschermacht und Religion den Bürgern wie den Gläubigen an Rechten und Gesetzen dargeboten wird. »Der ist des Todes schuldig.« Wie häufig fand und findet sich der Satz in den Strafgesetzbüchern antiker wie moderner Staaten! »Der wird mit Kerkerhaft nicht unter soundsoviel Jahren belegt.« Wer gibt den Richtern in der Amtstracht ihrer Roben die Legitimation, mit Menschen derart zu verfahren? Der Staat, dessen Diener sie mit ihrer »Rechtsprechung« sind, hat ihnen die Befugnis erteilt, doch woher bezieht der Staat das Recht dazu? Im Alten Orient von der Gottheit, die in dem Herrscher erscheint und als deren Sohn dieser gilt. Doch eine solche Gottheit dient allein der Ideologie des Machterhalts der Herrschenden. Gott sollte nicht dazu herhalten, Menschen in uniforme Untertanen zu verwandeln, er sollte ihnen die Kraft verleihen, sich aus dem Pulk der Menge herauszulösen und sich als Individuen, als Einzelne mit einer eigenen Beauftragung in ihrem Leben und mit einer eigenen Verantwortung für sich selber, als unvertauschbare Personen, im Gegenüber Gottes – gerade nicht der Allgemeinheit in Staat, in Kirche und Gesellschaft – nach Art der biblischen Propheten zu riskieren. »Man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen« (Apg 5,29).26
Dieser Satz des Petrus vor dem Hohenpriester zeigt überdeutlich, wohin die Gesinnung Jesu diejenigen führen wird, die ihm nachfolgen. »Sie werden euch vor Gericht stellen und euch aburteilen«, stellt er ihnen in Aussicht (Mt 10,17–19)27 und nennt gleichwohl glücklich all diejenigen, die um seinetwillen Verfolgung leiden (Mt 5,10)28, als sei diese Tatsache selber ein Wahrheitsbeweis für die Richtigkeit ihrer Lebensform. Was Jesus bringt, ist ein »Schwert«, das all die tradierten Ordnungen auflöst (Mt 10,34)29. Der Konflikt auf Leben und Tod um ein menschenwürdiges Leben in Freiheit, Achtung und Selbstbestimmung ist unvermeidlich.
Was die Schriftgelehrten in den Tagen Jesu als einen unverzeihlichen Affront und einen tödlichen Skandal erlebten, bestand in gleich zwei Grenzüberschreitungen. Zum einen erlaubte sich Jesus in prophetischer Kraft, das Gottesbild aus seinem patriarchalisch-autoritären Rahmen zu lösen und damit die Worte des Gesetzes in das Vertrauen einer unbedingten (maternalen) Güte zu stellen30; wie in den Tagen des Jeremia sollte Gott wieder beginnen, unmittelbar den Menschen ins Herz zu reden; die kasuistischen Kommentare der Rabbinen mit ihren endlosen Komplikationen und immer ausgedehnteren Weisungsabhängigkeiten erschienen nicht länger als Vermittlung zu Gott, sondern als Verhinderung der Gottunmittelbarkeit eines jeden Einzelnen. Und zum zweiten bedeutete dieser Schritt einen klaren Bruch mit der fest eingerichteten Gesetzestradition, die historisch zwar erst im und nach dem babylonischen Exil im 6. Jh. ausformuliert worden war, doch in jedem Jota als das Wort Gottes, durch Moses vermittelt, zu gelten hatte. Wer gegen diesen Kern des jüdischen Selbstverständnisses verstieß, verdiente als Anti-Moses, als Lügenprophet und als Diener des Teufels verurteilt zu werden. Das alles sind denn auch die Anklagepunkte, die im Prozeß gegen Jesus vorgebracht werden31.
Und ein noch »Schlimmeres«, Aufrührerisches lag darin: die entschiedene Verneinung der Heilsbedeutung des Tempels und der sadduzäischen Priesterschaft. Ein Gott, der keine Opfervorleistungen will noch braucht, um die Schuld der Menschen zu vergeben, benötigt keine Priester, die in einem geweihten Bezirk bei besonderen Anlässen nach gewissen kultisch korrekt einzuhaltenden Ritualvorschriften und Gebeten Tiere schlachten, um mit ihrem Blut eine ewig zürnende Gottheit von Augenblick zu Augenblick zu versöhnen. In Jesu Augen sind die Priester nicht nur überflüssig, sondern schädlich: Es muß sie nur solange geben, als sie die Angst der Menschen vor Gott ausbeuten und verwalten können; solange es die Priester gibt, kann es nicht, darf es nicht jenes kindliche Vertrauen geben, das Jesus lehrte und verkörperte. Zudem setzen die Priester in jeder Religion sich selbst und ihr Expertenwissen absolut: nur ihre Formeln bringen Heil und Segen, alle anderen Kult- und Religionsformen sind unter Androhung göttlichen Zornes zu verwerfen. So waren nach der Wiedereinrichtung des Tempels im 5. Jh. v. Chr. unter Esra und Nehemia die Samaritaner kategorisch aus dem israelitischen Kultverband ausgeschlossen worden. Es ist ein durch und durch antiklerikales Gleichnis, wenn Jesus in der Geschichte von dem barmherzigen Samariter schildert, wie ausgerechnet ein solcher Samariter Gott findet, indem er einem Schwerverletzten am Wegesrand aufhilft mit allem, was er kann, während ein Priester und ein Levit schon aus Reinheitsgründen an ihm vorübergehen (Lk 10,30–37)32.
Zudem ist der Jerusalemer Tempel nicht nur das Zentralheiligtum jüdischer Frömmigkeit, er ist auch die Zentralbank, in der die Tempelsteuergelder aus der gesamten jüdischen Diaspora zusammenfließen. Die Angstbindung der Gläubigen an die Priester erweist sich für diese als höchst profitabel. Was also will und meint man da – Gott oder Geld? Da müßte man sich wohl entscheiden (Mt 6,24)33. Als Jesus sieht, wie es im Tempel zugeht, folgt er ein zweites Mal seinem Vorbild Jeremia, der den Tempel eine Räuberhöhle genannt hatte (Jer 7,1–15): Im Tempelvorhof wirft er die Geldwechsler und Opfertierhändler hinaus (Mk 11,15–19)34. Alles, was die Hohenpriester da treiben, verfälscht Gott, – es gehört abgeschafft. Wenn es noch eines Grundes für die Hüter tradierter Frömmigkeit bedurft hätte, Jesus aus dem Weg zu räumen, – spätestens mit dem demonstrativen und provokativen Akt der Tempelreinigung war für sie das Maß voll. Ihr Entschluß stand fest. Das Problem bestand freilich, daß Todesurteile zwar vom Hohen Rat verhängt, doch nur von der römischen Besatzungsmacht exekutiert werden konnten. Und innerjüdische Auseinandersetzungen in religiösen Fragen betrachteten diese Heiden als kaum verstehbar und auch wohl als überflüssig. Man durfte ihnen Jesus nicht als einen religiösen, man mußte ihn als einen politischen Revolutionär präsentieren. Nur wie?
An keiner Stelle der Evangelien wird ein Wort aus dem Munde Jesu überliefert, das gegen die Römer gerichtet wäre oder gar zur gewaltsamen Guerilla gegen sie aufriefe. Wohl befindet sich im Kreise der Zwölf auch ein ehemaliger Bandenkämpfer, Judas, der »Eiferer« (Mk 3,18), doch desgleichen hat Jesus mit dem Zöllner Levi auch einen aus der Gruppe der bei den Orthodoxen am meisten verhaßten Kollaborateure Roms aufgenommen (Mt 10,3), wie er denn überhaupt als »Freund der Zöllner und Sünder« (Mt 11,19)35 sich verhaßt und suspekt gemacht hatte.
Eine Frage, die immer wieder in Israel seit dem Einzug des Pompejus im Jahre 63 v. Chr. hin und her diskutiert wurde, war das Problem der Erlaubtheit beziehungsweise der Verpflichtung, an den Kaiser Steuern zu zahlen. Mit genau diesem Problem konfrontierten Jesus die Herodianer und die Pharisäer, um daraus eine unentrinnbare Falle zu konstruieren. Vermöchte man ihm die Aussage zu entlocken, man solle getrost dem Kaiser die geforderten Steuern entrichten, so wäre er bei allen messiastheologisch Denkenden im Lande untragbar; ließe er sich hingegen zu der Behauptung verleiten, man müsse um Gottes willen dem Kaiser die Steuern verweigern, so könnte man ihn leichthin als einen gefährlichen Rebellen denunzieren. Jesus forderte in seiner berühmten Antwort dazu auf, die Steuer sang- und klanglos abzuführen, darüber aber niemals zu vergessen, daß Gott, mehr als der Kaiser sein Bild auf einen Denar, sein eigenes Bild in das Herz eines jeden Menschen geschrieben hat; ihm gehören sie ganz, – politische Herrschaftsverhältnisse sind relativ und ändern daran absolut gar nichts (Mk 11,13–17)36.
Gleichwohl legte man dem Prokurator Pilatus genau dies als Anklage gegen Jesus vor: er habe zum Steuerboykott aufgerufen und überhaupt das ganze Land in Aufruhr versetzt (Lk 23,1)37; aus der zutiefst religiösen »Umkehr« der Botschaft Jesu stilisierte man einen politischen Aufruhr. Und man setzte, nicht ungeschickt, dabei auf die Zweideutigkeit der traditionellen Messiaserwartung in Israel. Wer ist er, der von Gott verheißene »Gesalbte«, der kommende »Sohn Davids« (Mk 12,35–37)38? Wenn er erscheint, wird er die Römer wie Korn im Mörser mit dem Stößel zermalmen, glauben die einen; wenn er denn käme, unterstrich Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem, würde er (nach einer Weissagung aus Sach 9,9–11) alle Kriegswagen verbrennen und alle Bogen zerbrechen, er würde durch Abrüstung Frieden verbreiten (Mk 11,1–10)39. Wie also?
In jedem Falle beansprucht jemand, der sich als Wendepunkt in der Religionsgeschichte Israels, ja, damit zugleich in der Religionsgeschichte aller Völker versteht, nichts Geringeres, als ein neuer Moses, ein neuer Elija (Mk 9,11–13)40, ein neuer Jeremia (Mt 16,14) zu sein. Auch wenn er alle machtpolitischen Implikationen im Erbe des davidischen Königtums mit seinen Großreich-Phantasien ablehnt, läßt sich nicht leugnen, daß er sich geistig als den Mittelpunkt des Volkes Israel und seines Auftrags an die Welt begreift. Mit seiner Botschaft vom »Reich Gottes«, das durch ihn gekommen sei, führt er sich ohne Zweifel selbst als »Herrscher« eben dieses Reiches, mithin als den Messias ein. Und das allein ist es, was man den Römern sagen muß, wenn man ihn auf das Kapitaldelikt – auf Majestätsbeleidigung des Kaisers durch Inanspruchnahme einer angemaßten eigenen Königswürde in einer römischen Provinz – verklagen will.
Hätte Pilatus Jesus wirklich zugehört, so hätte er begreifen können, daß an dem Vorwurf absolut nichts stimmt, – von diesem Mann geht keinerlei Gefahr im Sinne einer bewaffneten Aufstandsbewegung aus, wie sie sich 35 Jahre später im Jüdischen Krieg (68–73 n. Chr.) auf grausame Weise Bahn brechen wird. Er hätte zugleich allerdings auch begreifen müssen, daß die Botschaft vom Reich Gottes dazu bestimmt ist, alle irdischen Machtverhältnisse umzustürzen. Dieser Mann ist für Rom und alle Reiche dieser Welt weitaus gefährlicher, als selbst seine Gegner vermuten. HENRIK IBSEN hatte recht, als er bereits die Antwort Jesu auf die Frage nach der Kaisersteuer als den heimtückischsten Tyrannenmord aller Zeiten bezeichnete41. Brutus tötete Caesar mit dem Dolch; der Mann aus Nazareth aber stürzt mit diesem einen Wort die Caesaren alle von ihrem Thron: »Gebt Gott, was Gottes ist!« (Mk 11,17) Das heißt, der Kaiser ist kein Gott. – Die frühen Christen, die sich weigern, im reichseinheitlichen Kaiserkult dem römischen Herrscher als einem Gott zu opfern, werden ihr Leben aufs Spiel setzen. Im Grunde weiß das jeder Jude: Man darf den Namen Gottes nicht aufs Wahnhafte heben (Ex 20,7); aber wer hätte dieses Wissen je so sanftmütig-zerstörerisch akzentuiert, wer hätte es je derart souverän gelebt, wie es im Gegenüber Gottes Jesus selbstverständlich war?
Noch anderes, nicht weniger Unglaubliches und Ungeheuerliches, hätte Pilatus hören können, als Jesus zu ihm sagte: »Mein Reich ist nicht von dieser Welt« (Joh 18,36).42 Es ist nicht nur, daß Jesus jede Form gewaltsamer Revolution verabscheut; er sieht nicht, wie der Einsatz militärischer Gewalt jemals dem Frieden dienen könnte. Gewiß, stets führen die Regierenden Krieg unter der Vorgabe, es sei nur dieses Mal noch nötig, im Namen der Humanität, im Kampf gegen die Barbarei, zu den Waffen zu greifen, hernach warte der ewige Friede; doch so ist es nie. Die Blutmühle der menschlichen, unmenschlichen Geschichte dreht sich nur um eine Windung weiter. Der Friede ist kein Ziel, das man mit dem genauen Gegenteil: mit Krieg, erreichen könnte; der Friede ist der Weg, und wer nicht mit ihm anfängt, wird niemals bei ihm ankommen.
Im übrigen gilt das Sprichwort, das Jesus bei seiner Verhaftung im Ölberggarten an einen seiner Jünger richtete: »Wer zum Schwerte greift, wird durch das Schwert umkommen« (Mt 26,52).43 Alle Gewalt ruft ihren Widerspruch und Widerstand hervor; sie ruft von selber nach der größeren Gewalt, an der sie schließlich selbst zugrunde gehen wird. So dreht die menschliche Geschichte sich wie ein Kreisel, den die Peitsche einer Kinderhand immer von neuem um die eigene Achse rotieren läßt, über den blutbeschmierten Asphalt der Zeit, als gäbe es kein natürliches Ende des Wahnsinns. Jesu Botschaft bedeutet gerade dies: Schluß mit dem Spuk aus wechselseitiger Einschüchterung im Gleichgewicht des Schreckens und stetiger Hochrüstung in Bereitschaft immer neuer Kriege. Ein Friede, wie die Welt ihn niemals geben kann (Joh 14,27)44, geht aus der jegliche Gewalt erübrigenden Einstellung des Mannes aus Nazareth hervor. Es war der Schuldtitel, mit dem man ihn ans Kreuz schlug: »König der Juden« (Mk 15,26)45; doch hätte man ihn begriffen, hätte der Titel lauten müssen: »Herrscher der Herzen in Erfüllung der Sehnsucht aller Menschen nach Frieden und Freiheit in der Wirklichkeit Gottes.«
Und dadurch wäre Schluß vor allem mit dem Machtstreben im ganzen. »Wer ist unter uns der Größte?« fragen noch im Abendmahlssaal einander die Jünger. Die Antwort Jesu hat im Lukas-Evangelium den Stellenwert eines Vermächtnisses: »Wer unter euch groß sein will, der sei der Diener aller« (Lk 22,24–26).46 »Die auf den Thronen sitzen, willküren herab auf ihre Untertanen und lassen sich dafür noch ›Wohltäter‹ nennen. Nicht so bei euch!« konnte Jesus an anderer Stelle sagen (Mk 10,42–45)47. O ja, es ist möglich, die Hände nach Weltherrschaft auszustrecken, doch dann muß man die Knie vor dem Teufel beugen und sich vor ihm zu Boden werfen. Machtgier – das ist der wahre Satanskult, so kam es Jesus vor (Mt 4,8–10; Lk 4,5–8)48. Die Menschen davon zu befreien und sie zu Individuen zu machen, die sich in Gott selber gehören und nicht länger irgend eines anderen Eigentum in Fremdherrschaft und innerer Versklavung sind, – das war das Ziel seiner heilsamen, den Menschheitswahn der Macht endenden Botschaft vom »Reich Gottes«. Und stimmt es nicht? Was soll das schon für eine »Größe« sein, in der als »Held« gilt, wer im Töten bei sinnlosen Schlachten sich am tüchtigsten hervortut, und in der als eine »Großmacht« diejenige gilt, die ungeheuere Ressourcen, mehr als der Rest der Welt, für Rüstung auszugeben pflegt, bis daß sie über eine unvergleichliche Kapazität zum Töten vieler Menschen im Handumdrehen verfügt? Ist sie nicht eher armselig und niedrig zu nennen, weil bereits ihre Aufwendungen nur für Waffen Elend und Tod für ungezählte Hungernde bedeuten? So löst man nicht Probleme, so schafft man sich mutwillig schier unlösbare Katastrophen.
Und warum dies? Des Geldes wegen. Auch dazu hat sich Jesus niemals systematisch, wirtschaftstheoretisch, nach Art etwa des ARISTOTELES geäußert. Aber er hat gewarnt davor, in Geldbesitz nach einer Sicherheit zu suchen, die es im äußeren nicht geben kann (Mt 6,24–34)49. Und vollends seine Grundhaltung, Schuld sei nicht einzutreiben, sondern zu vergeben, macht es finanzpolitisch unmöglich, mit Leihgeld aus der Not des Nachbarn durch Zins- und Zinseszinsgeschäfte auf möglichen Gewinn zu spekulieren. Geld ohne Zinsen! Das ganze kapitalistische Wirtschaftssystem bräche zusammen, wenn das gilt50, und mit ihm der permanente Druck, die eingegangenen unbezahlbaren Schuldverschreibungen mit kriegerischen Raubzügen refinanzieren zu wollen. Kein Krieg, für den der ihn führende Staat sich nicht vorweg durch gigantische Kredite hoch verschulden müßte, in der verbrecherischen Hoffnung, hernach, im Fall des Sieges, den Unterworfenen ein Vielfaches an Geld und Gut auf lange Zeit hin abpressen zu können. Diese gesamte Mixtur aus Macht, Gewalt und Geld, aus Kapital und Krieg und Korruption löste sich auf. Die sogenannte Normalität träte vor aller Augen als das in Erscheinung, was sie ist: als eine Abnormität des Humanen, als ein Räderwerk zur Zerstörung des Menschlichen. Wir hätten es hinter uns. Das scheinbar alternativlose Weiter-so erwiese sich als ein trügerischer und zynischer Verrat an der Wahrheit, die in den Menschen lebt mit dem Verlangen nach Einheit mit sich selbst und mit den anderen, nach Gemeinsamkeit, Gespräch und Verständigung. Frieden ist nicht nur möglich, er ist das Gebot der Stunde, ist doch sein Gegenteil: der Krieg, die Widerlegung alles Menschlichen.
In Jesus versammelt, wie zu sehen, sich mithin der umfassende Widerspruch gegen jedwede staatsgebundene Widerlegung des Humanen. Als Anti-Imperialist, als Anti-Militarist, als Anti-Kapitalist ist er im Grunde auch gegen die »Friedenspolitik« von Kaiser Augustus und seinem Nachfolger Tiberius; doch »Rom« kristallisiert nur die Aufgipfelung des Üblichen, – für alles Weltmachtstreben ist es in der abendländischen Geschichte vorbildlich geblieben, nicht anders als die Prachtentfaltung Salomos, die in der Bibel ebenso gerühmt wie kritisiert wird, der aber Jesus rundum eine Absage erteilte (Mt 6,29).
Für jedes Machtgebilde stellt der Mann aus Nazareth mit seiner Botschaft vom Reich Gottes deshalb einen unaufhebbaren Kontrast dar. Zu allen Zeiten nötigt er aufs absolute zur Entscheidung: entweder ist er selbst die Wahrheit (Joh 14,6)51 oder man zieht, wie seinerzeit Pilatus, sich ausweichend und achselzuckend auf den Standpunkt eines pragmatischen Agnostizismus zurück und antwortet mit der bekannten Gegenfrage: »Was ist Wahrheit?« (Joh 18,38)52 Egal, wie man es dann noch dreht und wendet, in letzterem Falle verurteilt man Jesus immer neu zum Tode; und so geschieht es allerorten und zu allen Zeiten, solange sich das Wesen des Politischen nicht ändert. Die »Herrlichkeit«, die sich in Jesu Hinrichtung erweist, überführt die »Welt« der Lüge und der »Sünde« (Joh 16,8–11)53; sie ist notwendig das »Gericht« über eben jene Welt, die Jesus hingerichtet hat.
In seinem Roman »Die Dämonen« läßt F. M. DOSTOJEWSKI den Gottsucher und Gottesleugner Kirillow diese äußerste Konsequenz aus der Kreuzigung ziehen: »Vernimm einen großen Gedanken! Es war auf der Erde ein Tag, und in der Mitte der Erde standen drei Kreuze. Einer der Gekreuzigten glaubte so fest, daß er zu einem der anderen sagte: ›Heute wirst du mit mir im Paradies sein.‹ Dieser Mensch war das Höchste auf der ganzen Erde. Er bildete das Ziel, zu dessen Erreichung sie leben sollten. Der ganze Planet, mit allem, was auf ihm ist, ist ohne diesen Menschen nichts als ein Wahnsinn. Weder vor Ihm noch nach Ihm gab es einen ebensolchen wie Er. Nie, nie, sodaß es sogar ein Wunder ist … Wenn dem aber so ist, wenn die Naturgesetze nicht einmal Diesen, nicht einmal ihr eigenes Wunderwerk schonen wollten, sondern auch ihn gezwungen haben, inmitten der Verlogenheit zu leben und einer Lüge wegen zu sterben, dann ist also der ganze Planet nur eine Ausgeburt der Lüge und beruht auf Verlogenheit und dummer Verhöhnung. Also sind auch die Gesetze selbst nichts als Lüge und eine vom Teufel ersonnene Komödie. Wozu soll man also leben? Antworte, wenn du ein Mensch bist?«54Kirillow folgert, der Mensch müsse sich selber zum Gott machen, indem er die Angst vor dem Tod überwinde; doch wenn es schon klar ist, daß die Gesetze dieser (Menschen)Welt auf Lüge und Gewalt basieren, warum dann nicht Jesus Recht geben und die Angst vor der Nichtigkeit des Daseins im Hintergrund der Unmenschlichkeit im Umgang miteinander im Vertrauen auf Gott überwinden?
Entscheidend ist, daß dieser absolute Widerspruch zwischen dem »Himmelreich« in Jesu Botschaft und den Reichen dieser Welt sich wesentlich aus gerade diesem Vertrauen in einen Gott ableitet, der einen jeden Menschen mit seiner unbedingten Liebe meint und will; ein solcher Gott wird einen Menschen nicht abstrafen, sondern ihm vergeben, und diese Aufhebung der in allen Rechtssystemen gültigen Entsprechung von Lohn und Strafe bildet den Kern des Widerspruches Jesu gegen die Grundlagen aller herkömmlichen staatlichen Verwaltung. Dafür wurde er hingerichtet und wird er immer wieder zum Schweigen gebracht werden; notwendigerweise muß er als schlimmste Form von Anomie und Anarchie erscheinen, solange man sich weigert zu begreifen, daß Jesus nicht das friedliche Zusammenleben unter Menschen stören und zerstören mochte, sondern daß er im Gegenteil in Anbetracht der offensichtlichen Friedlosigkeit der Welt zu allererst die Voraussetzung für eine solche Gemeinschaft zu schaffen suchte, indem er die Zwangsordnung von außen mitsamt ihren folgenschweren Verwüstungen durch eine Ordnung aus innen ersetzte. Eine Neuordnung in allem, nicht eine Reform an dieser oder jener Schadstelle in Beibehaltung des Gesamtsystems war seine Botschaft und sein Leben.
Oft wurde überlegt, was bei der Aburteilung Jesu vor 2000 Jahren eigentlich geschah. Liegt hier ein Justizirrtum vor oder ein Justizmord, beantragt von Juden, begangen von Römern? Die Wahrheit ist: beantragt und begangen von uns selbst, die wir den Worten nach Jesus als den Messias Israels bekennen und doch die Welt so lassen, wie sie ist, die wir uns also mit dem Bestehenden stets weiter arrangieren, statt uns dagegen existentiell zu engagieren. Im Rahmen der bestehenden »Ordnung« sahen die jüdischen Priester und Rabbinen zu Recht in der Botschaft Jesu einen tödlichen Angriff auf ihr Verständnis von Gerechtigkeit und Sühne; ihr ganzes Gottesbild geriet ins Wanken; sie mußten Jesus beseitigen, um nicht von ihm beseitigt zu werden. Und ebenso die römische Provinzverwaltung: sie hätte ihrer eigenen Liquidation zustimmen müssen, wenn sie nicht ihrerseits den Mann aus Nazareth liquidiert hätte. Kein Justizirrtum also, und auch keine Justizmord, vielmehr ein Notwehrurteil zur Erhaltung eben der Welt, die wir kennen. Immer ist da noch ein Einzelner zu opfern für den Erhalt des Volkes (Joh 11,50; 18,14).
Doch seitdem sehen wir klar. Als Jesus starb, erzählt das Matthäus-Evangelium (Mt 27,45.52), bebte die Erde, und die Sonne verfinsterte sich (Mk 15,33)55. Wollen wir weiter in dieser Finsternis verharren und das Licht verleugnen, das in ihr erstrahlen könnte (Joh 1,5)56? Wollen wir weiter in der Unruhe und Angst der Welt verbleiben (Joh 16,33)57 oder den Sieg Jesu über diese Welt als die Errettung unseres eigenen Lebens glauben? Wie wir über die Staatsjustiz mit ihrem Strafrecht denken, entscheidet über unser Selbstverständnis. Alles im bürgerlichen Leben steht seit dem Tag von Golgotha in Frage. Nichts mehr ist selbstverständlich, es sei denn jenes unbedingte Vertrauen Jesu in die Güte Gottes, das Jesus uns in seinem Leben und mit seinem Tod zu bringen kam.
Im Kern richtig verstanden hat die Botschaft Jesu FRIEDRICH NIETZSCHE, als er sie gegen die erdrückende Priesterpredigt endloser Schuldgefühle in Schutz nahm. »In der ganzen Psychologie des Evangeliums«, schrieb er, »fehlt der Begriff Schuld und Strafe; desgleichen der Begriff Lohn. Die ›Sünde‹, jedwedes Distanz-Verhältnis zwischen Gott und Mensch ist abgeschafft, – eben das ist die ›Frohe Botschaft‹. Die Seligkeit wird nicht verheißen, sie wird nicht an Bedingungen geknüpft; sie ist die einzige Realität – der Rest ist Zeichen, um von ihr zu reden … – Die Folge eines solchen Zustandes projiziert sich in eine neue Praktik, die eigentlich evangelische Praktik. Nicht ein ›Glaube‹ unterscheidet den Christen: der Christ handelt, er unterscheidet sich durch ein anderes Handeln. Daß er Dem, der böse gegen ihn ist, weder durch Wort noch im Herzen Widerstand leistet. Daß er keinen Unterschied zwischen Fremden und Einheimischen, zwischen Juden und Nicht-Juden macht (›der Nächste eigentlich der Glaubensgenosse, der Jude‹). Daß er sich gegen niemanden erzürnt, niemanden geringschätzt. Daß er sich bei Gerichtshöfen weder sehn läßt noch in Anspruch nehmen läßt (›nicht schwören‹). Daß er sich unter keinen Umständen, auch nicht im Falle bewiesener Untreue des Weibes, von seinem Weibe scheidet. – Alles im Grund Ein Satz, alles Folgen Eines Instinkts. – Das Leben des Erlösers war nichts anderes als diese Praktik, – sein Tod war auch nichts anderes … Er hatte keine Formeln, keinen Ritus für den Verkehr mit Gott mehr nötig, – nicht einmal das Gebet. Er hat mit der ganzen jüdischen Buß- und Versöhnungs-Lehre abgerechnet; er weiß, wie es allein die Praktik des Lebens ist, mit der man sich … jederzeit als ein ›Kind Gottes‹ fühlt. Nicht ›Buße‹, nicht ›Gebet um Vergebung‹ sind Wege zu Gott: die evangelische Praktik allein führt zu Gott.«58
Für diese seine »Praktik« ging Jesus in den Tod oder, richtiger, für diese seine Überzeugung brachte man ihn um. Und wie nun? »Denn durch sein heiliges Kreuz hat er die Welt erlöst«? Dieses christliche Bekenntnis kann nur gelten unter der Voraussetzung, daß man Punkt für Punkt die Bedingungen in Frage stellt, unter denen die Aburteilung Jesu möglich war und nach wie vor als unumgänglich praktiziert wird, nicht mehr freilich in einem öffentlichen Spektakel, wie damals, das ist auch gar nicht nötig, wohl aber unauffällig, wie ganz selbstverständlich, systemimmanent. Daß Jesus das Recht aufhob, mit Menschen über Menschen zu Gericht sitzen: im Namen Gottes, im Namen des Gesetzes, im Namen des Volkes, das ist der Grund, daß man ihn für des Todes schuldig sprach. Was also ist so falsch an einer persönlichen Einstellung oder an einer religiösen beziehungsweise staatlichen Einrichtung, die ihre monströse Lebensfeindlichkeit eben dadurch erweist, daß sie die Chance zu einem Leben, wie es Jesus uns zu bringen kam, augenblicks für ein todwürdiges Verbrechen gegen Gott und gegen die Grundlagen eines bürgerlich geregelten Zusammenlebens erklärt? Nichts von dem Hauptanliegen der Botschaft Jesu ist wirklich begriffen, solange es uns nicht gelingt zu zeigen, daß in dem Todesurteil über ihn sich das Prinzip des Richtens selbst zum Tode verurteilt.
Kritisch betrachten müssen wir daher das Institut der Strafjustiz als ganzes und uns zugleich an jeder Stelle überlegen, warum und wie seine Vorstellungen im Sinn der Haltung Jesu zu verändern sind. Wieso herrscht offenbar allerorten im Zusammenleben der Grundsatz: »Strafe muß sein«? In welchen Formen werden Strafen verhängt, und was bewirken sie? Wer ist die strafverhängende (legislative) und strafausübende (exekutive) Instanz, und woher nimmt sie die Normen ihrer Entscheidungen? Wir sind geneigt, unser heutiges System der Gefängnisstrafe als einen humanen Fortschritt gegenüber der Tortur qualvoller Hinrichtungen anzusehen, doch was war das in der Antike für ein System öffentlicher Tötungsspektakel, aus welchen Gründen kam man davon ab und welch ein Preis war und ist dafür zu entrichten? Und vor allem: Wie läßt sich das Strafen auf Grund seiner erweisbaren Gegenfinalität aufgeben und durch Verfahren wirklicher Hilfe ersetzen?
Immerhin gilt inzwischen der Grundsatz: »Keine Strafe ohne Schuld.« Wie aber läßt sich die Schuld eines Menschen an seiner Tat feststellen? Gibt es sie überhaupt? Was ist es mit der behaupteten Willens- und Entscheidungsfreiheit, die dem Menschen zugeschrieben wird, um ihn gerechterweise bestrafen zu können? Oder geht es beim Strafen gar nicht um Gerechtigkeit, sondern um ganz andere Ziele? Und gibt es womöglich weit bessere Wege, diese zu erreichen, als die Verfahren herkömmlicher Strafjustiz?
Mit all dem halten wir uns immer noch in einem Terrain auf, in dem das Strafrecht vielleicht praktisch eingeschränkt, modifiziert oder mit besseren Begründungen versehen, nicht aber prinzipiell beseitigt werden kann. Genau das aber wollte Jesus. Ihm erschien die Grundvoraussetzung unhaltbar, die zu allem Strafen wesentlich gehört: daß da eine Gruppe von im Recht Befindlichen über gewisse im Unrecht Befindliche den Stab bricht, als ließen sich die Menschen, womöglich mit Berufung auf Gott oder auf eine absolute Moralität, von einander trennen. Wie hängen Menschen zusammen, gerade wenn sie sich gegenüber anderen schuldig machen? Und was läßt sich tun, um den bedrohten Zusammenhalt aller zu stabilisieren? Wie läßt sich die Praxis des Strafens ersetzen durch eine Praxis des Helfens und Heilens?
Was sich damit abzeichnet, ist ein tieferes Verständnis des Begriffs der »Erlösung« im Christentum. Er gehört zentral in den Erfahrungsraum jedes Einzelnen, – nur der Einzelne vermag aus seiner inneren Negiertheit, aus Angst und Schuld, aus Aggression und Depression heranzureifen zu dem Vertrauen von Daseinsbejahung und Freiheit; doch dieser Prozeß ist nicht denkbar, ohne daß von den dazu nötigen Erfahrungen aus zugleich die Strukturen des gesellschaftlichen Zusammenlebens, ganz entscheidend in den Fragen des Strafrechts, sich vermenschlichen. Diese Durcharbeitung ist von den verfaßten Kirchen kaum begonnen worden, während die von ihnen beauftragten Seelsorger in den staatlichen Gefängnissen Tag um Tag in ihren Begegnungen die Defizite und Deformationen zu spüren bekommen, die der staatlich verordneten Strafjustiz eigen sind. Ein Umdenken im ganzen ist nötig, um der Menschen willen und um der Botschaft Jesu willen, die in nichts anderem besteht als darin, Gefangenen Freiheit zu schenken und ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen (Lk 4,18).
I) »Strafe muß sein« – Strafe als Normenkontrolle bei Tieren
1) Das Anstoßnehmen
Die Praktik, normabweichendes Verhalten zu bestrafen, ist in menschlichen Gruppen so allgemein verbreitet, daß diese Tatsache allein schon auf ihre Herkunft aus der Tierreihe schließen läßt. An dieser Stelle bereits steht ein völliges Umdenken auch in der »Schöpfungstheologie« an, denn man kann den absoluten Unterschied zwischen den Gesetzen der Natur und den »Gesetzen« Jesu auf keine Weise nivellieren oder sie schlechterdings umgehen durch eine »panentheistische Prozeßtheologie«, nach welcher mit »Gott« ein dynamisch kreatives Organisationszentrum der Evolution gemeint sein soll. Mit dem »Vater« Jesu hat das nichts zu tun. – Tatsächlich hängt das Verhalten von Menschen mit der Entstehungsgeschichte der Tiere zusammen. Verhaltensforscher bezeichnen nach dem Ornithologen FRIEDRICH GOETHE die entsprechenden Reaktionen bei sozial lebenden Artgenossen im Tierreich als »Anstoßnehmen«59 und beschreiben mit diesem Wort die gerichtsartige Antwort von Vögeln oder Säugetieren auf einen Sozialpartner, der in Aussehen und Gebaren sich nicht anständig benimmt. Dafür ein lehrreiches Beispiel.
Eine Möwe hat einen Flügel gebrochen; dann fallen die anderen Tiere mit spitzen Schnäbeln über sie her – es kommt zu einem »Möwengericht« (in Anlehnung an das bekannte »Krähengericht«). Es mag sein, daß Menschen den verletzten Vogel dem wütenden »Behassen« der Artgenossen entreißen und ihn gesund pflegen; alles könnte damit wieder in Ordnung sein; doch so ist es nicht. In die Freiheit entlassen, fliegt die Möwe auf, der Möwenschwarm aber erkennt sie wieder und fällt erneut über sie her. Das kranke Tier verkörpert offenbar eine Normabweichung, die mit Ausmerzung zu ahnden ist60. Ein gleiches geschieht, wenn ein Farbfleck das Gefieder eines Vogels negativ markiert, etwa wenn eine Möwe in die Ölreste eines Schiffes geraten ist, das auf See seine Tanks »gereinigt« hat. Über ein solches Tier fallen alle anderen her und hacken auf es ein; in bitterstem Wortsinn ist es buchstäblich »vogelfrei«.
Womit wir es hier zu tun haben, ist eine brutale Form der »Ausstoßvictimisation«, bei der durch die gezielte Aggression der ganzen Gruppe ein krankes, verletztes oder sonstwie negativ auffallendes Tier hingerichtet wird; es hat seinen Flügel gebrochen, es ist in eine Öllache geraten, –darauf offenbar steht die Todesstrafe. Als Biologe mag man versucht sein, hinter dem tödlichen Ausschluß eines einzelnen Artgenossen im Falle eines normabweichenden Auftretens einen darwinistischen Sinn zu vermuten: das Kranke soll eliminiert werden, damit seine Gene nicht weitergegeben werden; als Mensch aber kann man über soziale Phänomene wie diese nur zutiefst erschrocken sein, sieht man doch eine Fülle von Szenen voraus, die sich in vergleichbarer, ja gleicher Weise auch unter Menschen abspielen.
Da genügt eine an sich geringfügige, aber auffallende, mit Augen, Nase oder Ohren wahrnehmbare Abweichung vom Standardverhalten und -aussehen der Artgenossen, und es kommt zum Ausbruch einer spontanen kollektiven »Haß«-Reaktion mit dem Ziel, die Störung des Verhaltensreglements ein für allemal zu beseitigen: entweder verhält der Abweichler sich auf der Stelle so wie alle anderen oder er wird, wenn dazu außerstande, solange attackiert, bis er physisch ausgemerzt ist. Zunächst mag die gezielte Aggression aller noch der Wiedereingliederung des abweichenden Verhaltens oder Erscheinens eines Einzelnen in die Gruppenorm dienen; die Wut der anderen, die er auf sich zieht, verfolgt zunächst tatsächlich wohl den Zweck seiner »Besserung«: er soll wieder werden und handeln wie alle; doch wenn das nicht möglich ist, hört die Gruppenaggression nicht etwa auf, sie geht vielmehr immer weiter bis hin zur Vernichtung des Betreffenden. Selbst wenn nach einer Weile das ehedem behinderte Tier wieder voll funktionsfähig und normangepaßt in seine Bezugsgruppe zurückkehrt, bleibt es des früheren Befundes wegen, auf Grund seiner Altschuld, des Todes würdig; es ist als Haßobjekt den Artgenossen noch zu gut in Erinnerung, als daß es die vormalige Ablehnung nicht erneut und ungehemmt auf sich zöge. Ein »genug gestraft« gibt es nicht, so wenig wie ein Mitempfinden für das vorgefundene Leid hinter dem normabweichenden Verhalten. Was da als »Norm« empfunden wird, zeigt sich an der Heftigkeit der Haß- und Ärgerreaktion der Artgenossen im Falle einer mehr oder minder großen Abweichung.