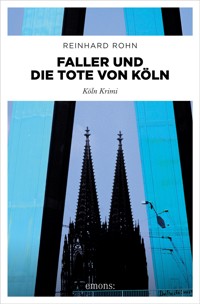7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ganz zufällig trifft er sie im Zug nach Köln. Die junge rothaarige Frau, die Michael Bacher an seine verstorbene Jugendliebe Marie erinnert. Vergeblich wartet er von nun an darauf, ihr erneut zu begegnen. Doch es müssen erst sieben lange Jahre vergehen, bevor er sie wiedersieht. Diesmal trägt sie jedoch eine Perücke und hält eine Waffe in der Hand. Michael ist fest entschlossen, sie nicht wieder entwischen zu lassen. Aber als er ihr ins Hotel folgt, ist es zu spät: Die schöne Rothaarige ist ermordet worden. Jetzt muß Michael schnell handeln, denn die Polizei ist hinter ihm her - und nicht nur die...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch
Ganz zufällig trifft er sie im Zug nach Köln. Die junge rothaarige Frau, die Michael Bacher an seine verstorbene Jugendliebe Marie erinnert. Vergeblich wartet er von nun an darauf, ihr erneut zu begegnen. Doch es müssen erst sieben lange Jahre vergehen, bevor er sie wiedersieht. Diesmal trägt sie jedoch eine Perücke und hält eine Waffe in der Hand. Michael ist fest entschlossen, sie nicht wieder entwischen zu lassen. Aber als er ihr ins Hotel folgt, ist es zu spät: Die schöne Rothaarige ist ermordet worden. Jetzt muß Michael schnell handeln, denn die Polizei ist hinter ihm her - und nicht nur die …
Über Reinhard Rohn
Reinhard Rohn wurde 1959 in Osnabrück geboren und ist Schriftsteller, Übersetzer, Lektor und Verlagsleiter. Seit 1999 ist er auch schriftstellerisch tätig und veröffentlichte seinen Debütroman »Rote Frauen«, der ebenfalls bei Aufbau Digital erhältlich ist.
Die Liebe zu seiner Heimatstadt Köln inspirierte ihn zur seiner spannenden Kriminalroman-Reihe über »Matthias Brasch«. Reinhard Rohn lebt in Berlin und Köln und geht in seiner Freizeit gerne mit seinen beiden Hunden am Rhein spazieren.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Reinhard Rohn
Rote Frauen
Roman
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Erster Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Zweiter Teil
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Dritter Teil
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Impressum
Für Michaela, Jan und Lars
Handlung und Personen in diesem Roman sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen ist zufällig. Schauplatz der Handlung ist Köln. Jedoch habe ich mir in kleinen Details der Ortsschilderung ein paar Freiheiten erlaubt.
R. R.
Erster Teil
1
Ich kann den Mond nicht sehen. Das ist das schlimmste, schlimmer noch als die Schlaflosigkeit und das Schweigen. Selbst wenn ich auf den einzigen Stuhl steige und mein Gesicht gegen das Glas presse, so entdecke ich kein Stück des Himmels. Meine Zelle liegt zu weit unten in diesem unförmigen Betonblock, und das vergitterte Fenster weist auf den Gefangenenhof hinaus. Nur wenn ich die Augen schließe und so, mit geschlossenen Augen, den Mond anrufe, kann ich ein sattes blaues Licht erahnen, das eine mondhelle, sternenklare Nacht verrät. Die Nächte im Oktober habe ich stets besonders geliebt. Nirgends im Jahr sieht man mehr Sternschnuppen, und zu keinem Zeitpunkt erzählt ein voller kalter Mond mehr von seinem Geheimnis. Wie kostbar ein Licht ist, sieht man in diesen matt silbrigen Mondnächten, wenn das Universum seine ganze Düsternis auf einen kleinen, unbedeutenden Planeten zu kippen scheint.
Der Mond hat mich schon als Kind getröstet, wenn ich hinter dem Schlachthaus saß und die Schreie der Schweine hörte. Manchmal habe ich mich geschämt, weil ich diese Schweine beobachtet hatte, wie sie fett und nichtsahnend über ihre Wiese liefen. Und da saß ich, hielt mir die Ohren zu und starrte den Mond an. Später bin ich seinem kalten Licht über leere Felder nachgelaufen. Und dann, wenn er stolz am Horizont stand, habe ich gemeint, er müsse nicht nur sein bläuliches Licht ausstrahlen, sondern auch eine Musik, seine Mondmusik, die wie ein kosmischer Walgesang durch das Universum wehte.
Wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt, dann müssen wir kurz vor Vollmond stehen.
Seit mehr als vier Wochen sitze ich in dieser mondlosen Zelle. Ich habe kaum etwas gegessen und wenig geschlafen, drei, vier Stunden in der Nacht vielleicht. Das genügt nicht, um sich auszuruhen, das genügt für ein paar traurige Träume. Dreimal bin ich in dieser Zeit von Ihnen verhört worden, Frau Kommissarin; und dreimal hat mich mein Anwalt besucht; er ist in dem engen, trostlosen Besprechungsraum auf und ab gegangen, hat Hosenträger getragen und geschwitzt, obschon es eher kalt war, und er hat mich gedrängt, endlich eine Aussage zu den Spuren zu machen, die ich im Zimmer der Toten hinterlassen habe. Ich bin ihm mit gleichgültigem Schweigen begegnet. Ich bin nicht der Mörder, für den man mich offenbar hält, aber ich will mich nicht so verteidigen, nicht mit Paragraphen und Gesetzestexten. Meine Geschichte ist eine mit vielen Irrtümern.
Frau Kommissarin, wenn der Mond in meine Zelle scheinen würde, wäre alles erträglicher. Ich würde mich gegen dreiundzwanzig Uhr ans Fenster stellen und an meinem Mondbuch schreiben, wie ich es seit über sieben Jahre zu tun pflege. Jeden Abend bin ich auf die Terrasse meiner Dachwohnung getreten und habe meine Beobachtungen über den Mond notiert. War er zu sehen? Schaute er zwischen zerrissenen Wolken hervor? In welcher Phase befand er sich? Stand er als zunehmender Mond östlich der Abendsonne? Oder würde man ihn erst vor Sonnenaufgang am Morgenhimmel sehen? Seit meinen Kindertagen hinter dem Schlachthaus bin ich auf eigentümliche Weise mondsüchtig. Der Mond sagt, daß es die totale, vollständige Dunkelheit nicht geben kann, deshalb kreist er um die Erde; ohne den Mond würde die Erde sich in unserem Sonnensystem verirren.
Ich habe sogar eine Nacht lang ernsthaft erwogen, ein Gesuch einzureichen: Verlegen Sie mich bitte in ein Zimmer mit Mondblick, und ich werde alles gestehen. Natürlich wäre so etwas lächerlich gewesen und hätte mir nur die Visite eines Psychologen oder die erhöhte Besorgnis meines Anwaltes eingetragen, also habe ich es gelassen und mich auf das verlegt, was ich sonst noch vermag, wenn ich ganz und gar mit mir allein bin. Ich höre Musik; zu meinem Bedauern nicht die Mondmusik meiner Kindheit, der Mond ist stumm. Nein, mein Kopf ist wie eine gigantische Empfangsanlage, in der ich alle Musiken gespeichert habe, die mich einmal angerührt haben. Ich kann wählen. Plötzlich höre ich mir alte Bruce-Springsteen-Stücke an, There’s a darkness at the edge of town, oder die ganz und gar unvergleichliche Stimme von Jackson Browne klingt in meinem Kopf. Er singt ganz allein, lediglich mit einem fernen Klavier im Hintergrund, und er singt so, als müsse er nur eine Kerze ins Flackern bringen. Aber auch Mozart liegt in meinem Kopf bereit, oder ich kann Beethovens Sechste, seine Symphonie des Frühlings, in der Zelle, die mein Kopf ist, erschallen lassen. Doch jede Musik bietet nur so lange Trost, solange sie erklingt, und danach kennt man die Tiefe von Schweigen und Alleinsein noch genauer.
Frau Kommissarin, auch wenn mein Schweigen es Ihnen nicht verraten hat – Ihre Besuche waren nie unwillkommen. Das liegt an Ihrem strengen Gesicht – ich mag strenge Gesichter –, an Ihrem roten Haar und Ihrem altertümlichen Parfüm. Das erste Mädchen, in das ich mich verliebte, benutzte schon dieses Parfüm. Musik und solche Wohlgerüche haben viel gemeinsam; sie umhüllen einen, verdrehen einem die Sinne und verändern einen für Momente. Ich glaube, ich habe deshalb nie richtig lieben können, weil mir Musik und Gerüche stets viel zuviel bedeuteten, weil ich immer nur den Moment suchte und niemals die Dauer.
Die Geschichte, Frau Kommissarin, die ich Ihnen jetzt erzähle und für die Sie ein wenig Geduld brauchen, begann vor sieben Jahren als eine kleine, scheinbar unbedeutende Episode. Ich war dreißig. Ich hatte mich wie viele Menschen in diesem Alter an meine innere Leere gewöhnt. Ich verdiente genug Geld, um mir ein paar schlechte Angewohnheiten leisten zu können. Ich trank schon damals zu viel und pflegte dann an teuren Hotelbars einen gewissen trunkenen Zynismus.
Es geschah an einem gewöhnlichen Morgen, kühl und regnerisch und voller Schweigen. Ich habe das Autofahren nie erlernt, es fordert mir zuviel ab, denn ich mißtraue jeder Geschwindigkeit. Daher benutzte ich wie gewöhnlich die S-Bahn und las einen schlechten Roman. Schlechte Romane sind meine Spezialität, aber das wissen Sie vermutlich längst, Frau Kommissarin. Als ich zufällig beim Umblättern einer Seite aufblickte, fingen meine Augen etwas ein: das schöne strenge Gesicht einer Frau, die nicht hier in diesen Zug gehörte. Diese Frau durchbrach das Gesetz eines grauen deutschen Morgens, nicht weil sie besonders bunt oder auffällig gekleidet war, sondern weil sie ein Licht verstrahlte wie ein kalter, ferner Silbermond. Müde sah sie aus, gähnte ein-, zweimal und strich sich anmutig ihre roten Locken zurück. Sie trug eine runde Metallbrille, wie sie vor ein paar Jahren modern gewesen war, und auf ihrer Nase schienen winzige Sommersprossen zu tanzen. Sie war die faszinierendste Frau, die ich jemals gesehen hatte, und sie konnte nicht so namenlos dasitzen zwischen all den gleichgültigen Gesichtern. Ich suchte sofort in meinem Gedächtnis nach einem geeigneten Namen. Noch nie war ich versucht gewesen, einer Reisenden in einem Zug einen Namen zu geben, und so fiel es mir nicht besonders leicht. Es durfte auch kein gewöhnlicher Name sein. Ein einfacher, aber klingender Name wird am besten zu ihr passen, dachte ich mir. Ich probierte ein paar Namen aus: Sabine, Marie und Hanna. Aber keiner dieser Namen gehörte zu ihr.
Dann, während sie einen Reisekatalog über Italien herausholte und studierte, flog ein Name auf mich zu. Eliza.
Sie hieß Eliza.
Ich ahnte damals natürlich nicht, daß diese Frau, die ich Eliza nannte, ein Wesen der vielen Namen war, daß sie zu gewissen Zeiten ihren Namen mit jedem Monat, jedem Jahr gewechselt hatte. Auch als ich ihren ersten, wahren Namen erfuhr, blieb sie für mich immer Eliza.
Ich behielt Eliza im Auge, unauffällig und verstohlen, aber immer wieder schaute ich in ihre Richtung. Und einmal, als sie scheinbar gedankenverloren von ihrem Reisekatalog aufsah, versuchte ich ihren Blick einzufangen. Kann ein einziger Blick ein Abenteuer sein? Ich hoffte jedenfalls, daß sie mich sah, daß ihre Augen beim Umherschweifen eine Sekunde innehielten. Eliza sollte erkennen, daß ich etwas Besonderes war. Ich war nicht so wie die anderen, die um mich herumsaßen und sich gleichgültig zu ihrer ebenso gleichgültigen Arbeit fahren ließen.
Aber nichts geschah. Elizas Blick glitt über mich hinweg, als wäre ich gar nicht vorhanden.
Dreißig Minuten währte die Bahnfahrt, die ich jeden Morgen hinter mich bringen mußte. Was kann man in dreißig Minuten über eine stumme Mitreisende erfahren? Ich versuchte mir Elizas Gesicht einzuprägen. Die Form ihres Mundes, die Bewegung ihres Ringfingers, wenn sie sich die Brille ein wenig zurechtschob, oder wie sie einen Finger anfeuchtete, als sie im Katalog blätterte. Überhaupt der Katalog! War sie doch nur eine gewöhnliche Frau, die sich auf ihren Urlaub freute: zweimal im Jahr zum Mittelmeer oder in die Karibik fliehen, um richtig zu leben? Nein, so eine Frau konnte Eliza nicht sein. Sie war eine Frau mit einem Geheimnis, nicht irgendeine Sekretärin oder Arzthelferin, die stets nur an die nächste Urlaubsreise dachte.
Und ihre Augenfarbe? Plötzlich kam mir der Gedanke, daß zu einer wunderbaren Frau auch eine ungewöhnliche Augenfarbe gehörte. Angestrengter und auffälliger blickte ich zu ihr hinüber. Hatte sie blaue Augen, oder waren sie vielleicht grün? Da sie mir nicht direkt gegenübersaß, konnte ich es nicht herausfinden; ich bemerkte aber ein kleines Muttermal unterhalb ihres rechten Ohres und eine gewisse Rötung am Hals. Kam sie gerade aus dem Bett eines anderen Mannes?
Kaum zehn Minuten war ich zusammen mit einer unbekannten Frau in einem schmutzigen, stickigen Großraumwaggon, und schon erfand ich eine Welt um sie herum: Ich erfand einen Mann, groß und dunkelhaarig und ein Künstler, Musiker vielleicht, der sie am Morgen mit einem leidenschaftlichen Kuß verabschiedet hatte. Er hatte sie noch einmal ins Bett ziehen wollen, aber Eliza hatte ihn sanft zurückgewiesen; nein, sie müsse gehen, schließlich habe sie diese neue Stellung angenommen und wolle nicht schon am ersten Tag zu spät kommen. Sie verabschiedete sich von ihrem Freund. Er hieß Carlo, oder nein, er nannte sich Duke, weil er ein Jazzpianist war. Zwei Stunden würde er noch schlafen, und dann würde er wieder ins Tonstudio gehen, um neue Stücke aufzunehmen.
War Eliza Lehrerin oder vielleicht Bibliothekarin?
Ihre Hände? Ich mußte ihre Hände genauer betrachten. Hände verraten ein paar der Geheimnisse, die man verbergen will. Eliza hatte recht große Hände; auch auf ihre Handrücken hatten sich ein paar Sommersprossen verirrt, und ihre Fingernägel waren zum Glück nicht lackiert. Ich war erleichtert zu sehen, daß ihre Fingernägel nicht in irgendwelchen modischen Farben leuchteten.
Und dann stand Eliza plötzlich auf.
Ich hatte die ganze Zeit damit rechnen müssen, daß sie von einem Moment auf den nächsten wieder verschwand. Ein kurzer, zwanzigminütiger Auftritt, der allenfalls reichte, um ein flüchtiges Licht in mein dunkles Leben zu werfen.
Eliza schritt zur Tür. Sie bewegte sich anmutig; sie hätte auch eine Tänzerin sein können, wenn es nicht völlig ausgeschlossen war, daß wirkliche Tänzerinnen sich morgens in einen Vorortzug verirrten. Eliza hatte sich offenbar aus Unkenntnis der Strecke ein wenig zu früh erhoben, der Zug war noch in voller Fahrt. Ich warf ihr ein Lächeln hinterher, aber vergebens. Auch als sie wartend an der Tür stand, schaute sie mich nicht an. Sie strich sich über ihren dunkelroten Rock, so als würde sie gleich jemandem gegenübertreten, vor dem sie unbedingt gepflegt und sozusagen adrett wirken mußte.
Dann wurde der Zug langsamer. Der Fahrer nannte vollkommen unverständlich den Namen der Station. Mein Blick hing wie gebannt an Eliza. Irgend etwas hätte ich tun müssen. Ihren Namen rufen vielleicht, so daß sie den Kopf wandte und mich sah. Eine Tat mußte her, die sie aufhielt, aber ich hatte keine Tat. Ich hatte nur den genauen Blick des unbeteiligten Beobachters, der verzweifelt beteiligt sein wollte. Für einen Moment registrierte ich jede ihrer Regungen ganz genau. Ich hörte den stillen, sanften Klang ihres Atmens, ich hörte ihr Herz pochen, und ich hörte, wie sie mit der Zunge über ihre Lippen fuhr. Alles geschah ungeheuer langsam. Dann hielt der Zug, die Tür öffnete sich, und dieser Moment der intensiven Wahrnehmung zerriß.
Ich bin ein hoffnungsloser Romantiker. Ich denke an Dinge, die niemals in Erfüllung gehen. In dem Augenblick, als die Frau, die für mich Eliza war, aus der Tür auf den Bahnsteig hinaustrat, senkte ich den Blick. Ich schaute ihr nicht einmal nach, berauschte mich nicht an den wenigen verbleibenden Momenten, als sie an der Bahn in Richtung Ausgang vorbeiging.
Den ganzen Tag dachte ich an sie. Warum hatte sie mich so fasziniert? Waren es ihre roten Haare? Oder war es ihr feingeschnittenes Gesicht mit den Sommersprossen? War es irgendein Duft gewesen, der von ihr ausging, oder die Farbe ihrer Augen?
Nein, sie war eine Frau mit einem Geheimnis; das machte all ihre Faszination für mich aus.
Vielleicht können Sie ermessen, Frau Kommissarin, mit welch Hoffen und Bangen ich am nächsten Morgen die Bahn betrat. Saß Eliza wieder da? Würde sie es sich zur Gewohnheit machen, jeden Morgen denselben Zug zu nehmen?
Ich hatte mir eine ganz besondere Garderobe zurechtlegen wollen. Ein buntes Hemd, das auffiel? Oder ein Jackett aus Seide? Doch ich begriff, daß all diese Überlegungen wenig Sinn hatten. Ich besaß keine auffällige Kleidung. Dann dachte ich an einen Satz, mit dem ich sie ansprechen wollte. Ein Satz, den es so noch nie gegeben hatte, der neu und anders war. Am Abend sprach ich sinnlose Sätze in den Spiegel hinein. Ich war mitten in der Lächerlichkeit angekommen. Ein dreißigjähriger Mann, ratlos und einsam, der nicht wußte, wie er morgens um halb neun eine unbekannte Frau ansprechen sollte.
Laß es sein, sagte ich mir dann, lebe dein Leben weiter, und schlage dir diesen romantischen Irrsinn aus dem Kopf. Und überhaupt – Eliza hat einen Freund, und sie hat rote Haare und ein Geheimnis, und dich kann sie nun überhaupt nicht gebrauchen. Ich trank schon damals zuviel Kognak und stand stundenlang auf meiner Dachterrasse und prostete dem Mond zu.
Zitternd betrat ich am nächsten Morgen die Bahn. Mein Herz war alt und jung zugleich. Ich spürte eine Sehnsucht, die jung war, und gleichzeitig eine Hoffnungslosigkeit, die mich altern ließ. Für gewöhnlich suchte ich mir möglichst rasch einen freien Platz, nahm meine Zeitung oder einen Roman und las, ohne darauf zu achten, was um mich herum geschah. Doch nun stieg ich mit hellwachen Augen ein. Ein paar bekannte Gesichter registrierte ich: die Frau mit dem Feuermal, die beiden Türkinnen mit den schwarzen Kopftüchern, der Mann im teuren Anzug, der aussah, als würde er in einer Bank arbeiten. Aber nirgends entdeckte ich einen roten Haarschopf.
Dann eilte ich weiter. Geradezu panisch drängte ich durch die schwere Metalltür, um in den zweiten Waggon zu gelangen. Unwillig schob ich sogar ein Schulkind beiseite, das meinen Weg kreuzte. So kannte ich mich gar nicht. Ich hatte ein Ziel. Zu meinem Unglück erwies sich dieser Wagen als ziemlich überfüllt. Eine Schulklasse mit zwei aufgeregten Lehrerinnen, die unentwegt ihre Ermahnungen riefen, hatte hier Platz genommen. Doch da, inmitten einer Gruppe von jungen Mädchen, saß Eliza. Sie trug eine Sonnenbrille, was sie mir auf Anhieb noch geheimnisvoller machte. Außerdem war sie eleganter gekleidet. Hatte sie gestern noch eine modisch wenig auffällige Kleidung getragen, so sah sie heute aus, als würde sie auf eine Hochzeit gehen. Ich glaube, sie hatte ein weißes Kostüm an, und ihre Lippen leuchteten rot. Hätte sie auch nur einen Augenblick den Kopf in meine Richtung gewandt, ich hätte meine Hand erhoben und sie gegrüßt. Aber so geschah nichts. Ich stand zwischen drängelnden, schiebenden Schulkindern, die sich mit Flüchen bedachten und Schimpfwörter zuriefen, und starrte in Elizas Richtung. Eine lange Stille trat in meinen Kopf; es war, als wichen die Geräusche um mich zurück; ich nahm sie zwar noch wahr, aber sie hatten keine Bedeutung.
Ein paar neue Kleinigkeiten fielen mir an Eliza auf. Sie trug einen Ohrring mit einem großen grünen Stein, und sie sprach offenbar Französisch, denn als zwei Schüler sich auf französisch begrüßten, wandte sie den Kopf und nahm die Sonnenbrille ab. Ansonsten beachtete sie die Gruppe um sie herum gar nicht. Auch für mich hatte sie keinen Blick. Dann kam die Station, an der sie gestern ausgestiegen war, und sie erhob sich, diesmal keinen Augenblick zu früh. Statt sich aber zur nächstgelegenen Tür zu wenden, schob sie sich plötzlich in meine Richtung. Ich konnte ihr direkt ins Gesicht schauen. Sie hatte hohe Wangenknochen und – ich erfaßte es sofort – graugrüne Augen. Da war kein Zweifel möglich; einen Wimpernschlag lang waren meine Augen zwei hochempfindliche Sensoren, die alle Daten des fremden Augenpaares, das vorbeistrich, aufnahmen und analysierten. Graugrün – keine Frage. Doch damit nicht genug. Ich roch auch Elizas Haar, als sie an mir vorbeiglitt. Wonach roch ihr Haar? Es war ein schwerer, herbstlicher Geruch, wie welkes Laub, durch das ein noch warmer Wind strich. Ein Geruch jedenfalls, der keinem gewöhnlichen Parfüm zuzuschreiben war.
Ich stand vollkommen benommen da und schloß für einen Moment wirklich die Augen, um ganz mit mir und diesem Geruch allein zu sein. Wenn mich in dieser Sekunde, als Eliza sich an mir vorbeischob, jemand beobachtet hätte, so hätte ich fraglos einen lächerlichen Eindruck hinterlassen.
Eliza verschwand wie am Tag zuvor, sie eilte zwischen anderen Passanten dem Ausgang entgegen, nur ihr Haar leuchtete rot aus der Menge.
In der Nacht hatte ich Herzschmerzen. Ich stand auf der Dachterrasse, trank wieder zuviel Kognak und starrte den Mond an. Ich redete mit dem Mond, so wie verloren Verliebte das wohl tun, und wünschte mir, daß er Wunder wirken könnte.
Katastrophen wie ein Zugunglück, einen Raubüberfall, ein Erdbeben malte ich mir als glückliche Fügungen aus, die mich Eliza näherbrachten … Aber all diese Unglücksfälle sind in unseren Breiten eher selten. Ja, werden Sie sagen, Frau Kommissarin, Sie mußten die Angelegenheit eben selber in die Hand nehmen; es kann doch nicht so schwer sein, morgens in der Bahn ein Gespräch anzufangen. Sie haben recht. Ich habe es jeden Morgen auf meine zweifelnde, kraftlose Weise versucht, ich habe mir einen Weg gebahnt, bin durch die Wagen geirrt, um sie zu finden, und dann, in der zweiten und bereits letzten Woche, in der ich Eliza begegnete, geschah es: eine beinahe wundersame Begegnung.
Es war ein glücklicher Morgen gewesen; ich hatte zum erstenmal einen Platz vor ihr ergattert; wir saßen uns also gegenüber. Eliza trug ein cremefarbenes Kostüm, sie sah sehr vornehm aus, und doch wirkte es so, als paßte diese Art Kleidung nicht ganz zu ihr, als spielte sie eine Rolle, die Rolle der jungen erfolgreichen Geschäftsfrau vielleicht. Mittlerweile war Eliza mir vertraut geworden; ich meinte zu sehen, ob sie ausgeruht war oder zu wenig geschlafen hatte. Ich hatte sogar bemerkt, daß sie eine bestimmte Technik entwickelt hatte, ganz verstohlen ihre Mitreisenden im Blick zu halten, während sie selbst las oder aus dem Fenster starrte. Wieder saß sie mit einem Reiseführer über Italien da. Ich sammelte mich, um sie anzusprechen. Sollte ich den Italien-Freund mimen? Den erfahrenen Weltenbummler, der ein paar gute Ratschläge erteilen konnte? Oder doch den interessierten, aber ahnungslosen Zeitgenossen? Zugegeben, ich starrte sie an. Ich liebte die Rundungen ihres Mundes, das Graugrün ihrer Augen, die sie, anders als die Tage zuvor, nicht hinter einer Sonnenbrille verbarg. Außerdem machte ich eine neue Beobachtung. Ich entdeckte, daß sie die kleinen Finger ihrer beiden Hände lackiert hatte. Sie hatte eine hellrote, irgendwie unernste Farbe benutzt, so wie junge Mädchen es tun, wenn sie sich zum erstenmal die Fingernägel bemalen.
Eliza muß gespürt haben, daß ich sie beobachtete. Einen Augenblick musterte sie mich, aber mit einem Argwohn, der mir in die Glieder fuhr. Hielt sie mich für verdächtig? Verbarg sie gar irgend etwas?
Da fiel auf einmal ein Sonnenstrahl durch das schmutzige Fenster. Irgendwo am Himmel rissen Wolken auf, ein grelles, gelbes Licht drang in unseren Wagen, und Eliza nieste. Eine vollkommen menschliche Regung, die sie aber einen Moment lang hilflos machte. Eliza nahm ihre kleine dunkelrote Handtasche hervor und suchte offensichtlich etwas: ein Taschentuch. Hastig griff ich in die Tasche meines Jackets und reichte ihr ein schneeweißes Papiertaschentuch. Mir kam es wie eine heilige Geste vor. Das schneeweiße Tuch lag in meiner flachen ausgestreckten Hand. Eliza beugte sich anmutig vor, nahm es mit zwei Fingern, blickte zu mir auf und lächelte mich freundlich an.
Während sie das Taschentuch benutzte, schaute sie mich an. Ihre Augen schienen mich vorsichtig aus all dem namenlosen Raum um sie herum herauszuschneiden, so wie man eine kleine Figur aus schwarzem Papier schneidet. Ich nickte Eliza zu, und ich wußte, jetzt war die Gelegenheit gekommen, um mit ihr zu sprechen. Eine simple Eröffnung war möglich, eine Bemerkung über das Wetter, der sie mit einer kurzen, Einverständnis zeigenden Floskel begegnen konnte.
»Glaubst du, daß dein Italienisch schon gut genug ist?« fragte plötzlich der Mann neben ihr. Ich schrak zusammen. Diese Frage war eindeutig an Eliza gerichtet gewesen. Es war auch nicht wirklich eine Frage, eher eine gelangweilte Bemerkung, deren Sinn sich mir nicht erschloß. Der Mann hatte Eliza bei dieser Bemerkung nicht angesehen; mit leiser Verachtung starrte er aus dem Fenster, als wäre diese unauffällige, eher triste Gegend eine Beleidigung für ihn.
Ich war entrüstet und überrascht. Noch nie hatte ich diesen Mann gesehen, einen dunklen, etwa dreißigjährigen Kerl mit Dreitagebart und langem schwarzem Haar. Bisher war Eliza jeden Morgen vollkommen allein gereist.
Eliza lächelte matt. Dann erwiderte sie etwas auf italienisch, das ich nicht verstand, obschon ich ein wenig Italienisch beherrschte, und bedachte den Mann mit einem flüchtigen, gleichwohl selbstsicheren Blick. Ihre Stimme überraschte mich, sie klang tiefer, als ich es erwartet hatte, ein sanftes Timbre, das von einer gewissen Erfahrung zeugte; ja, sie würde sich von diesem Kerl neben ihr nichts vormachen lassen.
Kaum hatte sie diese kurze Antwort gegeben, setzte Eliza sich mit einer langsamen, routinierten Handbewegung ihre Sonnenbrille auf. Ich wußte, daß meine einzige Chance vorüber war. Dann, als wir an ihrer Station anlangten, nickte sie dem Mann kurz zu. Beide erhoben sich und verschwanden.
Ich schloß die Augen und sah das schneeweiße Papiertaschentuch, und ich sah Elizas Hand mit den beiden in einer Kinderfarbe lackierten Fingern und hörte ihre dunkelsanfte Stimme.
Das war mein erstes Abenteuer mit Eliza. Welch ein Abenteuer – der wortlose Austausch eines Papiertaschentuches, ein flüchtiges Lächeln, der Klang einer Stimme, ein italienischer Satz. Ich spürte, daß es eine Leere gibt, die Verbrennungen hinterläßt, wenn sie zu groß wird, und ich entschloß mich zu handeln. Etwas mußte passieren. Am nächsten Tag würde ich Eliza folgen. Furchtlos und ohne Scheu würde ich herausfinden, wohin sie ging, wo sie arbeitete, wann sie nach Hause zurückkehrte. Wie ein Detektiv wollte ich mich an ihre Fersen heften und ihr Leben erkunden.
Doch am nächsten Tag fand ich Eliza nicht mehr in meinem Vorortzug.
Sieben Jahre lang blieb sie verschwunden.
2
Frau Kommissarin, habe ich Sie mit der Schilderung meines kleinen Abenteuers gelangweilt? Sie möchten etwas anderes hören: die Geschichte eines Mordes, die Geschichte von Spuren, von Tatwerkzeugen und Motiven. Nur Geduld. Ich bin nicht der Mörder von Eliza. Meine Nächte sind mondlos und ohne Schlaf, die Musik in meinem Kopf habe ich abgestellt; das heißt, ich muß noch ein wenig mehr erzählen.
Ich bin ein Schreiber, ein schlechter Lohnschreiber ohne Ehrgeiz und Inspiration, wenn man es genau nimmt. Daß ich irgendwann in einem späteren Leben ziemlich grobgestrickte Geschichten spinnen würde, hat mir niemand an meiner Wiege gesungen. Phantasie benutzte ich als Kind nur, um zu fliehen, weg von dem Schlachthaus, den groben Geräuschen, den rosigen Händen der Eltern, die einem nie beibrachten, was Zärtlichkeit war. Ich habe mich immer für das Tun der Eltern geschämt, die man in einem anderen Landstrich Fleischhauer genannt hätte.
Das Geschichtenerzählen begann vor elf Jahren; nach einem ziemlich mittelmäßigen Abitur war ich nach Köln abgehauen. Ich studierte ein paar Semester, bis ich durch den Tod einer Freundin völlig aus der Bahn geriet. Schließlich kam ich als Volontär bei einer Zeitschrift unter, die vor allem über Fürsten und Filmstars berichtet. Für mich war es zunächst die Erfüllung. Plötzlich saß ich Menschen gegenüber, die als Berühmtheiten galten, denen ihr Leben in Filmen und Magazinen eine Art Heiligenschein verlieh. Ich war nicht mehr der kleine Junge, der von Fleischhauern abstammte; ich hockte in eleganten Hotelbars, trank teuren Champagner und stellte belanglose Fragen, und anschließend ließ ich mich mit meinem Star fotografieren. Das war in diesen Kreisen von Reportern ein ehernes Gesetz: erst das Interview, dann das Foto, als müsse man beweisen, daß man wirklich mit der Berühmtheit zusammengetroffen war, über die man schrieb.
Es ist kein Geheimnis. Solch ein Leben ist nach kürzester Zeit langweilig. Man kennt bald die Fragen und Antworten, die Lügen und Eitelkeiten. Auch von den teuren Bars, in denen man sitzt und wartet, hat man schnell genug.
Meine andere Zeit kam, als an einem späten Freitagnachmittag der Chefredakteur in mein winziges Büro stürmte. In der Hand hielt er ein Telegramm, mit dem er aufgeregt wedelte. »Christensen ist gestorben!« rief er. »Herzinfarkt.« Offensichtlich war ich an diesem Tag der letzte in der Redaktion und daher ausersehen, die Aufregung meines Chefs zu teilen. Doch das fiel mir recht schwer, weil ich gar nicht wußte, wer dieser tote Christensen war. Ich bewahrte Ruhe; später würde mir dieses eher zufällig abgeklärte Verhalten gewissermaßen als Heldentat angerechnet werden.
»Das Heft sollte eigentlich schon zu sein, und wir haben noch keine Geschichte!« rief mein Chef. Entdeckte ich wirklich zum erstenmal Unruhe in seinen Augen und Schweiß auf seiner Stirn?
»Welche Geschichte?« fragte ich ahnungslos.
Es stellte sich heraus, daß Christensen der Mann gewesen war, der unseren wöchentlichen Roman geschrieben hatte. Nun hatte sein unzeitiger Herzinfarkt ihn daran gehindert, seinen neuen Text abzuliefern. Das Heft mußte ohne Roman erscheinen.
»Stellen Sie sich die Entrüstung unserer Leser vor«, jammerte mein Chef mit beinahe echter Verzweiflung. »Und was wird der Verleger sagen?« Er strich sich über seine Glatze; er war ein großer, schwerer Mann, dem man nachsagte, er sei mit allen Wassern gewaschen. Dann begann ich für ihn zu verschwinden; das heißt, er starrte mich an und starrte durch mich hindurch, weil er begriff, daß ich, der kleine, unbedeutende Volontär, nicht der rechte Adressat für seine Verzweiflung war.
Trotz erwachte in mir. Trotz und ein vollkommen unberechtigter Ehrgeiz. »Ich schreibe Ihnen die Geschichte«, sagte ich kühn und ohne eine Idee zu haben, wie ich das bewerkstelligen sollte. »Geben Sie mir zwei Stunden Zeit«, fügte ich selbstsicher hinzu.
Für meinen Chef kehrte ich wie von Zauberhand in die Realität zurück. Er klopfte mir auf die Schulter, er lächelte und brachte mir eigenhändig Kaffee und Kognak. Dann zog er sich in sein stattliches Büro zurück, um auf meine Geschichte zu warten.
Auch ich wartete auf meine Geschichte. Ich saß da, starrte aus dem Fenster auf den öden, mittlerweile leeren Parkplatz vor dem Haus oder auf die große Uhr mit den zwei schweren, schwarzen Zeigern, die an der Wand unserer Redaktion hing. Die Minuten verstrichen. Jede Minute riß sinnlos eine weitere mit sich ins Nichts. Eine halbe Stunde saß ich so, malte Kreise auf einem kleinen weißen Block und hatte nicht einen einzigen Gedanken. Kann man wirklich an nichts denken? Gewiß, in diesen Minuten, da ich eine Geschichte suchte, dachte ich an nichts. In meinem Kopf waren schneeweiße Wolkenfelder oder schwarze Löcher.
Dann ließ mich die Verzweiflung ruhelos werden. Völlig ohne Grund hatte ich ein Versprechen abgegeben. Eine Geschichte mußte her, gleichgültig, was für eine.
Ich erhob mich, durchschritt mein winziges Büro mehrere Male, wischte mit der Hand fahrig über meine schmutzige Schreibtischplatte und gelangte nur zu dem Entschluß, mir noch einen großzügig bemessenen Kognak einzuschenken. Wenn ich schon in Schande unterging und nach zwei Stunden ohne eine einzige Zeile auftauchte, dann wollte ich mir zumindest jetzt etwas gönnen. Flüchtig blätterte ich in einer alten Zeitung, schon gar nicht mehr auf der Suche nach etwas, das ich verwenden konnte. Und da sah ich dieses Foto: ein Eishockeyspieler, der über das Eis schlitterte, und darunter die Zeile: Dick de Loo – der Eiskönig riß wieder mal die weiblichen Fans von den Sitzen.
Dick de Loo – der Eiskönig! Welch ein wunderbarer Ausdruck! Da hatte ich den Helden für meine Geschichte. Ich veränderte nicht einmal den Namen, sondern machte aus ihm lediglich den Eishockeyspieler und Privatdetektiv, der sich ausgerechnet in eine Klientin verliebt, eine Türkin, die ihren Vater wiederfinden will.
Ich schrieb wie im Rausch, hackte alles in eine alte Schreibmaschine. Am Anfang brauchte ich ein paar kräftige Zufälle, damit die Sache funktionierte. Der Mittelteil mit Schutzgelderpressung und Bandenkrieg geriet mir für unsere betuliche Zeitschrift um einiges zu rasant, dafür versöhnte ich den Leser allerdings mit einem Happy-End voller Sambarhythmen – auch wenn Samba nicht gerade als der türkische Nationaltanz gilt.
Nach ziemlich genau zwei Stunden wankte ich erschöpft in das Büro meines Chefredakteurs, der mich mit sowohl banger als auch hoffnungsfroher Miene empfing. Ich schaute ihm beim Lesen zu, bekam jede Regung, jede Nuance in seinem alten, grauen Gesicht mit. Frau Kommissarin, Sie können sich vielleicht vorstellen, wie grausam es ist, jemandem zuzusehen, der einen Text liest, den man kurz zuvor unter größten Mühen und noch größeren Zweifeln verfaßt hat.
Bald aber war mir klar, meinem Chefredakteur gefiel die Geschichte nicht, ganz und gar nicht, und als er die zwölf eng beschriebenen Seiten aus der Hand legte, sagte er nur: »Nein.« Seine Augen waren dunkel erloschen, so als habe er wirklich Hoffnung gehabt, ich könne ihn mit einer gelungenen Arbeit überraschen.
»Aber es ist eine Geschichte«, erwiderte ich matt.
Er wedelte mit dem Papier. Seine grauen Bartstoppeln glänzten, und er erlaubte sich auf diesen grundsätzlichen Einwand etwas, was sich ein gestandener Redakteur niemals erlauben kann: Unschlüssigkeit. Dann senkte er den Blick, seine Augen glitten über das Papier, als suche er in meinen Zeilen eine Bedeutung, einen Sinn, der ihm entgangen war. Erst viel später habe ich begriffen, was damals in ihm vorging; er gab sich der Gleichgültigkeit hin; letztlich war es gleichgültig, was im Blatt stand, Hautpsache, irgendeine Geschichte wurde präsentiert.
Wortlos winkte mein Redakteur mich hinaus, ohne weiteren Tadel oder eine matte versöhnliche Bemerkung. Meine Geschichte wurde gedruckt und erschien.
Doch wie war die Reaktion unserer Leser, die für uns Schreiber eine stumme, unbekannte Größe darstellten? Ich war noch nie einem Menschen begegnet, der das, was ich schrieb, freiwillig las. Kaum war das Heft auf dem Markt, erlebte unsere Telefonzentrale einen nie gekannten Ansturm. Unsere Leser, ferne, unbekannte Wesen, meldeten sich; sie wollten alles über Dick de Loo erfahren.
So begann meine Karriere als Lohnschreiber. Mein Chefredakteur, der sich schon bald damit auszeichnete, mein Entdecker zu sein, verdonnerte mich, für jedes Heft einen Roman zu schreiben. Ich wurde Dick de Loo, der Eishockeyspieler, der Detektiv, der Frauenheld, der Mann, der alles möglich machte.
Ich erhielt ein etwas größeres Büro am Ende des Ganges, und meine Kollegen nannten mich eine Zeitlang Dick, was ihre Art von Humor charakterisierte. Außerdem kam einmal in der Woche mein Chefredakteur vorbei und erkundigte sich nach meinem Vorrat an Kognak. Als alter, erfahrener Journalist war er offenbar der Meinung, daß ich solche Geschichten nur mit einem gewissen Quantum an Alkohol schreiben konnte. Der Erfolg bei meinen Lesern blieb, nur mich selbst langweilten meine Geschichten bald. Morgens um neun saß ich an meiner Schreibmaschine und erfand Dick de Loo. Das heißt, Dick de Loo schlich sich wie ein Kobold in meinen Kopf und spazierte da wie in einem alten staubigen Lager umher und inspizierte, ob er irgendwelche Dinge, die da herumlagen, für eine Geschichte verwenden konnte. Gab es die Erinnerung an einen alten Film, in dem Dick de Loo sich einrichten konnte? Hatte ich irgendwann einmal eine Musik gehört, die Dick hinter dem Steuer seines roten Sportwagens pfeifen konnte? Welche Bücher hatte ich in meiner Jugend am liebsten gelesen, und warum sollte Dick de Loo daraus nicht ein neues Abenteuer spinnen? Mit anderen Worten: Dick de Loo, der Kobold, der ein Eishockeyspieler, der ein Detektiv, der ein Frauenheld war, konnte alles gebrauchen, was in meinem Kopf umherspukte und -geisterte.
Ich klaute für Dick de Loo hemmungslos alles, was mir in den Sinn kam. Dick de Loo war gefräßig, er brauchte immer neuen Stoff für seine Geschichten. Am Anfang war ich noch wählerisch, was ich Dick zumuten konnte; ich glaubte, die Geschichte mußte spannend sein und ein Happy-End haben, dann mit der Zeit setzte ich ihm irgend etwas vor – eine Affäre mit einer Frau, eine Autoverfolgung, einen Verbrecher im Fahrstuhl, was auch immer –, und es funktionierte. Meine Leser schienen Dick de Loo alles zu glauben, weil er an sich eine unglaubliche Figur war.
Eine Geschichte, schrien sie, erzähl uns eine Geschichte. Und Dick de Loo fuhr mit seinem roten Sportwagen rechts ran, steckte sich mit großer Geste eine Mentholzigarette in den Mund – sein Markenzeichen – und begann zu erzählen.
Während Dick de Loo mich mehr und mehr für sich einnahm, mir sogar schon in meinen Träumen erschien, wurde ich immer einsamer. Manchmal suchte mich den ganzen Tag niemand in meinem Büro auf. Mein einziger Kontakt war der Gang zur Kaffeemaschine. Eigentlich haßte ich es, Kaffee zu trinken, aber nun wurde ich zum Kaffeesüchtigen. Vier- oder fünfmal am Tag pilgerte ich in das Büro der Redaktionssekretärin, holte meinen Kaffee und konnte so wenigstens ein paar Worte sprechen. Meistens redete allerdings die Sekretärin, eine füllig gewordene Mittvierzigerin, die begonnen hatte, Männer zu hassen und Katzen zu lieben. Natürlich wurden auch ihre Katzen ein Opfer von Dick de Loo, der sie erbarmungslos für seine Geschichte ›Die Katzenfrau‹ verwendete.
Nach vierundsechzig Folgen Dick de Loo war ich am Ende. Ich hatte im Grunde aufgehört zu existieren. Dick de Loo hatte die bedingungslose Herrschaft über mein graues Leben übernommen. Alles, was ich tat, las, sah, roch, wurde für eine Geschichte verwendet, und wenn ich überhaupt keine Idee hatte, so schrieb ich nichtsdestotrotz. Ich ließ Dick de Loo mit seinem roten Sportwagen losfahren, ließ ihn das Dach öffnen, weil die Sonne plötzlich hervorkam, und schon fiel irgendwo ein Schuß, und Dick war in seiner nächsten Geschichte angekommen. Alle Menschen, die ich von nah oder fern kannte, mußten Dick de Loo mit einem Auftritt beehren. Selbst mein Chefredakteur mit der Vorliebe für Alkoholisches durfte für die Folge ›Der Kognak-Mörder‹ herhalten.
Als ich an der Folge fünfundsechzig schrieb, war ich ein nervliches Wrack. Ich träumte schlecht, ich überlegte, mir einen teuren roten Sportwagen zu kaufen, und ich saß nächtelang in irgendwelchen Bars herum, ohne mit jemandem ein Wort zu wechseln. Nicht einmal die Barkeeper brachten mich zum Reden. Bis ich diese Frau traf. Keine besondere Frau; eine Frau, die sich spätabends in eine Bar verirrt hatte. Unsere Hände berührten sich, als wir nach den unvermeidlichen Nüssen griffen, die jeder ordentliche Barmann für seine späten Gäste bereithält. Sie nahm diese Berührung zum Anlaß, mich nach meinem Namen und nach meinem Sternzeichen zu fragen.
»Widder«, antwortete ich. Ich schaute sie nicht an. Das einzige, was ich sah, war ihr rechter Oberarm, waren die zwei Impfnarben, die mir verrieten, daß sie über Dreißig sein mußte.
Meine Antwort gab ihr Stoff für ausschweifende Spekulationen über meinen Charakter: Egoistisch und zielstrebig, aber leicht verletzbar müsse ich sein. Sie war eine von den Frauen, die nicht allein sein können, die deswegen sogar langweilige Männer in Hotelbars ansprechen.
»Ich glaube nicht an die Sterne, ich glaube nur an den Mond«, erklärte ich und bestellte bei dem höflich zurückhaltenden Barkeeper gleich eine neue Runde. Da mußte ich die Frau endlich anschauen. Sie war auf eine belanglose Art schön, hatte gepflegtes blondes Haar und eine Haut, die wie falscher Samt wirkte, als wäre es gar nicht ihre richtige Haut.
Die Frau hieß Sabine und war Innenarchitektin. Eine große Möbelmesse hatte sie nach Köln gelockt. Natürlich verriet sie mir auch ihr Sternzeichen mit Aszendent und dazugehörender Deutung. Offen gesagt, ich verfolgte ihr Sternengerede nicht sonderlich aufmerksam. Ich sah ihre kleinen, zarten Hände, die mir für einen sinnlosen Moment wie Kinderhände vorkamen, die gleich nach einer Puppe greifen würden. Dann fiel mir Dick de Loo ein. Hatte ich schon einmal sein Sternzeichen erwähnt, und konnte ich dieses neue Interesse für Astrologie in einer Geschichte verwenden?
Sabine beugte sich zu mir vor. Sie legte mir sogar ihre Hand auf die Schulter und blickte mir in die Augen, als wäre sie eine Ärztin, die einen Patienten begutachtete. »Woran denkst du?« fragte sie.
Offenbar hatte der Austausch unserer Sternzeichen zur Folge, daß wir uns duzten und uns in die Augen sehen durften.
»Ich denke an Dick de Loo«, erwiderte ich leichthin. Auch Sabines Augen wirkten falsch, als trüge sie Kontaktlinsen, deren Farbe sie passend zu ihrer Kleidung aussuchte.
Und da geschah es – mitten in dieser schwach erleuchteten, mittelmäßig teuren Hotelbar: Sabine entpuppte sich als eine Leserin.
»Aber wieso?« fragte sie. »Nehmen dich diese Geschichten auch so gefangen?« Ich lächelte. Was sollte ich darauf antworten? Sollte ich sagen, daß ich diese Geschichten schrieb und sie mich unendlich quälten und langweilten?
Ich entschied mich für ein Spiel, das meinem Helden, dem Eishockeyspieler und Frauenheld, in seiner billigen Wirklichkeit alle Ehre gemacht hätte.
»Ich bin Dick de Loo«, antwortete ich und kippte noch einen Kognak. Dann schnippte ich nach dem Barkeeper, der darauf tatsächlich hinter seinem Tresen heranglitt.
Sabine riß die Augen auf. Sie war schon ziemlich betrunken, und so gerieten ihr die Gesten ein wenig zu fahrig. »Du bist der Schriftsteller, der alle diese Geschichten schreibt?«
Schriftsteller? So hatte ich mich noch nie gesehen.
Sabine beugte sich vor und küßte mich. Blitzschnell schob sich mir ihre große, schwere Zunge in den Mund, so daß ich fast meinte, ich hätte es mit einem seltsamen Tier zu tun. Dann stürzte ein neuerlicher Redeschwall auf mich herab, der alles und nichts bedeutete. Wie großartig es sei, mich zu treffen; daß sie sich den Mann, der Dick de Loo schrieb, viel spektakulärer und interessanter und wunderbarer vorgestellt habe; daß ich eine irre Phantasie besitzen müsse.
Ich winkte den Barkeeper heran, der uns eine neue Runde brachte. Es mußte bald drei Uhr morgens sein. Sabine redete nur noch, und zwischen all ihrem betrunkenen Gerede vergaß sie, wer ich war. Ich nickte dann und wann, wenn ich eines ihrer Worte zufällig aufgeschnappt hatte. Endloses Gerede; New Age. Thorsten? Liebesnacht. Verrat?
Sie erzählte mir ihr Leben, und dann ließ ich mich von ihr mit auf ihr Zimmer nehmen, weil sie mir herzlich gleichgültig war. Sie roch nach Schweiß und Lavendel, und ihre Brust war schön und genauso aus falschem Samt wie ihr Gesicht.
So geht es mir gelegentlich. Menschen, die mir gleichgültig sind, kann ich eine Weile nah sein, bei anderen fällt es mir um so schwerer. Und doch bin ich immer voller Sehnsucht, einer Sehnsucht, die mich zum Mond und zu den endlosen Liedern in meinem Kopf trieb.
Als ich am nächsten Tag beinahe pünktlich in meinem Büro saß, beschloß ich, Dick de Loo umzubringen. Nach dieser Nacht mit einer meiner Leserinnen hatte ich genug von ihm. Die Geschichte seines Todes schrieb sich fast von selbst. Eine Frau mit dem unschuldigen Namen Sabine wurde Dick de Loo zum Verhängnis. Er hatte für sie einen Koffer mit Geld aus einem Schließfach geholt. Dann wurde er von ihr auf einen zugefrorenen See gelockt und brach im Eis ein. Ein grandioses Ende für einen Eishockeyspieler, wie ich fand. Ich beglückwünschte mich zu diesem besonderen Happy-End und brachte meine Geschichte eigenhändig zu meinem Chefredakteur.
Ich hatte seine Wut und Entrüstung gefürchtet, doch es gelang ihm, mich zu überraschen.
Nach dem unvermeidlichen Kognak wurde er vertraulich, väterlich geradezu. Seine Glatze glänzte vor Schweiß, wie immer, wenn er sich Mühe gab, jemandem seinen Standpunkt zu erklären. Das war einer seiner Lieblingssätze: den Standpunkt erklären. Er lobte meinen sechsten Sinn als Autor; es sei eine weise Entscheidung, Dick de Loo endlich sterben zu lassen. Die Verlagsleitung habe schon überlegt, wie man es mir beibringen könne. Dick de Loo sei am Anfang erfrischend neu und unkonventionell gewesen, doch nun sei es an der Zeit, mir etwas anderes auszudenken. Außerdem solle ich längere Romane schreiben. Billige Taschenbücher, die man an jedem Kiosk kaufen konnte.
Frau Kommissarin, ich bin käuflich. Ich gehöre zu den Menschen, die sich heimlich Sorgen um ihren Kontostand machen und die, haben sie einmal über die Stränge geschlagen, hinterher nachrechnen, was sie diese Eskapade gekostet hat.
Ich unterschrieb einen Vertrag, den mein Chefredakteur kurzerhand aus einer Schublade hervorzog, und machte weiter. Dick de Loo war tot, aber andere Helden und Abenteuer kamen. Wenn es hieß, wir brauchen mehr Liebesgeschichten, schrieb ich Liebesgeschichten. Wenn man Krimis orderte, lieferte ich Krimis. Ich mußte nur darauf achten, daß mir keine Figur mehr so nahekam wie Dick de Loo, der sogar meine Träume beherrscht hatte. Ich verdiente so gut, daß ich mir nächtens meine Ausflüge in die teuerste Hotelbar der Stadt leisten konnte, wenn ich einmal aus dem Tritt geriet. Wissen Sie, daß man spät nachts in den Hotelbars die einsamsten Menschen dieses Planeten trifft? Und sie haben eine Menge Geschichten zu erzählen, Geschichten, die ich dann für meine Geschichten verwendete. So gesehen, hob ich nur den Müll auf, den andere irgendwo liegenließen, und machte daraus mein Geschäft.
3
Es gibt Menschen, die tragen die Kraft der Zerstörung in sich. Sie zerstören andere, ob sie es wollen oder nicht. Eliza war so ein Mensch. Sie hat Menschen zerstört, weil das ihr Wesen war, weil sie sich nichts daraus machte. Ich bin auch so ein Mensch, auf ganz andere Art. Meine Schuld trägt ein, zwei Namen. Ich habe Cristina zerstört. Jede Nacht, wenn ich in den Schlaf sinken will, wenn ich meine, in ein warmes Dunkel abzutauchen, dröhnen von irgendwoher die zwei Schüsse, die Cristina getötet haben. Ihr kurzer überraschter Schrei gräbt sich in meine Ohren; und dann höre ich nur wilde Schritte, die meine sind, und einen keuchenden Atem, der mir gehört. Als Cristina starb, war die Welt endgültig verrückt geworden, und ich war der Feigling, der floh und sein ewiges Versteck suchte. Ihr Tod allein ist Grund genug, daß ich in dieser Zelle sitze und erzähle, um nicht ganz vor die Hunde zu gehen.