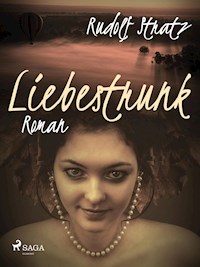Rudolf Stratz: Das freie Meer – Band 200e in der maritimen gelben Buchreihe – bei Jürgen Ruszkowski E-Book
Rudolf Stratz
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: maritime gelbe Buchreihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
In diesem Buch schildert der heute weitgehend unbekannte Autor Rudolf Stratz in Romanform das Verhältnis Englands und Deutschlands im Ersten Weltkrieg. Im Mittelpunkt des Romans stehen die aus München stammende Frau eines holländischen Kaufmanns und der Kommandant des fiktiven deutschen Hilfskreuzers "HEIDELBERG", der den Briten zunächst auf dem Atlantik, später auf der Briten-Insel in den Jahren 1914 und 1915 erheblichen Schaden zufügte. Der Text beschreibt die Stimmung der deutschen Seite im Ersten Weltkrieg, die euphorische Begeisterung von glühender Vaterlandsliebe beseelt im Hurrah-Patriotismus jener Zeit. Bis ins kleinste Detail wird der Krieg aus deutscher Sicht beschrieben. Dies Busch ist ein großartiges historisches Zeitdokument mit vielen Bildern. Leid und Sinnlosigkeit des Weltkrieges werden dem Leser bewusst. - Rezension zur maritimen gelben Reihe: Ich bin immer wieder begeistert von der "Gelben Buchreihe". Die Bände reißen einen einfach mit. Inzwischen habe ich ca. 20 Bände erworben und freue mich immer wieder, wenn ein neues Buch erscheint. oder: Sämtliche von Jürgen Ruszkowski aus Hamburg herausgegebene Bücher sind absolute Highlights. Dieser Band macht da keine Ausnahme. Sehr interessante und abwechslungsreiche Themen aus verschiedenen Zeit-Epochen, die mich von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt haben! Man kann nur staunen, was der Mann in seinem Ruhestand schon veröffentlicht hat. Alle Achtung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 414
Ähnliche
Rudolf Stratz
Rudolf Stratz: Das freie Meer – Band 200e in der maritimen gelben Buchreihe – bei Jürgen Ruszkowski
Band 200e in der maritimen gelben Buchreihe
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort des Herausgebers
Der Autor Rudolf Stratz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Die maritime gelbe Buchreihe
Weitere Informationen
Impressum neobooks
Vorwort des Herausgebers
Vorwort des Herausgebers
Von 1970 bis 1997 leitete ich das größte Seemannsheim in Deutschland am Krayenkamp am Fuße der Hamburger Michaeliskirche.
Dabei lernte ich Tausende Seeleute aus aller Welt kennen.
Im Februar 1992 entschloss ich mich, meine Erlebnisse mit den Seeleuten und deren Berichte aus ihrem Leben in einem Buch zusammenzutragen. Es stieß auf großes Interesse. Mehrfach wurde in Leser-Reaktionen der Wunsch laut, es mögen noch mehr solcher Bände erscheinen. Deshalb folgten dem ersten Band der „Seemannsschicksale“ weitere.
Hamburg, 2022 Jürgen Ruszkowski
Ruhestands-Arbeitsplatz
Hier entstehen die Bücher und Webseiten des Herausgebers
* * *
Der Autor Rudolf Stratz
Der Autor Rudolf Stratz
Rudolph Heinrich Stratz wurde am 6. Dezember 1864 in Heidelberg geboren und starb 17. Oktober 1936 in Bernau am Chiemsee. Er war ein erfolgreicher, heute weitgehend vergessener und produktiver Autor populärer Romane. Er war er Sohn des begüterten Großkaufmanns Heinrich Stratz aus Odessa. Rudolph Stratz verbrachte seine Kindheit und Jugend in Heidelberg. Er studierte Geschichte. Während des Ersten Weltkrieges war er Mitarbeiter im Kriegspresseamt der Obersten Heeresleitung, als vom Generalstab zugelassener Kriegsschilderer verfasste er Propagandaschriften und hielt auch entsprechende Vorträge.
* * *
1
1 – https://www.projekt-gutenberg.org/stratz/freimeer/chap001.html
Je düsterer der frühe Oktoberabend von 1914 über den Wogen dunkelte, desto mehr belebten sich die Lüfte von unsichtbaren Wellen. Tausende von Stimmen im Sturm flogen über die windgepeitschten Länder und Meere, kreuzten sich, hallten ineinander mit ihren Meldungen: „Krieg auf Erden!“ Alle Antennen des Festlandes arbeiteten, alle drahtlosen Stationen Europas rasselten, alle Funktürme der Erde sprachen, verkündeten mit ihren Schwingungen den Tagesverlauf des Weltbrands dem Freund und wider Willen auch dem Feind, empfingen von ihm ebensolche prasselnden Schwärme höhnender, unverständlicher Rätsel, ließen sie laufen, suchten sie zu überholen.
Funkstation von Nauen
Eiffelturm
Die Masten von Nauen schwangen, der Eiffelturm sprühte, Stationen des schwarzen Erdteils suchten den Anschluss an die ferne deutsche Heimat, die Schiffe auf allen Meeren des Erdballs riefen sich, warnten sich, gaben sich Nachricht vom Kanonendonner in der Südsee, vor Sansibar und Patagonien, von brennenden Wracks im Indischen Ozean, von japanischen Leichenhügeln vor Kiautschou, von Flintengeknatter in Südafrika, vom neuen Tod unter See und vom Untergang der Britenkreuzer durch „U9“.
Torpedierte britische Kreuzer am Morgen des 22. September
Die Wogenberge der Nordsee rauschten über ihrem Grab.
Nacht und Grauen lag über der leeren Stelle in der Wasserwüste. Rings brüllte das Dunkel. Aber fern davon, an der belgischen Küste, stand in der Finsternis eine weit leuchtende, purpurdüstere Lohe. Dort brannte, wie das Wahrzeichen des flammenden Erdballs, eine große Stadt.
Die Belagerung von Antwerpen fand zu Beginn des Ersten Weltkrieges vom 20. August bis zum 10. Oktober 1914 statt. Angreifer waren deutsche Truppen.
Sie brannte nicht nur. Weite Feuerbogen senkten sich von drei Seiten in sie hinein, krachendes Feuer stürzte vom Himmel auf sie hernieder, an dem lange blaue Lichtbahnen fegten und sekundenlang hoch oben schwimmende, unbekannte fischähnliche Ungeheuer enthüllten, und die Stadt unten knatterte ihr Feuer dagegen und hinaus wider den Flackerkranz von Blitzen in der Nacht, und durch die Nacht jagten ihre drahtlosen Notschreie immer verzweifelter in die Weite und über den Kanal: England, hilf! Antwerpen in Not! England, hilf! Sonst ist es zu spät! ... Die Deutschen nehmen Antwerpen. Die Deutschen kamen rascher nach Belgien als ihr, denen wir blind vertraut und uns in die Arme geworfen haben. England, hilf!
Aus Blut- und Brandschein und Völkerdämmerung flehten es die Funksprüche des entsetzten Landes, zitterten an den Kreideklippen Englands über den aus dem Donner der Brandung ragenden Mastspitzen versenkter Dampfer, trafen sich mit den zu Hunderten und Tausenden gleich den Apokalyptischen Reitern durch den Sturm heranjagenden Kriegsnachrichten von nah und fern, brausten mit ihnen gen London und vergingen dort in nichts ...
Denn diese große stockdunkle Häusermasse tief unter ihnen, das war die City. Die war jetzt am Abend so still und leer wie im Frieden. Alle Menschen hatten sie verlassen. Der Drache schlief vor seinem Hort und dachte nicht einmal im Traum an den Krieg.
Denn diese lärmende, weite Lichterhelle aus zähem gelbem Nebel, das war Londons Strand. Da waren alle Singspielhallen und Lustspielhäuser offen, da gleissten die Kinos, da rollten zu Tausenden die Kraftwagen, da bummelten schwarz wie die Ameisen die Menschen, da kümmerte sich keiner von ihnen um den Krieg auf dem Festland.
Denn diese wohlanständig nicht zu hell und nicht zu dunkel beleuchteten, durch schnurgerade Straßen in ehrbare Viertel geteilten Stadtteile da unten, das war Londons Westen. Die „Gesellschaft“, die in Frack und weißer Binde und tiefem Schulterausschnitt der Damen träumerisch in das flackernde Kaminfeuer schaute, zwischen Silber, Kristall und Orchideen des Luxushotels den Zigeunerweisen lauschte oder im Männerparadies des Clubpalasts die Beine räkelte, die „Society“ wusste, dass Aufregung nach Tisch nicht weise ist. Warum von unangenehmen Dingen wie von Belgien erst reden? Kleine Kolonialkriege begannen für England oft mit einem kleinen Missgeschick. Also auch die kleine Expedition nach Europa ... Nur eine Stelle gab es im Londoner Westen, wo die belgischen Hiobsposten gleich einem Schwarm böser Geister niedergehen konnten.
Das war die Ecke von Downing Street und Whitehall, unten im Reich der Regierungspaläste nahe der Themse. Hier, im britischen Auswärtigen Amt, entzifferte man die belgischen Nachrichten mit dem gleichen Stirnrunzeln, mit dem ein Großkaufmann einen vorübergehenden Geschäftsverlust bucht, und unten auf der breiten, windumpfiffenen Straßenfläche von Whitehall sagte der Marquess Harald von St. Asaphs, Mitglied des Britischen Unterhauses und Senior-Clerk im Auswärtigen Amt:
„Genug jetzt von Antwerpen, mein alter Craven!“
Der Markgraf von St. Asaphs, der älteste Sohn und Erbe des Herzogs von Chichester, lachte dabei, dass seine starken weißen Zähne unter dem bürstenartig kurzgeschnittenen schwarzen Schnurrbärtchen blitzten. Er war ein Mann in den Dreißigern, hatte die hagere Athletengestalt und die lässige Haltung und den Gesichtsausdruck des vornehmen Engländers. Aber was als Rassenmerkmal blond, blauäugig und sommersprossig war, das hatte sich bei ihm zu einem tiefbrünetten Typ gewandelt und verlieh ihm mit seinem kurzen, dunklen Haar, den lebhaften schwarzen Augen und der bräunlichen Gesichtsfarbe etwas Fremdartiges, einen Widerspruch zwischen dieser südlichen Tönung seines Äußeren und seiner urbritischen Art des Wesens und der Sprache.
Er lehnte, im langen, ledernen Automantel, die schwere Schutzbrille noch über die lederne Sturmkappe geschoben, lange Lederstulpen an den Händen, neben seinem ventillosen Daimler, dessen Kühler, den Rennwagen verratend, in einen spitzen Schnabel auslief und dessen Oberbau beinahe nur aus einem mächtigen Benzintank bestand, und meinte hoffnungsvoll zu seinem Begleiter, dem Reverend Craven:
„Ich schätze ernstlich: heute schaffen wir's!“
„Wenn wir's heute nicht schaffen, dann nie!“ sagte der glattrasierte, schmächtige junge Gottesmann der anglikanischen Hochkirche. Ein alter Gentleman kam von nebenan aus dem Schatzamt. „Was Neues, Saint Asaphs?“
„Wohl! Man munkelt, dass Rosicoucian gestern bei der Morgenarbeit die linke Hinterfessel gestrichen hat. Man telefonierte eben, die Ärzte gäben dem Hengst gute Hoffnung.“
„Und wie steht es mit Antwerpen?“
„Oh, es ist ein lästiger Platz! ... Ich habe eine Wette gemacht, von einem Punkt hinter Hampstead die sechzig Meilen big Ogmore Castle in neunzig Minuten zu fahren. Heute haben wir einen nützlichen Sturm im Rücken, und jetzt am Abend sind die Straßen frei von den verwünschten Hammelherden.“
Er schwang sich auf den schmalen Doppelsitz neben Mr. Craven. Dabei leuchtete ihm ein neuer Sportgedanke auf:
„Es wäre wahrhaft interessant, Craven, festzustellen, wer rascher in Ogmore ankommt – eine Depesche oder wir? Ich werde zur Probe meinem Vater das üble Ding von Antwerpen voraustelegrafieren.“
Der Marquess Harald von St. Asaphs schrieb ein paar Zeilen und gab sie einem Türhüter zur Besorgung. Dann fuhr er los. Im Wirbelwind flog an ihm und seinem Begleiter, nachdem sie die letzten Ausläufer des Häusermeers von London hinter sich gelassen, das alte England vorbei, jetzt in Dunkel gehüllt, jetzt wieder in bläulichem Zwielicht, je nachdem der Mond aus den zerrissen jagenden schwarzen Wolken trat und den tiefen Frieden des Inselreiches beschien, die stundenlangen grünen Rasenflächen und hohen Baumgruppen, die sich ununterbrochen folgenden Spiel- und Sportplätze, die Städtchen mit ihren zwei Reihen einstöckiger Häuschen, die behaglichen Landsitze und die türmereichen Schlösser, Glut von Hochöfen und Fabriken in der Ferne, dunkle Gestalten in regelmäßigen Abständen am Wege: die Aufpasser des britischen Automobilklubs, die rechtzeitig den dahinrasenden Fahrer vor der Polizei warnten. Polizei war nicht in Sicht. Die Kilometerfresser sausten ungehemmt durch Nacht und Sturm, der Markgraf am Steuer, der Geistliche die Uhr in der Hand.
Aber der elektrische Funke war doch schneller als der Motor. Die Depesche kam vor ihnen in Ogmore Castle an, gerade als der lange Zug der Ladies sich von der Tafel im Speisesaal erhoben hatte und feierlich und seiderauschend, mit hochfrisierten Blondköpfen, rosig leeren Gesichtern, mageren weißen Schultern und glitzernden Familiendiamanten durch die ungeheuren Hallen des Tudorschlosses und die marmorne Freitreppe zu den Gesellschaftsräumen hinaufbewegte. Mit ihnen waren die Herren aufgestanden. Während sie sich wieder setzten und zusammenrückten, ersah der Haushofmeister die Gelegenheit. Die goldene Kette um den Hals, trat er feist und würdevoll hinter den uralten, geschnitzten Eichenstuhl seines Herrn und reichte ihm die Botschaft, die jener halb unter dem Tisch vom Silberteller nahm.
John Herbrand, der elfte Herzog von Chichester aus dem Hause Glun und Vater des Marquess von St. Asaphs, war ein äußerlich unscheinbarer, magerer und mittelgroßer Mann mit einem ergrauenden rötlichen Vollbart, dessen ungepflegte Wirrnis seine völlige Gleichgültigkeit gegen alles verriet, was irgendein Mensch auf Erden über ihn dachte. Streng genommen erkannte er auch von allen Menschen auf Erden höchstens einen als über sich stehend an, den Herzog von Norfolk als Ersten Herzog und Earl von England. Er hatte kalte blaue Augen und ein leidenschaftsloses, rosig getöntes Gesicht, das bis auf die stark entwickelten Kiefer fein, fast zart geschnitten war. Ein grämlicher Zug lag darauf. Der Herzog von Chichester stand, mit seinem Ende der Fünfzig, an der Schwelle der Jahre, wo seit Jahrhunderten alle regierenden Häupter seines Geschlechts in Trübsinn zu verfallen pflegten, wenn sie nicht vorher wegen Felonie enthauptet worden waren, wie sein Stammherr David Glun auf dem Bild gerade über ihm und viele andere. Diese frühzeitig Geköpften zeigten im dunklen Rahmen der Ahnenbilder noch frische und grausam lächelnde Gesichter. Bei den Überlebenden kam mit der Neuzeit und mit dem Alter das Schweigen, die Versunkenheit, die Verdrießlichkeit, dass man alles besaß, was nur ein Mensch zu besitzen vermag: den Rang eines Halbgottes, unermesslichen Reichtum, die Herrschermacht eines erblichen Gesetzgebers über England und damit über die halbe Erdkugel.
Sein stiller und unnahbarer Gesichtsausdruck veränderte sich nicht, während er die paar Zeilen las. Er betrachtete sich als ein Stück England. Was England nützte, war gut. Was England schadete, war schimpflich. Die Wahrheit war in diesem Fall schädlich. Ein plötzliches freimütiges Lächeln übersonnte und verjüngte sein Gesicht.
„Zufriedenstellende Neuigkeiten!“ sagte er zwischen den Zähnen.
„Und welche, mein Lord Herzog?“
„Die Deutschen haben in Antwerpen das Nachsehen. Die britische Besatzung hat sich ihnen durch einen glänzenden Rückzug entzogen!“
„Und Antwerpen selbst?“
„Antwerpen ist ein Platz wie mancher andere. Lassen wir ihn vorläufig den Deutschen.“
Nichts wog im Vereinigten Königreich schwerer als das Wort eines Lords. Diese fünfhundert Männer des Britenadels waren für Britannien und das angelsächsische Weltreich das Maß der Dinge. Das Vorbild, wie man sich anzog, rasierte, im Sattel saß, aß, trank, rauchte, betete, redete, dachte. Nun ja! Antwerpen war ein unbeträchtlicher Ort. Man konnte sich freuen, den zerschossenen Steinhaufen an die Germans losgeworden zu sein...
Der Herzog von Chichester goss seinem Nachbar zur Linken, dem hochwürdigen Bischof Abbot, eigenhändig den hundertjährigen Diamant-Jubiläums-Portwein ein. Rechts von ihm, dem Witwer, saß sein Schwager, der Earl Fairtlough, ein klapperdürrer alter Lord und sonst nicht viel als kraft der Erbwürde Lordleutnant und Custos Rotulorum seiner Grafschaft und Ehrenoberst ihres Neomanry-Regiments. Gegenüber von ihm, klein, breitschultrig, mit rohem, braunem Bulldoggengesicht und Stiernacken, der Admiral Sir James Warrington von der Königlichen Marine, rechts und links von ihm Lord Beaulieu, Mitglied des Geheimen Rats Seiner Britischen Majestät, und, ein nützlicher Neuling in diesem blaublütigen Kreis von Angelsachsen- und Normannenadel, mit seinen sarkastischen und beweglichen Zügen und Augen flink wie eine Maus, Sir Frederick Bacharach. Und es war, als stände hinter ihm, wie Bankos Geist, die feiste Schattengestalt seines gekrönten Meisters und Gönners, der ihn, wie all die anderen Baronets von Goldes Gnaden, zu seinem Vertrauten gemacht, als frage aus dem Jenseits heraus Eduard VII., der Lebemann, der Spieler, der Wüstling und Liebling seines Britenvolkes: Vollstreckt ihr meinen letzten Willen?
König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Irland, Kaiser von Indien (1901–1910)
Ich habe das Land eingekreist, aus dem einst mein Vater als armer Ritter nach England kam. Seid ihr dabei, es zu vernichten?
Die Großen des Landes um den Herzog von Chichester rauchten gedankenvoll. Ihre Augen ruhten fischblütig in den steinernen Zügen unbestimmten, scheinbar bei allen ziemlich gleichmäßigen Alters. Aber hinter der undurchdringlichen Maske brauten Sorgen: schon nusste sich des Königs berittene Garde nach Belgien einschiffen, die Grenadiergarde, die Coldstream-Garde.
Was war wohl von den Königsfüsilieren noch übrig, die gleich jenen die stolzen Bärenmützen von Waterloo trugen, von des Königs Schützencorps und der Londoner Schützenbrigade Prinzgemahl, von den Sherwood-Jägern und König-Sussex? Vom Leicestershire- und Bedfordshire-Regiment?
Und gar in Schottland! Der MacIntyre of MacIntyre, das Haupt seines Clans, dessen Geschlecht so vornehm war, dass er keinen Herzogstitel trug, sondern einfach MacIntyre angeredet wurde, dachte sich: Was ist aus den Gardefüsilieren geworden, aus den König-Schotten von Lothian? Die stolzesten Regimenter des Reiches, des Königs Hochländer von der Schwarzen Wache, des Königs Eigene Cameronians, die Gordon- und Argyll-Hochländer tot in Flandern oder lebend in Döberitz ...
Selbst Irland blutete. Man war ängstlich über den Verbleib seiner Königsgarde, der südirischen Reiterei, der vierten Gardedragoner.
„Ein raues Werk, dieser Feldzug, Mac Intyre!“
„So ist es!“ sagte der Schottenhäuptling, dessen Vorfahren ebenso wie die Ahnen und Ahnfrauen der Britenlords um ihn geköpft in der geschichtlichen Blutstätte Londons, der Kirche St. Peter ad vicula, im Tower, ruhten, aber noch in der Richtung nach Norden, nach ihren heimatlichen Bergen. „Es ist die Hölle für unser Heer!“
„Nicht nur für das Heer!“
„Auch für die Flotte, Chichester?“ fragte der Admiral. Breiter Dünkel stand auf seinem Bulldogg-Gesicht. „Oh, redet nicht von dieser lächerlichen Unterseebootpest!“
Sir James Warrington, R. N., bekam beim bloßen Gedanken an diese schimpflichen Fahrzeuge einen dunkelroten Kopf. Draußen heulten Sturmstöße um Ogmore Castle.
Ogmore Castle
Es war, als seien die zerrissen an der gelben Mondscheibe vorüberfliegenden Wolken schwarze Boten, die über die graue See her, im Wind verweht, das Grollen ferner Schlachten, das Stöhnen Sterbender nach dem Frohen Alten England brachten.
„Der Krieg wird teuer!“ sagte der Baronet Bacharach.
Die Lords schauten nachdenklich drein. Dieser Krieg war ihre eigene Sache. Sie hatten ihn unternommen, um dem drohenden irischen Aufruhr mit Blut und Eisen vorzubeugen, um in England die von „Little David“, dem „kleinen Zauberer von Wales“, dem Volksmann Lloyd George unterwühlte Hochburg des Hochadels in ihren Grundfesten neu zu mauern.
David Lloyd George, 1. Earl Lloyd-George of Dwyfor OM (* 17. Januar 1863 in Manchester als „David George“; † 26. März 1945 in Llanystumdwy, Caernarfonshire) war ein britischer Politiker. Er wurde während des Ersten Weltkriegs, im Dezember 1916, zum Premierminister gewählt und war der letzte Liberale, der dieses Amt innehatte.
Und zu ihren Peerskronen hatten sich die Geldsäcke der City gegen den deutschen Wettbewerb gesellt.
„Nichts ist sicherer“, sagte der Herzog von Chichester in das gespannte Schweigen um ihn, und seine Worte folgten einander leidenschaftslos und gleichmäßig wie ein Tropfenfall dem andern, „nichts ist sicherer, als dass dieser Krieg gegen Deutschland im nächsten Frühjahr getan ist.“
„Es ist unmöglich, ein Ding ängstlicher zu prüfen, als wir es mit der Getreideeinfuhr nach Deutschland taten. Nun meinen unsere besten Männer, dass im Mai in ganz Deutschland kein Huhn mehr in einer Tenne ein Korn pickt. Geschweige denn ein Mann. Oder eine Frau. Oder ein Kind!“
Der Bischof Abbot lachte herzlich über sein sonst frostiges, kirchlich würdevolles Gesicht. Der Gedanke machte dem geistlichen Lord Spaß. Der Schotte MacIntyre, der hier nicht wie in seiner Heimat zum Abendfrack den gegürteten Schurz über nackten Knien, sondern schwarze Beinkleider gleich den anderen trug, forschte:
„Und dann, Chichester?“
„Dann wird es weise sein, Deutschland nicht völlig zu vernichten. Wir brauchen es zum eigentlichen Krieg. Gegen die Russen!“
„Vorsicht, dass der neutrale Gentleman nichts hört!“
Zugleich erhob sich, ziemlich weit von den Lords, ein großer starker Herr, breitschultriger als ein Engländer, in der Mitte der Vierzig, mit ziemlich kahlem Kopf und angegrautem Schnurrbart, und machte eine Handbewegung der Entschuldigung.
„Ich habe etwas Kopfschmerz“, sagte er lächelnd in ausgezeichnetem Englisch. „Ich werde, wenn es beliebt, meine Zigarre im Freien zu Ende rauchen.“
Er ging hinaus, bedächtig, in etwas gebeugter Haltung. Sein Gesicht zeigte den jedem Briten vertrauten ledergelben Anflug eines langen Aufenthalts in den Tropen.
„Ist er wirklich krank?“
„Ich fürchte, es ist nur ein allzu feines Taktgefühl des Gentlemans. Er besorgt, uns als Ausländer im Gespräch beim Portwein zu stören.“
„Ein verbündeter Ausländer, Herzog Chichester?“
„Ein Holländer. Ein Yonkheer Ter Meer aus vornehmem altem Haus. Er war lange Jahre im Dienst seines Landes in manchen Teilen der Erde. Seine Gesundheit zwang ihn, kurz vor Ausbruch des Krieges, zur Heimkehr.“
Oh – ein Holländer! Man hatte nichts gegen die kleinen Staaten. England schützte sie...
„Er hätte hierbleiben sollen“, sprach der Admiral.
„Sehr richtig, Sir James! Man muss sich jetzt um jeden Neutralen rund um die Welt so bemühen, als ob es auf ihn allein gegen Deutschland ankäme.“
„Aber nicht, wenn seine Frau eine Deutsche ist.“
„Oh ... oh!“
„Sprechen Sie von diesem Mynheer Ter Meer, mein Herzog?“
„Ich verbessere mich und sage: wenn seine Frau eine Deutsche war! Denn durch ihre Heirat mit dem Yonkheer Ter Meer ist sie seit zehn Jahren Holländerin geworden und hat ihn an alle Enden der Erde begleitet.“
„Und wo ist sie jetzt?“
„Nun, sie stand eben hier mit den andern Ladies von der Tafel auf.“
„Die schlanke blonde Dame, die dort unten saß?“
„Allerdings.“
„Sie sah lieblich aus.“
„Oh – wie gefährlich ist das!“
„Nirgends im Himmel und auf Erden sehe ich eine Gefahr für Briten“, sagte John Herbrand, der elfte Herzog von Chichester, und in seinen eiskalten hellblauen Augen lag ein Dünkel, ein stiller Wahnsinn der Macht, wie ihn die Welt seit Römerzeiten nicht gekannt. „Wir haben vor der Lady nichts zu verbergen. Wir sind ihr nur die Empfindungen des Mitleids mit dem bevorstehenden Schicksal ihres einstigen Vaterlandes schuldig. Im Übrigen sucht Yonkheer Ter Meer hier nicht mich, sondern meinen Sohn Harald, den er von früher her kennt. Es handelt sich um den Krieg.“
„Bei einem Neutralen?“
„Ich erwähnte schon, dass seine Frau aus Deutschland stammt. Der Mann ihrer Schwester, ein süddeutscher Reiteroffizier, ist auf einem Spähritt in Flandern gefallen und liegt hinter unseren Linien begraben. Yonkheer Ter Meer hofft durch die Vermittlung von Downing Street für seine Frau die Erlaubnis zu erhalten, die Leiche ihres Schwagers über Holland in die Heimat zu befördern. Deswegen kam er über den Kanal hierher.“
Bei der Erwähnung des Marquess von St. Asaphs, des ältesten Sohnes und Erben des Herzogs von Chichester, war unten an der Tafel, wo die jüngeren Gentlemen saßen, eine Heiterkeit entstanden. Da kannte man Seine Herrlichkeit. Man mutmaßte, wo er wohl augenblicklich sei. Vielleicht nach Paris hinübergespritzt? Dort war er zu Hause, auch im Krieg. Oder in London, in dem Bummel des Strand, wo jetzt seine Freundin, Miss Phyllis Phelps, zum fünfhundertsten Mal in dem Singspiel „The French Girl“ singend, tanzend und vor dem Vorhang radschlagend die Briten entzückte? Lord Harald suchte jetzt solche kleinen Zerstreuungen ohne Belang, seitdem er in diesem Frühjahr, kurz vor dem Krieg, gerade in dem skandalösesten der eben fälligen zwölf Ehescheidungsprozesse der Londoner Welt als unfreiwilliger Zeuge der zur Season versammelten Gesellschaft Englands und der Vereinigten Staaten ausgiebigen Gesprächsstoff geliefert hatte. Immerhin ... was ein Lord und Peerserbe tat, war gut. Über Lord Haralds Liebesgeschichten hatte schon viel, sehr viel Gras wachsen müssen...
„Ich schätze, dass der Marquess in Portsmouth ist, zu Versuchen mit seinem Wasserflugzeug, das wie eine Robbe an Land gehen kann.“
„Hat er es selbst erfunden?“
„Wenn ich Seine Herrlichkeit recht verstand, will er in diesem Winter damit im Fayum in Ägypten Wildgeflügel aus der Luft schießen.“
„Welch ein Kopf!“
„Ja. Es ist wundervoll!“
„Wenn man bedenkt, dass seine jüngeren Brüder ebensolche Sportcharaktere sind ...“
„Lord Charles Glun sticht zurzeit in Marokko auf der Hetzjagd Wildeber aus dem Sattel mit der Lanze.“
„Und Lord Francis Glun ist, so schätze ich, in diesem Augenblick so nahe bei Mekka, als es einem Christen möglich ist.“
Man war von England aus immer unterwegs auf diesem kleinen runden Erdball. Von dem Turmgewimmel und den langen, lichthellen Fensterreihen des Schlosses Ogmore auf hohem Hügel aus betrachtet, schien die Weltkugel nur ein einziger großer Sportplatz Englands. Niemand wusste das besser als der Mynheer Cornelis Ter Meer, der in fünfundzwanzig Jahren und fünf Erdteilen im Dienste seines eigenen kleinen Vaterlandes zugleich Großbritannien am Werk gesehen hatte. Er ging draußen einsam, bedächtig rauchend, in Frackanzug und bloßem Kopf, die Hände auf dem Rücken, auf der windigen, endlosen Schlossterrasse auf und ab. Er schaute gelassen mit seinen ruhigen grauen Augen, aus denen natürlicher Verstand sprach, um sich und fühlte, so sehr er ein freier Holländer und stolz auf diese Freiheit war, doch eine Art Andacht vor der schrankenlosen Weite dieser britischen Verhältnisse. Er wusste, der Herzog von Chichester besaß noch ein halbes Dutzend Schlösser wie das hier. Ihm gehörte ein gutes Stück englischen Bodens, Ländereien in Rhodesien vom Umfang eines europäischen Königreiches. Seine Jahreseinkünfte rechneten nach vielen Millionen. Und Peers wie dieser Herzog, in dessen stillem, gefurchtem, rötlich ergrauendem Haupt wenig Klugheit, aber viel Lebensschulung wohnte, der in seiner Jugend nur ein guter Ruderer in Cambridge gewesen war, aber jetzt im Alter im Oberhaus mit den Köpfen seiner Vorfahren nützlich dachte und redete, solche Peers gab es noch zu vielen Dutzenden in England und Wales, in Schottland und Irland.
Der Mynheer Ter Meer hatte nichts gegen die Deutschen. Seine Frau stammte ja aus Bayern, wo er sie durch Zufall bei einem Kuraufenthalt in Kissingen vor elf Jahren kennengelernt. Er hörte gern deutsche Musik, trank gern deutschen Rheinwein, war gern im Sommer in Baden-Baden. Noch lieber in Paris. Dort aß man gut. Er las fast nur französische Bücher. Er liebte die Franzosen. Aber er bewunderte die Briten...
Weithin dehnte sich vor ihm unter der Terrasse des Schlosses Ogmore der Park, verlor sich, mit Wiesenflächen beginnend, über Baumgruppen in stundenweite Waldwildnis. Vor hundert Jahren hatten noch Bauerndörfer da gestanden, wo jetzt das gefleckte Damwild im Mondschein die Schaufeln hob, verhoffte, ruhig weiteräste. Es war nichts Besonderes. Nur ein Auto, das wild schnatternd mit weißglühenden Augenpaaren gleich einem Dämon der Nacht die leere, glatt asphaltierte Parkstraße über die Leichen wilder Kaninchen hinweg mit Hundertkilometergeschwindigkeit heranschnob, langsamer wurde, in dünnem, bläulichem Schmirgelnebel vor dem Schloss hielt.
Zuerst kletterte der Reverend Craven heraus und schwenkte glückwünschend seine Uhr gegen den Marquess Harald von St. Asaphs, der ihm folgte. „Glorreich gewonnen!“ rief er, und man hätte glauben können, sein Triumph gelte einem Sieg in Flandern und nicht einer Kaminfeuerwette im Londoner Marlborough-Club.
Die beiden, der hünenhafte, brünette Lord und der schmächtig-athletische Gottesmann, liefen in das Haus, um vor allem die Minuten- und Sekundenzahl der Rekordfahrt an den fieberhaft harrenden Club zu telefonieren und sich dann in den Abendanzug zu werfen.
Als der Markgraf von St. Asaphs eine halbe Stunde später sich der langen, glänzend hellen Flucht der Gesellschaftssäle näherte, deutete nichts mehr in seinem Äußeren auf die wilde Jagd durch Nacht und Wind. Er war mit seinen sechs Fuß Länge, der durch Kinderstube und Sportplatz geschulten, federnden Leichtigkeit seiner Bewegungen, dem heiteren Ausdruck eines Halbgottes das Urbild eines jüngeren Engländers der höchsten Stände, nur dass das Weiß der Halsbinde und Hemdbrust noch fremdartiger die bräunliche Färbung seines Antlitzes, das Schwarz der Augen, des Scheitels und des kurzen Schnurrbarts hervortreten ließ.
Auf der Türschwelle des ersten Raumes blieb er stehen, sah auf die Damen drinnen und gähnte. Viele Ladies und Gentlemen saßen da im Halbkreis um den riesigen Kamin. Durch das Knattern der Buchenscheite klangen die halblauten Stimmen. Man besprach leidenschaftslos die Einzelheiten des großen Gymkhana (Gymkhana [dʒɪmˈkænə, -ˈkanə] ist im deutschen Sprachraum ein Geschicklichkeitsturnier in einem Parcours, das in möglichst kurzer Zeit zu absolvieren ist.) zu Ende dieser Woche. Es wurde ein gutes Ding: Miss Briggs und Mr. Graham würden nebeneinander über die Hürden galoppieren, ihre rechte und seine linke Hand mit einem Taschentuch zusammengebunden. Oh – sie hatten schon oft in Indien das halsbrecherische Kunststück zusammen gemacht! Und dann würden die Ladies um die Wette laufen, jede ein rohes Ei auf einem Teelöffel in der Hand. Alle Misses würden ihre Schuhe ausziehen und auf einen großen Haufen werfen, und wer aus dem Wirrwarr die seinen zuerst wiedergefunden und angezogen, war Siegerin. Zum Schluss das Geflügelrennen: die Ladies hüpften rückwärts und lockten durch Körnerfutter jede ihre Pute, ihre Gans, ihre Ente oder Henne, damit sie rascher liefe als die Mitvögel rechts und links...
Der Krieg ... wer sprach denn da nebenan vom Krieg? Eine helle Damenstimme...? Was ging einen hier der Krieg an! Aber da war das Wort schon wieder... Der Marquess von St. Asaphs schaute von der Schwelle, wo er stand, hinüber in den zweitnächsten Raum.
Die mageren Schultern der Ladies, die da saßen, hoben sich alle aus weißen oder buntfarbigen Roben. Nur ein ausgeschnittenes Kleid in der Mitte mahnte durch seinen schwarzen Samt an Halbtrauer. Eine junge schlanke Frau zu Ende der Zwanzig trug es. Die Lichtfülle des Kronleuchters fiel gerade von oben auf ihr schmales, zartes und lebhaftes Gesicht, über dessen reiner und rosig klarer Hautfarbe aschblondes Haar sich von der Stirn wellte. Ihre Augen waren blau und viel wärmer und belebter als die kalte Inselruhe im Blick der Britinnen, auf die sie fortwährend gedämpft und rasch einsprach.
„Wer ist denn die Lady dort drüben, Sir James?“
„Eine geborene Deutsche.“
„Ja. Zu allem Glück aber seit zehn Jahren eine Mevrouw Ter Meer. Sie verteidigt ihr früheres Vaterland!“
„Oh – kommen Sie zum Bridge.“
Der Markgraf Harald von St. Asaphs hörte das hinter sich. Er blieb stehen und schaute auf Johanna Ter Meer und betrachtete sie wie ein Bild. Ihr Mienenspiel war in seinem raschen Wechsel viel ursprünglicher und temperamentvoller als die seelenlos lächelnden Züge der Damen um sie. Sie hob unwillkürlich beim Sprechen etwas die Hände und rang sie ineinander und wiederholte zu den Ladies halblaut, etwas atemlos von innerer Unruhe und Erregung und in einem fließenden Englisch, dessen unschöne Quetschtöne der weichen Färbung ihrer Stimme widersprachen:
„Was haben euch denn nur die Deutschen getan?“
„Oh, fragen Sie das nicht, Mrs. Ter Meer!“
„Wozu dieser entsetzliche Krieg zwischen euch und ihnen? Es blutet einem das Herz!“ „Beten wir zum Herrn, Mrs. Ter Meer.“
„Ich kenne Britannien! In den zehn Jahren meiner Ehe habe ich das Britische Weltreich überall mit eigenen Augen gesehen und aufrichtig seine Größe bewundert. Aber mein Herz hängt an dem Land, in dem ich geboren bin ...“
„Nichts ist begreiflicher.“
„Warum gönnt man den Deutschen nicht die Freiheit, zu leben? Unzählige andere weiße und farbige Menschen dürfen es doch. Warum also der Krieg?“
„Kriege sind Handelskriege, Madam!“
„Nun, Sir, mein Mann ist Holländer, warum dürfen die Holländer Handel treiben und die Deutschen nicht?“
„Weil die Holländer keine so große Kriegsflotte bauen, Madam!“
„Oh, Sie als ehemaliger Seelord wissen es: warum dürfen die Japaner und die Amerikaner mächtige Kriegsflotten bauen und die Deutschen nicht?“
„Die Kolonien ...“
„Warum dürfen die Franzosen alles, was nicht britisch ist, auf der Welt annektieren und die Deutschen nichts? Ich möchte immer euer beider Hände ineinanderlegen, damit die beiden größten Völker, die es gibt, sich versöhnen!“
„Nicht, solange der preußische Militarismus herrscht.“
„Oh, Mr. Maxwell, antworten Sie mir freimütig als Oberst ... sind die Heere des Zaren nicht viel zahlreicher?“
„Es ist nicht die Zahl, es ist der Geist der Heere! Potsdam ist der Sitz der Herrschsucht.“
„Nein! Selbst wenn es so wäre – beginnt nicht die Nationalhymne Ihres großen und freien Reiches: Britannia, beherrsche die Meere! Warum ist dem einen erlaubt, was dem anderen verboten ist?“
Johanna Ter Meers zarte und regelmäßige Züge hatten sich mit einer feinen Röte bedeckt. Sie atmete rasch. Die Peeresses und ihre Verwandten und die Frauen und Töchter der Landherren um sie lächelten kaum merklich. Eine Dame, die sich aufregte ... Das war das Festland! Auf den Briteninseln kam das nur bis Sonnenuntergang, während des Sports, vor. Zum Glück stammte die blonde Lady im schwarzen Samtkleid aus einem vornehmen feindlichen Haus und war mit einem vornehmen Neutralen verheiratet. Sie würde schon keine Taktlosigkeiten sagen. Alles Übrige, außer gesellschaftlichen Verstößen, verzieh man...
„Ich habe immer noch die Hoffnung“, versetzte Johanna Ter Meer, und über die unterdrückte Leidenschaft und Unruhe ihrer schmalen Züge legte sich wieder die Selbstbeherrschung der Diplomatenfrau, „dass England und Deutschland eines Morgens in den belgischen Schützengräben ihre Gewehre beiseite stellen ...“
„Oh ... armes Belgien ...“
Ein „Poor Belgium“ rauschte durch den Raum. Ein Seufzen. Zum Himmel verdrehte wasserblaue Augen. Es gehörte bei der Erwähnung Belgiens zum guten Ton.
„... und England und Deutschland sich zurufen: Genug! Wir wollen wieder Geschäfte miteinander machen und voneinander lernen und uns künftig besser vertragen. In der Welt ist doch reichlich Platz für uns beide. Also fort mit den Schrecken dieses Kriegs!“
Schrecken des Kriegs? Im Vereinigten Königreich merkte man davon nichts. Die Leute in der Ferne, die den Krieg führten, wurden angemessen dafür bezahlt. Daheim gingen die Geschäfte wie gewöhnlich. Es gab guten Sport. Die Londoner Season im nächsten Frühjahr versprach glänzender denn je zu werden. Man hörte Johanna Ter Meer höflich zu wie einem plaudernden Kind. Es war so drollig, dass die fremde Lady immer ganz ernsthaft England und Deutschland miteinander verglich und auf eine Stufe stellte ... England und Deutschland...
„Hoffen wir, meine teure Madam, dass Gott beiden Ländern bald die Erkenntnis von Recht und Unrecht sendet“, sprach der Bischof Abbot salbungsvoll und trat nebenan in einen Kreis der Herren um MacIntyre, und dort war seine Stimme voll unterdrückter Entrüstung: „Es war soeben zum ersten Mal, dass ich diese Hochburg des Satans, das Deutsche Reich, verteidigen hörte, und ich möchte es nicht wieder hören ...“
Drüben war Johanna Ter Meer verstummt. Die Briten und Britinnen um sie herum schwatzten aus ihrem unerschöpflichen Gesprächsstoff, den Verlobungen, Hochzeiten und namentlich den ständigen Ehescheidungen der „society“. Sie begriffen die Stille der Lady vom Festland. Die hatte den Tod ihres Schwagers zu beklagen. Sie sah den Untergang ihres ehemaligen Vaterlandes vor sich. Es war gut, diese Stimmung zu ehren. Dann sah Johanna Ter Meer ihren Gatten auf sich zukommen. Neben ihm einen großen schlanken Mann Mitte der Dreißig. Vielleicht auch ein paar Jahre jünger. Denn der tiefbrünette Einschlag seines Äußeren gab dem Markgrafen von St. Asaphs hier, auf den Inseln der Flachshaarigen, einen scheinbaren Vorsprung im Alter.
Der Yonkheer Ter Meer an seiner Seite ging rascher, als es sonst seine Art war. Er sah feierlich aus. Sein gewöhnlich wohlgelauntes, verständiges Gesicht war von verhaltener Ehrerbietung durchleuchtet.
„Seine Höchste Ehren, der Marquess von Saint Asaphs!“
Der Lord Harald von St. Asaphs zeigte lächelnd die weißen Zähne unter dem gestutzten schwarzen Bärtchen, durch das er sich von den glattrasierten Großen und Herren ringsum unterschied. Er reichte Johanna Ter Meer seine mächtige weiße Hand und sagte rasch, einfach und herzlich:
„Was kann ich für Sie tun?“
„Mein Lord Markgraf ...“
„Kommen Sie! Wir wollen uns hier beiseite setzen!“
Er nahm in einer Ecke neben ihr Platz, schlug ein Bein über das andere, warf, nach der zwanglosen Art des Landes, den Oberkörper tief in den Ledersessel und schaute sie über die Schulter lächelnd an. Seit er in dem Raum war, schien dessen Luft verändert und durchzittert. Alle jüngeren Damen hatten einen neuen und belebten Gesichtsausdruck ... Diese stille Erregung galt nicht nur dem noch immer unvermählten Peerserben, sondern auch ihm selbst und seinem Ruf.
„Ich bin so froh, Ihre Bekanntschaft zu machen, Mrs. Ter Meer“, sagte er. „Ich kannte Yonkheer Ter Meer, noch ehe Sie ihn kannten. Ich war vor zwölf Jahren viele Wochen lang in Java sein Gast. Es waren prächtige Tage in Weltevreeden. Ich war damals ein junger Bursche von kaum Zwanzig.“
Er überging, dass ihn seine Familie zu jener Zeit mit Mühe in Ägypten aus den Netzen einer der vielen fahrenden anglo-indischen Witwen gerissen und zur Abkühlung auf eine Weltumseglung geschickt hatte. Er meinte mit einem lächelnden und forschenden Blick:
„Wissen Sie, Mrs. Ter Meer, dass ich Sie eben, als ich die Ehre hatte, Sie zum ersten Mal zu sehen, für eine Holländerin hielt?“
„Ich bin deutscher Abstammung, Herr Markgraf.“
„Oh, ich weiß. Es macht nichts, Madam!“
„Eine Bayerin. Eine geborene Freiin von Forchheim.“
„Man sieht es Ihnen nicht an, dass Sie aus einem so wilden Land stammen.“
„Wild?“
„Es sind doch noch halbe Wilde in diesen rauen Bergen?“
„Mein Gott: waren Eure Herrlichkeit je dort?“
„In Österreich?“
„Nein. In Bayern!“
„Nun – Tirol gehört doch zu Österreich.“
„Aber Bayern nicht zu Tirol!“
„Oh – ich wusste nicht, dass es preußisch sei.“
Johanna Ter Meer schwieg. Sie dachte sich: das ist nun einer ihrer Höchsten, ihrer erblichen Gesetzgeber! Wie ungeheuerlich ist die Unwissenheit in deutschen Dingen erst in der großen Masse seines Volkes. Kein Mensch in Deutschland würde es mir glauben. Sie hub an:
„Ich sprach von meiner deutschen Herkunft, um auf meine Schwester zu kommen. Sie war mit einem württembergischen Rittmeister verheiratet. Einem Freiherrn von Rüdenberg ...“
„... und er fiel! Yonkheer Ter Meer erzählte es mir. Die Witwe möchte seine Leiche durch Ihre Vermittlung aus unseren Linien nach Holland überführen?“
„So ist es.“
„Wo liegt er begraben?“
„Bei Sluysbeke. Das Dorf wurde wiederholt verloren und genommen.“
„Ja. Es waren frische Tage!“ Lord Harald erhob sich in seiner ganzen Länge. Er war sofort bereit, zu helfen. Sie merkte, dass er überhaupt einer hübschen Frau nicht leicht etwas abschlug.
„Ich werde Viscount Killigrews in Whitehall anrufen“, sagte er. „Wir saßen in Oxford zusammen in einem Boot. Wir sind beide vom Christ-Church-College.“
„Und wird Seine Lordschaft denn jetzt noch auf dem Kriegsamt sein?“
„Oh, sicher! Der alte Bursche ist so ängstlich im Dienst. Er wird noch einmal seiner Gesundheit schaden.“
Der Marquess von St. Asaphs sagte es mit einem freimütigen Lachen. Ihn drückten die Pflichten des Lebens nicht, weder der Sitz im Unterhaus, der ihm mit siebenundzwanzig Jahren in den Schoss gefallen war, noch seine Tätigkeit als vornehmer Dilettant in der Politik von Downing Street. Er ging. Irgendwo war in England immer ein Fenster offen. Man fühlte plötzlich in der Luft das salzige Wehen der nahen, grau grollenden, an den Kreideklippen im Mondschein sich aufbäumenden See. Nebenan knisterte das Kaminfeuer, kicherten die Misses. Eine von ihnen stand plötzlich auf und verschwand, das Tuch krampfhaft vor dem Gesicht. Zwei Freundinnen mit ihr.
„Was ist mit Miss Rogers? Ist sie krank?“
„Sie bekam eben eine Depesche. Gewissheit, dass ihr Bruder mit der ‚ABUKIR‘ unterging!“
Britischer Panzerkreuzer „ABUKIR“, am 22. September 1914 von deutschen
U-Boot U 9 mit zwei Schwesterschiffen versenkt. 527 Männer starben.
„Armer junger William ...“
Es war, als lange der Schattenarm eines Riesen über die brausende Finsternis des Kanals, als klopfe eine knochige Faust dröhnend an die Tore des Tudorschlosses. Aufgemacht! Ich bin da, der Krieg ... In der plötzlichen Stille tönten Lord Haralds sich rasch nähernde Schritte. Er kam zurück, frohgelaunt und gesund, und blieb unterwegs noch einen Augenblick im ersten Raum bei dem Gespräch einer Runde von Gentlemen stehen.
„Nur keine Dumdum-Geschosse“, sagte er lachend.
„Oh ... oh ...“
„Ich empfahl schon vorigen Monat kleine Explosivkugeln. Sie zerreißen jeden Mann. Ich verwandte sie in Afrika nicht nur gegen Großwild, sondern auch gegen Nigger. Es würde unser Werk in Belgien abkürzen.“
„Wie wahr!“
„Warum hört man nicht auf Lord Saint Asaphs?“
Der Markgraf trat in den zweiten Raum. Um ihn schwirrte das Abendgespräch, im Krieg genau so leise und leer wie im Frieden.
„Hat Sir Edwin guten Sport in Ceylon, Mylady?“
„Ich hoffe so, meine teure Mrs. Briggs. Zum Beginn der Hirschhetze in Taunton erwarten wir ihn zurück.“
„Sind die Königlichen Buckhunde schon in Ascot?“
„Sicherlich! Aber Miss Neish und ich reiten diesen Herbst hinter dem Leicestershire-Pack.“
Durch das Wortgeplätscher ging der Marquess von St. Asaphs rasch auf Johanna Ter Meer zu.
„Sie werden erstaunt sein, Madam“, sagte er, vor ihr stehenbleibend, die Hände in den Hosentaschen. „Sluysbeke ist ja seit kurzem wieder in den Händen der Deutschen!“
„Ist das sicher?“
„Der gute Killigrews telefonierte es mir. Es geht da stürmisch zu in Flandern. Er meint, Napoleon selber würde da in Verwirrung geraten!“
„Was soll ich nun tun?“
„Sehr einfach! Sie reisen über Holland nach Belgien und holen das irdische Teil Ihres Schwagers von den Deutschen. Ich werde sorgen, dass man Ihnen in London sofort Ihre Pässe visiert.“
„Ich bin Eurer Herrlichkeit innig dankbar!“
Der Lord St. Asaphs lachte und beugte sich etwas zu ihr herunter, die, die Hände im Schoss verschlungen, aufrecht dasaß und aus ihren blauen Augen zu ihm aufsah.
„Wissen Sie, dass Sie in diesen Tagen ganz einzigartig auf der Welt sind, Madam?“
„Wieso, Marquess Saint Asaphs?“
„Weil Sie überall sind! Heute hier bei uns, morgen bei den Deutschen in Brüssel, dann wieder bei den Neutralen in Holland. Sie sehen mehr als andere. Sie sind ein wahrhaft interessanter Mensch, Madam. Wir sollten Freunde werden ...“
Er setzte sich neben Johanna Ter Meer und sah sie mit dem unbefangenen Lächeln eines Mannes an, der keine Hindernisse im Leben kennt.
Aus dem Musiksaal rauschten gedämpfte, feierliche Klänge. Eine der Ladies in der Nähe versetzte gerührt:
„Oh ... Bätsch!“
Es war wirklich Johann Sebastian Bach. Die Fuge wandelte über die Tasten. Der Marquess von St. Asaphs sagte unvermittelt in einem leidlichen Deutsch, das er merkwürdigerweise plötzlich konnte:
„Warum macht ihr Deutschen nicht Musik statt Panzerplatten? So stünde alles zum Besten!“
Johanna Ter Meers feine, schmale Züge wandelten sich bei den deutschen Worten zu der unwillkürlichen Lebhaftigkeit ihres Wesens.
Sie beugte den schlanken Oberkörper vor und begann halblaut mit ihrer tiefen und weichen Stimme wieder auf Englisch, während sie in ihrer unterdrückten Erregung die Hände ineinanderschlang:
„Sie sagten, Mylord, mir sei mehr gegeben als anderen, weil ich überall daheim bin. Aber Ihnen ist noch viel mehr gegeben. Sie sitzen im Unterhaus; wenn Sie sprechen, hört es England und der ganze Erdball.“
„Ich mache dem Speaker wenig Mühe, Madam! Ich ergreife selten das Wort.“
„Aber Sie sollten es, mein Lord Marquess!“ Johanna Ter Meer sah dem riesigen brünetten Peerserben trotz ihrer Erregung unbefangen ins Gesicht, mit dem ruhigen Zutrauen irgendeiner Frau auf der Welt zu einem Gentleman, dessen Schutz sie suchte. „Sie könnten ein Wohltäter der Menschheit sein!“
„Das ist die Aufgabe jedes Briten, Madam.“
„Mein Lord ... Sie haben Ihren Zylinderhut auf irgendeinen der Plätze auf den Bänken von Westminster gelegt. Auf diesem Platz sind Sie mächtiger als die Kaiser und Könige, die jetzt streiten. Denn von ihm aus können Sie zu Freund und Feind laut die Wahrheit sagen.“
„Ein Engländer ist der Lüge unfähig, Madam.“
„Das Parlamentszepter liegt vor Ihnen auf dem Tisch. Es ist das Zeichen der britischen Macht! Sonst hat Britannien diese Macht zum Frieden benutzt. Warum jetzt zum Krieg?“
„Man zwingt uns dazu, Madam.“
„Ich kenne Deutschland und ich kenne euch! Ich weiß, es ist nur ein furchtbares Missverständnis. Marquess St. Asaphs – ich beschwöre Sie, erheben Sie Ihre Stimme! Jeder Tag früher kann Tausende von Leben hüben und drüben retten. Europa ist doch eine große Völkerfamilie. Engländer und Deutsche sind Vettern. Blutsverwandte müssen sich doch vertragen!“
„Ich danke Ihnen, Madam“, sagte der Marquess von St. Asaphs ernsthaft. „Ich werde es auf das gründlichste überlegen, ob ich nicht eine solche Rede halten kann.“
„Oh – tun Sie es, Mylord! Auf Sie hört man. Was eine Frau wie ich spricht ... wenn ich auch viel von der Welt gesehen und viele Vorurteile abgelegt habe ... Aber so wenig auch an mir liegt ... wenn ich nach Deutschland komme, will ich auch mein Bestes tun, um zur Versöhnung zu reden.“
Lord Harald wurde aufmerksam.
„Sie gehen jetzt nach Deutschland, Mrs. Ter Meer?“
„Ich begleite jedenfalls meine Schwester, wenn sie die Leiche ihres Mannes dorthin überführt.“
„Und dann?“
„Dann kehre ich zu meinem Mann nach Holland zurück.“
„Oh – und ich werde Sie dort besuchen“, sagte der Marquess von St. Asaphs mit einem herzlichen und freimütigen Lächeln. „Sie werden mir erzählen, wie es in Deutschland aussieht und was man dort denkt, und ich werde Ihnen von hier berichten, und wir wollen uns zusammensetzen und sehen, wie wir unser Bestes tun können, um die Dinge zu bessern.“
„Ich wäre glücklich, Mylord! Niemand kann mir verdenken, dass ich Deutschland so heiß liebe wie Sie Britannien. Wollte Gott, dass wir uns in der Versöhnung der beiden großen Länder träfen!“
„Ich sagte Ihnen ja schon: Sie und ich – wir beide müssen Freunde sein, Mrs. Ter Meer.“
„Wir sind es, Mylord, wenn Sie es mit dem Frieden so aufrichtig meinen wie ich.“
„Briten sind stets aufrichtig, Madam! Sie wissen das. Denn Sie kennen uns. Gestatten Sie, dass ich Ihnen die Hand drücke. Ich sehe, dass der Yonkheer Ter Meer kommt, um Sie zu holen. Sie müssen morgen früh heraus, wenn Sie reisen wollen. Auf Wiedersehen in Holland!“
Der Marquess Harald von St. Asaphs verbeugte sich mit einer verbindlichen Leichtigkeit und ging. Im Saal war es schon leer geworden. Die Damen zogen sich zurück. Schloss Ogmore versank in den frühen englischen Schlaf. In einem kleinen Raum saßen noch der Herzog von Chichester und seine Freunde um die Kaminglut. Sein Sohn trat heran und setzte sich rittlings auf die Lehne eines Klubsessels.
„Menschen wollen hassen“, sprach der Herzog von Chichester. Die Flammen überspielten den leidenschaftslosen Kopf mit dem rötlichgrauen Haar- und Bartgewirr. „Hass ist für die Völker die beste Methode, die Notwendigkeiten des Lebens zu ertragen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Völker hundert Jahre lang Deutschland hassen, nicht uns. Wir werden es. Wir haben die Welt hinter uns!“
Der Herzog von Chichester beugte sich vor, um eins der vor dem Kamin aufgeschichteten Buchenscheite mit der Zange in die Glut zu legen. Die anderen Holzstücke blieben vorläufig auf ihrem Platz. Es war, als warteten die Völker der Erde darauf, der Reihe nach von England, je nachdem es ihm weise dünkte, in den Weltbrand geschoben zu werden.
„Deutschland muss aus dem Weg!“
Lord Beaulieu, P. C. machte dabei eine gleichgültige Handbewegung, als habe er seinem Trainer den Befehl gegeben, ein verunglücktes Rennpferd zu erschießen. Hinter ihm gähnte der Marquess Harald von St. Asaphs.
„Die Deutschen bilden sich immer noch ein, es handle sich um einen Krieg und nicht um eine Bestrafung“, versetzte er. „Ich hörte es eben wieder von der holländischen Lady aus Deutschland.“
„Sie ist lieblich!“
„Ich bin wahrhaft froh, dass sie es ist!“ sagte Lord Harald mit einem Zug um den Mund, in dem sich das Lächeln des Damenmannes mit dem nüchternen Geschäftsernst des Politikers vermengte. „Denn ich hoffe, sie noch öfter zu sehen.“
„Warum?“
„Um manches zu erfahren, was man in Deutschland denkt. Nun gute Nacht! Ich will morgen wieder im Unterhaus sein.“
* * *
2
2
Haben Sie die Vermittlung angerufen?“ „Befehl, Herr Hauptmann! Eben meldet sich die Etappe.“
Es schnarrt von weither in den belgischen Kriegsfernsprecher.
„Hier Stationskommandant! ... Bitte gehorsamst um Entschuldigung: hat vielleicht ein Marinekraftwagen heute an Ihrer Tankstelle Benzin gefasst?“
„Ein junger Marineoffizier, mit einem Sarg auf dem Auto? Der kam aus Sluysbeke schon vor einer Stunde hier durch ... Warum?“
„Die Witwe des gefallenen Kameraden und ihre Schwester warten hier auf der Station. Der Leutnant zur See, der den Sarg bringt, ist ihr Bruder. Ich bin gar nicht auf Damen eingerichtet. Es ist hier ein toller Betrieb ...“
„Na – seien Sie mal hier vorne! Bei Ihnen herrscht ja noch der dickste Friede.“
„Wenigstens kann ich den Damen melden, dass das Auto gleich da sein wird?“
„Frohlocken Sie nicht zu früh. Die Straße ist unter aller Würde. Auf Wiederhören!“
„Auf Wiederhören! Danke gehorsamst, Herr Oberst!“
Der Hauptmann trat aus der Telefonzelle seiner belgischen Eisenbahnstation in das herbstliche Regensprühen und die Windstöße über der weiten Ebene. Er stieg, gewohnheitsgemäß die bespornten Stiefel über die am Boden gespannten Telefon- und Telegrafennotdrähte hebend, quer über die Schienen. Die zitterten dumpf. Ein rotes Kreuz in weißem Feld nach dem anderen rollte langsam auf grauen Güterwagen vorbei und brachte die Verwundeten von Ypern. Schwerer noch dröhnten die Nachbarstränge. Auf ihnen keuchten in entgegengesetzter Richtung die Munitionszüge an die ferne Front. Truppentransporte dazwischen. Weithin lagen auf der Strecke hinten noch drei, vier Züge im freien Feld und warteten. Man sah die ausgestiegenen Gruppen der Offiziere, wie sie, die Hand vor den Augen, ungeduldig nach dem roten oder grünen Einfahrtszeichen spähten. Wieder grollte der Boden unter der Wucht eines durchrollenden Granatentransportes. Verstummte. Dafür kam aus der Ferne der unbestimmte, kaum hörbare Donner des Todes von Ypern. Der Herbstwind stöhnte. Zwischen dem Grau der Krieger auf dem Bahnsteig flatterten schwarze Trauerflore. Der Stationskommandant drängte sich zu ihnen durch.
„Ihr Herr Bruder ist bald hier!“
Johanna Ter Meer stand neben ihrer Schwester und schlug sich den Schleier aus dem Gesicht, das sich in seiner blassen Regelmäßigkeit und seinen blonden Haaren noch schmaler und zarter von der dunklen Umrahmung abhob.
„Und dann wird der Zug hier fahren?“
„Ich werd' das Menschenmöglichste tun, um ihn zwischen zwei Lazarettzügen abzuschieben ... Was gibt's? Die Linienkommandantur ist am Fernsprecher? Ich komme! Entschuldigen die Damen ...“
Der Stationskommandant stürzte davon. Der Zug auf dem Nebenstrang, von dem er gesprochen, glich einer Rumpelkammer auf hundert Rädern. Halb zerschmetterte belgische Autos standen auf den Loris, französische Geschütze mit zersiebten Schutzschildern, niedergebrochene Feldküchen, ein durchlöcherter Ponton, zerbrochene englische Gewehre füllten einen Güterwaggon, kranke Pferde einen anderen. Im letzten Wagen saß friedlich harrend eine Schar Krankenschwestern. Ein Johanniter mit weißem Spitzbart zwischen den weißen Kragenausschlägen lief den Zug entlang.
Ein plötzliches Brausen erfüllte den Bahnhof. Ein Zug lief ein. Ein nagelschuhtrampelnder, lachender, drängender Schwall von grauen Helmen, braunen Gesichtern, grauen gerollten Mänteln, braunen Tornistern, grauen Röcken, braunen Gewehrkolben, grauen Hosen, braunen Fäusten überschwemmte die Verpflegungsstation, durchflutete vielhundertköpfig das mächtige Holzgebälk mit seinen Reihen brusthoher Tische ohne Bänke, fing an, stehend und hungrig, sich dabei die Beine von der langen Fahrt vertretend, zu löffeln.
Johanna Ter Meer trat mit ihrer Schwester in den Wind und Regen vor dem Stationsgebäude, unter dessen Notdach eine Reihe alter belgischer Weiber saß und Kartoffeln schälte. Frau von Rüdenberg war einen halben Kopf größer und einige Jahre älter als sie. Ihre bleichen Züge erschienen wie leblos unter dem Witwenschleier. Sie starrte unverwandt auf die schnurgerade, aufgeweichte Landstraße vor ihr, auf der zu beiden Seiten sich die Bäume unter dem grauen, regentriefenden Himmel im Sturm bogen.
Hinter dem verwaschenen Ruß des ausgebrannten Hauses am Hügel lief etwas hervor wie eine flinke graue Maus, glitt den Weg entlang, wurde immer größer.
„Da ist er!“
„Ist ihm denn etwas passiert, dass er immer so im Zickzack fährt?“
„Das ist wegen der Granatlöcher in der Straße“, sagte einer der Krieger, die mit den Schwestern zusammen Wasser holten und ihnen die Kübel trugen. „Bei dem Regen kann keiner wissen, ob das 'ne Pfütze ist oder ein tieferer Trichter.“
Auf dem Bahnhof entstand plötzlich Schweigen. Es bildete sich von selbst eine Gasse. Soldaten waren herbeigeeilt und trugen zu sechst den weißen hölzernen, mit ein paar Astern geschmückten Sarg des gefallenen Rittmeisters hinüber zum Zug. Drüben fuhr das wieder eingestiegene Bataillon gen Ypern weiter. Das stählerne Hurra der Lebenden verklang mit den Grüßen vom Bahnsteig, dem Winken der Schwestern im Brausen des Zuges voll vergilbten Laubgewinds und verwischter Kreideinschriften, verlor sich gen Westen in der Weite. Dann setzte sich auch der zweite Zug, der die Trümmer und Opfer des Krieges gen Osten heimführte, langsam in Bewegung.
„Lass Sibylle ganz in Ruhe, Hans.“
Johanna Ter Meer sagte es leise zu ihrem Bruder.
Der Oberleutnant zur See, Freiherr von Forchheim, war erst in der zweiten Hälfte der Zwanzig. Aber sein glattrasiertes junges Marinegesicht schien seiner Schwester Johanna um vieles älter geworden, seit sie ihn, noch im Frieden, zuletzt gesehen. Antwerpen lag darauf. Die Dünen. Die Yser. Der Krieg, der eben wieder draußen als geköpfter Kirchturm im Nebelgrau, als ein kleines schwärzliches Pompeji eines ehemaligen Dorfes vor den regenblinden Scheiben vorbeizog, der den Wagen erzittern ließ, wenn die Räder über die Schwellen der hölzernen Notbrücken neben gesprengten Steinpfeilern rumpelten, der in dem tiefen Schweigen herrschte, wenn der Zug, der Fliegergefahr wegen verdunkelt, stundenlang in der hereingebrochenen Finsternis auf freier Strecke hielt.
„Begleitest du Sibylle nach Deutschland, Johanna?“
„Ja, gewiss.“
„Du warst noch gar nicht dort seit dem Krieg?“
„Bisher ging es ja nicht. Jetzt erst verkehren ja wieder richtige Züge.“
Es gab einen Krach, einen Stoß, dass sie sich an den Holzbänken des Abteils dritter Klasse festhalten mussten, um nicht herunterzufliegen. Der Zug ruckte zur Weiterfahrt ohne Bremsen und Lichter an, rollte an entgleisten Lokomotiven, an stummen, vermummten Landsturmwachen in einsamer Nacht vorbei, kam glücklich durch das sonst stets verstopfte Schaerbeck nach Brüssel.
Schwere deutsche Soldatentritte hallten vereinzelt unter der mächtigen, tot und leer daliegenden Glaswölbung der Bahnhofshalle, eine Wache schützte den Eingang, Landsturmmänner und belgische Bürgergarde mit blauroten Armbinden sperrten den Platz davor ab, Doppelposten standen daneben vor dem Palasthotel, eine Schar grauer Feldautos war an dessen Eingang aufgefahren. Brüssel war im Krieg. Brüssel war in deutscher Hand.
Der Leutnant von Forchheim hatte alles wegen der morgigen Überführung der Leiche des Schwagers geordnet und folgte jetzt seinen Schwestern in das Hotel. Er ging an der Wachtstube am Eingang rechts vorbei, an dem großen Saal, der jetzt des Abends voll war von Massen von Offizieren in Feldgrau und ein paar weißen Kitteln von Feldärzten darunter, und stieg dann, aus seinem Zimmer kommend, die paar Stufen zu dem kleinen Luxusrestaurant hinten hinauf.