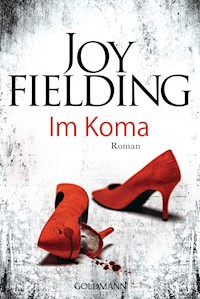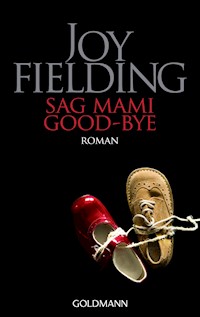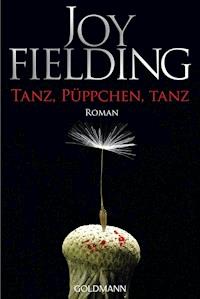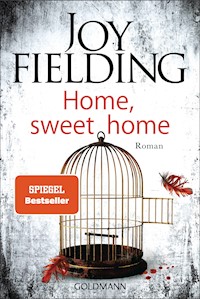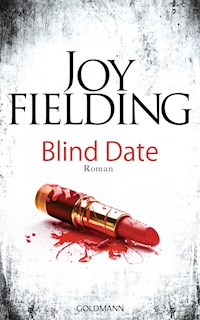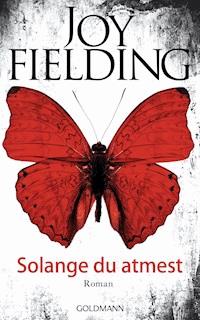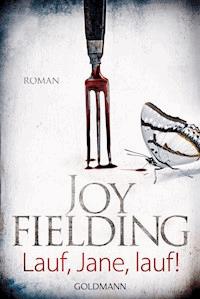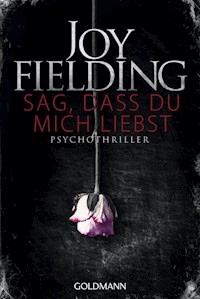
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als erfolgreiche Privatermittlerin in Miami ist es Bailey Carpenter gewohnt, die Dinge unter Kontrolle zu haben. Das ändert sich schlagartig, als sie eines Nachts von einem Unbekannten brutal überfallen wird. Von nun an quälen Bailey Panikattacken und Alpträume, sie ist besessen von dem Gedanken, verfolgt zu werden. Und dann bemerkt sie, dass ein Nachbar im Hochhaus gegenüber sie beobachtet. Bailey ist außer sich vor Angst, denn er scheint ein makabres Spiel mit ihr zu treiben. Doch niemand will ihr glauben – selbst dann nicht, als der Mann in seiner Wohnung einen kaltblütigen Mord begeht ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
gehört zu den unumstrittenen Spitzenautorinnen Amerikas. Seit ihrem Psychothriller „Lauf, Jane, lauf“ waren alle ihre Bücher internationale Bestseller. Joy Fielding lebt mit ihrem Mann und zwei Töchtern in Toronto, Kanada, und in Palm Beach, Florida. Weitere Informationen unter www.joy-fielding.de
Mehr von Joy Fielding:
Die Schwester • Sag, dass du mich liebst • Das Herz des Bösen • Am seidenen Faden • Im Koma • Herzstoß • Das Verhängnis • Die Katze • Sag Mami Goodbye • Nur der Tod kann dich retten • Träume süß, mein Mädchen • Tanz, Püppchen, tanz • Schlaf nicht, wenn es dunkel wird • Nur wenn du mich liebst • Bevor der Abend kommt • Zähl nicht die Stunden • Flieh wenn du kannst • Ein mörderischer Sommer • Lebenslang ist nicht genug • Schau dich nicht um • Lauf, Jane, lauf!
(alle auch als E-Book erhältlich)
Joy Fielding
Sag, dass du mich liebst
Roman
Deutsch von Kristian Lutze
Für meine liebsten Menschen auf der ganzen Welt:Warren, Shannon, Annie, Renee, Courtney, Hayden und Skylar
KAPITEL 1
Der Tag fängt an wie immer. Bloß ein weiterer ungetrübt strahlender Oktobertag in Miami, der Himmel typisch blau und wolkenlos, die Temperatur soll bis zum Mittag auf über fünfundzwanzig Grad steigen. Nichts deutet darauf hin, dass sich heute wesentlich von gestern oder vorgestern unterscheiden wird, nichts lässt vermuten, dass der heutige Tag oder genauer gesagt der heutige Abend mein Leben für immer verändern wird.
Ich wache um sieben auf, dusche und ziehe mich an – schwarzer Faltenrock, weiße Baumwollbluse, ein klein wenig förmlicher als üblich –, bürste mein hellbraunes, langes welliges Haar, gebe einen Hauch Rouge auf die Wangen, strichele Mascara auf die Wimpern. Ich mache mir Kaffee, verschlinge einen Muffin und rufe um halb acht unten an, damit ein Angestellter vom Haus-Service meinen Wagen aus der Tiefgarage fährt.
Ich könnte den Oldtimer-Porsche auch selbst holen, doch den Männern vom Haus-Service gibt es einen Kick, ihn zu fahren, und seien es nur die dreißig Sekunden, die man braucht, um ihn von seinem Parkplatz im dritten Untergeschoss über die gewundene Rampe bis vor den Haupteingang des Gebäudes zu lenken. An diesem Morgen ist es Finn, der in seiner Uniform aus Khakihose und kurzärmeligem laubgrünem Hemd hinter dem Steuer beinahe gut aussieht. »Viel zu tun heute, Miss Carpenter?«, fragt er, als er mir den Fahrersitz frei macht.
»Nur ein weiterer Tag im Paradies.«
»Viel Vergnügen«, sagt er, schließt meine Tür und winkt mir hinterher.
Ich fahre zur Kanzlei Holden, Cunningham und Kravitz am Biscayne Boulevard, für die ich seit fast zwei Jahren als Ermittlerin arbeite. Die Firma beschäftigt circa dreihundert Angestellte, davon einhundertfünfundzwanzig Anwälte, und hat ihre Büros in den obersten drei Etagen eines imposanten Wolkenkratzers aus Marmor im Herzen des Finanzdistrikts der Stadt. Normalerweise trinke ich gern noch eine Tasse Kaffee und plaudere mit irgendjemandem, der gerade im Aufenthaltsraum ist, doch heute habe ich einen Termin vor Gericht, deshalb parke ich in der Tiefgarage, schließe meine lizenzierte Glock im Handschuhfach ein und winke für die kurze Fahrt zum Gerichtsgebäude des Miami-Dade County, 73 West Flagler Street, ein Taxi heran. In der Gegend gibt es praktisch keine Parkplätze, und ich kann es mir nicht leisten, meine Zeit mit der Suche nach einer freien Lücke zu verschwenden. Ich bin als Entlastungszeugin in einem Fall von Industriespionage geladen und freue mich darauf, in den Zeugenstand gerufen zu werden. Im Gegensatz zu vielen Kollegen in meiner Branche, die lieber unsichtbar bleiben, sage ich tatsächlich gern vor Gericht aus.
Vielleicht liegt es daran, dass ich in meinem Beruf als Ermittlerin meistens relativ einsam arbeite. Ich sammele Informationen, die bei der Verteidigung eines Mandanten vor Gericht nützlich sein können, beschatte untreue Ehegatten oder verdächtige Angestellte, beobachte Menschen, mache Fotos oder Videoaufnahmen von heimlichen Begegnungen, spüre potenzielle Zeugen auf und befrage sie, finde vermisste Erben und trage Fakten zusammen, von denen sich einige als relevant und vor Gericht zulässig erweisen, andere als lediglich voyeuristisch interessant, aber trotzdem nützlich. Wenn ich alle notwendigen Informationen beschafft habe, setze ich mich hin und schreibe einen Bericht. Hin und wieder werde ich wie heute als Zeugin vor Gericht aufgerufen. Dafür ist eine zumindest flüchtige Kenntnis der Gesetze von Vorteil, weshalb die Jahre, die ich an der University of Miami Kriminologie studiert habe, nicht völlig vergeudet waren, auch wenn ich keinen Abschluss gemacht habe. Laut der Website, bei der ich meine Lizenz als private Ermittlerin bekommen habe, muss man für meinen Job intelligent, gut informiert, hartnäckig, einfallsreich und diskret sein. Ich bemühe mich, all diese Kriterien zu erfüllen.
Am Gerichtsgebäude hat sich bereits eine lange Schlange vor den Metalldetektoren gebildet, der überfüllte Fahrstuhl braucht ewig bis in den einundzwanzigsten Stock. Heute erscheint es einem fast lächerlich, dass das achtundzwanzigstöckige Gebäude bei seiner Vollendung im Jahr 1928 nicht nur das höchste Gebäude in Florida, sondern südlich des Ohio war. Mit seiner Fassade aus weißem Kalkstein sticht es immer noch zwischen den überwiegend gesichtslosen Glaskonstruktionen hervor, die es überragen. Das Innere des Gebäudes ist dagegen weniger eindrucksvoll, die Halle wartet immer noch auf Mittel für die mehrfach verschobene umfassende Renovierung, und die Mehrzahl der Gerichtssäle macht einen so muffigen Eindruck, wie sie bisweilen riechen.
»Geben Sie Ihren Namen und Ihren Beruf an«, weist mich der Gerichtsschreiber an, als ich in den Zeugenstand trete und meine Absicht bekunde, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu sagen.
»Bailey Carpenter. Ich arbeite als Ermittlerin für die Kanzlei Holden, Cunningham und Kravitz.«
»Wie geht es Ihnen, Bailey?«, fragt Sean Holden, nachdem ich Platz genommen habe. Sean ist nicht nur mein Chef, sondern auch einer der Gründer und Staranwälte der Firma, obwohl er erst zweiundvierzig ist. Ich beobachte, wie er sein blaues Nadelstreifenjackett zuknöpft, und mir fällt auf, was für ein stattlicher Mann er ist. Er ist nicht das, was man gemeinhin als gut aussehend bezeichnet, seine Gesichtszüge sind ein wenig derb, seine haselnussbraunen Augen zu klein und zu stechend, seine dunklen Haare ein bisschen zu lockig, seine Lippen eine Spur zu voll. Einfach ein bisschen zu viel von allem, was für gewöhnlich allemal genug ist, um die Gegenseite gehörig einzuschüchtern.
Der zur Verhandlung stehende Fall ist relativ einfach: Unser Mandant, Eigentümer einer erfolgreichen Bäckereikette, wird von einer ehemaligen Angestellten wegen unrechtmäßiger Kündigung verklagt. Er hat die Frau im Gegenzug verklagt, weil sie Firmengeheimnisse an seinen Hauptkonkurrenten verraten haben soll. Die Frau hat bereits ausgesagt, dass ihre Treffen mit dem fraglichen Konkurrenten, einem Mann, den sie und ihr Mann seit ihrer Kindheit kennen, vollkommen harmlos gewesen seien und nur der Planung einer Überraschungsparty zum vierzigsten Geburtstag ihres Mannes gedient hätten. Freiwillig hat sie weiter erklärt, dass sie eine ehrliche Frau sei, die das Vertrauen eines Arbeitgebers nie wissentlich hintergehen würde. Das war ihr Fehler. Zeugen sollten nie freiwillig irgendetwas sagen.
Sean stellt mir eine Reihe scheinbar harmlose Fragen zu meiner Tätigkeit, bevor er langsam zum Grund meiner Anwesenheit kommt. »Ihnen ist bekannt, dass Janice Elder unter Eid ausgesagt hat, sie sei, ich zitiere, ›eine ehrliche Frau, die zu einem solchen Betrug nicht fähig ist‹.«
»Ja, das ist mir bekannt.«
»Und Sie sind hier, um diese Aussage zu widerlegen?«
»Ich habe Beweise, die sowohl die Beteuerung ihrer Ehrlichkeit als auch die Aussage widerlegen, dass sie zu einem Betrug nicht fähig sei.«
Der Anwalt der Gegenseite springt sofort auf. »Einspruch, Euer Ehren.«
»Mrs Elder hat diesen Aspekt durch ihre Aussage selbst aufgeworfen«, stellt Sean fest, und der Richter lehnt den Einspruch knapp ab.
»Sie sagten, Sie haben Beweise, die sowohl die Beteuerung ihrer Ehrlichkeit als auch die Aussage widerlegen, dass sie zu einem Betrug nicht fähig sei?«, fragt Sean unter wörtlicher Wiederholung meines Satzes.
»Ja, die habe ich.«
»Und was sind das für Beweise?«
Ich blicke auf meine Notizen, obwohl ich sie in Wahrheit nicht brauche. Sean und ich sind meine Aussage tagelang durchgegangen, und ich weiß genau, was ich sagen werde. »Am Abend des 12. März 2013«, beginne ich, »bin ich Mrs Elder zum Doubleday Hilton Hotel in Fort Lauderdale gefolgt …« Aus den Augenwinkeln bemerke ich, wie Mrs Elder sich mit Panik in den Augen hastig mit ihrem Anwalt berät.
»Einspruch«, sagt ihr Anwalt wieder.
Wieder wird der Einspruch abgelehnt.
»Fahren Sie fort, Miss Carpenter.«
»Ich habe beobachtet, wie sie an der Rezeption eine Schlüsselkarte in Empfang genommen hat. Zimmer 214, gebucht von einem Mr Carl Segretti.«
»Was? Zum Teufel!«, ruft ein Mann, der auf der Bank direkt hinter Mrs Elder aufgesprungen ist. Es ist Todd Elder, Janice’ Mann, dessen gebräuntes Gesicht feuerrot angelaufen ist. »Du machst heimlich mit Carl rum?«
»Einspruch, Euer Ehren. Das hat absolut nichts mit dem anstehenden Fall zu tun.«
»Im Gegenteil, Euer Ehren …«
»Du verlogene kleine Schlampe!«
»Ruhe im Gerichtssaal.«
»Du hast meinen verdammten Cousin gevögelt?«
»Gerichtsdiener, entfernen Sie diesen Mann.« Der Richter schlägt mit dem Hammer auf seinen Tisch. »Die Verhandlung ist für eine halbe Stunde unterbrochen.«
»Gute Arbeit«, lobt Sean mich aus dem Mundwinkel, als ich beim Verlassen des Gerichtssaals an ihm vorbeigehe, während Mrs Elders hasserfüllter Blick in meinem Rücken brennt wie Säure.
Während ich im Flur warte, ob ich noch einmal in den Zeugenstand gerufen werde, checke ich die Nachrichten auf meinem Handy. Alissa Dunphy, seit drei Jahren Anwältin in der Kanzlei, bittet mich, das mögliche Wiederauftauchen eines gewissen Roland Peterson zu untersuchen, eines säumigen Vaters, der vor ein paar Monaten aus Miami geflohen ist, weil er keine Lust hat, seiner Exfrau mehrere hunderttausend Dollar zu zahlen, die er ihr und seinen Kindern an Unterhalt schuldet.
»Nun, das war eine ziemlich unangenehme Überraschung«, sagt eine Stimme hinter mir, als ich das Handy gerade in meine überdimensionierte Leinentasche stecke. Die Stimme gehört dem Anwalt von Janice Elder. Er heißt Owen Weaver, und ich schätze ihn auf Anfang dreißig, also nur ein paar Jahre älter als ich. Mir fallen seine perfekten weißen Zähne auf, die nicht so recht zu seinem einnehmend schrägen Lächeln passen.
»Ich habe nur meinen Job gemacht«, entschuldige ich mich halbherzig.
»Müssen Sie ihn so gut machen?« Das Lächeln, das sich von seinen Lippen bis zu den sanften braunen Augen ausbreitet, lässt mich vermuten, dass wir eigentlich nicht mehr über den Fall reden. »Tun Sie mir einen Gefallen«, sagt er.
»Wenn ich kann.«
»Gehen Sie mit mir essen.« Er bestätigt meinen Verdacht.
»Was?«
»Essen? Mit mir? In einem Restaurant Ihrer Wahl? Samstagabend?«
»Sie laden mich zum Essen ein?«
»Überrascht Sie das?«
»Na ja, unter den Umständen …«
»Sie meinen, weil Sie gerade meinen Fall versenkt haben?«
»Das auch.«
»Der Mensch muss trotzdem essen.«
»Das auch, ja.« Die Tür zum Gerichtssaal fliegt auf, und mein Chef Sean Holden schreitet entschlossen auf mich zu. »Wenn Sie mich kurz entschuldigen … mein Chef …«
»Selbstverständlich.« Owen Weaver greift in die Innentasche seines dunkelblauen Jacketts und gibt mir eine Visitenkarte. »Rufen Sie mich an.« Er lächelt erst mich und dann Sean an. »Geben Sie mir zehn Minuten mit meiner Mandantin«, sagt er zu ihm und geht.
Sean nickt. »Was hatte denn das zu bedeuten?«
Ich schiebe Owens Karte in meine Tasche und zucke die Achseln, um anzudeuten, dass unser Gespräch belanglos war. Sean schaut zurück in den Gerichtssaal, und ich folge seinem Blick. Mrs Elders Mann steht allein und mit versteinerter Miene neben der Tür, die Fäuste geballt, den muskulösen Körper angespannt. Er fängt meinen Blick auf und formuliert tonlos das Wort »Schlampe«. Offenbar hat er die Empörung über seine Frau auf mich übertragen. Es wäre nicht das erste Mal, dass mich fehlgeleitete Wut trifft.
Als das Gericht eine halbe Stunde später wieder zusammentritt, erklärt Mrs Elder sich bereit, ihre Klage zurückzuziehen, wenn unser Mandant das Gleiche tut. Dem stimmt er schließlich knurrend und widerwillig auch zu. Keiner verlässt den Saal glücklich, was angeblich das Zeichen für einen guten Kompromiss ist. Wenigstens Sean und ich sind zufrieden. »Ich muss gleich weiter«, erklärt er mir, als wir das Gerichtsgebäude verlassen. »Wir sehen uns später. Und Bailey«, fügt er hinzu, während er in das Taxi steigt, das er herangewunken hat, »Glückwunsch. Wirklich gute Arbeit.«
Ich sehe dem Taxi nach, bis es im Verkehr verschwunden ist, bevor ich mir selbst eins rufe und mich zurück zum Biscayne Boulevard fahren lasse. Trotz unseres Triumphes vor Gericht bin ich ein wenig enttäuscht. Mir wurde bewusst, dass ich mir mehr erhofft hatte als einen Klaps auf den Rücken und einen unvollständigen Hauptsatz. Ein Mittagessen zur Feier des Erfolgs wäre nett gewesen, denke ich, während ich zu meinem Parkplatz in der Tiefgarage gehe, in meinen Wagen steige, das Handschuhfach aufschließe und meine Pistole wieder in meine Handtasche stecke, wo sie auf Owen Weavers Visitenkarte landet. Ich spiele mit dem Gedanken, auf sein Angebot zurückzukommen. Seit der Trennung von meinem Freund habe ich zu viele Samstagabende allein verbracht.
Als ich gut zwanzig Minuten später in die Northeast 152 Street in North Miami biege, überlege ich immer noch, ob ich seine Einladung annehmen soll. Ich parke in der ruhigen Wohnstraße und gehe zielstrebig auf das mehrstöckige zitronengelbe Gebäude am Ende einer Reihe ähnlich altmodischer pastellfarbener Häuser mit Eigentumswohnungen zu. Dort wohnt Sara McAllister. Sie war Roland Petersons Freundin zu dem Zeitpunkt, als er aus der Stadt abgehauen ist, anstatt seine Kinder zu unterstützen. Meine Intuition sagt mir, dass Sara der Grund sein könnte, warum er zurückgekommen ist, und ich habe vor, das herauszufinden.
Am Ende der Straße gibt es eine ovale Freifläche mit Gebüsch und Sträuchern rundherum, nah an der Straße und trotzdem verschwiegen. Einen perfekteren Platz für meine Beschattung hätte ich mir nicht wünschen können. Mit einem kurzen Blick vergewissere ich mich, dass mich niemand beobachtet, bevor ich mein Fernglas aus der Tasche ziehe und ins Gebüsch schlüpfe. Mehrere rote Blüten werden zerdrückt, als ich mich zwischen die Blumen kauere und das Fernglas an die Augen hebe. Ich visiere die Eckwohnung in der zweiten Etage des dreistöckigen Gebäudes an und stelle die Linsen scharf, bis die beiden Bilder zu einem verschmelzen.
Die Vorhänge in Sara McAllisters Wohnzimmer sind offen, aber ohne Licht in der Wohnung kann man bis auf eine Lampe mit weißem Schirm neben dem Fenster kaum etwas erkennen. Allem Anschein nach ist niemand zu Hause, was nicht besonders überraschend ist, da Sara als Verkäuferin bei Nordstrom’s arbeitet und in der Regel nicht vor sechs Uhr Feierabend hat. Ich entscheide, dass es im Augenblick nichts bringt, weiter hier rumzuhängen. Es ist sinnvoller, wenn ich am Abend wiederkomme.
Am Nachmittag habe ich zwei Meetings und einen Haufen Papierkram aufzuarbeiten. Außerdem will ich meinen Bruder Heath anrufen. Wir haben seit einer Woche nicht miteinander gesprochen, und ich mache mir unwillkürlich Sorgen um ihn. Ich werfe einen letzten, eher beiläufigen Blick auf die alte Straße, die im Sonnenlicht still daliegt, als ob die Zeit stillstünde, still wie ein Foto.
Als ich aufstehe, sehe ich in einem Fenster auf der anderen Straßenseite etwas aufblitzen, den Schatten einer Gestalt, die gerade aus dem Bild tritt. Hat mich jemand beobachtet?
Ich blicke noch einmal durch das Fernglas, kann jedoch niemanden entdecken. Beruflich bedingter Verfolgungswahn, entscheide ich, krabbele aus dem Gebüsch, streiche eine abgefallene Hibiskusblüte von der Schulter meiner weißen Bluse und klopfe mir die Erde von den Knien. Ich werde mir etwas Passenderes anziehen, bevor ich heute Abend im Schutz der Dunkelheit zurückkomme. Ich bin so dumm zu glauben, dass sie mich vor neugierigen Blicken wie meinen schützen wird.
KAPITEL 2
Daran kann ich mich erinnern: die warme Abendluft, dunkel, so weich und anschmiegsam wie ein Kaschmirschal, eine sanfte Brise, die verführerisch über die süß duftenden Sträucher streicht, in denen ich mich verstecke, die roten Blüten mit in sich gedrehten Blättern in der Dunkelheit geschlossen. Ihr Aroma dringt unterschwellig in mein Bewusstsein, während ich durch das Fernglas in Sara McAllisters Fenster im zweiten Stock blicke. Meine Knie schmerzen, weil ich schon zu lange in derselben Position kauere, meine Zehen sind verkrampft. Es ist kurz vor Mitternacht, ich hocke schon seit Stunden hier, und Gereiztheit knebelt meine Gedanken wie eine hungrige Boa constrictor. Ich beschließe, wenn ich nicht bald etwas – irgendwas – sehe, mache ich für heute Schluss.
In diesem Moment höre ich es – das Knacken eines Zweiges. Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht kündigt es eine Person an, die sich von hinten nähert. Ich drehe mich um, doch da ist es schon zu spät. Eine Hand in einem Handschuh bedeckt meinen Mund und erstickt mein Schreien. Ich schmecke Leder – alt, schal, erdig. Und dann sind diese Hände scheinbar überall, auf meinen Schultern, in meinen Haaren, reißen mir das Fernglas weg. Eine Faust trifft meinen Magen und dann meinen Kopf, sodass die Welt vor meinen Augen verschwimmt und meine Beine nachgeben. Ein Kissenbezug wird grob über meinen Kopf gezogen. Ich kann nicht atmen und gerate in Panik. Du musst einen klaren Kopf behalten, ermahne ich mich, um mich zu fassen und die Panik in Schach zu halten. Merk dir genau, was passiert.
Aber alles passiert viel zu schnell. Bevor der Kissenbezug über meinen Kopf gezogen worden ist und die weiße Baumwolle das nächtliche Licht verdeckt hat, habe ich nichts außer vagen Umrissen gesehen. Mit Sicherheit ein Mann, aber ob jung oder alt, dick oder dünn, schwarz, braun oder weiß, ich habe keine Ahnung. Hat der Mann, auf den ich gewartet habe, umgekehrt mir aufgelauert? Hat er mich in meinem Versteck im Gebüsch entdeckt und einfach den richtigen Moment abgepasst?
Das ist eine gute Nachricht, rede ich mir ein. Denn wenn es Roland Peterson ist, will er mir nur Angst einjagen und mich nicht umbringen. Damit würde er sich nur noch mehr Ärger einhandeln, und davon hat er auch so schon genug. Vielleicht will er mir eine kleine Abreibung verpassen, mir einen Heidenschrecken einjagen, doch dann wird er verschwinden. Je eher ich aufhöre, mich zu wehren, desto eher wird er mich in Ruhe lassen.
Aber er lässt mich nicht in Ruhe. Er dreht mich um und zerrt an meinen Kleidern, reißt meine schwarze Bluse auf und schiebt meinen BH hoch, um meine Brüste zu entblößen. »Nein!«, rufe ich, als ich begreife, was geschieht. »Aufhören. Bitte. Tun Sie das nicht.« Doch er bringt mein Flehen zum Verstummen, und wenn er es überhaupt hört, lässt er sich davon nicht aufhalten oder in der Heftigkeit seines Überfalls auch nur bremsen. Stattdessen zerrt er mir Jeans und Slip von den Hüften. Ich trete wild um mich und meine auch, dass mein Fuß seine Brust trifft, doch ich bin mir nicht sicher. Womöglich war das auch nur Wunschdenken.
Was ist los? Warum kommt keiner? Ich weiß die Antwort bereits. Es ist niemand da. Die meisten Leute, die in diesem Viertel wohnen, haben die sechzig überschritten. Nach zehn geht keiner mehr vor die Tür, von kurz vor Mitternacht gar nicht zu reden. Selbst die hingebungsvollsten Hundehalter haben ihren Fifi schon vor Stunden ins Körbchen gepackt.
Der Arm des Mannes lastet schwer auf meinem Hals und meinen Schultern und presst mich zu Boden. Ich fühle mich hilflos wie ein aufgespießter Schmetterling. Mit der anderen Hand fummelt er an seiner Hose. Ich höre das widerliche Geräusch, wie ein Reißverschluss heruntergezogen wird, weiteres Nesteln, als er irgendwas auspackt. Ich begreife, dass er ein Kondom überstreift, und überlege, ob ich den Moment der Ablenkung ausnutzen sollte, als ein unvermittelter Schlag in den Magen mir beinahe den Atem raubt, an Flucht ist nicht zu denken. Der Mann zwängt meine Beine auseinander und dringt in mich ein. Ich spüre die Kälte des befeuchteten Kondoms, als er in mich stößt und mit beiden Händen meinen Hintern packt. Ich versuche, mich am ganzen Körper taub zu stellen, und spüre doch jeden brutalen Stoß. Nach einer gefühlten Ewigkeit ist es vorbei. Als er zum Höhepunkt kommt, beißt er in meine rechte Brust, und ich schreie auf. Im nächsten Moment sind seine Lippen an meinem Ohr, sein Atem dringt durch den dünnen Stoff des Kissenbezugs. Er riecht scharf nach Mundwasser mit Minze. »Sag, dass du mich liebst«, knurrt er und packt mit seiner behandschuhten Hand meine Kehle. »Sag, dass du mich liebst.«
Ich öffne den Mund und höre das Wort »Schwein« über meine Lippe dringen. Er fasst fester zu. Meine Nasenlöcher weiten sich gegen die steife Baumwolle, mit einem entsetzten Keuchen schnappe ich nach Luft und schlucke Blut. Ich werde hier sterben, denke ich und weiß nicht, wie lange ich noch bei Bewusstsein bleiben kann. Ich sehe meine Mutter und meinen Vater vor mir und bin zum ersten Mal froh, dass sie nicht mehr leben und sich nicht mit dem hier befassen müssen. Der Mann drückt seinen Daumen fest auf meine Luftröhre. Die winzigen Blutgefäße in meinen Augen zerplatzen wie Feuerwerk. Gott sei Dank schleicht sich schließlich die Dunkelheit von draußen unter meine Lider, und ich sehe gar nichts mehr.
Als ich zu mir komme, ist der Mann weg.
Der Kissenbezug über meinem Kopf ist weg, und die Nachtluft leckt an meinem Gesicht wie eine Katze. Eine Zeitlang liege ich ganz still, unfähig, mich zu bewegen, und versuche meine Gedanken zu sammeln, die zwischen den zerdrückten Hibiskusblüten um mein Gesicht verstreut sind. Ich schmecke Blut, spüre ein schmerzhaftes Pochen zwischen den Beinen, meine Brüste sind wund und tun weh. Ich bin von der Hüfte abwärts nackt, und selbst aus meinen halb zugeschwollenen Augen kann ich die Blutrinnsale kreuz und quer über meinen Schenkeln ausmachen. Langsam ziehe ich den BH wieder über die Brüste, raffe meine Bluse zusammen und greife nach der Jeans in dem plattgedrückten Gebüsch. Mein Slip ist verschwunden, genau wie meine Stofftasche, meine Pistole samt Waffenschein, meine Brieftasche, mein Handy, meine Kamera, meine Ausweise, privat wie dienstlich, sowie die Schlüssel für meinen Wagen und meine Wohnung. Immerhin ist das Fernglas noch da. »Hilfe«, höre ich jemanden rufen, dessen Stimme ich kaum erkenne, obwohl ich weiß, dass es meine ist. »Hilfe, bitte, kann mir jemand helfen.« Mühsam ziehe ich die Jeans über und versuche aufzustehen, aber meine Beine sind so kräftig wie weiche Nudeln und knicken unter meinem Gewicht ein, sodass ich zu der Straße krieche, in der ich meiner Erinnerung nach meinen Wagen geparkt habe.
Wundersamerweise steht der silberne Porsche noch an seinem Platz. Wahrscheinlich ist er zu auffällig, um ihn zu klauen. Definitiv nicht der ideale Wagen für jemanden meiner Profession, aber er hat meiner Mutter gehört, und ich gebe ihn nicht her. Ich klammere mich an den Türgriff wie an einen Rettungsring und versuche, mich hochzuziehen. Sofort bricht die ausgetüftelte Alarmanlage in eine Kakophonie von Hupen, Klingeln und Pfeifen aus. Ich sacke auf der Straße zusammen, mein Rücken an der Wagentür, die Beine ausgestreckt. Als ich zu der Wohnung blicke, die ich beobachtet habe, sehe ich einen Mann am Fenster. Instinktiv hebe ich das Fernglas. Aber das Fernglas ist zu schwer, und ich bin zu schwach. Es fällt mir aus der Hand und landet hart auf dem Asphalt.
Das Nächste, woran ich mich erinnere, ist mein Erwachen im Krankenwagen. »Jetzt wird alles gut«, höre ich den Sanitäter sagen.
»Alles wird gut«, wiederholt eine andere Stimme wie ein Echo.
Doch sie irren sich.
Das war vor zwei Wochen. Jetzt bin ich zu Hause. Aber es geht mir definitiv nicht gut. Ich kann nicht schlafen, jedenfalls nicht ohne starke Medikamente, und ich kann nichts zu mir nehmen. Wenn ich es versuche, muss ich mich prompt übergeben. Ich habe neun Pfund abgenommen, die zu verlieren ich mir nicht leisten konnte, weil ich schon vorher mindestens neun Pfund zu wenig auf den Rippen hatte. Nicht mit Absicht. Ich gehöre nicht zu den Frauen, die an Diäten glauben oder auch nur darauf achten, was sie essen, und ich hasse Sport. Ich bin jetzt neunundzwanzig und von Natur aus seit jeher schlank. »Sie wächst wie Unkraut«, wurde ich in der Highschool gehänselt. Von allen Mädchen in meiner Klasse war ich die Letzte, die einen BH tragen musste, doch als meine Brüste endlich sprossen, wurden sie überraschend und sogar verdächtig groß und voll. »Offensichtlich Implantate«, hörte ich eine Frau in einer Gruppe von Anwältinnen bei Holden, Cunningham und Kravitz flüstern, als ich letzten Monat im Flur an ihnen vorbeiging. Zumindest glaube ich, dass es letzten Monat war. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe mein Zeitgefühl verloren. Ein weiterer Eintrag auf der Liste »verlorener Dinge«. Direkt unter »Selbstvertrauen«. Und über »Verstand«.
Mein Aussehen habe ich auch verloren. Vorher galt ich als hübsch. Mit großen grünen Augen, markanten Wangenknochen, einem leichten Überbiss, der meine Lippen voller erscheinen lässt, als sie in Wirklichkeit sind, und langem, dichtem braunen Haar. Jetzt sind meine Augen von einem nicht enden wollenden Tränenstrom verquollen und von Blutergüssen gerahmt; meine Wangen sind aufgekratzt und hohl, meine Lippen rissig und sogar aufgeplatzt, weil ich darauf herumgebissen habe, eine Angewohnheit aus meiner Kindheit, die ich seit kurzem wieder aufgenommen habe. Mein Haar, auf das ich vorher so stolz war, hängt schlaff herunter, im Gesicht ist meine Haut von zwanghaftem Waschen ausgetrocknet, genau wie am ganzen Körper, der aschfahl ist wie der einer Leiche und wundgerieben vom ständigen Duschen. Aber selbst wenn ich drei oder manchmal auch vier Mal am Tag dusche, fühle ich mich nicht sauber. Es ist, als hätte ich mich wochenlang im Dreck gewälzt und der Schmutz wäre durch meine Poren in den Blutkreislauf gelangt. Ich bin kontaminiert. Giftig. Eine Gefahr für jeden, der mich ansieht. Kein Wunder, dass ich mich kaum erkenne, wenn ich in den Spiegel sehe. Ich bin eine dieser erbärmlich aussehenden Frauen geworden, die an Straßenecken herumlungern und mit hängenden Schultern und zitternden Händen um Kleingeld betteln, die Sorte Frau, wegen der man die Straßenseite wechselt, um ihr aus dem Weg zu gehen. Die Sorte Frau, der man heimlich unterstellt, ihr Unglück selbst verschuldet zu haben.
Diese Frau ist meine Mitbewohnerin und ständige Begleiterin geworden. Sie schlurft mir wie Marleys Geist aus Dickens’ Weihnachtsgeschichte über den beigefarbenen Marmorboden meiner geräumigen Dreizimmerwohnung hinterher. Gemeinsam leben wir im zweiundzwanzigsten Stock eines hypermodernen, komplett verglasten Gebäudes im Brickell-Distrikt von Miami, einer Gegend, die häufig als »Wall Street South« bezeichnet wird. Sie ist nicht nur das Finanzzentrum von Miami, darüber hinaus finden sich etliche Nobeleinkaufszentren und Luxushotels sowie mehr als zehntausend Luxuseigentumswohnungen in Wolkenkratzern mit spektakulärer Aussicht sowohl auf die Stadt als auch auf den Ozean. Die vom Boden bis zur Decke reichenden Fenster in meinem Wohnzimmer blicken auf den wunderschönen Miami River, die gleichen Fenster in meinem Schlafzimmer auf andere verglaste Hochhäuser. Zurzeit stehen leider viele Wohnungen leer. Die jüngste Wirtschaftskrise hat die Immobilienbranche in Miami besonders hart getroffen. Trotzdem wird direkt gegenüber ein weiterer Wolkenkratzer hochgezogen. Überall Kräne. Der neue Nationalvogel, höre ich meine Mutter lachend sagen. Es gibt doch bestimmt schon genug hohe verglaste Gebäude, denke ich. Aber wer bin ich, dass ich mich beklage? Wer im Glashaus sitzt, sollte schließlich nicht …
Eingezogen bin ich im letzten Jahr. Mein Vater hat mir die Wohnung gekauft, obwohl er gleichzeitig beteuerte, dass ich von ihm aus gern für immer zu Hause wohnen bleiben könnte. Aber er stimmte mir zu, dass es wahrscheinlich an der Zeit sei, dass ich allein zurechtkäme. Seit dem Tod meiner Mutter waren zwei Jahre vergangen. Ich arbeitete. Ich hatte einen Freund. Mein ganzes Leben lag vor mir.
Aber das war natürlich vorher.
Und jetzt ist jetzt.
Jetzt habe ich nichts mehr. Mein Job liegt auf Eis; mein Freund ist weg; mein Vater ist vor vier Monaten unerwartet einem Herzinfarkt erlegen und hat mich als Waise zurückgelassen. Jedenfalls glaube ich, dass er vor vier Monaten gestorben ist. Ich habe wie gesagt mein Zeitgefühl verloren. Das kann passieren, wenn man den ganzen Tag in der Wohnung bleibt, jedes Mal zusammenzuckt, wenn das Telefon klingelt, und das Bett nur verlässt, um zu duschen und auf die Toilette zu gehen, wenn man nur Besuch von der Polizei und dem einzigen seiner Geschwister bekommt, das einen nicht wegen des väterlichen Erbes verklagt hat.
Gott sei Dank für meinen Bruder Heath, selbst wenn er keine große Hilfe ist. Als er mich nach dem Angriff zum ersten Mal sah, ist er im Krankenhaus in Ohnmacht gefallen und hätte sich um ein Haar an meiner Rollliege den Kopf aufgeschlagen. Es war beinahe komisch. Ärzte und Schwestern eilten ihm zu Hilfe, ich war vorübergehend vergessen. »Er sieht so gut aus«, hörte ich eine der Schwestern flüstern. Ich konnte es ihr nicht verdenken, dass sie von Heaths Erscheinung kurzzeitig abgelenkt war. Mein Bruder ist gerade mal elf Monate älter als ich und mit Abstand das hübscheste Kind meines Vaters. Ständig fällt eine Strähne seines dunklen Haars in seine unnatürlich dunkelgrünen Augen, seine Wimpern sind geradezu obszön lang und mädchenhaft. Frauen verlieben sich dauernd in Heath. Männer auch. Und Heath fällt es immer schwer, Nein zu sagen. Zu irgendjemandem. Oder irgendetwas.
Im Krankenhaus erklärte man mir nach der gründlichen Untersuchung, dass ich Glück gehabt hätte. Eine seltsame Wortwahl, fand ich, was man mir wohl auch angesehen hat, weil sie sich sofort korrigierten. Mit »Glück« meinten sie, dass der Angreifer ein Kondom benutzt und keinen Samen in mir hinterlassen hatte. Deshalb müsste ich keine starken Anti-Aids-Medikamente oder die Pille danach nehmen, um eine ungewollte Schwangerschaft zu verhindern. Das hat er mir erspart. So ein rücksichtsvoller Vergewaltiger. Die Kehrseite ist, dass er keine Spur von sich hinterlassen hat. Es gibt keine DNA, mit der man die polizeiliche Datenbank füttern könnte. Wenn ich nur einen Anhaltspunkt liefern könnte, wenn ich mich bloß an etwas erinnern könnte … irgendwas.
»Denken Sie nach«, hallt die sanfte Aufforderung des uniformierten Polizisten am Abend des Angriffs in meinen Ohren wider. »Können Sie sich an irgendein Detail des Mannes erinnern?«
Ich schüttelte den Kopf und hatte das Gefühl, dass das Gehirn darin klappern würde. Es tat weh, aber der Versuch zu sprechen war noch schmerzhafter.
»Können wir alles nur noch einmal durchgehen, Miss Carpenter?«, fragte eine andere Stimme, diesmal eine weibliche. »Manchmal erinnern wir uns an mehr, je öfter wir uns etwas noch einmal vergegenwärtigen. Etwas, von dem wir nicht einmal wissen, dass es wichtig sein könnte …«
Klar, dachte ich. Wichtig. Was auch immer.
»Sie heißen Bailey Carpenter und wohnen in der 1228 East Flagler Street. Ist das richtig?«
»Ja, das ist richtig.«
»Die East Flagler Street liegt in der Innenstadt. Man hat Sie in der Northeast 152 Street in North Miami gefunden.«
»Ja. Ich habe dort wie schon gesagt eine Wohnung beobachtet. Ich bin Ermittlerin bei Holden, Cunningham und Kravitz.«
»Das ist eine Anwaltskanzlei?«
»Ja, ich habe einen Mann namens Roland Peterson gesucht, der vor etwa einem Jahr aus der Stadt verschwunden ist. Wir vertreten seine Exfrau und haben Wind davon bekommen, dass Mr Peterson vor kurzem heimlich in die Stadt zurückgekehrt sein soll, möglicherweise um seine letzte Freundin zu besuchen.«
»Also haben Sie die Wohnung der Freundin beobachtet?«
»Genau.«
»Glauben Sie, Roland Peterson war der Mann, der Sie angegriffen hat?«
»Ich weiß es nicht. Werden Sie ihn festnehmen?«
»Wir werden ihn auf jeden Fall überprüfen.«
Ich vermutete, dass Roland Peterson, ob er nun der Mann war, der mich vergewaltigt hatte, oder nur ein unterhaltsäumiger Vater, mittlerweile schon auf halbem Weg zur Staatsgrenze war.
»Können Sie den Mann beschreiben, der Sie angegriffen hat?«
Ich schüttelte erneut den Kopf, und es fühlte sich so an, als ob mein Gehirn in Richtung meines linken Ohrs rutschte.
»Nehmen Sie sich einen Moment Zeit«, drängte die Polizistin. Mir fiel auf, dass sie zivile Kleidung trug, also vermutlich Detective war. »Ich weiß, das ist nicht leicht für Sie, aber könnten Sie versuchen, sich in das Gebüsch zurückzuversetzen …?«
Ist diese Frau wirklich so naiv, denke ich jetzt. Begreift sie nicht, dass ich für den Rest meines Lebens in diesem Gebüsch sein werde?
Ich weiß noch, dass sie mir zu zierlich vorkam, zu schmächtig für eine Polizistin, ihre hellgrauen Augen zu sanft und zu mitfühlend. »Es ging einfach alles so schnell. Ich weiß, das ist ein Klischee. Ich weiß, ich hätte wachsamer sein müssen, meine Umgebung besser im Blick haben …«
»Es war nicht Ihre Schuld«, unterbrach sie mich.
»Aber ich habe Judo und Taekwondo gelernt«, widersprach ich. »Es ist nicht so, als hätte ich nicht gewusst, wie ich mich wehren muss.«
»Jeder kann unvorbereitet erwischt werden. Sie haben gar nichts gehört?«
»Ich weiß nicht«, erklärte ich ihr, während ich versuchte, mich zu erinnern und gleichzeitig nicht zu erinnern. »Ich habe etwas gespürt. Einen Luftzug. Nein, warten Sie. Ich habe etwas gehört, vielleicht einen Schritt, einen knackenden Zweig. Ich wollte mich umdrehen und dann …« In der ausgestreckten Hand der Polizistin tauchte plötzlich ein Papiertaschentuch auf. Ich nahm es und riss es in Stücke, bevor es meine Augen erreichte. »Er hat mich geschlagen. Er hat mir in den Magen und ins Gesicht geboxt. Ich konnte mich nicht orientieren. Er hat einen Kissenbezug über meinen Kopf gezogen. Ich konnte nichts sehen. Ich konnte nicht atmen. Ich hatte solche Angst.«
»Konnten Sie irgendwas erkennen, bevor er Sie geschlagen hat? Seine Gestalt? Seine Größe?«
Ich versuchte, mir den Mann vorzustellen. Wirklich. Aber ich sah nur die Dunkelheit der Nacht, gefolgt von der erstickenden Weiße des Kissenbezugs.
»Konnten Sie erkennen, was er anhatte?«
Ein weiteres Kopfschütteln. »Er muss Schwarz getragen haben. Und Jeans. Er hatte Jeans an.« In meinem Kopf hörte ich, wie der Reißverschluss geöffnet wurde, und wollte schreien, um das Geräusch zu übertönen.
»Gut. Das ist sehr gut, Bailey. Sie haben etwas gesehen. Sie können sich erinnern.«
Ich war lächerlich stolz auf mich und merkte, wie sehr ich dieser Frau mit den sanften grauen Augen gefallen wollte.
»Könnten Sie mir sagen, welche Hautfarbe der Mann hatte, war er schwarz, weiß, ein Latino?«
»Weiß«, sagte ich. »Vielleicht ein Latino. Ich glaube, er hatte braune Haare.«
»Was noch?«
»Er hatte große Hände. Er trug Lederhandschuhe.« Ich schmeckte wieder das muffige Leder und schluckte, um einen Würgereiz zu unterdrücken.
»Können Sie schätzen, wie groß er war?«
»Durchschnittlich, glaube ich.«
»Könnten Sie mir sagen, ob er übergewichtig war, dünn, muskulös …?«
»Durchschnittlich«, sagte ich wieder. Ging es noch weniger informativ? Ich war darauf trainiert, auf das kleinste Detail zu achten. Aber mit dem ersten Schlag war alles verpufft, was ich in meiner Ausbildung gelernt hatte. »Er war sehr kräftig.«
»Sie haben sich gewehrt.«
»Ja. Aber er hat mich immer weiter geschlagen, sodass ich nicht nah genug an ihn herangekommen bin. Sein Gesicht habe ich überhaupt nicht gesehen. Es ist alles verschwommen. Und dann hat er mir den Kissenbezug über den Kopf gezogen …«
»Sind Ihnen seine Schuhe aufgefallen?«
»Nein. Ja!«, verbesserte ich mich, als der Nike-Swoosh auf seinen Sneakers vor meinem inneren Auge aufblitzte. »Er hatte schwarze Nike-Sneakers an.«
»Können Sie die Größe schätzen?«
»Nein, verdammt. Ich bin nutzlos. Absolut nutzlos, ich weiß überhaupt nichts.«
»Doch«, widersprach sie. »Sie haben sich an die Sneakers erinnert.«
»Halb Miami besitzt solche Sneakers.«
»Hat er etwas gesagt?«
»Nein.«
»Sind Sie sicher?«
»Er hat nichts gesagt.«
Im selben Moment spürte ich die Lippen des Mannes wieder an meinem Ohr, seine Stimme, die mit derselben widerlichen Kraft durch den Stoff dringt, mit der er in mich stößt. Sag mir, dass du mich liebst.
Ich fing an, am ganzen Körper zu zittern. Wie konnte ich das vergessen? Wie konnte mein Verstand etwas so offensichtlich und schrecklich Wichtiges verdrängen?
»Er hat Sie aufgefordert, ihm zu sagen, dass Sie ihn lieben?«, wiederholte die Polizistin, unfähig, ihre Verblüffung oder ihren Ekel zu verbergen.
»Ja, er hat es sogar wiederholt.«
»Und, haben Sie …?«
»Was?«
»Ihm gesagt, dass Sie ihn lieben.«
»Nein. Ich habe ihn ein Schwein genannt.«
»Gut«, sagte sie, und wieder war ich eigenartig stolz.
»Okay, Bailey. Das ist sehr wichtig. Können Sie mir sagen, wie er klang?« Bevor ich eine Antwort formulieren konnte, führte sie ihre Frage schon weiter aus. »War er ein Amerikaner? Hatte er einen Akzent? Hatte er eine tiefe oder eine hohe Stimme? Hat er gelispelt? Klang er jung oder alt?«
»Jung«, sagte ich. »Oder wenigstens nicht alt. Aber kein Teenager«, schränkte ich ein. »Er hat geflüstert – eigentlich mehr geknurrt. Ich habe keinen Akzent und auch kein Lispeln bemerkt.«
»Gut. Das ist sehr gut, Bailey. Sie machen das großartig. Glauben Sie, Sie würden ihn wiedererkennen, wenn Sie die Stimme noch einmal hören würden?«
O Gott, dachte ich, und mir wurde vor Panik schwindelig. Bitte lass mich diese Stimme nie wieder hören. »Ich weiß nicht. Schon möglich. Er hat wie gesagt geflüstert.« Ein erneuter Panikanfall, ein Tränenstrom, ein weiteres Taschentuch. »Bitte. Ich will einfach nach Hause gehen.«
»Nur noch ein paar Fragen.«
»Nein. Keine Fragen mehr. Ich habe Ihnen alles gesagt.«
Was ich ihr gesagt habe, ist, dass der Mann, der mich vergewaltigt hat, wahrscheinlich weiß, mittelgroß und von durchschnittlicher Statur, zwischen zwanzig und vierzig ist und braune Haare sowie eine Vorliebe für schwarze Nike-Sneakers hat. Mit anderen Worten, ich habe ihnen gar nichts gesagt.
»Okay«, gab die Polizistin nach, obwohl ich den Widerwillen in ihrem Ton hörte. »Ist es in Ordnung, wenn wir morgen noch einmal bei Ihnen vorbeikommen?«
»Wozu?«
»Falls Ihnen noch etwas einfällt. Wenn man erst einmal eine Nacht drüber geschlafen hat …«
»Sie meinen, ich würde schlafen?«
»Ich denke, die Ärzte werden Ihnen etwas verschreiben, das Ihnen hilft.«
»Sie glauben, dass irgendwas hilft?«
»Ich weiß, im Augenblick fühlt es sich nicht so an«, sagte sie und legte sanft eine Hand auf meinen Arm. Ich zwang mich, nicht vor ihrer Berührung zurückzuzucken. »Aber irgendwann werden Sie darüber hinwegkommen. Ihr Leben wird zur Normalität zurückkehren.«
Ich staunte über ihre Gewissheit und wunderte mich gleichzeitig über ihre Naivität. Wann sollte mein Leben je normal gewesen sein?
Eine kurze Familiengeschichte: Mein Vater Eugene Carpenter war dreimal verheiratet und hat sieben Kinder gezeugt, ein Mädchen und einen Jungen mit seiner ersten Frau, drei Jungen mit seiner zweiten und Heath und mich mit seiner dritten. Er war ein erfolgreicher Unternehmer und Investor, der an der Börse ein Vermögen machte, indem er regelmäßig bei einem niedrigen Kurs einstieg und bei hohem wieder verkaufte, und dabei so verdächtig viel Glück hatte, dass es ihm mehr als einmal die Aufmerksamkeit staatlicher Ermittler einbrachte. Trotz all ihrer Anstrengungen konnten sie ihm jedoch nie etwas nachweisen, was auch nur in die Nähe einer Verfehlung oder gar einer strafbaren Handlung gekommen wäre, was meinen Vater mit ebenso tiefem Stolz erfüllte, wie es seinen ältesten Sohn frustriert hatte. Der war nämlich der stellvertretende Generalstaatsanwalt, der die Ermittlungen eingeleitet hatte. Anschließend kappte mein Vater sämtliche Verbindungen zu seinem nach ihm benannten Kronsohn und enterbte ihn. Deshalb die Klage gegen sein Testament, dessen Hauptbegünstigte Heath und ich sind. Unsere übrigen Halbgeschwister haben sich der Klage angeschlossen, um zu beanspruchen, was ihnen ihrer Ansicht nach rechtmäßig zusteht.
Ich kann nicht behaupten, dass ich es ihnen übel nehme. Mein Vater war ihren Müttern bestenfalls ein lausiger Ehemann und ihnen allen ein gleichgültiger Vater. Schlimmer noch, er hatte einen verdrehten, manchmal sogar grausamen Humor. Er nannte die drei Söhne, die er mit seiner zweiten Frau hatte, Thomas, Richard und Harrison (Tom, Dick und Harry), und auch wenn er stets beteuerte, dass das keine Absicht gewesen sei, zumindest nicht bis zur Geburt von Harry, war eines unbestreitbar: Er hatte die Brüder ständig gegeneinander ausgespielt, mit dem Ergebnis, dass sie heute ohne die gemeinsame Klage wahrscheinlich kein Wort miteinander wechseln würden.
Erstaunlicherweise ist das nicht der Vater, den Heath und ich kannten. Unsere Kindheit war idyllisch, unser Vater war liebevoll und so aufmerksam, wie es ein Kind sich nur wünschen konnte. Das Verdienst schreibe ich meiner Mutter zu. Sie war achtzehn Jahre jünger als mein Vater, und er behauptete oft, sie sei die erste Frau gewesen, die er wirklich geliebt habe, die Frau, die ihn gelehrt hatte, ein Mann zu sein. Und ich schätze, weil er sie geliebt hat, hat er uns auch geliebt. Der Vater, an den ich mich erinnere, war mild und großzügig, hatte ein weiches Herz und wollte uns mit aller Macht vor jeglichem Bösen beschützen. Als meine Mutter vor drei Jahren tragisch jung mit fünfundfünfzig Jahren an Eierstockkrebs starb, war er außer sich vor Trauer. Trotzdem hat er uns nie im Stich gelassen, nie Zuflucht gesucht in dem Mann, der er früher war, der Mann, an den sich all meine Halbgeschwister erinnern.
Er war immer für mich da.
Und dann plötzlich nicht mehr.
Der Mann, den ich für unbesiegbar gehalten hatte, erlag mit sechsundsiebzig einem schweren Herzinfarkt.
Das war vor vier Monaten.
Nach seinem Tod habe ich mich von meinem Freund Travis getrennt und eine, wie die meisten finden, unbesonnene Affäre mit einem verheirateten Mann angefangen. Nicht, dass das eine etwas mit dem anderen zu tun gehabt hätte. Mit meiner Beziehung mit Travis war es schon eine Weile bergab gegangen. Ich war durch den unerwarteten Verlust meines Vaters aus der Bahn geworfen worden und erlebte eine Rückkehr der täglichen Angstattacken, die mich nach dem Tod meiner Mutter gequält hatten, Zeiten, in denen ich meine Beine nicht bewegen konnte und kaum Luft bekam. Ich versuchte, diese Attacken vor allen zu verbergen, und war damit auch größtenteils erfolgreich, aber ein Mann ließ sich nicht so leicht täuschen. »Willst du mir erzählen, was los ist?«, fragte er. »Was wirklich los ist.« Das tat ich, zunächst zögernd und dann regelrecht zwanghaft, als ob es, nachdem dieser spezielle Hahn einmal geöffnet war, unmöglich wäre, ihn wieder zuzudrehen. Rasch wurde der Mann mein engster Verbündeter, mein Vertrauter und irgendwann vielleicht unvermeidbar mein Liebhaber.
Ich wusste von Anfang an, dass er seine Frau nie verlassen würde. Sie war die Mutter seiner Kinder, und er konnte sich nicht vorstellen, bloß ein Wochenendvater zu sein, egal wie unglücklich seine Ehe sein mochte. Er sagte, er und seine Frau würden nur selten streiten, weil sie weitgehend getrennte Leben lebten, und obwohl man sie in der Öffentlichkeit regelmäßig zusammen sah, zögen sie sich in entgegengesetzte Teile des Hauses zurück, sobald sie allein waren. Sie hätten seit Jahren nicht mehr miteinander geschlafen.
Glaube ich das? Bin ich so einfältig? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wenn ich bei ihm bin, wenn ich mit ihm zusammen bin, bin ich, wo ich sein will und die ich sein will. So einfach – so kompliziert, so komplex, so schrecklich – ist es.
Wenn ich jetzt daran zurückdenke, wie wir miteinander geschlafen haben, die sanfte Art, wie seine Finger meinen Körper erkundeten, das zärtliche Drängen seiner Zunge, wie er mich geschickt zum Orgasmus brachte, scheint es unmöglich, dass ein Akt so voller Zärtlichkeit und Liebe unter anderen Umständen so hasserfüllt und wütend sein kann, dass das, was so viel Lust bereitet, auch derart viel Schmerz verursachen kann. Ich frage mich, ob ich die Berührung eines Mannes je wieder genießen werde oder ob ich jedes Mal, wenn er in mich eindringt, das Gefühl habe, dass ein Vergewaltiger mich brutal zerreißt, ob ich jedes Mal, wenn die Lippen eines Mannes zu meinen Brüsten wandern, vor Ekel und Entsetzen zurückschrecken werde. Ich frage mich, ob ich je wieder Freude am Sex haben werde oder ob das noch etwas ist, was mir für immer genommen wurde.
Als man mich nach den stundenlangen Untersuchungen und Befragungen durch die Polizei nach Hause brachte, war mein Bruder so traumatisiert, dass er mindestens vier Joints hintereinander rauchte, ehe er sich beruhigte. »Wir sollten Travis anrufen«, murmelte er immer wieder und schlief dann fest ein. Obwohl ich und Travis kein Paar mehr sind, ist er immer noch Heaths Freund. Sie waren schon befreundet, bevor Travis und ich zusammenkamen. Genau genommen hat Heath uns miteinander bekanntgemacht. Er versteht bis heute nicht, warum wir uns getrennt haben, und ich habe es ihm nicht gesagt. Er ist auch so schon aufgewühlt genug.
Jetzt stehe ich in der Wohnung, die ich nie verlasse, am Schlafzimmerfenster, starre abwesend auf die Rückseite eines halben Dutzends identischer Glastürme, und meine hohlen Augen starren zurück. Ich habe die Finger um das allgegenwärtige Fernglas gelegt, das praktisch zu einer Verlängerung meiner Hände geworden ist. An einer Seite ist ein großes Stück abgesplittert vom Aufprall bei dem Angriff, und meine Finger tasten instinktiv nach der Kerbe wie nach einer Narbe. Ich hebe das Fernglas an die Augen und höre die Stimme meiner Mutter: Sag mir, was du siehst. Ich visiere die Baustelle gegenüber an und beobachte, wie ein Arbeiter mit einem anderen streitet und ihm wütend den Finger in die Brust bohrt, bis ein dritter Kollege dazwischengeht.
Langsam wechsle ich das Blickfeld, die beiden Kreise der Gläser trennen sich und verschmelzen wieder, während ich den Blick flüchtig von Stockwerk zu Stockwerk schweifen lasse und die Linsen scharf stelle. Schließlich bleibe ich an dem Gebäude direkt hinter meinem kleben, mein Blick gleitet von Fenster zu Fenster, ich dringe in das Leben von Arg- und Ahnungslosen ein, verfolge ihre alltägliche Routine, verletze ihre Privatsphäre, zoome sie aus sicherer Distanz näher heran.
Als das Telefon neben meinem Bett klingelt, schrecke ich zusammen, mache jedoch keine Anstalten dranzugehen. Ich will mit niemandem reden. Ich bin all der Menschen überdrüssig, die mir versichern, dass alles gut und es jeden Tag ein bisschen leichter wird.
Das wird es nicht.
Ich presse das Fernglas dichter an mein Gesicht und beobachte aus der Ferne, wie sich das Universum entfaltet. Näher will ich die Welt draußen nicht an mich herankommen lassen.
KAPITEL 3
Die Leute erklären einem immer, dass es nutzlos sei, sich über Dinge aufzuregen, die man nicht kontrollieren kann. Früher habe ich das auch so gesehen. Aber das war, bevor man bei meiner Mutter Krebs diagnostizierte, bevor ich hilflos zusehen musste, wie die Krankheit ihr die Kraft, ihr Lächeln und zuletzt ihr Leben nahm. Bevor mein Vater einem schweren Herzinfarkt erlag, nur Wochen nachdem ihm sein Arzt beste Gesundheit attestiert hatte. Bevor ein Mann mich in einem süßlich duftenden Gebüsch überraschte, mir die Kleider herunterriss und meine Würde und das raubte, was ich an innerem Frieden noch übrig hatte. Ich weiß jetzt, dass Kontrolle bestenfalls eine harmlose Illusion ist, schlimmstenfalls eine gefährliche Täuschung.
Ich hatte nie viele enge Freundinnen oder Freunde. Ich weiß nicht genau, warum. Ich bin eigentlich ziemlich gesellig und komme mit den meisten Menschen zurecht. Smalltalk kann ich gut, Tiefsinnigeres nicht so. Ich hatte nie das Bedürfnis, über meine Gefühle zu sprechen. Ich wollte die Details meiner privaten Beziehungen nie anderen mitteilen. Meine Schulfreundin Jocelyn, die ich seit Jahren nicht gesehen habe, meinte immer, diesbezüglich wäre ich eher wie ein Junge, ich würde lieber über Allgemeines als über Konkretes sprechen und auch wenn ich eine großartige Zuhörerin sei, würde ich nie über eigene Probleme reden und keinen zu nahe an mich heranlassen. Sie meinte, ich hätte Probleme, Vertrauen aufzubauen, wahrscheinlich weil meine Familie so wohlhabend war. Von meiner Selbstentfremdung ganz zu schweigen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich meine, vielleicht bin ich wirklich nicht toll darin, andere Menschen in mein Leben zu lassen. Vielleicht war ich wirklich immer lieber Beobachterin als Teilnehmerin. Aber so bin ich eben. Vielleicht macht mich das so gut in meinem Beruf.
Jocelyn ist jedenfalls schon lange aus meinem Leben verschwunden. Nach der Highschool ist sie ein Jahr durch Europa gereist und dann nach Westen gezogen, um in Berkeley aufs College zu gehen. Ich bin in Südflorida geblieben. Wir haben den Kontakt verloren, obwohl sie mir vor ein paar Jahren eine »Freundschaftsanfrage« auf Facebook geschickt hatte. Ich wollte auch antworten, doch das war zu der Zeit, als meine Mutter starb, und ich bin nie dazu gekommen.
Es klingt wie ein Klischee, aber meine Mutter war immer meine beste Freundin. Ich kann nach wie vor nicht glauben, dass sie nicht mehr da ist. Ich vermisse sie jeden Tag. Doch sosehr sich mein Körper nach ihrer Umarmung sehnt, nach einem Kuss auf die Stirn und der Versicherung, dass dieser Kuss alles besser machen wird, bin ich andererseits zutiefst dankbar, dass sie nicht mehr da ist und mich nicht so sieht. Nicht einmal ihr Kuss könnte es besser machen.
Ich pflege freundlichen Kontakt zu Alissa Dunphy, der seit drei Jahren in der Kanzlei angestellten Anwältin, für die ich am Abend des Angriffs gearbeitet habe, und zu Sally Ogilby, der Assistentin von Phil Cunningham, dem Topanwalt der Firma für Familienrecht, doch außerhalb des Büros sehe ich beide nur selten. Alissa ist ohnehin an ihren Schreibtisch gekettet, weil sie noch vor ihrem fünfunddreißigsten Geburtstag zur Partnerin der Kanzlei aufsteigen möchte, und Sally ist verheiratet, Mutter eines dreijährigen Jungen und erwartet in wenigen Monaten ihr zweites Kind, diesmal ein Mädchen. Das lässt ihr nicht viel Zeit für andere Interessen. Ihr Leben ist ziemlich ausgefüllt. Unser aller Leben ist ziemlich ausgefüllt.
Korrektur: War.
Mein Leben war ziemlich ausgefüllt. Mein Leben war alles Mögliche.
Seit dem Überfall ruft Alissa täglich an, erklärt mir, wie leid es ihr tue, dass sie sich verantwortlich fühle, und fragt, ob sie irgendetwas für mich tun könne, um mir durch diese schwierige Zeit zu helfen. Nein, versichere ich ihr, es gebe nichts, was sie tun könne, und ich kann sie förmlich vor Erleichterung seufzen hören. »Du sagst mir Bescheid«, ermutigt sie mich, »wenn du irgendwas brauchst …«
Ich brauche mein Leben zurück. Ich will, dass alles wieder so wird wie vorher. Ich muss herausfinden, wer mir das angetan hat.
Die Polizei glaubt, dass es eine wahllose Tat war, ein Verbrechen aus Gelegenheit, ein Fall von falscher Zeit und falschem Ort. Trotzdem fragen sie: Gibt es vielleicht jemanden, gegen den ich ermittelt habe, jemanden, dessen Ehe durch meine Fotos zerstört wurde oder dessen Unternehmen wegen eines von mir entdeckten Sachverhalts bankrottgegangen ist, jemanden, der mich so sehr hasst, dass er getan hat, was er getan hat.
Ich denke an meine Zeugenaussage vor Gericht am Morgen des Angriffs, den Hass, der mir aus Todd Elders Blick entgegenschlug, als er, das Wort »Schlampe« auf den Lippen, an der Wand vor dem Gerichtssaal lehnte. Er entspricht der vagen Beschreibung des Vergewaltigers. Genau wie Owen Weaver, wie mir klar wird, als ich mich an unseren kurzen Flirt und die Reihe seiner weißen Zähne erinnere. Schaudernd spüre ich, wie diese Zähne in meine Brust beißen. Ist das möglich?
»Können Sie sich an irgendein Detail des Mannes erinnern?«, wiederhole ich die Frage der Polizistin täglich für mich.
Ich krame in meiner Erinnerung, zerre jedes noch so winzige Fragment hervor, bemühe mich, in meinem privaten Leben so hartnäckig, methodisch und einfallsreich zu sein, wie ich es beruflich war. Aber ich finde nichts. Ich kann nichts entdecken.
»Es hätte auch noch schlimmer kommen können«, erinnere ich mich an die Bemerkung einer Krankenschwester. »Er hätte Sie anal vergewaltigen können. Er hätte Sie zwingen können, seinen Penis in den Mund zu nehmen.«
»Ich wünschte, er hätte«, höre ich mich antworten. »Ich hätte ihm den Schwanz abgebissen.«
»Er hätte Sie umgebracht.«
»Das wäre es wert gewesen.«
Hat diese Unterhaltung wirklich stattgefunden, oder bilde ich mir das nur ein? Und wenn sie sich tatsächlich so ereignet hat, was habe ich sonst noch verdrängt? Was ist noch da draußen, das zu schrecklich ist, um es zu sehen, zu grauenhaft, um sich daran zu erinnern?
Ein typischer Tag nach der Vergewaltigung: Ich wache nach ein oder zwei Stunden Schlaf um fünf Uhr auf, schüttele einen von verschiedenen wiederkehrenden Albträumen ab – ein maskierter Mann, der mich durch eine Straße jagt, eine Frau, die vom Balkon zusieht und nichts tut, Haie, die in einem ruhigen Gewässer um meine Füße kreisen –, stehe auf, krame in der obersten Schublade meines Nachttischs nach der großen Schere, die ich seit dem Überfall dort aufbewahre, und beginne meine morgendliche Durchsuchung der Wohnung.
Wer immer mich vergewaltigt hat, hat mir auch meine Pistole gestohlen, und ich bin noch nicht dazu gekommen, sie zu ersetzen. Aber das ist okay. Ich habe beschlossen, dass eine Schere direkter, körperlicher, persönlicher, befriedigender ist. Sooft ich daran denke zurückzuschlagen – und das tue ich mit praktisch jedem Atemzug –, stelle ich mir nie vor, meinen Angreifer zu erschießen. Ich male mir aus, ihn zu erstechen, so wie er in mich eingedrungen ist. Und auch wenn ich im Gegensatz zu ihm meinen Körper nicht als Waffe einsetzen kann, kann ich doch seine Haut zerfetzen und in ihn stoßen wie er in mich, mit der Schere als Verlängerung meines Armes, meiner Wut.
So ein Mensch bin ich geworden. Zu einer solchen Frau hat er mich gemacht.
Mit gezückter Schere sehe ich unter dem Bett nach, obwohl es so niedrig ist, dass sich niemand darunter verstecken könnte, bevor ich den langen, mit Marmor gefliesten Flur hinuntergehe, der auf beiden Seiten von den Gemälden gesäumt ist, die ich von meinen Eltern geerbt habe – eine Serie bunter Herzen von Jim Dine, ein Motherwell-Akt, ein abstrakter Gottlieb in Schwarz und Pink, ein orange-schwarzer Calder, der mich irgendwie an einen Truthahn erinnert. Rasch überprüfe ich das zweite Schlafzimmer, das ich als Arbeitszimmer benutze, gucke unter die schwarze Schreibtischplatte aus Marmor auf dem bunten Acrylgestell und hinter das violette, ausziehbare Cordsofa, auf dem Heath manchmal schläft. Ich spähe in den kleinen Kleiderschrank und das von dem Zimmer abgehende Gästebad und sehe im Schrank unter dem Waschbecken nach, bevor ich weiter den Flur entlang zu dem großen Bad gehe. Nachdem ich mich vergewissert habe, dass niemand hinter der Tür lauert, nehme ich mir die Garderobe im Flur vor und halte Ausschau nach Füßen, die unter den Mänteln hervorragen. Ich überprüfe, dass die Wohnungstür abgeschlossen ist, und werfe auf dem Weg zum Wohn-/Essbereich einen Blick in die Küche.
In der Mitte des rechteckigen Raumes stehen sich zwei moderne, weiße, geschwungene Sofas gegenüber, auf einem asymmetrischen Kuhfell zwischen ihnen ein quadratischer Couchtisch mit Kalksteinplatte. Die Zierkissen auf den Sofas sind hellviolett, passend zu dem violetten Sessel auf der unsichtbaren Trennlinie zwischen Wohn- und Essbereich. In dem länglichen Drahtkorb auf dem gläsernen Esstisch liegen zehn Plastikzitronen. Auf einem Beistelltisch an der Wand gegenüber dem Fenster sind ein Dutzend pinkfarbene Seidenrosen in einer hellgrünen Vase arrangiert, darüber hängt ein Gemälde von zwei gesichtslosen Frauen, die Hand in Hand über einen verlassenen Strand schlendern. Ich kann mich nicht erinnern, wer es gemalt hat. Ein lokaler Künstler, glaube ich.
Neben dem Fenster streckt sich eine Kunstpalme zur hohen Decke, die so echt aussieht wie eine der allgegenwärtigen Palmen auf der Straße unten. Aus einer Wandvase neben der Küchentür hängen weiße Plastikorchideen, die jeder für echt hält. Die Leute gratulieren mir zu meinem grünen Daumen und wirken geschockt, wenn ich ihnen erkläre, dass es Kunstblumen sind, und noch geschockter, wenn ich gestehe, dass mir diese Nachbildungen lieber sind als echte Pflanzen. Sie sind pflegeleicht und anspruchslos, erkläre ich. Man muss sich nicht um sie kümmern. Sie sterben nicht.
Natürlich habe ich auch echte Blumen. In den Tagen direkt nach meiner Vergewaltigung bekam ich mindestens sechs verschiedene Sträuße. Die meisten sind von meinen Kollegen, und ich habe sie in der ganzen Wohnung verteilt. Sean Holden hat zwei Dutzend pinkfarbene Rosen geschickt, Travis einen großen Topf violette Chrysanthemen. Er hat sich gemerkt, dass ich Violett mag, aber vergessen, dass ich Chrysanthemen hasse. Vielleicht hat er sie auch mit Absicht ausgesucht, oder ich habe es ihm nie erzählt.
Nachdem ich mich versichert habe, dass auch hinter den Zierblenden der Vorhänge niemand lauert, um mich anzugreifen, kehre ich ins Schlafzimmer zurück, wo ich durch die Klamotten in meinem Ankleidezimmer wühle, um mich zu vergewissern, dass sich niemand zwischen meine Jeans und Kleider geschmuggelt hat. Ich prüfe das Badezimmer, die abgetrennte Toilette, die verglaste Dusche, sogar die weiße Emaillewanne mit den kupfernen Krallenfüßen, für den Fall, dass sich jemand wie eine Schlange im Korb darin zusammengerollt hat, um unerwartet zuzubeißen. Apropos Korb, auch den Deckel des weißen Flechtkorbs neben der Badewanne hebe ich an und stoße mit der Schere hinein.
Dieses Ritual vollführe ich mindestens dreimal am Tag, wobei die Reihenfolge gelegentlich variiert. Erst wenn ich vollkommen überzeugt bin, dass niemand in meine gläserne Zufluchtsstätte im Himmel eingedrungen ist, drehe ich die Dusche an. Wenn Dampfschwaden durchs Bad wehen, ziehe ich meinen Schlafanzug aus und betrete die Kabine.
Die Schere nehme ich mit.
Meinen nackten Körper schaue ich nicht an. Ich kann den Anblick meiner Brüste nicht ertragen. Ich ekele mich vor meinem Schamhaar. Seit dem Angriff habe ich mir Beine und Achselhöhlen nicht mehr rasiert. Alles schmerzt: Rippen, Handgelenke, Rücken. Sogar meine Haut. Ich bleibe unter dem heißen Wasserstrahl stehen, bis ich meinen Körper nicht mehr spüre. Ich blicke nicht in den beschlagenen Spiegel, wenn ich mich mit dem Handtuch wund rubbele. Ich stopfe den Schlafanzug in den überquellenden Wäschekorb, ziehe einen frischen an und kehre mit gezückter Schere ins Schlafzimmer zurück.
Der Raum ist dunkel. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Bis zum Tagesanbruch halte ich die Jalousien geschlossen.
Man weiß nie, wer einen vielleicht beobachtet.
Ich fühle ihn, bevor ich ihn sehe, rieche ihn, bevor ich spüre, wie er sich über mir bewegt. Ich erkenne den Geruch sofort wieder. Mundwasser mit Menthol und Minze. Unvermittelt spüre ich das volle Gewicht seines Körpers auf meinem, sein Ellbogen drückt auf meine Luftröhre, raubt mir den Atem und erstickt meinen Schrei im Keim. »Sag, dass du mich liebst«, befiehlt er, als er mit solcher Gewalt in mich eindringt, dass mein Inneres brennt, als würde er eine brennende Fackel in mich hineinstoßen. »Sag, dass du mich liebst.«
»Nein!«, schreie ich und will gegen seine Brust schlagen, gegen seine Schenkel treten, seinen Rücken aufkratzen, doch meine Hände greifen ins Nichts, während ich mich hilflos in meinem Bett winde.
Ich öffne die Augen. Da ist niemand.
Ich richte mich auf. Es dauert einige Minuten, bis mein Atem wieder halbwegs normal geht. Der Fernseher läuft noch. Ich greife nach der Fernbedienung auf dem Nachttisch und schalte ihn aus. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist oder welcher Tag, wie viele Stunden vergangen sind, seit ich zum letzten Mal wach war.
Das Telefon klingelt, ich zucke zusammen und starre es an, bis sein grässliches Schrillen verstummt. Die Uhr neben meinem Bett sagt mir, dass es zehn vor acht ist. Am Morgen, nehme ich an, doch ich bin mir nicht sicher, und es spielt eigentlich auch keine Rolle. Ich stehe auf, nehme die Schere aus der obersten Nachttischschublade und beginne meinen Rundgang durch die Wohnung. Als ich im Flur bin, fängt das Telefon wieder an zu klingeln. Ich beachte es gar nicht.
In den zehn Minuten, die ich brauche, um mich zu vergewissern, dass meine Wohnung sicher ist, klingelt das Telefon immer wieder, so auch als ich in mein Schlafzimmer zurückkehre. Wahrscheinlich die Polizei, denke ich und greife nach dem Hörer. Doch just in dem Moment hört es auf und weigert sich störrisch, erneut zu läuten.