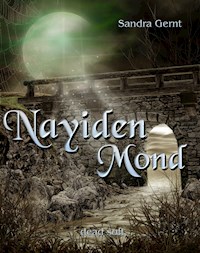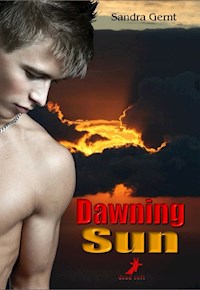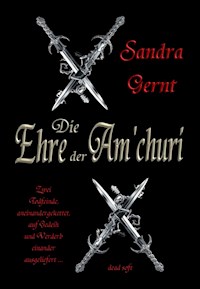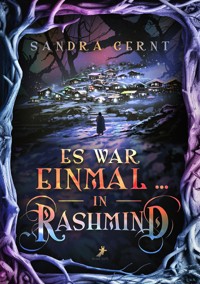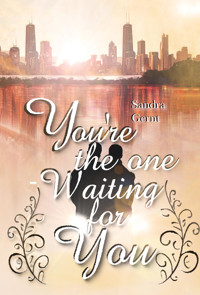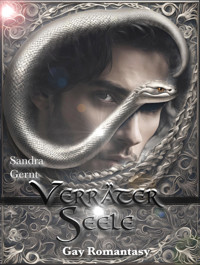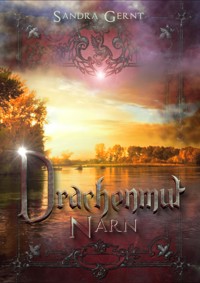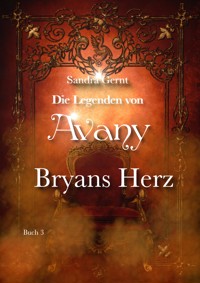5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Artrú ist ein Sayihir – ein legendäres Geschöpf, ein Mensch mit Flügeln. Einst seiner Familie entrissen, wird er versklavt, benutzt und umhergereicht wie ein Gegenstand, eine Trophäe. Bis ein Mann ihn kauft. Ein Magier, der seinem selbstgewählten Ziel folgt, ohne Rücksicht auf den Preis, der dafür gezahlt werden muss. Artrú muss lernen, die unsichtbaren Sklavenfesseln abzustreifen, um überleben zu können, um ein Unglück zu verhindern, das die Welt, wie er sie kennt, mit aller Macht bedroht – und um sich der Liebe zu öffnen, die ihm unverhofft begegnet. Ca. 82.500 Wörter Im normalen Taschenbuchformat hätte diese Geschichte ungefähr 400 Seiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Artrú ist ein Sayihir – ein legendäres Geschöpf, ein Mensch mit Flügeln.
Einst seiner Familie entrissen, wird er versklavt, benutzt und umhergereicht wie ein Gegenstand, eine Trophäe. Bis ein Mann ihn kauft. Ein Magier, der seinem selbstgewählten Ziel folgt, ohne Rücksicht auf den Preis, der dafür gezahlt werden muss.
Artrú muss lernen, die unsichtbaren Sklavenfesseln abzustreifen, um überleben zu können, um ein Unglück zu verhindern, das die Welt, wie er sie kennt, mit aller Macht bedroht – und um sich der Liebe zu öffnen, die ihm unverhofft begegnet.
Ca. 82.500 Wörter
Im normalen Taschenbuchformat hätte diese Geschichte ungefähr 400 Seiten.
von
Sandra Gernt
„Artrú? Hier, fang!“
Seine kleine Schwester warf eine Handvoll Nüsse in die Luft. Kichernd schaute sie zu, wie Artrú, der bis dahin mit einer Flechtarbeit beschäftigt gewesen war, sich vom Nestrand fallen ließ. Erst etliche Herzschläge später öffnete er die Flügel und fing geschickt eine Nuss nach der anderen auf. Es gehörte zu den Spielregeln, dass er alle Nüsse gefangen haben musste, bevor er mehr als fünfhundert Flügelspannen abgestürzt war. Wie üblich gelang ihm das ohne Mühe und er kehrte zum Nest zurück.
„Das war viel zu einfach, Sessa“, sagte er und aß genüsslich seine Beute.
„Pah! Wenn das zu leicht war, dann fang mich doch!“ Sie zog davon, ein weißer, schlanker Blitz, kaum auszumachen zwischen den tiefhängenden Schleierwolken.
Weiße Flügel waren extrem selten bei den Sayihiri. Sessa besaß zudem schneeweißes Haar, weißlichen Hautflaum und rötliche Augen. Dafür wurde sie zumeist als Nadjar-Tochter gerufen, Kind der Schneegöttin. Nadjar pflegte sich zumeist als schneeweißer Gerfalke zu zeigen, selten auch als weiße Wölfin.
Artrú besaß im Gegensatz zu seiner Schwester die üblichen schwarzen Flügel, wie fast jedes Mitglied der Sippe. Als Kind hatte er Sessa glühend beneidet, weil er sie so viel schöner fand und spürte, dass sie Aufmerksamkeit auf sich zog. Inzwischen war ihm klar geworden, was das für sie bedeutete, und ihm war durchaus recht, dass er nicht wie sie überall auffiel, ausgenommen bei Nebel und in Schneestürmen.
An klaren Tagen konnte Sessa nicht an der Jagd teilnehmen, man sah sie schon aus hunderten Flügelspannen Entfernung. Bei Treffen mit anderen Sippen wurde sie von jungen Männern umschwärmt. Nadjar-Töchter waren begehrt, ihre Kinder sollten besonders gesund und stark sein, wenn man den Überlieferungen glauben wollte. Nein, diese Art von Aufmerksamkeit wünschte sich Artrú beim besten Willen nicht.
Er tat Sessa den Gefallen und jagte ihr hinterher. Sie war schließlich schon dreizehn Jahre alt und musste seit einigen Monaten neben dem Lendentuch, das für jeden von ihnen Alltag war, auch ein Brusttuch tragen, kunstvoll um und unterhalb ihrer Flügel geschlungen. Bald würde sie das Interesse an solchen Spielen verlieren, das war unausweichlich. Artrú hatte sie beim letzten großen Treffen der Sippen beobachtet. Zur Sommersonnenwende war das gewesen. Da hatte Sessa zum ersten Mal nicht ausschließlich kindlich-niedlich oder empört auf die Aufmerksamkeit der jungen Männer reagiert, sondern mit ihnen geredet, gelacht, gespielt, sich mit Schmeicheleien und kleinen Geschenken überhäufen lassen. Mehr als einmal war ihre Mutter dazwischengegangen, weil ihr das Treiben zu wild wurde. Zu gefährlich für ein solch junges Mädchen. Nadjar-Töchter heirateten jung, das wusste jeder. Sie hatten freie Auswahl und konnten sich die besten Männer nehmen. Solange Sessa noch Kind genug war, um mit ihrem großen Bruder fangen spielen zu wollen, ging er gerne darauf ein. Selbst wenn der Tag schon langsam endete und er müde von der harten Arbeit war. Endlose Stunden hatte er getan, was ihm aufgetragen wurde. So wie jeder andere in der Sippe auch. Die Jagd, das Sammeln von Früchten, Pilzen und Wurzeln, gerade jetzt, wo der Herbst begann und man den ersten Schneefall bereits in der Luft wittern konnte. Für Sessa war er willens, die Müdigkeit zu vergessen.
Sie tobten eine Weile in den Wolken umher, umflogen Berggipfel und scharfkantige Felsen. Mehrere Tausend Flügelspannen unter ihnen befand sich das Land, die Erde, der feste Boden, das Reich der Flügellosen – es gab zahlreiche Namen für diese sonderbare Welt, in die sie sich tagtäglich hinabbegeben mussten, um Pflanzen, Beeren und Nüsse zu sammeln. Lange verblieben sie nie, sie fühlten sich dort niemals sicher, regelrecht gefangen und von sämtlichen Seiten bedroht und beengt. Sayihiri waren für die Höhen geboren. Dort, wo die Welt karg und felsgrau war, der Himmel endlos, die Winde stark, der Schnee ein treuer Begleiter durch das gesamte Jahr.
Als sie sich gegenseitig mehr als dreimal gefangen hatten, gaben sie das Spiel lachend auf, ließen sich auf einen der Felsen nieder und beobachteten, wie die gute Mutter unterging. Anjali, die Sonnengöttin, so wurde sie von den Sayihiri genannt. Gemeinsam mit Karyi, ihrer Mondschwester, beherrschte sie den Himmel, Branwe, der Vater der Winde, regierte hingegen zusammen mit Kalar, dem Wintergott, über die niedere Welt. Arjuki, Mutter Erde, war diejenige, die das vielfältige Leben gebar, befruchtet von Lladal, dem Vater der Gewässer. Hunderte weitere Gottheiten tummelten sich in dieser endlosen Weite und sorgten dafür, dass alles seinen immer gleichen Lauf ging. Geburt, Leben, Tod. So war es stets gewesen. So würde es immer sein.
Artrú liebte seine Welt. An Tagen wie diesen war er sich zudem sicher, dass diese Welt auch ihn liebte. Auch wenn er wusste, wie dieser Tag enden würde …
„Wir müssen zurück“, sagte er zu Sessa. „Gleich wird es dunkel sein. Du weißt, Mutter mag es gar nicht, wenn wir uns verspäten.“
Sessa brummte lediglich, starrte missmutig in die Tiefe und ließ ihre langen, schlanken Zehen spielen. Unter ihnen verhüllten immer dichter werdende Wolken den Blick auf das Erdenreich.
„Lass es raus“, murmelte Artrú. „Was ärgert dich?“
„Vater sagte, ich muss morgen zum großen See, um Fische zu fangen“, knurrte sie mit allen Zeichen ehrlicher Empörung. „Immer muss ich diese scheußliche Aufgabe übernehmen! Das ist ungerecht! Ich mag es gar nicht, in kaltes Wasser zu tauchen. Danach fühle ich mich noch Ewigkeiten lang schwer wie ein Stein.“ Sie strich über ihren schönen, weichen Körperflaum, weiß genug, um beinahe in den letzten Strahlen der Sonne zu leuchten. Dieser kurze Flaum, der zu dünn war, um als Fell durchzugehen, schützte die Sayihiri vor der Kälte. Regen perlte weitestgehend daran ab, doch wenn sie erst einmal richtig durchweicht waren, half auch die leichte Talgschicht nicht mehr weiter.
„Ich weiß, wie sehr du das Fischen hasst“, sagte Artrú langsam. „Trotzdem brauchen wir dringend Vorräte, um für den Winter gerüstet zu sein. Alle Vorzeichen besagen, dass auch unten im Erdenland mit einem frühen Vormarsch von Schnee und Eis zu rechnen ist. Dörrfisch ist darum unabdingbar wichtig, da so viel leichter zu fangen als Wild. Deine Qualen helfen der Sippe.“
Sie schaute ihn böse an. Natürlich hatte er das Falsche gesagt, wie meistens, wenn er versuchte, jemanden zu trösten. Sie wusste selbst, warum genau sie zum Fischfang ausgesandt wurde. Er verstand nicht, warum sie dieses Wissen nicht tröstete.
„Würde es helfen, wenn ich dich begleite und wir uns im Wasser abwechseln?“, fragte er zögerlich. Er konnte seine Schwester einfach nicht unglücklich sehen!
„O ja! Bitte, bitte, Artrú! Bitte frag Vater, ob du mitgehen darfst, das wäre so viel besser, als allein am See zu stehen!“ Jetzt strahlte sie wieder und drückte ihm sogar einen Kuss auf die Wange, bevor sie aufsprang und zurück nach Hause flog. Ihre Energie war schlicht unerschöpflich!
Artrú folgte ihr lächelnd. Gewiss würde Vater nichts dagegen haben, wenn er Sessa begleitete. Fisch war beliebt, egal ob frisch gefangen oder über dem Feuer getrocknet, um haltbar zu werden. Diese Feuer wurden in den Räucherhöhlen entzündet, zu dieser Zeit im Jahr brannten sie Tag und Nacht.
Die Sippe nutzte die zahlreichen Höhlen, die das Gebirge durchzogen, sammelten dort ihre Vorräte, kochten, räucherten, dörrten, stellten Werkzeuge und Geräte her und suchten Schutz, wenn Stürme, Schnee und Eis zu stark tobten. Doch wann immer es möglich war, fand für sie das Leben in den gewaltigen Nestern statt, die sie mithilfe von Baumstämmen, Zweigen und Strohmatten nach dem Vorbild der Vögel an die windabgewandten Seiten der Berge bauten. Dort schliefen sie nachts unter den Sternen, jeweils in kleinen Familiengruppen, die sich zu einem größeren Sippenverband zusammengeschlossen hatten. Ihre Sippe besaß fünf Nester, was recht durchschnittlich war.
Artrú hegte gemischte Gefühle bezüglich des Abendessens. Normalerweise konnte er es kaum erwarten, denn hungrig war er eigentlich immer. Heute allerdings … Sie würden sich wie üblich mit der gesamten Sippe in der großen Gemeinschaftshöhle treffen, wo die Alten, die nicht mehr auf die Jagd gehen konnten, gemeinsam mit den Kindern, die noch zu jung dafür waren, aber schon anpacken konnten, das Essen verteilten, das gemeinschaftlich zubereitet worden war. Heute stand das große Abschiedsessen von Großmutter Rutyia an.
Sie war einhundertachtzehn Winter alt, beinahe taub, doch bis vor Kurzem hatte sie mitten im Leben gestanden. Vor einigen Tagen dann hatte sie einen Schlag erlitten, der sie halbseitig gelähmt zurückgelassen hatte. Inzwischen war klar, dass sich keine Besserung einstellen wollte, die Lähmung war geblieben. Damit war für sie das Ende besiegelt.
Die Sayihiri versorgten ihre Alten und Kranken mit Respekt und Liebe. Wer allerdings nicht oder nicht mehr fliegen konnte und keine Aussicht auf Besserung besaß, der stürzte sich freiwillig in den Tod, sei es aus eigener Kraft, sei es unter Mithilfe der Familie. Es war nicht möglich, hier oben in den Wipfeln der Berge zu überleben, wenn die Flügel dauerhaft gebrauchsunfähig waren.
Rutyia würde sich nach dem gemeinsamen Abschiedsmahl und einer kleinen Feier ihr zu Ehren von ihrer ältesten Tochter zum Gipfel der Mondkuppe tragen lassen. Dieser Berg war der höchste weit und breit. Danach folgte ein einsamer Sturz in den Abgrund, die harte Landung durch die Dunkelheit gnädig vor den Augen der anderen verborgen. Da unten waren die Wälder dicht, zahlreiche Raubtiere würden sich des zerschlagenen Körpers annehmen.
Artrú empfand es als traurig, wenn er einmal mehr Abschied von einem der Alten nehmen musste. Großmutter Rutyia lag ihm sehr am Herzen, sie hatte ihn vieles gelehrt. Doch sie hatte ein mehr als volles Leben führen dürfen und wollte selbst auf keinen Fall ein Krüppel sein, unfähig, irgendetwas selbst zu tun und sogar für die intimsten Kleinigkeiten Hilfe beanspruchen zu müssen. Darum bemühte sich Artrú, die Traurigkeit nicht zu tief dringen zu lassen und sich stattdessen auf das besonders gute Essen zu freuen.
Ihre Eltern warteten bereits ungeduldig auf Sessa und ihn. Ohne weitere Worte oder Verzögerung ging es zur Gemeinschaftshöhle hinab, eine riesige Auswaschung im Felsgestein, wo leicht fünfhundert Sayihiri Platz finden würden. Natürlich war ihre Sippe nicht einmal annähernd so groß. Außer ihnen waren bereits alle versammelt. Großmutter Rutyia saß auf dem Ehrenplatz. Ein gepolstertes, bequemes Sitznest, das ihr ermöglichte, aufrecht zu sitzen, obwohl ihr dafür sonst inzwischen die Kraft fehlte. Sie war klein und hager, von den vielen Lebensjahren ausgehöhlt und ausgezehrt bis auf die Knochen. Ihr Haar und Körperflaum waren so stark gebleicht, dass sie Sessa ähnelte, ihre Finger vom Alter ebenso gekrümmt wie ihr Rücken, ihre Flügel wirkten zerzaust und kümmerlich. Das Licht, das stets in ihren dunklen Augen gelodert hatte, der unbeugsame Wille, die Freude am Leben, die ihr zu eigen gewesen waren – all dies war erloschen.
Ihre Kinder, Enkel, Ur- und Ururenkel umgaben sie, und selbst letztere trugen bereits Säuglinge in den Armen. Jemand hatte ihr einen Blütenkranz geflochten und um den faltigen Hals gelegt. Sie akzeptierte es, störte sich vermutlich nicht mehr an diesen unwichtigen Dingen. Auf ihren Wunsch hin gab es Bira-Suppe. Ein Wurzelgemüse war das, süßlich schmeckend, das nur selten zu finden und darum kostbar war. Danach wurde frisch erlegte Ente serviert, knusprig gebraten und mit Honig glasiert, und zum Schluss Beerenküchlein. Eine außergewöhnliche Leckerei, denn die Mühe, einzelne Wildgetreidekörner zu sammeln und zu Mehl zu zermahlen, und mitsamt Honig und Beeren zu einer süßen Mahlzeit auf heißen Steinen zu backen, nahmen sie selbst für ein Abschiedsmahl kaum je auf sich. Großmutter Rutyia war außergewöhnlich, in ihrer Persönlichkeit ebenso wie ihrem langen Leben. Für sie wurden sogar Kuchen gebacken und niemand nahm ihr die Mühe übel.
„Singt für mich!“, befahl sie mit ihrer rauen, hochlagigen Altfrauenstimme, als jeder gesättigt und die Reste fortgetragen worden waren. „Singt für mich von den vier Winden!“
Gehorsam rückten sie alle näher heran und stimmten aus über neunzig Kehlen das Wind-Lied an, mit dem jeder Sayihiri aufwuchs. Artrú fröstelte, denn dieses Lied handelte vom Abschied ohne Wiederkehr. Ein Sayihir flog aus, um die Götter zu besänftigen, damit der seit Jahren währende Winter ein Ende fand. Da er den Weg nicht wusste, fragte er nacheinander die vier Winde, wie er zu den Göttlichen gelangen konnte. Jeder der Winde war selbst ein Gott und gab ihm stets gerade genug Wissen an die Hand, um weiterzukommen. Der Nordwind schließlich trug ihn zu den höchsten Mächten hinauf – mit der eindringlichen Warnung, dass es für ihn keine Rückkehr ins Leben mehr geben konnte. Der Sayihir war damit einverstanden und man hatte ihn niemals wieder gesehen … Doch der Winter endete noch in derselben Nacht und man gedachte ihm und seinem Opfer mit diesem Lied. Es war fester Bestandteil der Abschiedsfeiern und bildete dabei praktisch immer den Schlusspunkt.
Einige Alte zögerten das Unvermeidliche bis weit in die Nacht hinaus, genossen noch ein letztes Mal die Nähe ihrer Sippe. Niemand drängte sie, und wenn die Feier bis zur Morgendämmerung andauerte. Es blieb ihre Entscheidung, der Gang ohne Wiederkehr musste freiwillig geschehen. Großmutter Rutyia schien davon wenig zu halten, ja, es regelrecht eilig zu haben, es zügig hinter sich zu bringen und dem Tod entgegenzustürzen.
Jetzt, wo es soweit war, wollte Artrú sie nicht verlieren. Das war selbstsüchtig von ihm, denn ohne jede Frage hatte sie ihren Frieden verdient. Mehr als verdient … Jeder Moment länger, den sie auf dieser Welt verweilte, gefangen in einem zerbrochenen Körper, musste unerträgliche Qual für sie bedeuten. Das wollte er ihr nicht zumuten, das konnte er nicht verlangen! Und dennoch sehnte er sich nach einem einzigen Tag mehr, an dem er zu ihren Füßen sitzen und ihrer Weisheit lauschen durfte. Warum hatte er zahllose Tage ungenutzt verstreichen lassen? Warum hatte er nicht vorausgesehen, dass es dazu kommen würde, unausweichlich wie der Schnee?
Artrú beendete das Lied mit den anderen. Danach huschte er zum Höhlenausgang, unbemerkt von der Sippe, die auf Rutyia konzentriert war, und floh hinaus in die Nacht. Großmutter Rutyias Stimme war zu hören. Er wollte die Worte nicht verstehen. Es würden ihre letzten sein, die sie zu der Sippe sprach.
Vorzuwerfen hatte er sich nichts, seiner Meinung nach. Schließlich hatte er das letzte Mahl mit ihr geteilt, sie ein letztes Mal umarmt, das letzte Lied für sie gesungen. Da musste er nicht Zeuge werden, wie sie ihren Abschied nahm. Nicht heute. Er fühlte sich nicht stark genug, dies ohne Tränen zu überstehen, wie die Sitte es erforderte. Weinen durfte man hinterher, beim Abschied hatte man zu lächeln. Nein, er war zu schwach, zu selbstsüchtig dafür!
Artrú flog zum Nest seiner Familie. Es war nicht außergewöhnlich, beim Abschiedsfest zu versagen. Das geschah immer wieder, selbst den Besten von ihnen. Niemand würde ihn darauf ansprechen oder ihn verspotten. Mit etwas Glück war er bereits eingeschlafen, bevor die anderen kamen, ansonsten würde er sich schlafend stellen und …
Mit einem Mal umringten ihn dunkle Gestalten, die aus dem Nichts erschienen waren. Fremde! Feindliche Sayihiri! Hier? Ihre Sippe lebte weit abseits, es hatte seit Jahrzehnten keine feindlichen Überfälle mehr gegeben!
Artrú sah rauschende Flügel. Finstere Gesichter. Ausgestreckte Hände. Eiserne Fesseln an den Hälsen der Fremden. Ohne zu zögern ließ er sich nach unten fallen, raste dem Erdboden entgegen. Wie er es tausend Mal zuvor getan hatte, im Spiel mit Sessa. Weg, er musste weg! Zurück zu den anderen!
- Nein. Nein, auf keinen Fall! Er durfte nicht zu seiner Familie. Er musste sie beschützen, egal was es ihn kosten würde. Wenn es zu viele Feinde waren, würde es sonst Opfer geben. Ein unerträglicher Gedanke.
Also erst einmal fliehen, die Feinde abschütteln, und dann die Sippe warnen.
Artrús Herz raste, als er seinen Fall unterbrach und seitlich davonschoss. Wohin? Dort, die Schneekuppe. Dieser Berg war stark zerklüftet, bot zahlreiche Verstecke. Dies war sein Zuhause! Er kannte sich blind aus. Das war sein Vorteil. Er musste ihn nutzen. Artrú schlug Haken, als er die dunklen Gestalten über sich gewahrte.
Dort, ein Fels. Er erreichte ihn, konnte sich dahinter verbergen. Duckte sich nieder, schwer um Atem ringend, am ganzen Leib vor Anspannung bebend. Sieben Feinde zählte er, die sich fluchend nach ihm umblickten, auseinanderfächerten, um ihre Beute nicht entkommen zu lassen. Sie würden ihn schnell finden, der Fels war zu offensichtlich. Was wollten sie von ihm? Seine Gedanken rasten.
Es musste eine Vorhut sein. Ein Spähtrupp, der ihre Anzahl und Kampfstärke ausspionieren sollte. Ihn hatten sie als Zufallsopfer ergreifen wollen, um wertvolle Informationen zu erzwingen. Ja, so musste es sein.
Artrú presste die langen, scharfen Fingerkrallen in das Gestein. Er musste durchbrechen. Fliegen, so schnell wie er noch nie geflogen war. Zurück zur Sippe. Sie warnen, dass ein Angriff bevorstand. Der Spähtrupp würde noch keine Gefahr bieten, sie würden ihn nicht weiter verfolgen, wenn er es erst einmal in Rufweite geschafft hatte. Jetzt musste er einen rasanten Start schaffen und dabei den bestmöglichen Aufwind erwischen.
Salziger Schweiß auf seinen Lippen. Seine Muskeln spannten sich, waren bereit für ihre Aufgabe. Artrú durchdrang die Nacht, die für Sayihir-Augen keineswegs finster war. Er konnte es schaffen!
Mit diesem Gedanken stieß er sich ab, warf sich wie ein Raubtier in die Luft, katapultierte sich mit aller Macht voran. Seine Schwingen schmerzten, so rasch und gewaltsam riss er sie auseinander und schlug, schlug, schlug sie auf und nieder, verzweifelt wie nie zuvor in seinem Leben. Er musste es schaffen!
Brutal stieß er einen der Feinde aus der Flugbahn. Es kostete Kraft und wertvolle Zeit. Schneller, schneller, schneller! Sie hingen ihm an den Fersen. Er konnte sie spüren, wie ein Prickeln auf der Haut; das Rauschen ihrer Flügel dröhnte in seinen Ohren. Keine Rufe, keine Schreie. Sie setzten auf Heimlichkeit.
Noch fünfzig Flügelschläge, wenn ihn der Aufwind nicht im Stich ließ, denn er musste sich in die Höhe kämpfen. Noch fünfzig Schläge, dann müsste er in Hörweite sein. Nah genug für einen warnenden Schrei. Alles in ihm pulsierte. Seine Sippe, das war alles, was zählte. Nicht das Brennen der überlasteten Muskeln, nicht die Angst, die in den Knochen nistete.
Wütend streckte er sich, zwang sich, noch härter zu kämpfen. Nun zahlte sich jedes wilde Spiel mit seiner Schwester aus. Jedes Mal, wenn sie sich gegenseitig gejagt hatten. Ausgestreckten Händen ausgewichen waren, manchmal im letztmöglichen Moment. Das abrupte Fallenlassen, wenn der Häscher sich seiner Beute schon sicher wähnte. Gleich, gleich konnte er den Warnschrei riskieren, auch wenn ihn das in die Klauen der Feinde schleudern würde, weil er dafür unwillkürlich verlangsamen musste. Artrú holte tief Luft …
… Und verlor fast das Bewusstsein, als es einen harten Ruck gab, der ihm jeglichen Atem aus den Lungen presste. Trudelnd sackte er ab. Ein zweiter Ruck um seine Brust.
Ein ledernes Seil! Einer der Feinde hatte es zur Schlinge geknüpft und zielsicher nach ihm geworfen. Artrú kämpfte, riss an dem Seil, das ihm die Flügel abdrückte, versuchte sich zu befreien, zu entfliehen, den Schrei auszustoßen, gleichgültig wie weit er noch entfernt sein mochte.
Das konnte nicht das Ende sein! Unmöglich!
Er schlug und trat um sich, als er brutal hochgerissen wurde, Hände nach ihm griffen, ihn hart umklammerten. Doch seine Peiniger lachten bloß über seine Mühen und hatten ihn in Windeseile gefesselt und geknebelt. Kein Widerstand war mehr möglich. Artrú sackte schockiert in sich zusammen, als ihn diese Erkenntnis wie eine Gerölllawine traf.
„Ein schönes Exemplar!“, rief einer der Männer mit Gier in der Stimme. Mit beiden Händen tastete er über Artrús gesamten Leib, prüfte seine Muskeln, die Flügel, selbst das Gemächt sparte er nicht aus. Artrú schrie seinen Protest, seine Wut gegen den Knebel an. Hilflos. Wehrlos ausgeliefert. Was immer diese Kerle ihm antun wollten, er konnte sie nicht daran hindern.
„Der Herr wird entzückt sein. Ein strammes, junges Männchen, gesund, noch deutlich unter zwanzig Jahren.“ Während er sprach, legten die anderen Häscher Artrú weitere Fesseln an. Eine Schlinge aus rauhem Strick um den Hals, die sowohl mit seinen Hand- als auch Fußgelenken verbunden wurde. Jede ruckartige Bewegung seinerseits würde zu schweren Verletzungen und schlimmstenfalls zum Tod führen, sollte er sich dabei unglücklich die Kehle quetschen. Selbst wenn er nichts mehr weiter tat als zu atmen, ließen sich Abschürfungen nicht vermeiden. Diese elenden Schurken! Dass sie ihm zum Schluss auch noch die Fügel zusammenbanden, war unnötige Grausamkeit. Er konnte sich sowieso nicht mehr rühren, an Flucht war nicht zu denken.
Artrú schluchzte in den Knebel, das Einzige, was zu tun er jetzt noch in der Lage war. Er wollte sich nicht dergestalt vor den Feinden entehren; er wollte es wirklich nicht. Doch die zusammengekrümmte Haltung schmerzte unerträglich, atmen war eine schreckliche Quälerei, er hatte panische, unkontrollierbare Angst, hier einfach zu ersticken und er konnte darum nicht verhindern, dass er erbärmlich zitterte und weinte. Die Kerle kümmerte es nicht weiter, sie diskutierten irgendwas und hielten ihn dabei an zwei zusätzlichen Fesselschlaufen fest, die um seine Oberarme angebracht worden waren.
„Mutter!“, heulte Artrú, vom Knebel derartig gedämpft, dass er sich selbst nicht verstehen konnte. Er wollte, dass seine Mutter kam, den Feinden die Krallen durch die Gesichter zog und ihn zurück nach Hause brachte. Denn ja, er begriff nun, was hier geschah.
Das waren Sklavenfänger. Es konnte nichts anderes sein. Sayihiri, die wie er in Kindheit oder Jugend verschleppt wurden oder sogar in der Gefangenschaft geboren worden waren. Über Jahre hinweg wurden sie gebrochen, bis sie alles taten, was man ihnen befahl. Einschließlich der Entführung von anderen Kindern und Jugendlichen, um die Reihen der Sklaven weiter zu füllen. Er würde seine Sippe niemals wiedersehen. Nie mehr …
Das Brennen von verzweifelter Angst wütete in seiner Kehle, raubte ihm noch mehr den Atem, als der verfluchte Strick es bereits tat, der ihm in den Hals schnitt. Sie hatten sich sicher vor solchen Attacken gewähnt, waren immer weiter fort von den Gebieten der Flügellosen zurückgewichen, immer höher ins Gebirge hinaufgezogen. Großmutter Rutyia hatte mehr als einmal von den Sklavenhäschern erzählt, hatte in ihrer Kindheit miterleben müssen, wie zwei ihrer Schwestern geraubt wurden – man bevorzugte Mädchen, denn es war leichter, wenn neue Sklaven geboren wurden, als riskante Raubzüge zu unternehmen.
Sie hatten sich sicher gewähnt. Welch ein Glück, dass Großmutter Rutyia die Rückkehr der Häscher nicht mehr miterleben musste.
Seine Peiniger trugen ihn, je zwei hielten die Armschlaufen, die dergestalt angebracht waren, dass die Schlinge um seinen Hals nicht davon beeinflusst wurde. Er konnte dennoch kaum atmen. Seine Nase war vom Weinen zugeschwollen, verzweifelt rang er Luft durch das durchweichte Stück Stoff in seinem Mund. Lichter flammten vor seinen Augen auf. Ihm war entsetzlich übel, sein gesamter Körper brannte, das Herz donnerte in seiner Brust. Wie lange sollte er das durchhalten? Wie lange, bevor er sterben durfte?
Mit einem Mal gab es einen Ruck. Artrú stöhnte matt. Die Gruppe hatte angehalten, verbarg sich hinter einem Felsbrocken. Er wurde achtlos abgeworfen wie ein erlegter Springbock.
Besser. So konnte er leichter atmen. Die feuchte Kühle des Gesteins unter ihm fühlte sich tröstlich an. Zeit verstrich. Sein Herzschlag beruhigte sich etwas, das Rauschen in den Ohren ließ nach. Dann hörte er eine Stimme. Eine vertraute, hohe Stimme, die seinen Namen rief. Sessa! Ihr Götter, nein …
„Nun komm schon!“, rief sie. „Es ist zu spät für Spiele. Komm raus, du hast gewonnen. Vater ist wirklich ungehalten, dass du einfach weggeflogen bist!“
Neinneinneinneinnein! Sessa suchte ihn! Allein, wie es klang. Sie musste sofort fliehen! Ungeachtet aller Qualen richtete Artrú sich auf, brüllte gegen den Knebel an, um seine Schwester zu warnen. Er musste sie beschützen, dafür sorgen, dass wenigstens sie sicher nach Hause zurückkehren konnte. Musste sie beschützen …
Ein gnadenloser Tritt in den Bauch setzte seinen schwachen Mühen ein Ende. Die Häscher ließen ihn zurück, flogen auf. Artrú hörte die Schreie seiner Schwester. Viel zu rasch verstummten sie. Dann kehrten die Sklavenfänger zurück, widerlich lachend, hörbar zufrieden. Von Sessa war lediglich leises Stöhnen wahrzunehmen.
„Eine Nadjar-Tochter! Man wird unseren Herrn in Gold aufwiegen, sie ist unbezahlbar! Und noch so jung … Ihre Brut wird ebenfalls ein Vermögen wert sein.“
Tränenblind erhaschte Artrú einen Blick auf seine Schwester. Sie war weniger grausam gefesselt. Bei weiblichen Gefangenen war es womöglich wichtig, keine entstellenden Narben zu hinterlassen … Sessa konnte noch zappeln. Chancen auf Flucht blieben ihr dennoch keine.
Mit einem neuerlichen Ruck wurde Artrú in die Höhe gerissen. Sein eigenes schmerzliches Wimmern war nicht laut genug, um Sessas Schluchzen zu übertönen. Er betete zu sämtlichen Göttern. Bettelte um ein Gewitter. Um Blitze, die ihn und Sessa erschlugen und somit für ein rasches, gnädiges Ende sorgten. Die ihnen ersparten, was als Schicksal vor ihnen lag.
Doch die Götter erhörten ihn nicht.
Genauso wenig schickten sie ihm die Gnade einer Ohnmacht, um wenigstens für kurze Zeit Schmerz und Angst zu vergessen. Schmerz und Angst. Angst und Schmerz.
Durch finstere, sternenlose Nacht ging der Flug. Noch finsterer war es, was ihn und Sessa am Ende dieses Weges erwartete.
Eilunn betrat die widerlich stinkende Kaschemme. Kaum zu glauben, dass dies der richtige Ort sein sollte. Obwohl die Sonne erst vor drei Stunden aufgegangen war, trieben sich rund ein halbes Dutzend abgerissen aussehende Männer in den düsteren Ecken herum, tranken Bier und rauchten, dass die Schwaden den Raum erfüllten. Vermutlich waren sie noch von der letzten Nacht übrig. Nagiad gehörte zu den freien Städten, die sich dank ihrer herausragenden Position als wichtigste Hafenstadt im gesamten Nordwesten ohne Einmischung von Landesfürsten oder Königen selbst verwalten durfte. Lediglich Steuern mussten sie zahlen und mit ihren Schiffen die königliche Streitmacht unterstützen, sollte es zum Krieg gegen eine der Nachbarstaaten kommen. Ansonsten genossen sie vollkommene Freiheit. Das hatte zur Folge, dass es keine Sperrstunden in den Tavernen gab, wie es sonst überall im Reich üblich war.
Eilunn verachtete diese Art von Freizügigkeit. Es führte dazu, dass betrunkene Menschen zu allen Tages- und Nachtstunden bewusstlos auf der Straße lagen, inmitten ihres eigenen Erbrochenen, der Gnade und Willkür von Bettlern und Straßenräubern ausgeliefert. Es führte zu sinnloser Gewalt, diese Art von Selbstverwaltung. Was hatte sinnlose Gewalt mit Freiheit zu tun?
Auf der Vorteilsseite stand, dass man in Nagiad Waren erwerben konnte, die nirgends sonst erhältlich waren, aus den verschiedensten Gründen.
In den meisten Fällen waren sie verboten, und das strikt. Genau dies hatte Eilunn hergeführt, in diese abgerissene, stinkende, rauchschwadengeschwängerte Taverne. Dies war vermutlich der letzte Ort auf der gesamten Welt, an dem man einen Sayihir käuflich erwerben konnte.
Vor etwa fünf Jahren wurde der weit verbreitete Sklavenhandel mit diesen absonderlichen Kreaturen von König Mauretan IV. untersagt. Zunächst gab es das Dekret, das sämtliche Sklaven freizusetzen waren – da gab es die romantische Vorstellung, dass sie ohne zu zögern zu ihren Familien heimkehren und noch alle diejenigen mitnehmen würden, die in Gefangenschaft geboren worden waren. Sehr schnell musste man feststellen, dass nichts davon geschah. Vielleicht zwei Dutzend Jugendliche, die erst wenige Tage zuvor gefangen worden waren, hatten sich auf den Heimweg gemacht. Alle anderen blieben, wo sie waren und selbst auf direktem Befehl wollten sie nicht losfliegen. Es stellte sich heraus, dass sie zu tief verletzt waren, gebrochen durch massive Gewalt. Man hoffte, dass freundliche Zuwendung sie aus ihrer inneren Starre erwecken konnte, was tatsächlich gelang – und zu einer beispiellosen Serie von Selbstmorden führte. Offenkundig wollten die Sayihiri lieber sterben, als gebrochen und zerstört zu ihren Sippen heimzukehren, wo sie auf Hilfe angewiesen wären. Darum wurde der Erlass rasch abgeändert. Die noch vorhandenen Sklaven durften bei ihren Besitzern verbleiben beziehungsweise zu ihnen zurückkehren, mussten allerdings registriert werden. Die Entführung weiterer Jugendlicher aus Sayihiri-Kolonnien wurde unter Todesstrafe gestellt. Weibliche Sklaven zu Brutzwecken einzusetzen führte zur Enteignung der gesamten Familie des Täters sowie eines sehr grausamen Foltertodes. Wer Sayihiri-Frauen schwängerte, um Mischlinge zu provozieren – aus schwer nachvollziehbaren Gründen hatte es vor rund vierzig, fünfzig Jahren eine Welle solcher geschmacklosen Untaten gegeben – riskierte öffentliche Entmannung. Es ging das Gerücht, dass König Mauretans Frau, Königin Fara, selbst ein Mischling sein könnte und er deshalb mit solcher Vehemenz gegen die Sklaverei vorging. Sie war jedenfalls außergewöhnlich groß für eine Frau, sehr schmal, zugleich sehr stark, wenn man dem Geflüster der Dienerschaft Glauben schenken wollte.
Die außergewöhnliche Härte der Strafen hatte den Sklavenhandel vollständig zum Erliegen gebracht. Gut für die Sayihiri. Schlecht für viele andere, denn diese Sklaven hatten Höchstleistungen vollbracht. Ein einziger dieser Flügelmenschen besaß die Kraft von vier bärenstarken Männern. Sie hatten Steine und Bäume geschleppt, Brücken und andere Bauwerke errichtet, höchst gefährliche Aufgaben übernommen. Manchen hatte man gar die panische Angst vor engen unterirdischen Tunneln abtrainieren können, wodurch sie in Minen einsetzbar waren. All diese gefährlichen, anstrengenden Arbeiten mussten nun von Menschen übernommen werden, unterstützt von den sehr wenigen Sayihiri, die den Massenselbstmord überlebt hatten. Anfangs hatte es Proteste und Aufstände deswegen gegeben, die mit harter Hand eingedämmt worden waren. Inzwischen hatten sich die meisten daran gewöhnt, wie die neuen Zustände waren, und nahmen es hin. Irgendwann würden die letzten Sklaven sterben und dann vergaß man vermutlich, dass es dieses Volk von Flügelmenschen überhaupt jemals wirklich gegeben hatte, und nicht bloß eine Legende gewesen war. Ein Märchen, das man Kindern vor dem Einschlafen erzählte.
Für Eilunn war der Besuch dieser Kaschemme die letzte Hoffnung, einen Sklaven mitsamt den notwendigen gefälschten Papieren zu erwerben. Er brauchte einen Sayihir. Brauchte ihn ebenso dringend wie Luft zum Atmen. Sein gesamtes Schicksal hing davon ab, ob er heute ein gebrauchsfähiges Exemplar erwerben konnte. Dafür war er bereit, absurde Preise zu bezahlen. Er war bereit, beinahe alles zu tun.
Genau deshalb war es so wichtig, sich die Verzweiflung nicht anmerken zu lassen, die ihn beherrschte. Man musste ihn für einen unschlüssigen Kunden halten, der Überzeugung benötigte. Andernfalls würde er schlimmstenfalls morgen früh mit aufgeschnittener Kehle in irgendeiner stinkenden Gasse gefunden werden, ausgeraubt und angenagt von herrenlosen Kötern und Ratten. Seine Talente würden ihn davor nicht unbedingt bewahren. Gewöhnliche, niedere Gewalt konnte geradezu unglaublich effektiv sein.
Der Wirt, erkennbar an der schmierigen Schürze, blickte kaum auf, als Eilunn sich an einem Tisch in der hintersten Ecke niederließ. Ein Platz, von dem aus er jederzeit durch das Fenster in seinem Rücken fliehen konnte, sollte es notwendig sein. Erst nach mindestens einer Viertelstunde ließ sich der Kerl dazu herab, über klebrige Holzdielen und Bierlachen zu ihm herüberzustapfen. Er war fett, aufgedunsen und bleich wie eine Leiche, die sehr lange Zeit im Wasser verbracht hatte. Für das geschulte Auge war es leicht erkennbar, dass er abhängig von einem dämonischen Kraut namens Ebaz sein musste. Das ihm büschelweise die Haare einschließlich Wimpern und Augenbrauen ausfielen, war das stärkste Kennzeichen. Das würde erklären, dass er als Mittelsmann benannt worden war, um den illegalen Sklavenverkauf zu regeln. Ein Suchtkranker rief niemals die Stadtgarde, gleichgültig, was geschah.
„Wollt Ihr trinken, essen oder beides?“, knurrte er.
Allein der Gedanke, inmitten dieses Drecks etwas in den Mund zu nehmen! Eilunn mühte sich um einen gefühlsbefreiten Gesichtsausdruck.
„Ich hätte gerne Tee“, sagte er langsam und betont. „Tee mit Honig.“
Die dunklen Augen des Wirts leuchteten für einen Moment auf. Rasch musterte er Eilunn, schien ihn zu bewerten, zu richten. Welches Urteil er fällte, war schwer zu erkennen. Er blieb ruhig sitzen, brach für keinen einzigen Atemzug den Blickkontakt. Es war wichtig, dass er Stärke demonstrierte, das hatte ihm Vardis eingebläut. Sein Kontaktmann, von dem er für viel Geld die Adresse und die Passwörter gekauft hatte. Gleich würde sich zeigen, ob sich die Investition gelohnt hatte …
„Tee, der Herr“, sagte der Wirt und beugte sich etwas weiter zu ihm vor. Nah genug, dass eine Geruchswolke auf Eilunn niederging. Schales Bier, Zwiebeln, uralter Schweiß. Er hielt stand.
„Tee“, entgegnete er. „Mit Honig. Ich hab mich wohl …“ Er tippte sich mit dem Zeigefinger zweimal gegen die Nase, „… ein wenig verkühlt.“
Ein aufmerksamer Beobachter, ein Spitzel der Stadtgarde, könnte das Passwort erlauschen. Die Geste erkennen, mit der er sich gegen die Nase getippt hatte. Bemerken, wie er das letzte Wort gesondert betonte. Was ein solcher Spitzel nicht wissen konnte war, dass es auf das Wörtchen „wohl“ ankam. Während er das aussprach, berührte er mit der freien Hand sein rechtes Knie. Eine Bewegung, die nur der Wirt sehen konnte, da der Tisch sie verdeckte.
Momente verstrichen, in denen der feiste, grässliche Mann schwieg, ohne sich zu rühren. In Eilunn begann Angst zu kribbeln. Falls Vardis, dieser vornehme, steife Adelsspross ihn betrogen haben sollte …
Doch dann nickte der Wirt kaum merklich. „Erkältungen sind unangenehm. Ich nehme Euch mit in die Küche zu meinem Sohn. Dessen Eheweib versteht sich auf heilende Kräuter. Sie wird Euch einen feinen Tee zusammenbrauen, der Euch die Erkältung schneller austreibt, als Ihr es je erlebt habt.“ Er wies mit einladender Geste zur Durchgangstür, die vermutlich in die Küche führte. Eilunn folgte ihm. Seine Instinkte schrien, sich umzuwenden und zu rennen, so rasch er in der Lage wäre. Er traute diesem Mann nicht weiter, als er spucken konnte. Stattdessen schritt er gleichmäßig und ohne Hast hinter ihm her. Dies war seine einzige Chance, an einen Sayihir zu gelangen. Schlug es fehl, warum auch immer, machte es keinen Unterschied, sollte man ihn töten. Sein Leben hätte dann sowieso jeglichen Sinn verloren.
Keiner der Zecher reagierte auf ihn. Niemand schien auch nur zu bemerken, dass er durch die Tür zur Küche ging. Eilunn wappnete sich für noch mehr Gestand und Dreck, für vergammelte Lebensmittel, Ratten und Ungeziefer, das offen umherrannte. Stattdessen erwartete ihn ein sauber gefegter Steinboden, eine alte, zahnlose Frau, die in einem Kessel rührte, aus dem durchaus angenehme Gerüche nach einem Eintopf aufstiegen, ordentlich aufgereihte Bierfässer, ein Arbeitstisch, auf dem sich Gemüse stapelte, das zumindest noch halbwegs frisch zu sein schien.
„Mein Name ist Kjord“, sagte der Wirt und grinste, wobei er mehrere Zahnlücken offenbarte. „Vergebt den Drecksstall da hinten. Es hilft, die Stadtgarde fernzuhalten. Die denkt, dass hier nichts an Schutzgeldern zu holen sein kann, wenn alles möglichst verlottert aussieht. Die Küche betreten sie zum Glück nie. Ich weigere mich, inmitten von Ungeziefern zu essen. Die größte Schwierigkeit besteht darin, den Zechern schlechten Fraß zu servieren, der ihren Erwartungen entspricht. Ein anstrengendes Leben, mein Herr, anstrengend.“ Er strich sich über den fast kahlen Schädel. „Vorzutäuschen, ich wäre süchtig nach Ebaz, kostet mich einiges. Zugleich ist es lebensverlängernd.“ Mit eiligen Schritten verließ er die Küche durch eine Hintertür und führte Eilunn in einen engen gepflasterten Hof. „Ich war der führende Sklavenhändler im Reich. Es ist noch nicht genug Zeit verstrichen, als das die Leute das vergessen hätten. Naturgemäß habe ich mir damals Feinde geschaffen … Solange die glauben, dass ich schön langsam und qualvoll an meiner Sucht verrecke, versuchen sie nichts aus eigenem Antrieb, um mein Leben zu verkürzen.“ Es war beinahe anrührend, wie eifrig Kjord die Gelegenheit nutzte, über sein verändertes Dasein zu jammern. „Ich muss leider darauf achten, dass ich mich nicht mehr allzu lange halte, sonst schöpfen die Aasfresser Verdacht. Drei, vier Jahre kann ich mir allerdings noch vor meinem unzeitigen Ableben gönnen, denke ich.“ Lachend schob er Eilunn in einen wackligen, baufälligen Schuppen, in dem bis vor einiger Zeit anscheinend Hühner gehalten worden waren. Man sah noch die Hinterlassenschaften und Krallenspuren der Vögel sowie Überreste von Holzkäfigen. Spuren des typischen Geruchs hingen in der Luft.
„Hinten durchlaufen!“, kommandierte Kjord. „An der Wand schaut Ihr nach unten, dort findet Ihr eine Falltür. Steigt hinab und folgt dem Weg, er ist nicht lang. Ich hoffe, Ihr fürchtet Euch nicht vor engen, stockfinsteren Tunneln? Zum Glück seid Ihr ja nicht fett, das wird auf jeden Fall passen. Dieses lächerliche Versteckspiel ist notwendig, niemand darf sehen, wie Ihr das Gehöft meines Sohnes betretet. Leider sind unsere Nachbarn allesamt Spitzel der Stadtgarde. Diese Brut vertraut uns nicht und der Neid auf meine einstige Vorherrschaft stirbt wohl auch nie. Ich wünsche Euch einen erfolgreichen Handelsabschluss.“ Kjord warf die Tür des Hühnerstalls zu. Dämmriges Licht fiel durch Löcher im Gebälk und wies ihm den Weg zu der Falltür, die unter halb zerfallenem Flechtwerk, Seilen und sonstigem Schutt versteckt war. Eilunn war froh, dass er schäbige Kleidung angelegt hatte, um für Straßenräuber uninteressant zu bleiben. Er raffte seinen wollenen Mantel enger um sich, als er sah, wie eng der Einstieg war – gerade breit genug für eine schmale, schlecht gezimmerte Leiter. Seufzend vertraute er sein Gewicht diesem Gestell an, das unter ihm knarrte und ächzte, stieg in die kühle, feuchte Tiefe hinab. Die Luke zu schließen kostete ihn Überwindung. Er hasste es, durch die Finsternis irren zu müssen und schmale, niedrige Tunnel von zweifelhafter Stabilität trugen keineswegs zur Beruhigung seiner angespannten Nerven bei.
Doch bis hierher war es gut verlaufen. Wenn Kjord ihm nicht geglaubt hätte, dass er ein vertrauenswürdiger Kunde war, hätte er ihn in der Küche abzustechen versucht, statt ihm fröhlich von seinen Feinden zu erzählen, nicht wahr? Also schloss Eilunn die Luke. Diese Unannehmlichkeit war ein geringfügiger Preis. Er musste einen Sayihir haben! Dafür konnte er nun wirklich einige Schritte durch einen engen Schacht kriechen.
Kriechen traf es vollkommen, was ihm auf dem Weg zum ersehnten Ziel zugemutet wurde. Eilunn musste fast auf dem Bauch liegend die erste Strecke überwinden. Mindestens zwanzig Schritt ging es durch die stille, absolute Finsternis. Wäre er nur zwei Fingerbreit mächtiger in den Schultern, würde er steckenbleiben. Es roch allgegenwärtig nach Erde. Erde rieselte ihm in den Kragen seines Hemdes, Wurzelausläufer verfingen sich in seinem Haar. Atmen war schwierig. Eilunn hatte nicht gewusst, wie beklemmend es sein konnte, nichts als zwei Schritt festgestampfte Erde über sich zu wissen. Sollte sie einbrechen, würde man sich wohl kaum die Mühe machen, nach ihm zu suchen. Dann wäre dies sein Grab und Kjord müsste andere Wege finden, um vertrauenswürdige Kundschaft ungesehen auf das Gehöft seines Sohnes zu bringen, vorbei an den spitzelnden Nachbarn …
Ihr Götter, wie lang war dieser verfluchte Tunnel? Eilunn kroch hastiger voran. Was, wenn ihm die Luft ausgehen sollte? Was, wenn er auf die sterblichen Überreste eines anderen Kunden stieß, der steckengeblieben und erstickt oder verdurstet war? Seine Fantasie malte panische Schreckensbilder. Die Dunkelheit war die vollkommene Leinwand für solche Albträume, schon immer gewesen.
Es wurde erst besser, als der Tunnel sich zu verbreitern begann, höher wurde. Schließlich konnte er auf Händen und Knien vorwärts eilen, bis er irgendwann – ein Äon schien vergangen – an eine Wand stieß und in der Lage war, sich wieder aufzurichten. Auch hier gab es eine schlecht gezimmerte Holzleiter, die ihn in die Höhe führte. Sie endete an einer weiteren Luke. Einen weiteren panischen Moment lang fürchtete Eilunn, dass sie sich nicht öffnen lassen würde, denn sie klemmte. Doch mit ein wenig Gewalt gab sie nach und öffnete sich knarzend.
Staub rieselte ihm entgegen. Staub, Stroh, frische Luft und Licht. Licht! Eilunn trank Licht und Luft, genoss beides wie ein Verdurstender den ersten Schluck klares Quellwasser. Nichts wie raus aus diesem finsteren Grab! Er entstieg dem Tunnel und fand sich in einem weiteren abgewrackten Hühnerstall, diesmal allerdings mit lebenden Hühnern bestückt. In seiner unendlichen Erleichterung, wieder Tageslicht um sich zu haben, hatte er das vielkehlige Glucken und Gackern, Glucksen und Kollern, das langgezogene Ooorgh, das Scharren, Rascheln und Picken nicht wahrgenommen. Rasch verließ er den Stall, um die Hennen nicht beim Brüten zu stören und am Ende noch von ihnen angegriffen zu werden. Ein wenig entnervt war er schon nach dieser Tortur. Das musste er niederkämpfen. Herr der Lage bleiben. Sein Überleben konnte davon abhängen. Gerade weil er in dieser Stadt nicht zu seinen Talenten greifen konnte, ohne sich dadurch in größte Gefahr zu begeben. Das fiel ihm schwer, musste er zugeben, anderseits war es auch eine Herausforderung.
Er fand sich auf einem grasbewachsenen Innenhof wieder. Gänse, Hühner und sogar einige Schafe tummelten sich hier, um zu weiden. Gebäude umgaben diesen Hof von allen Seiten. Die Fassaden wirkten schlecht gepflegt, waren jedoch in weitaus besserem Zustand als Kjords Taverne. Ein kleiner Junge hockte im Gras, anscheinend dafür verantwortlich, dass keines der Tiere entwischte oder gestohlen wurde. Er blinzelte Eilunn träge entgegen. Das sandblonde Haar hing in unordentlichen Strähnen um den Kopf des Kleinen, ähnlich wie die armselige Kleidung um seinen mageren Körper schlotterte.
„Hey“, sagte Eilunn freundlich. „Ist dein Vater da? Der Herr des Hauses?“
Der Junge starrte ihn bloß an, als wären die Worte in einer für ihn fremden Sprache gesprochen worden. Dann stand er auf und schritt langsam auf das Haus zu. Eilunn wollte ihm folgen, doch mehrere Gänse zischten ihn erbost an und ließen ihn in Richtung Hühnerstall zurückweichen. Dort blieb er stehen und wartete geduldig. Er nutzte die Zeit, sich gründlich abzuklopfen, Erde aus Haaren und Bart zu wischen, seine Hände mit Wasser aus einem Steintrog zu reinigen.
Als der Junge in Begleitung eines Mannes zurückkehrte, fühlte Eilunn sich fast schon wieder wohl in seiner Haut. Erstaunlich jung war er, sein Geschäftspartner. Sicherlich noch vier, fünf Jahre jünger als er selbst, und er war Anfang dreißig. Sein Haar war ebenso sandblond wie das des Jungen, was eher untypisch für die Menschen dieser Gegend war – die meisten besaßen dunklere Körperfarben. Auch er war hager, sein Vollbart struppig, die Kleidung ärmlich.
Jetzt, da Eilunn wusste, dass dies ein Possenspiel war, das Kjord betrieb, um die Garde wie auch seine alten Feinde zu täuschen, kam es ihm lächerlich vor. Wer einen solch großen Gebäudekomplex mit Ställen sein eigen nennen konnte, mit einer solch großen Anzahl von Nutztieren, der nagte ganz gewiss nicht am Hungertuch. Doch wer war er, über seine Geschäftspartner zu urteilen?
„Möge Ro Euch leuchten“, sagte er respektvoll und neigte den Kopf.
„Und Euch“, entgegnete der junge Mann. „Ich bin Torald, Kjords Sohn. Er hat mir eine Nachricht geschickt bezüglich Eurer Wünsche nach … Tee. Also, kommt mit.“ Abschätzig wanderte sein Blick über Eilunns Gestalt. Was er sah, schien ihm nicht zu gefallen, urteilte man danach, wie er den Mund verzog. Er gefiel Eilunn auch nicht allzu sehr. Ein arroganter Mickerling, der sich für ewas Besseres hielt, obwohl er in Sack und Asche einherging, um in Ruhe seine illegalen Geschäfte betreiben zu können. Eilunn verkniff sich jegliche Regung. Immerhin lief er auch in schlechter Kleidung umher, um einem illegalen Geschäft nachzukommen. Dass er sich deswegen nicht für großartig hielt, musste man ihm nicht zwangsläufig als Tugend auslegen …
Er folgte Torald ins Haus. Eine unterernährt wirkende Frau saß in der Stube auf einem Schemel, wo sie Bohnen abfädelte. Sie war sehr schwanger, ihr kugelrund geschwollender Leib bereitete ihr sichtlich Beschwerden. Geradezu grau wirkte sie, das Gesicht war eingefallen, das lange braune Haar hing kraftlos über ihre Schultern. Der graue Kittel, den sie trug, verstärkte den Eindruck von kränklicher Schwäche. Sicherlich war sie noch sehr jung, aber ihr Alter ließ sich nicht schätzen. Neben ihr kauerte ein kleines Mädchen, das noch Windeln trug. Der Junge war draußen geblieben, wohl um dort weiter auf die Tiere aufzupassen.
„Meine Frau“, sagte Torald in einem Tonfall, als würde er sich für den Kadaver einer toten Ratte in der Ecke entschuldigen. „Elsa, koch Tee. Mein Gast ist durstig.“
Sie duckte sich auf eine Weise, als würde sie Schläge erwarten und sprang sofort auf, um dem Befehl nachzukommen. Eilunns Meinung über diesen Mann sank in unterirdische Tiefen. Auch davon ließ er sich nichts anmerken. Er wollte ein Geschäft abschließen, keinen neuen Freund gewinnen. Die Frau tat ihm leid. Das Mädchen war seiner Mutter gefolgt, auch sie war zu dünn und viel zu still für ein solch kleines Kind.
„Weiber brauchen eine feste Hand, sonst tanzen sie einem nur auf der Nase herum, nicht wahr?“ Torald grinste widerlich und schien auch noch eine Antwort zu erwarten, so wie er ihn anschaute.
„Ich wüsste es nicht zu sagen“, entgegnete Eilunn vorsichtig. „Für das Wagnis, zu heiraten und eine Familie zu gründen, war ich nie tapfer genug und zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt.“
„Welch ein Jammer, Ihr versäumt was. Aber Ihr seid ja noch kein Greis, es ist sicherlich kein Fehler, später anzufangen, als ich es getan habe.“ Torald führte ihn in eine Treppenstiege und dort hinauf, in ein enges Zimmer, das mit schweren, dunklen Möbeln ausgestattet war.
„Mein Arbeitszimmer. Hier redet es sich unbeschwerter“, sagte er mit sichtlichem Stolz. Eilunn sah nicht viel, was solchen Stolz rechtfertigte. Ihm wurde stetig unwohler zumute.
„Habt Ihr viele Sayihiri in Eurem Besitz?“, platzte es unbeherrscht aus ihm heraus.
„Ihr mögt wohl kein Vorspiel? Kein Wunder, dass Ihr keine Frau habt.“ Torald lachte über seinen eigenen erbärmlichen Witz und schlug sich auf den Oberschenkel. Eilunn quetschte sich mühsam ein halbes Grinsen heraus. Das hier war anstrengender als befürchtet.
Elsa kam die Treppe herauf und stellte ihnen zwei dampfende Holzbecher auf den Tisch. Sie wich mit gesenktem Kopf zwei Schritte zurück, wartete anscheinend auf weitere Anweisungen.
„Verschwinde“, knurrte Torald, was sie offenkundig erleichtert befolgte. „Taugt vom Aussehen nicht viel, aber ihr Kräutertee ist recht gut. Kochen kann sie auch, und sie wirft fleißig Bälger ab. Ich denke, ich habe es gut getroffen. Schöne Weiber, die nicht kochen können, wären mir ein Graus.“
„Schönheit ist vergänglich“, erwiderte Eilunn schmallippig.
„So ist es. Erzählt mir etwas, werter Herr. Warum wollt Ihr einen Sayihir?“
Auf diese Frage war Eilunn gut vorbereitet. Er erzählte von seinem Elternhaus, reiche, hoch gestellte Bürger.
„Mein Vater ist Leibarzt beim Fürst von Ressakil, meine Mutter Apothekaria. Sie hatten immer Sayihiri auf ihrem Anwesen, nie weniger als ein halbes Dutzend. Gerade meine Mutter glaubte fest daran, dass ihnen die Rudelhaltung guttut. Die Sklaven lebten im Freien, innerhalb einer riesigen Käfigkonstruktion aus Stahl, die Unsummen in der Herstellung kostete. Innerhalb des Käfigs gab es einen Felsen mit Sitzhöhlen, in dem sie Zuflucht finden konnten, wenn es zu stark regnete. Sie mussten nicht hart arbeiten. Stattdessen nutzte mein Vater die rasche Regeneration der Sayihiri, um Wundversorgungstechniken zu erproben, während meine Mutter es höchst entspannend fand, die Sklaven zu den Klängen einer Harfe in der Luft tanzen zu lassen. Sie bevorzugte stets männliche Exemplare, was meinem Vater soweit recht war. Es hat ihnen beiden das Herz gebrochen, als sie ihre Sklaven abgeben mussten, sobald das Gesetz verordnet wurde. Als hochgestellte Persönlichkeiten wagten sie auch nicht, die Sache herauszuzögern. Als sie erfuhren, dass die sieben Männchen geschlossen Selbstmord begangen hatten, hat meine Mutter geweint. Ich habe sie nie zuvor weinen gesehen, Torald. Ich will den Sklaven für sie kaufen. Es soll auf den Dokumenten alles tadellos sein. Es soll so aussehen, als hätte ich einen Sayihir übernommen, den mir ein Freund vererbt hat. Solch einen Sklaven darf ich ohne Schwierigkeiten an meine Eltern weitergeben, ich müsste es nur bei Einreise in die Stadt der Garde melden.“
„Als Sohn solch hochgestellter Persönlichkeiten verfügt Ihr, wie ich vermute, über die notwendigen Mittel? Ihr müsst verstehen, der Verkauf eines Sayihir ist kostspielig. Die Dokumente anzupassen erhöht den Preis“, sagte Torald. Seine Augen glänzten in unverhohlener Gier, die Geschichte hatte ihn überzeugt. An ihr hatte Eilunn lange gefeilt, sich genau überlegt, welche Details er hinzufügen musste, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Solche Dinge liebte er sehr. Er griff in die verborgene Innentasche seines Mantels und zog ein Päckchen heraus.
„Das sollte die Kosten für ein junges, gesundes Männchen decken“, sagte er nachlässig. „Es war bereits immens teuer, hierherzufinden, Meister Torald. Die Gemeinschaft der Sklavenbesitzer und -händler ist klein und hält zusammen.“
„So sind die Zeiten, mein Herr, so sind die Zeiten“, murmelte Torald, der eifrig damit beschäftigt war, das Päckchen zu entfalten. Darin befanden sich Smaragde von außergewöhnlicher Reinheit und Qualität. Ein Vermögen, hoch genug, um die halbe Stadt kaufen zu können. „Ah, mein Herz!“, rief der widerwärtige Kerl, riss ein Sehglas aus seinem Gürtel hervor und trat ans Fenster, um die Edelsteine zu prüfen. „Wunderschöne Ware“, sagte er, nachdem er sich ausgiebig mit ihnen beschäftigt hatte. „Und ja, unsere Gemeinschaft ist eng. Wir müssen es sein, Neulinge werden nur sehr zögerlich eingelassen. Verrat ist die ständige Bedrohung, die über unseren Köpfen schwebt. Verrat würde für uns alle den Untergang bedeuten. Es hilft, dass zu unserer Gemeinschaft in erster Linie Adlige und reiche Bürger gehören. Menschen, die es sich leisten können, einen Sklaven zu besitzen. Es mag sein, dass uns das dennoch nicht retten wird. Mag sein, dass wir allesamt hingerichtet werden. Bis dahin werden wir sehen, wie wir vorankommen … Meine Sklaven sind offiziell als herrenlos gemeldet. Vorgeblich führe ich einen Gnadenhof für sie. Kaufe ich Sayihiri, dann sagen die Dokumente, ich hätte ein weiteres herrenloses Exemplar aufgenommen. Verkaufe ich, schreibe ich nieder, dass der Besitzer gekommen ist und seinen Anspruch nachweisen konnte. Natürlich benötige ich Hilfe von der Stadtverwaltung. Darum ist es auch sehr kostspielig, bei mir zu kaufen, denn jeder von uns will überleben … Und ich habe eine Menge Mäuler, die gestopft werden müssen.“
„Ihr braucht Euch nicht zu rechtfertigen, mein lieber Torald. Ich brenne darauf, die Sklaven zu begutachten.“
„Dann auf! Ich will Euch nicht länger hinhalten, verehrter … ach, ich habe Euren Namen vergessen.“ Er grinste verschlagen, während Eilunn sich um einen irritierten Gesichtsausdruck bemühte.
„Ich war vielleicht zu leise, als ich mich draußen vor dem Haus mit Floreán Natescor, jüngerer Sohn des Hauses Natescor, Stammlinie derer von Ressakil vorstellte?“, fragte er unterkühlt. Torald zeigte sich beeindruckt, obwohl er es sichtlich zu verbergen versuchte. Ressakil war über tausend Meilen von hier entfernt. Da es selbst Eilunns Fürsprecher nicht gelungen war, die Fälschung, den dreisten Betrug zu durchschauen, fühlte er sich unbesorgt, dass es einem Dumpfschädel wie Torald gelingen würde.
„Nun denn! Ich habe wohl genug von Eurer Zeit verschwendet, mein lieber Floreán. Ich darf Euch beim Vornamen nennen?“
„Ich bitte darum. Wir sind schließlich unter Freunden.“ Eilunn jubilierte innerlich, als es endlich wieder die Treppe hinabging. Die Frau war mitsamt ihrer Tochter verschwunden. Umso besser für sie … Torald führte ihn durch eine andere Tür ins Freie als zuvor. Und dann …
… Da waren sie.
Sayihiri.
Ein Dutzend männliche Exemplare, kein einziges Weibchen. Das war zu erwarten gewesen. Natürlich wurde weiterhin illegale Brut betrieben. In sehr viel geringerem Maße als zuvor, ohne jeden Zweifel; doch Eilunn war sich sicher, dass keine weibliche Sklavin länger als einen halben Tag in diesem engen, kargen Innenhof ausharren musste.