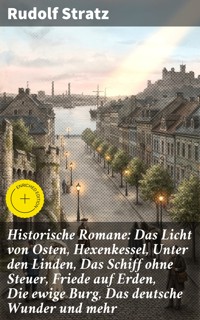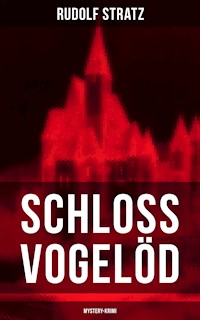
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Rudolf Stratz' 'Schloss Vogelöd' ist ein fesselnder Mystery-Krimi, der in einem düsteren Schloss voller Geheimnisse und unerklärlichen Ereignissen spielt. Der Autor verwendet eine präzise und detaillierte Sprache, die die Leser in die düstere Atmosphäre des Schlosses eintauchen lässt. Der Roman ist ein Paradebeispiel für die Gothic-Fiktion des späten 19. Jahrhunderts, die mit ihren mysteriösen Elementen und unheimlichen Stimmungen die Leser fasziniert. Stratz' geschicktes Erzählen und seine unheimlichen Beschreibungen machen 'Schloss Vogelöd' zu einem fesselnden Leseerlebnis. Rudolf Stratz, ein bekannter deutscher Autor des fin de siècle, war bekannt für seine Werke im Bereich der Mystery- und Kriminalliteratur. Sein Interesse an unheimlichen Themen und seinen literarischen Fähigkeiten führte ihn dazu, 'Schloss Vogelöd' zu schreiben, ein Werk, das bis heute Leser aus aller Welt fasziniert. 'Schloss Vogelöd' ist ein Muss für jeden Liebhaber von Mystery- und Kriminalliteratur. Stratz' meisterhaftes Spiel mit Spannung und Geheimnissen wird selbst den anspruchsvollsten Leser begeistern. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Sorgfältig ausgewählte unvergessliche Zitate heben Momente literarischer Brillanz hervor. - Interaktive Fußnoten erklären ungewöhnliche Referenzen, historische Anspielungen und veraltete Ausdrücke für eine mühelose, besser informierte Lektüre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Schloss Vogelöd
Inhaltsverzeichnis
Vorwort des Herausgebers, des Justizrats und Rechtsanwalts Dr. von Lechner in München
Wenn ich in dem Nachfolgenden den Schleier von den jetzt längst dem Gedächtnis der Lebenden entschwundenen, seltsamen und furchtbaren Ereignissen ziehe, deren Schauplatz um die Mitte des vorigen Jahrhunderts in den Oktobertagen des Jahres 1850 das Schloß Vogelöd im Bayrischen Hochland gewesen ist, so erfülle ich damit nur meine Pflicht als Testamentsvollstrecker gemäß dem mir seinerzeit persönlich eingehändigten, gesetzlich einwandfreien letzten Willen des am 22. August 1907, versehen mit den Tröstungen der hl. Kirche, im hohen Alter von siebenundachtzig Jahren in Meran verstorbenen hochwohlgeborenen Herrn, des K. Kämmerers und Rittmeisters a. D., Schloßgut- und Brauereibesitzers Leopold Salvator von Vogelschrey auf Vogelöd. Die diesbezügliche Stelle in seinem Testament, Abschnitt III, zweiter Absatz, Linea 4 und folgende, lautet wörtlich:
»Des Menschen Leben, heißt es in der Schrift, währet siebzig Jahre. So möge nach siebzig Jahren, 1920, das Geheimnis von Vogelöd, von 1850, gelüftet werden, über das sich damals die Menschen jahrzehntelang umsonst den Kopf zerbrachen. Denn wir wenigen, die darum wußten, haben seinerzeit, sofort nach dem Abschluß der Tragödie, auf die Hostie geschworen, das Geheimnis, so lange einer von uns noch leben würde, nicht über die Lippen zu bringen. Ich bin der letzte Überlebende. Nahe an Neunzig. Meine Tage sind gezählt. Kraft dieses Rechtes des Einsamen gebe ich es dem Jahre 1920 anheim, die Geister von 1850 noch einmal zu rufen und, so Gott will, dann zur ewigen Ruhe zu bringen.«
Im Sinne dieser Verfügung des Verstorbenen und im Einverständnis mit den Erben und Rechtsnachfolgern des verewigten Herrn Rittmeisters wurden in meiner, des Justizrats, und eines Vertreters des Nachlaßgerichtes Gegenwart, in Wahrung des § 2197 ff. BGB. die Siegel von einem Pergamentumschlag gelöst, der ein dickes, verschnürtes Pack von Aufzeichnungen in verschiedenen Handschriften, Papierformaten und Tintenfarben enthielt. Diese Aufzeichnungen waren von dem Herrn Erblasser sorgfältig geordnet und durchlaufend mit Rotstiftzahlen numeriert und gelangen, nach seinem Willen, hier genau in derselben Reihenfolge, unverkürzt und unverändert, zum Abdruck.
I Einleitende Bemerkungen nach Sammlung und Abschluß der Aufzeichnungen aller Beteiligten durch mich, Leopold Salvator von Vogelschrey auf Vogelöd, zu Ende des Jahres des Heils 1853
Wie und warum gerade ich, vor nunmehr drei Jahren, dazu berufen war, Zeuge all des Unerhörten und Ungewöhnlichen unter meinem Dache zu sein, das ist Gott dem Herrn allein bekannt. Denn weder ich noch meine liebe Frau Centa haben irgend etwas Ungewöhnliches an uns oder möchten etwas Unerhörtes erleben. Wir sind Menschen wie andere, in festem Glauben an unsere christlich-katholische Kirche, und, dank der Gnade Gottes, in glücklichen äußeren Lebensumständen, beide jung und gesund, ich damals vor drei Jahren dreißig, meine Eheliebste fünfundzwanzig Jahre alt, mit drei blühenden Kindern und mit ansehnlichem irdischem Gut. Nichtsdestoweniger berief uns der Wille der Vorsehung, ohne unser Wissen und, wenn wir es hätten vorausahnen können, sicher wider unseren Wunsch, zu dem Los, in unserem Schlosse Vogelöd die ungläubigen und ratlosen Zuschauer unerklärlicher Vorgänge zwischen unseren Gästen zu werden, die, auf das Recht der Freundschaft und Verwandtschaft pochend, ihre finsteren Geheimnisse in unsere friedliche Berg- und Waldwelt trugen.
Ich und die Meinen sind an allem, was geschah, völlig unbeteiligt. Unsere Hände und Herzen sind rein. Nur der Schreck zittert noch im Herzen nach und bebt in der Hand, mit der ich das schreibe. Ich bin kein Schreibkünstler. Ich halte lieber die Zügel oder die Jagdbüchse oder auch, in Mußestunden, den Malpinsel als die Feder. Ich habe mich daher nicht getraut, alles, was geschah, allein zu Papier zu bringen. Es könnten zuviel menschliche Irrtümer mit unterlaufen. Denn ich war natürlich nicht bei allem selber dabei. Da habe ich mit meiner lieben Frau und auch mit dem hochwürdigen Herrn Nepomuk Thurmbichler, Pfarrer in Vogelöd, beraten, und wir haben geglaubt: Es ist am besten, wir bitten jeden, der in den schwarzen Oktobertagen vor drei Jahren Augen- oder Ohrenzeuge von wichtigen Vorkommnissen gewesen ist, es uns einfach und schlicht aufzuschreiben, was er gesehen und gehört hat. Stellt man sotane Aidemémoires richtig nebeneinander, so muß doch ein klares Gesamtbild der Vorgänge herauskommen, geradeso wie, nach den Worten unseres verehrten Herrn Landrichters Ritter von Söller, durch eine Reihe von Zeugenaussagen vor Gericht die Wahrheit. Die Beteiligten haben sich denn auch ohne Ausnahme auf meine Bitte bereit gefunden, mir ihre Beobachtungen schwarz auf weiß, so gut es eben ein jeder konnte, zur Verfügung zu stellen. Ich, der Rittmeister von Vogelschrey, habe das Ganze zeitlich geordnet und, als Schloßherr von Vogelöd, durch meine eigenen Erfahrungen und Erlebnisse ergänzt.
So ist dieser wahrheitsgetreue Gesamtbericht entstanden, für den ich die Verantwortung trage. Als Erstem unter den vielen, die etwas zu sagen haben, gebe ich nun meinem Freunde Franz, Kunstmaler aus München, das Wort.
II Bericht des Kunstmalers Franz Salvermoser, 32 Jahre alt, katholisch, ledig, in München
Es gedenkt mir noch wie heute. Es war ein schöner, heller Oktobervormittag in München. So recht ein gutes Licht zum Malen, und ich hab' in meinem Atelier gestanden und mir eins gepfiffen und mein Porträt nur so heruntergestrichen. Langweilig war's schon. Rein ums Geld! Die dicke Frau von einem Großhändler! Überraschung zu seinem Namenstag! Man hat bald die Augen vor Speck nicht in dem Gefries gesehen! Ich war froh, wie die fade Nocken die Treppe herunter war, und hab' ihr nachgerufen: »Also bildsauber wird's, gnä' Frau. Da derfen's sich frei' drauf verlassen!«
Und zugleich bringt mir der Postbote einen Brief mit einem großen, rotpetschierten Wappen: Ein Vogel auf dem Zweig! Da hab' ich gleich einen Luftsprung getan vor Freud'! Denn ich habe den Brief kaum aufzumachen brauchen, um zu wissen: das ist meine Einladung zur Hirschbrunst nach Vogelöd!
Der Herr Rittmeister von Vogelschrey hat während seiner Kommandierung nach München in seiner dienstfreien Zeit fleißig gemalt. Wir haben uns damals oft in der Akademie getroffen. Später ist er mit seiner Staffelei zu mir in mein Atelier übergesiedelt, und ich hab' ihm die Perspektive korrigiert und ihm jeden Tag gesagt, daß er ein Patzer ist, und so sind wir gute Freunde geworden. Das geht in München schneller als da oben bei den steifen Preußen. Aber hauptsächlich sind wir auch Jagdfreunde gewesen. Denn das darf ich schon sagen: Mit dem Kugelstutzen steh' ich meinen Mann.
Ich also in heller Freude meiner Haushälterin, der Frau Duschl, gerufen: »Frau Duschl! Richten's die G'nagelten und die gamsledernen Buxen! Und kommen's mir fei' net übern Weg, wann i weggeh! Ein altes Weib bringt Unglück!«
Richtig: wie ich auf und davon will, steht doch die Duschl gerad' vor mir mitten im dunklen Korridor, das hat mich schon gegiftet. Draußen im Hellen, auf der Treppe, habe ich den Brief vom Herrn Rittmeister noch einmal gelesen, und da bin ich erschrocken. Denn da war noch ein Nachsatz, der mir in meiner Freude entgangen war: »Tu mir den Freundschaftsdienst, Franzl, und wasch' nicht erst Deine Pinsel aus und trödel' herum, wie's Deine Art ist, sondern komm auf der Stelle! Es bereitet sich hier im Schloß Vogelöd etwas Unheimliches vor. Ich brauche vernünftige Leute um mich, die mir zur Seite stehen, wenn's not tut! ...«
Ein gutes Stück bin ich mit der Bahn gefahren. Dann im Stellwagen bis Höhenleiten. Dort hat das Jagdzeugl vom Rittmeister schon gewartet, und aufwärts ist es gegangen in unsere lieben bayrischen Berge hinein, und ich hab' von München ab dagesessen, mit der Büchse zwischen den Knien, und war ganz damisch im Kopf bei dem Gedanken: Herrgott Sakra! Was geht denn nur in dem Vogelöd vor?
Dunkel war's schon fast, wie ich in den Schloßhof eingefahren bin. Der Haushofmeister, der Herr Rubesoier, hat mir aus dem Wagerl geholfen und gesagt: »Die Herren sind alle noch bei Tisch, nach der Jagd!« und die großen Fenster des Speisesaales waren verhängt, aber hell erleuchtet, und von innen hat man lautes Lachen und Lärmen gehört, daß ich mir ganz beruhigt gedacht hab': Na, Franzl! In 'nem Geisterschloß bist du noch net!
Wie ich mich sauber hergerichtet hab' und in den Saal hineingekommen bin, da war er ganz voll von Jagdherren. Ihre Zigarren haben's geraucht und Wein dazu getrunken, und die Luft war blau von Rauch, mit goldigen Kerzenlichtern dazwischen, verschleiert und verschwimmend, wie man's als Maler gern hat.
Meine Hauptleidenschaft im Leben sind die Köpf'! Die Köpf'! Die Menschenköpfe! Dafür bin ich Porträtmaler. Die Menschenköpfe, die einem was sagen, nicht so ein Münchener Vollmond, den man halt fürs liebe Geld mit Seufzen auf die Nachwelt bringt. In solche Köpfe kann ich mich gleich verlieben! Und solch ein Kopf war da am anderen Ende der Tafel! Beileib' nicht ein Kopf von einem Madel oder überhaupt von einer Eva, sondern von einem Mann in der zweiten Hälfte der Dreißig.
Er war mehr als mittelgroß und hager und sehnig, recht von edler Rasse. Sein Gesicht: Im ersten Augenblick denke ich: das ist ein großer Schauspieler, trotz dem langen, wilden, rotblonden Schnurrbart. Aber das ist der allererste Eindruck gewesen. Gleich darauf kommt mir der Gedanke: Halt! Der Don Quichotte! Es war so etwas Abenteuerliches in den großen, graublauen Augen und im Schwung der gebogenen, verwegen vorspringenden Nase. Und hinterher berichtigte ich mich wieder: Nein, der ist mehr! Der ist kein Narr! Der hält eher die anderen zum Narren! Da brauchte man nur auf das rätselhafte Zucken um die Mundwinkel zu achten, während er sprach und alles um ihn horchte. Die übrigen lachten, und sein längliches, gebräuntes Gesicht blieb dabei tief ernst, und in dem Blick war etwas Visionäres, als hörte er sich selber gar nicht zu, sondern sei dabei mit seinen Gedanken ganz wo anders! Und mit düsteren Gedanken: Es waren da so Schattenstriche, von den Nasenflügeln am Wangenabsatz herunter. Derlei sieht nur der Maler.
Dabei hat er aber eine unerschütterliche Kaltblütigkeit an sich gehabt, wie er das Dutzend Herren am Tisch mit seinen metallischen Augen fixiert hat, so wie die Ringelnatter einen Frosch, den sie verschlucken will, so daß das grüne Vieh gerad' nur noch still dahockt und wartet. Ich hab' in den Gesichtern von den andern deutlich eine unwillkürliche Abwehr gelesen, bei manchem geradezu ein heimliches Grauen. Es war wie drei Schritte unsichtbarer, leerer Raum um den Cortez oder Pizarro oder so einen Flibustier oben am Tisch. Den hätte man als Hidalgo in altspanischer Tracht malen sollen, in Schlapphut mit roter Stoßfeder, und mit blankem Stoßdegen. Das wär' so ein Fressen für meinen Pinsel gewesen. Ich hab' mich leise unten am Tisch hingesetzt, um nicht zu stören, und höre, wie der Fremde oben ganz erstaunt sagt und sich dabei mit seinen langen, dünnen Mephistofingern eine kostbare Wappennadel in der Halsbinde zurechtschiebt:
»Warum soll ich denn nicht zweitausend Jahre alt sein? Das ist doch kein Alter für einen kräftigen Mann! Wie, Herr Landrichter: Sterben? Sterben ist eine europäische Einbildung! In Indien ist man längst darüber hinaus. Wenn es dort einem zu langweilig auf der Welt wird, hält er den Atem an, nach der heiligen Regel: ›hum‹, und läßt sich auf einem gefunden Fleck Erde begraben und kommt nach ein paar Menschenaltern wieder heraus. Ich hab' das selber öfters gemacht.«
»War er denn überhaupt jemals in Indien?« frug ein Herr in meiner Nähe seinen Nachbar, und der sagte:
»Wo war er denn nicht?«
Und oben meinte einer zu dem abenteuerlichen Mann, der mir jetzt wieder dahergeschaut hat wie der Fliegende Holländer: »Dann müßtest du doch mit deinen eigenen Vorfahren verkehrt haben!«
»Die bin ich doch selber!« sagt der oben mit dem Ernst eines Geistersehers und dabei mit dem rätselhaften Zug unter dem Schnurrbart, den ich, glaub' ich, allein als Maler von allen bemerkt hab'! Denn in dem Zug war nicht nur Spott, sondern zugleich auch tiefer Gram, ganz wie aus einer zerrissenen Seele. »Es gibt überhaupt nur einen einzigen Menschen,« fuhr er fort, »der zieht sich verschiedene Kleider an und spielt verschiedene Schicksale, so wie ein Schauspieler. Aber er ist doch jeden Abend hintereinander derselbe Kerl!«
»Du hättest selber Schauspieler werden sollen!« rief einer.
»Er ist es ja 'mal gewesen – damals – gleich wie sie ihn aus der Pagerie 'rausgetan haben!«
»Das ist zwanzig Jahr' her, daß das irgendeinem Lausbub passiert ist!« sagte der mir Unbekannte und lachte. »Das war schon wieder ein anderer Mensch als ich jetzt!«
»Ich denke, es gibt bloß einen einzigen Menschen, Johann Preisgott?«
Die Augen von dem, den sie Johann Preisgott nannten, wurden sonderbar schleierhaft und dabei doch so eindringlich, daß sie keinen am Tisch aus ihrem Bann ließen.
»Das ist ja das Geheimnis aller Dinge,« sagte er leise, so daß auch die Diener unwillkürlich mit angehaltenem Atem auf den Fußspitzen gingen, »daß die Menschen ineinanderfließen und sich teilen und wieder zu eins werden, und daß es kein Ich gibt, sondern viele Ich, und daß es gut ist, wenn man 'mal in dem einen, 'mal in dem andern Ich lebt, je nachdem der Wind bläst, und sich doch aller Seelen bewußt ist!«
»Er wird immer närrischer!« meinte der Herr neben mir und trank bekümmert sein Glas Rotwein aus. Der oben sagte:
»In den Kämpfen der Spanier neulich gegen die Rifkabylen bei Tetuan, an denen ich mich aus Langeweile beteiligte, stand gerade im kritischen Augenblick mein Ahne Ottokar vor mir, der kurz vorher, im sechzehnten Jahrhundert, in der Schlacht an dem ganz nahen Judenfluß, als Führer der deutschen Landsknechte dem Untergang des Königs Sebastian und des ganzen portugiesischen Adels in der Verkleidung eines damaligen Wunderscheichs entronnen war. Ich verschmolz mit ihm und erreichte im weißen Burnus und grüngestreiften Turban eines Nachkommen Mohammeds unangefochten mitten durch die Marokkaner hindurch das Kap Negro!«
»Dös san Sprüch'!«
»Nein. Nein. Es ist was wahres an der Geschichte!« murmelte einer der Jagdgäste. »Ich hab' es auch von anderer Seite gehört!«
»In den Karlistenkriegen zum Beispiel,« sprach der fahrende Ritter oben am Tisch weiter, sich eine Zigarre anzündend, »war es für mich einmal von rechtem Nutzen, daß ich zu gelegener Zeit die Gestalt meines Vorfahren Johannes Beatus annahm, der nach abenteuerlichen Fahrten in Westindien unter Karl V. spanischer Mönch in Saragossa wurde. In seiner Kutte kam ich unangefochten durch die feindlichen Linien, obwohl ich sonst, wie du weißt, Leopold Salvator,« – er wandte sich an den Hausherrn – »die Pfaffen bis in den Tod nicht leiden kann! Mir graut's – ich lauf' aus dem Zimmer, wenn ich nur so einen schwarzen oder braunen Hochwürdigen seh'!«
»Dabei heißt deine riesige Schloßherrschaft auch noch Pfaffenrod!« rief einer und zuckte gleich hinterher zusammen, als hätte er eine Unvorsichtigkeit gesagt. Zugleich lief ein lähmendes Schweigen über die Tafel. Auf allen Gesichtern lag ein sonderbarer, stummer, gedrückter Schrecken. Reden wollte keiner. Merkwürdig: auch der kaltblütige, mit den anderen wie der Kater mit der Maus spielende Unbekannte dort oben war einen Augenblick geisterbleich geworden. Sein scharfgeschnittenes Antlitz mit dem langwehenden Schnurrbart und der gebieterischen Nase veränderte sich. Jetzt hätte man ihm glauben können, daß er schon ein paar tausend Jahre auf dem Buckel hatte. Er sah eine Sekunde ganz alt aus, verfallen, vergrämt – ein Ahasver, das wandernde böse Gewissen. Dann meinte er, plötzlich wieder ganz gemütlich, und nun merkte ich an einer Bewegung der Nasenflügel ganz deutlich, daß er sich jetzt über seine Zuhörer lustig machte:
»Wir in Europa sind halt Barbaren! Wir wissen nichts von der Kunst, die Seelen zu vertauschen und in andere Hüllen von Menschenleibern zu kriechen ...«
»Johann... jetzt sei schon stad!«
»... und aus Menschen-Tiergestalt anzunehmen und wieder zurück und durch alle Kreise der Weltspiegelung zu schweifen ...«
»Ach geh...«
»Jetzt wird's mir zu hoch!«
»Ja, was wißt ihr von Indien und der Seelenwanderung? Ihr schießt einen Gamsbock über den Haufen und denkt gar nicht daran, daß das euer eigener Großpapa ist! In Ägypten haben die Menschen auf den Tempelbildern Tierköpfe und die Vögel Menschenköpfe, und der Mistkäfer ist die Sonne in der Hieroglyphe Ra, und alles ist eins, wie sich's gehört, und auf den Mumiendeckeln halte ich den Lebensschlüssel in der Hand.« Wie er dabei mystisch die Linke auf die Brust legte, lief sein Gesichtsausdruck jäh ein halbes Dutzend Jahrtausende rückwärts, wurde geheimnisvoll wissend, feierlich starr wie aus ferner Pharaonenzeit, und ich dachte mir: Ui Jegerl, den malen! Der ist ja jeden Augenblick ein anderer! Da kommt keine Hand und kein Pinsel mit! Da tät' ich mir schon leichter eine Handvoll Flöh' festzuhalten als das Mienenspiel!
Ich konnt' meine Neugier nicht mehr zähmen und frug leise den Herrn neben mir, wer denn der rätselhafte Mann da oben wäre, und der war ganz erstaunt, daß ich das nicht wußte, und antwortete:
»Das is doch der Johann Oetsch!«
Jetzt war ich bald gerade so klug wie vorher. Es klang mir nur so etwas im Ohr nach ... Oetsch ... Oetsch ... eine sonderbare Geschichte ... vor ein paar Jahren ... In den Zeitungen hatte immer was davon gestanden. Aber ich lese die Zeitungen nur, wenn ich gar nix sonst zu tun hab', manchmal wochenlang nicht. Mein Nachbar sagte:
»Er ist einer unserer größten Grundherren im Land. Er hat das ungeheure Fideikommiß Pfaffenrod.«
Von gegenüber ergänzte ein anderer von den vornehmen Jagdherren: »Er hat's vor drei Jahren geerbt!«
»Von seinem Vater?«
Da war ein langes, sonderbares, mir unbegreifliches Schweigen. Dann meinte der Baron oder was er war, drüben kurz: »Nein. Von seinem älteren Bruder. Dem Grafen Peter-Paul. Der hinterließ nur eine junge Witwe mit einem nicht zur Erbfolge im Fideikommiß berechtigten Töchterchen ...«
»... und der Graf Peter-Paul hat also schon in jüngeren Jahren sterben müssen?«
»Er wurde im Park mit einer Schußwunde im Kopf tot aufgefunden!« sagte mein Nachbar kaum hörbar. »Eine abgefeuerte alte Reiterpistole lag neben ihm.«
Es war ein Schweigen. Ich merkte leicht, daß die Leute um mich herum viel mehr wußten und dachten, als sie mir, dem Fremden, dem Kunstmaler aus München, sagen wollten. Aber ganz konnten sie's doch nicht bei sich behalten. Es drückte etwas auf ihnen. Es lastete etwas über der ganzen Tafel, so laut die Herren auch lachten und sich Jagdgeschichten erzählten und fleißig Rotwein dazu tranken. Das unheimliche Gefühl ging von dem Platz oben am Tisch aus, wo der Graf Johann Preisgott von Oetsch saß und plötzlich mit seinem sonnenverbrannten verwegenen Abenteurerkopf genau wie ein oberbayrischer Wildschütz dareinsah und eben sagte:
»Das ganze Geheimnis ist ja nur, zu wissen, daß man gestorben ist. Dann lebt man. Ich hab' einmal in Ceylon ...«
»War denn der selige Bruder, der Graf Peter-Paul, auch solch ein wundersamer Herr?« erkundigte ich mich und fröstelte förmlich in dem endlosen, bleiernen Schweigen, das meinen Worten folgte. Endlich brach der dicke Baron die Stille.
»Ein Heiliger war er!« sprach er mit einem sonderbaren Nachdruck. »Ich hab' ihn von Kind auf gekannt!«
»Ein Heiliger, wie er im Buch steht!« bestätigte ein anderer, beinahe flüsternd. Plötzlich mehrten sich um mich die unterdrückten, verhaltenen, gedämpften Stimmen.
»Ein Wohltäter der Armen!«
»Seinen Leuten ein reiner Vater!«
»Im ganzen Land bekannt. So einen findet man nicht wieder. Tageweit sind die Leute zu vielen Hunderten zu den heiligen Seelenmessen gekommen!«
»So ein frommer Christ. Solch ein Freund der Klöster. Jedes Jahr war er in Rom!«
»Bei ihm gab's ein für allemal keine Anzeigen wegen Holzfrevels und Früchtediebstahls! Er hat einmal selber einem alten Weiblein das gestohlene Reisig aus seinem Wald bis zu ihrer Hütte getragen!«
»Jeden Tag haben er und seine Frau selbst am Schloßtor die Suppe an die Armen ausgeteilt.«
»In glücklichster, allerglücklichster Ehe hat er gelebt!«
»So selig waren die beiden zusammen ...«
»Wenn er das geahnt hätte, daß seine Frau und sein Mädi, die er auf den Händen getragen hat, mit leeren Taschen von dem Besitz herunter mußten ...«
Mir drehte sich der Kopf. Ich hub an:
»Jetzt muß ich aber doch 'mal ganz dumm fragen: Wenn das so ist, dann ... dann ...«
»Reden's schon, Herr Kunstmaler ...« »Drucken's net!«
»... dann kann er doch nicht gut selbst Hand an sich ...«
»Ja – wer hat denn das behauptet?« sagte der Herr mir gegenüber. Auf einmal wurde alles um mich so still, daß man deutlich von oben vom Tisch her die Stimme des Erben, des jetzigen Fideikommißherrn auf Pfaffenrod, des abenteuerlichen Grafen Johann Preisgott von Oetsch, hörte. Der redete jetzt, die Zigarre schief unter dem langen Schnurrbart im Mund, die Hände in den Taschen, im breitesten, gemütlichsten Bayrisch gleich einem Holzhacker und schien ein Alltagsmensch wie irgendein anderer.
»Mei' Lieber – da bist gestimmt! Auf solcher 'ne Entfernung mußt du mit der Kugel pfei'grad Fleck halten ... beim Gamsbock ... bei demselbigen auf der Schnee-Alp! Nacher feit si nix!«
Ich dachte mir als Maler: Wenn ich jetzt mein Skizzenbüchl vorziehen dürft'! Die Mienen um mich ... alle so düster ... so verlegen ... so ungewiß ... Keiner sagt was ... und wann die Lippen stad sind, dann reden die Augen ... die verstehen sich bei dem allen ... schauderhaft ist's ... Ich frug: »hat man denn die näheren Umstände des Todes nicht gleich untersucht?«
»Schon! Aber g'funden haben's nix, die Behörden!«
»Rein gar nix!«
»Schließlich haben's das Verfahren eingestellt, weil's keinen Angeklagten haben ermitteln können.«
Jetzt bin ich wieder eine Weile dagesessen und hab' ein recht dummes Gesicht gemacht. Um mich hat die Luft gesungen und geklungen von allerhand, was keine Menschenseele hat mit einem Sterbenswörtchen andeuten wollen. Schließlich hab' ich mir ein Herz gefaßt und zu Ende gefragt: »Was ist denn aus der Witwe geworden?«
»Sie hat jetzt, vor einem Jahr wieder geheiratet. Sie mußte ja wohl. Sie hat ja nichts, außer ihrem Leben!«
»Also sag' halt schon: Eine Vernunftehe!«
»Und vier Wochen nach der Hochzeit legt sich ihr Töchterchen erster Ehe an der Bräune hin und stirbt in vierundzwanzig Stunden!«
»Die arme Frau!«
»Ja. Der liebe Gott straft sie schon hart!«
»Lebt sie hier im Lande?«
»Sie lebt nicht nur hier im Land, Herr Kunstmaler!« sagte der dicke Baron neben mir mit einem kurzen Atem der Beklemmung, und es schien mir auf einmal, als holten auch die anderen umher vor Aufregung nur mühsam Luft. »Sie wird hier erwartet! Sie ist in einer Stunde mit ihrem zweiten Mann hier im Schloß!«
»... und sie und ihr Schwager, der Johann Preisgott Oetsch, sehen sich zum erstenmal wieder seit dem Tode ihres ersten Mannes!«
»Am Abend vorher war der Johann Preisgott, ihr Schwager, damals noch mit ihrem Mann zusammen und hatte mit seinem älteren Bruder einen heftigen Auftritt ...«
»... wegen Geldangelegenheiten ...«
»Alles kann der Johann Preisgott, wenn man ihn hört! Bloß nicht das Geld in der Tasche behalten!«
»Immer stak er in Schulden!«
»Na ... jetzt ist er draus heraus ... seit er Pfaffenrod hat!«
Das alles, was da zuletzt gesprochen wurde, war gewiß nicht für meine Ohren bestimmt, sondern von den andern hastig, als ob sie's nicht mehr in sich bewahren könnten, einander in die Ohren geraunt, in dem Geräusch und Gescharre, mit dem alle von der Tafel aufstanden und die Stühle zurückschoben. Aber ich hab' ein Gehör wie ein Schießhund! Mir ist kaum ein Wort von den furchtbaren Andeutungen entgangen, und es ist mir eine Gänsehaut über den Rücken gelaufen. Es wurde mir jetzt klar, daß der Graf Oetsch da oben von all den andern eigentlich in ihrem Innern wegen eines düsteren Verdachtes, der auf ihm lastete, halb verfemt und geächtet war, und daß dabei doch keiner den Mut hatte, das offen auszusprechen, was er so wenig wie das Gericht beweisen konnte, und daß vielmehr der eine Mann mit seinen hypnotisierenden, bläulich-grauen Pupillen die ganze Gesellschaft im Bann seines Willens hielt. Er stand jetzt einsam und allein mitten im Saal, das hagere, entschlossene Gesicht kaltblütig gegen die andern gewandt, so wie ein Bändiger im Raubtierkäfig sich den Rücken deckt und im Spiel jeder Muskelfaser zeigt, daß er der Stärkere ist. Der ganze Mann bestand aus Muskeln und Sehnen. Die spannten sich für ein Auge, das den menschlichen Körper kennt, plastisch unter den Kleidern. Aber mehr noch bestand er aus Nerven. Das konnte man nicht sehen. Das mußte man fühlen. Während wir alle in die großen Nebenräume gingen, frug ich:
»Ist der Herr Graf denn verheiratet?«
»Der Johann Preisgott? Den kann ich mir beim besten Willen nicht als Ehekrüppel denken!«
»Sie – lassen's das den Oetsch nicht hören, daß Sie meinen, er könnt' eine Frau haben! Das hält er für eine Beleidigung und fordert Sie!«
»Frauen – ja! Aber eine Frau – da wär' es bei dem gefehlt!«
Die Herren lachten. Einer sagte ernster:
»Er dürft' sich schon daranhalten! Eigentlich ist er doch der Letzte des Geschlechts!«
»Ein einziger entfernter Vetter lebt noch! Aber der ist Mönch!«
»Der Pater Faramund, vom Orden der Kreuzträger von Golgatha!«
»Ist das der italienische Orden?« erkundigte sich einer von den Herren.
»Ja. Der Pater Faramund lebt ständig in Rom!«
»Ich habe ihn selbst dort heuer zu Ostern gesprochen, als ich mit dem Pilgerzug zu dem Heiligen Vater kam!« bemerkte ein stattlicher weißbärtiger Herr, der mir als Graf Franz Assisi von Meerwarth bezeichnet wurde.
»Diesen Herbst sollte er in Ordensangelegenheiten nach Deutschland kommen!« sagte einer, und der Graf meinte: »Ist schon da, der Pater Faramund. Gar nicht weit von hier. Im Kloster Maria Stern. Auf dem Weg dorthin hab' ich ihn vor vierzehn Tagen noch in München beim Erzbischof begrüßt und ihm meine Verehrung und meinen Dank ausgedrückt. Er war uns Pilgern in Rom in vieler Hinsicht behilflich!«
»Das hab' ich schon gehört, daß du dir in Rom vom Pater Faramund deine sündige Seele hast ausputzen lassen!« sagte der Graf Johann Preisgott Oetsch, der plötzlich neben uns stand, und lachte. »Du – da hat der Gottesmann wohl geschwitzt – was?«
»Wende du dich nur auch an ihn! Tät bei dir vielleicht gerade not!«
»Ich kann die Brillenträger in Weiberröcken nicht riechen!« meinte der wilde Graf, ohne bei der Anspielung mit der Wimper zu zucken. »Ich lass' sonst den Teufel auf die Saufeder laufen, aber bei dem Geraschel von Priesterröcken und dem Weihrauchdunst, da schau' ich, daß ich aus dem Zimmer komm', und wenn es mein hochwürdiger Herr Vetter selber ist!«
»Er hat es auch noch vor zwei Wochen in München wieder in seiner milden Gelehrtenart mir gegenüber herzlich bedauert,« sagte der alte Franz Assisi Meerwarth, »daß du voriges Jahr bei unserer zufälligen Begegnung in Rom, auf der Tiberbrücke vor dem Borgo, vor ihm Reißaus genommen hast, als wäre er der Antichrist selber!«
»Vor jedem Pfaffen!« sprach der Graf Oetsch grimmig, aber leichthin, zwei Reihen weißer Raubtierzähne unter dem langen Schnurrbart zeigend, und ging auf langen, wiegenden Beinen hinüber zum Ecktisch, wo die Schnapsflaschen standen. Ich hab' ihm mit dem Interesse des Künstlers nachgeblickt und halb für mich gemeint: »Einen Charakterkopf hat er schon auf den Schultern sitzen!«
»Er ist überhaupt ein ungewöhnlicher Mensch, wie oft bei ausgehenden alten Geschlechtern!« versetzte der greise Graf Meerwarth und schnaufte. »Die Kerzen flackern ja auch immer noch einmal hell auf, ehe sie verlöschen!«
Während er so spricht, legt mir einer die Hand auf die Schultern, und ich erkenne unsern lieben Hausherrn und meinen Münchener Maler-Spezl, den Rittmeister von Vogelschrey. Er hat mich unter den Arm genommen und beiseite geführt, durch ein paar menschenleere Räume bis in ein kleines, gemütliches Wohnzimmer. Da war auch seine Frau. Und wie ich die beiden lieben Menschen so blaß und aufgeregt hab' vor mir stehen sehen, da haben sie mir recht herzlich leid getan. Denn die haben gewiß noch nie in ihrem Leben jemanden gekränkt. Ich hab' sie ja oft, wenn ich auf dem Schloß war, mit Kohle skizziert und gemalt. Das waren zwei Gesichter wie ein Glas Wasser, durchsichtig und klar bis auf den Grund der Seele. Ihm, dem Leopold Salvator von Vogelschrey, hat man so in Zivil den Rittmeister nicht angesehen. Er hat nichts Kriegerisches an sich gehabt. Liebe Zeit ja: Es war ja auch seit bald vierzig Jahren tiefster Frieden, und er hat auch immer schon davon geredet, daß er noch heuer sich abdanken lassen und auf Vogelöd ganz seinen Passionen leben wollte.
Passionen hat er drei gehabt. Zuallererst seine Familie. Das glaub' ich gern, wenn man so eine Frau Gemahlin hat wie die Frau Centa von Vogelschrey. Ich wüßte wenig Leute auf der Welt zu nennen, die so lieb und freundlich dahergeschaut haben und zu jedermann gut gewesen sind wie die Dame. Sie hat mit ihren unschuldigen braunen Rehaugen wie ein junges Mädchen ausgesehen, und dabei hat eben die Bonne die drei Kinder zum Gutenachtkuß hereingebracht: den Bubi, den Ältesten, die Burgel und das Peperl, das auf seinen Strampelbeinchen noch nicht ganz taktfest war, und das die Bonne auf dem Arm getragen hat.
Die zweite Passion des Herrn von Vogelschrey war die Malerei. Er hatte auch so ein weiches Künstlergesicht mit kurzgeschnittenem braunem Vollbart und dem Zwicker vor den versonnenen dunklen Augen. So recht die vornehme, still in sich gekehrte bayrische Art. In der Ecke am Nordfenster stand die Staffelei, an der er und seine Frau, die Katzel, wie er sie nannte, den Tag über einträchtig beieinander gehockt waren und fleißig wie die Bienen ihr Allianzwappen für die Schloßkapelle auf Glas gepinselt hatten.
Die dritte Passion – ja – der Herr Rittmeister hat mir und allen geschworen, daß außer ihm kein Menschenauge diese Aufzeichnungen lesen wird, ehe man nicht das Jahr 1920 schreibt. Bis dahin sind fast siebzig Jahre vergangen, und Gott der Allmächtige hat mit uns und unsern Kindern und vielleicht schon unsern Kindeskindern abgerechnet, und wir, die jetzt leben, haben längst unsern Frieden, und keiner denkt mehr an uns.
Also kann ich's schon sagen. Denn ich hab' es dem Herrn von Vogelschrey oft selber ins Gesicht gesagt: »Leopold – du bist ein seelenguter Kerl! Bloß bei deiner dritten Passion, bei der Jagdleidenschaft, da hat dir der Herrgott ein schwarzes Tupferl aufgemalt. Da bist du – verzeih mir's – halt ein bissel schußneidisch! Deine besten Hirsche und stärksten Gamsböcke tätest du dem König selber nicht gönnen und noch weniger deinen Jagdgästen. Du hast sogar deinem Jagdpersonal verboten, zu verraten, in welchem Revier sie stehen! Ja – und nachher? Dann kommen die Wilderer, so wie jetzt seit ein paar Wochen der verflixte Filzenschuster, der wieder sein Unwesen in der Gegend treibt, und knallen dir die Kapitalviecher nachts weg, und du darfst dir das Maul wischen. Sixt, Freunderl: Das ist die Strafe!«
Die Kinder waren weg, und der Rittmeister ist kopfschüttelnd im Zimmer auf und ab gegangen, und die gnädige Frau Centa ist recht nervös im Fauteuil daneben gesessen, und schließlich ist er stehen geblieben und hat zu mir gesagt: »Um Jesu willen, Franzl, ich hab' eine Bitte: Tu mir den Liebesdienst und schau, daß du mir den Oetsch aus dem Schloß bringst! Gleich! In einer Stunde ist's zu spät!«
Ich war erstaunt. »Wie kann ich denn das? Ich kenn' ihn ja gar nicht!«
»Macht nix! Der Oetsch ist ein leidenschaftlicher Jäger. Deswegen ist er ja seit vierzehn Tagen hier und hilft mir die sakrischen Wilderer abfangen, vor denen sich meine ganze Jägerei fürchtet. Zwei hat er schon ins Gefängnis geliefert – die beiden schlimmen Rambacherbuben von der Einöde Almosen! Beim Aufbrechen einer Gams hat er sie oben im Gebirg in den Latschen von hinten mit einem Tigersatz überrascht und wie die Kälber mit vorgehaltenem Gewehr vor sich her ins Tal getrieben! Er wird auch noch mit dem Filzenschuster selber fertig, der schon zwei Morde auf dem Gewissen hat! Der Oetsch hat den Teufel im Leib – wenn er nicht der Teufel selber in Person ist, wie die Katzel immer meint. Die ganzen Nächte und den halben Tag ist er draußen in den Bergen!«
»Ja – was soll denn aber ich ...«
Der gute Herr von Vogelschrey tat einen tiefen Atemzug. Leicht kam es ihm nicht an, wie er gottergeben sprach: »Alsdann ... Ich will ein übriges tun und dem Oetsch mein stolzestes Stück im Revier opfern! Du kennst den Schwarzen!«
Ob ich ihn kannte! Den ganz dunkelgefärbten Sechzehn-Ender! Das Herz war mir vor Andacht stillgestanden, wie ich den das erstemal im Morgengrauen zu Holz ziehend geschaut hab'. Auf den Finger krumm machen ... Ui Jegerl ... Jetzt war ich bald selber neidisch auf den Glückspilz, den Grafen Oetsch!
»Du weißt, Franzi, wo der Schwarze steht! Der Wechsel ist noch derselbe! Sechs Stunden Aufstieg von hier! Bei dem Windbruch im Hochwald an der End' der Welt-Leiten!«
Das war wirklich das Ende der Welt: ein Chaos von übereinandergestürzten, hundertjährigen Stämmen, die niemand zu Tal schaffen konnte. Denn überall fielen die kahlen Granitwände Hunderte von Fuß tief in den düsteren Bergkessel des Ödsees ab.
»Außer dir, Franzl, und mir kennt nur noch mein Büchsenspanner, der Anderl, genau die Stelle für den Anstand!«
»Warum schickst du nicht den Gschwendtner-Anderl?«
»Der haßt den Oetsch, weil der Oetsch immer allein in die Berge geht und die Wilderer am Zipfel kriegt und meine Leute beschämt! Der Anderl führt mir den Oetsch bloß in die Irre und vergrämt ihm den Schwarzen! Nein, Franzl, du mußt den Oetsch zum Schuß bringen! Es ist heller Vollmond. Wenn ihr euch gleich aufmacht, seid ihr noch vor Tagesanbruch an Ort und Stelle!«
Dabei schaute der Rittmeister auf die Uhr und drängte, als sollte ich nur gleich den Rucksack umhängen und los. Ich sagte: »Is schon recht! Wenn der Herr Graf halt durchaus fort soll ...«
»Er muß fort!« Der Rittmeister schlang ganz bang und unruhig die Hände ineinander, und die liebe, kleine Frau Centa sprang auf, und ihr Gesichtel war bleich, und sie wiederholte:
»Er muß fort! In der nächsten halben Stunde!«
»Um neun Uhr kommt seine verwitwete Schwägerin, die jetzige Baronin Safferstätt, mit ihrem Mann! Sie und der Oetsch dürfen sich nicht treffen!«
»Sie dürfen nicht!« rief die Frau Centa von Vogelschrey verzweifelt.
»Ja weißt, Leopold Salvator – dann hätt' ich sie auch nicht gerade jetzt eingeladen!«
»Hab' ich sie denn eingeladen?« frug der Rittmeister gleich dagegen. »Nein, mein Lieber! Das hab' ich nicht! Ihr erster Mann, der Graf Peter-Paul Oetsch, war mein Freund. Ich hab' ihn verehrt, wie alle Welt! Durch den ist man selber ein besserer Mensch geworden, wenn man hat mit ihm verkehren dürfen. Das war kein Mensch wie du da, der Salvermoser, oder ich, der Vogelschrey, sondern schon auf Erden halb im Himmel. Da hängt sein Bild!«
Ähnlich dem Oetsch, in dem dunklen Trauerrahmen, mit den großen, graublauen Augen und der großen Nase, aber mit einem langwallenden, rötlich-blonden Bart. Der Apostelkopf eines angehenden Vierzigers. Eine Reinheit auf der hohen Stirn. Etwas von feierlicher Güte über die Züge ausgegossen. Ein Licht von reinem Menschentum um das Haupt. Mein erster Gedanke war: Der hat sicherlich nicht selber Hand an sich gelegt. Der gewiß nicht. So schauen die Heiligen aus! Ich hatt' ja auch gehört, daß die Leute von weit und breit jetzt noch, nach drei Jahren, sein Grab in Pfaffenrod immer mit frischen Blumen schmücken.
»Jetzt krieg' ich gestern mittag einen Brief von seiner Witwe, der armen Mette,« fuhr der Rittmeister fort. »Nur ein paar Zeilen an mich und meine Frau: ›Ich komme morgen abend um neun Uhr mit meinem Mann zu Euch nach Vogelöd. Bitte gewährt mir für ein paar Tage Gastfreundschaft. Den Grund meines Besuchs sage ich Euch, wenn ich da bin‹.«
»Und du hast ihr nicht mehr abschreiben können?«
»Wohin denn? Der Brief war von unterwegs, aus Wolfratshausen, datiert. Dort hat sie keine Wohnung. Und sogar wenn ich ihre Adresse gewußt hätte – das kann ich ihr nicht antun, sie hier nicht aufzunehmen! Die arme junge Frau ist seit dem Tod ihres ersten Mannes ja ganz gebrochen ...«
»... und ihr einziges Kind vor nicht einem Jahr gestorben!« schaltete Frau Centa ein.
»... und nach einem Mann wie dem Peter-Paul Oetsch, einem Mann, wie er alle Jahrhunderte einmal vorkommt, ihren Jetzigen! Ich will ja nix gegen den guten Gaudenz Safferstätt sagen ...«
»Man kann nichts gegen ihn sagen und nichts für ihn!« bestätigte kopfschüttelnd die kleine Frau Centa.
»Denn er ist eben selber nichts! Wenn du so recht einen Dutzendmenschen malen willst, Franzl – dann schau dir den an! Da hast ihn! Nicht gut und nicht böse! Nicht klug und nicht dumm! Halt gar nichts als reich! Deswegen hat sie ihn genommen, weil sie halt selber keinen Kreuzer besitzt. Eine Freud' ist so eine zweite Vernunftehe für die arme Frau weiß Gott nicht!«
»Sie schaut ja auch immer blaß und elend aus!« sprach die Frau vom Hause sanft und mitleidig.
»Wenn sie ankommt und hört, daß der Johann Preisgott Oetsch, ihr ehemaliger Schwager, da ist, dann reist sie von selber so bald wie möglich wieder ab. Es handelt sich nur darum, den Johann Preisgott für diesen Abend bis zum nächsten Vormittag aus dem Hause zu bringen, damit sich die beiden nicht begegnen!«
»Ach – es wär' schrecklich!« klagte die gnädige Frau Centa und schaute wieder nach der Wanduhr. Der Zeiger rückte gerade mit einem Ruck vor. Es schlug mit einem tiefen Gedröhne halb neun und brummte noch eine Zeitlang im Zimmer nach. Aus der Ferne, durch zwei Türen, hörte man das Gelächter der Jagdgäste.
»Noch eine halbe Stunde!« flüsterte die Frau von Vogelschrey. Ihr Mann sagte erschöpft:
»Seit gestern mittag red' ich auf den Johann Preisgott ein, er soll mir doch den einzigen Gefallen tun und weggehen. Er sagte hartnäckig: Nein! Er bleibt! Wegen ihm könne die Mette kommen!«
»Und wenn sie ihn plötzlich vor sich sieht ...!« Die Frau von Vogelschrey zerzupfte das Spitzentuch vor Aufregung zwischen den Kinderfingern und hatte bange, nasse, große Augen.
»Ich will jetzt dem Johann Preisgott noch einmal zusprechen!« sagte der Hausherr. »Verrückt und unberechenbar ist er ja und spielt gern mit den Menschen. Er ist ein Spieler und ein Schauspieler. Vielleicht gibt er im letzten Augenblick nach! Meine letzte Lockspeise ist der Schwarze in der End' der Welt-Leiten! Hoffentlich hilft's, und du mußt ihn führen!«
Er faßte bittend meine beiden Hände und sagte weiter: »Zu dir wird der Oetsch Zutrauen haben, Franzl!«
»Er kennt mich ja gar nicht!«
»Gerade darum! Du bist nicht aus seinen Kreisen. Er weiß ganz genau, was die hinter seinem Rücken reden. Er tut nur so herausfordernd, als ginge es ihn nichts an. Mit Absicht, wie es seine Natur ist. Er läßt doch keinen Menschen über sich kommen. Du, Freund Franzl, ahnst gottlob von den düsteren Geschichten nichts ...«
»Doch! Ich hab' bei Tisch genug gehört, um mir mein Sprüchel für den Rest selber zu machen!«
Da haben die beiden Gatten einen stummen Blick miteinander ausgetauscht. Keiner von uns dreien hat mehr ein Sterbenswort gesprochen. An der Wand hing das Bild des Grafen Peter-Paul mit seinem Christuskopf. Ich bin doch als Kunstmaler so in Leinwand und Farben vernarrt, daß ich mir als einbilde, die Gemälde, in denen man etwas vom Geist eines Menschen festgehalten hat, die wären dadurch ein Stück von ihm selber geworden und hätten ihr inneres Leben und könnten die Augen bewegen und die Lippen öffnen, wenn man scharf hinsieht. Und ich hab' das Bild des Grafen Peter-Paul Oetsch unverwandt angeschaut und mir gedacht: Du allein weißt, wer dich umgebracht hat! Du allein! Sonst keiner. So red' doch! Deine Lippen zucken ja schon. Ich sehe es deutlich unter dem Bart an den Mundwinkeln! ... Schrei es doch heraus, wenn es wahr ist! Schrei es den Menschen in die Ohren: Kain! Kain! ... Mein Bruder Kain ...
In diesem Augenblick steht ein langer, hagerer, straffer Schatten in der Türe, und wie ich hinschau', ist's der Graf Johann Preisgott Oetsch, und er kommt nachlässig und ungezwungen näher, mit einem leichtsinnigen Lächeln, und geht an dem Bild seines toten Bruders vorbei und sieht es gleichgültig an, oder eigentlich darüber hin, ganz seelenlos, als wäre da nichts, was ihn irgendwie berühren könne, und mir ist kalt ums Herz geworden, und ich hab' nicht gewußt, was ich dazu sagen soll. Der Graf Oetsch hat aber gemütlich gelacht, wie wenn er zu kleinen Kindern spräche: »Ja – was macht's ihr denn da herum? Warum versteckt's euch denn vor euren Gästen?« und dabei mit der Gelenkigkeit eines altfranzösischen Kavaliers das Knie gebeugt und der Hausfrau den graziös gerundeten Arm geboten: »Bitt' schön! Eure Gäste schicken mich! Laß uns nicht allein!« Und es lag solch eine schmeichelnde Willenskraft in seinem Wesen, daß die Katzel wahrhaftig folgsam mit ihm in den Saal hinübergegangen wäre, hätte sich ihr Mann nicht davorgestellt.
Der war von Natur ernst und von schwerem, zuverlässigem Geblüt. Und so hat er noch ernster als sonst gesagt: »Lasse jetzt die Narrenspossen, Johann Preisgott, und bleib hier! Es ist eine Schicksalsstunde. Die Centa und ich haben jetzt mit dir Worte zu sprechen, die kein dritter hören darf!«
Da hab' ich verstanden, daß von den Vieren im Zimmer einer überflüssig war, und der hieß Franz Salvermoser und war ein Kunstmaler aus München, und ich bin still hinübergegangen in den großen Wappensaal, zu den andern Herren.
III Ergänzung des vorstehenden Berichts durch mich, den Schloßherrn, Rittmeister Leopold Salvator von Vogelschrey auf Vogelöd
Kaum hat mein lieber Freund, der Kunstmaler Franz Salvermoser aus München, so, wie er eben geschildert, voll natürlicher Delikatesse das Zimmer verlassen gehabt, da bin ich in meiner Unruhe und Aufregung, und weil keine Minute Zeit mehr zu verlieren war, dicht vor den Johann Preisgott Oetsch hingetreten. Von dem Schwarzen mit seinen sechzehn Enden hab' ich nicht erst angefangen. Das wollt' ich mir auf zu guter Letzt versparen, wenn ich ihn schon so weit herumgekriegt hätte, daß er einsah, er müßte fort, und ihm dann eine goldene Brücke bauen. Jetzt bin ich mit den ersten Worten gleich aufs Ganze gegangen. Ich weiß selbst nicht wie. Mir war, als hätte ein anderer Mensch, in meiner Angst, aus mir geredet, und ich deute auf die Wand hin:
»Schau das Bild von deinem Bruder an!«
Und er guckt auch hin und nickt ganz ruhig.
»Schad' is halt schon um den Peter-Paul!« sagt er. Und ich noch einmal: »Schau das Bild an!«
Darauf der Oetsch gleichmütig die Achseln zuckend:
»Ich kann heute nicht mehr daran sehen wie jeden Tag!«
»Johann Preisgott ...« Es hat mir in der Seele gewürgt. »Johann Preisgott ... wodurch dein Bruder Peter-Paul so jäh abberufen worden ist, und wessen Hand sich das Schicksal bedient hat, das kennt unser Herr und Seligmacher Jesus Christus allein, dessen kostbares Blut und bitteres Leiden uns alle erlöst hat ...«
Der Oetsch gähnte. »Weißt: I glaub' an nix!« sagte er dann. Meine Frau, die Katzel, hat in der Ecke die Hände zusammengefaltet und geschauert und halblaut ein » Omnes sancti« gebetet.
»... und zu seiner Zeit wird Gott schon den Schuldigen richten!«
»Eben! Da könnt' er fei' gleich zeigen, daß er auf der Welt ist!« meint der Johann Preisgott trotzig.
»Die Menschen sollen nicht richten, wo sie nicht beweisen können ...«
»Sag's ihnen nur!«
»... aber mit einem Menschen muß man Nachsicht haben, Johann Preisgott, und das ist die Mette, die Witwe vom Peter-Paul, die ihn so sehr geliebt hat und an seiner Seite so unendlich glücklich gewesen ist!«
»Ja. Ich kann ihr nicht helfen. Mich hat sie nie leiden mögen!«
»Das weiß ich. Gerade darum: Setze dich einmal in ihre Lage! Denke, wie in ihrem Kopf – ich sag' ausdrücklich: in ihrem Kopf, dem einer trostlosen, aus allen Himmeln gestürzten, jählings ihres Gatten beraubten, verarmten, von ihrem Schloß vertriebenen Frau, sich die Vorgänge von damals gruppieren müssen. Gewiß ungerechterweise! Ich spreche jetzt nur vom Schein! Johann Preisgott ... Du hast doch ewig Schulden gehabt ...«
»Ja – wovon hätt' ich denn sonst meine weiten Reisen zahlen sollen! Ich kann nix dafür, daß ich der jüngere Bruder war!«
»In irgendeinem festen Beruf, um dir eine sichere Lebensstellung zu schaffen, hast du's nie ausgehalten!«
Der Oetsch sah mich bloß mitleidig an, von oben her, lang, hager, die Hände in den Taschen, der rechte Flibustier. »Es gibt doch bloß ein einziges Verbrechen auf der Welt«, sagt er. »Das heißt arbeiten! Das ist die wahre Todsünde! Selber arbeiten, mein' ich! Dazu sind die andern da! Die Dummen! Ihr seid's alle dumm. Ich und die andern Räuber draußen, die Beduinen und die Rifkabylen – was haben wir uns oft bucklig über euch gelacht!«
»Hauptsächlich hast du doch vom Spiel gelebt, Johann Preisgott!«
»Vom falschen Spiel!« ergänzt der Oetsch und setzt sich und hat plötzlich den listigen Ausdruck von einem Reineke Fuchs in den zwinkernden Augen.
»Mach' dich nicht schlechter, als du bist!«
»Mein Lieber: ich bin schlecht!« spricht er ganz behaglich und streckt die langen Beine aus.
»Wenn du falsch gespielt hättest, hättest du nicht so viel verloren! Schließlich stand dir das Wasser an der Kehle ...«
»Oft!« meinte er träumerisch und wohlgefällig, als hätt' ich ihm eine Schmeichelei gesagt, und wiederholt: ... »oft ... oft ... oft ...«
»Da hast du den Peter-Paul bestürmt, daß er dir den Diebsturm in der Parkmauer von Pfaffenrod eingeräumt hat. Du hast dir dort in den ehemaligen geheimen Illuminaten-Zimmern aus dem achtzehnten Jahrhundert ein schwarzes Kabinett eingerichtet und hast versucht, Gold zu machen!«