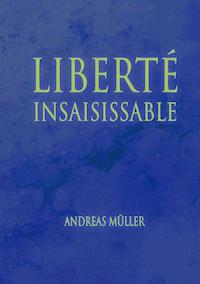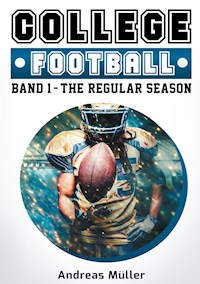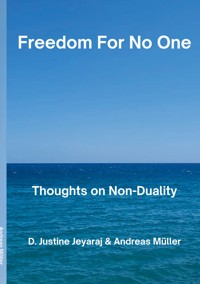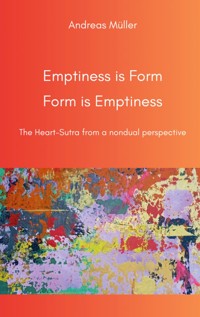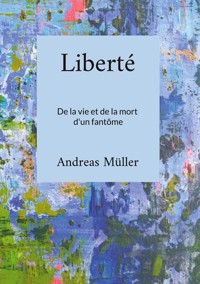Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seit fast 20 Jahren arbeitet Andreas Müller als Richter. Vor seiner Richterbank landen viele harte Fälle: S-Bahn-Überfälle, Gewaltausbrüche, sexueller Missbrauch. Auch drei Jahre nach dem Tod von Kirsten Heisig, einer engen Weggefährtin Müllers, kann Müller keine Besserung der Zustände erkennen: Im Bereich des Jugendstrafrechts soll eingespart werden, das Neuköllner Modell gerät in Vergessenheit, gleichzeitig werden die jungen Intensivtäter immer brutaler. Das kann Müller nicht hinnehmen - jetzt ist die Zeit für Veränderung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Müller
Schluss mit der Sozialromantik!
Ein Jugendrichter zieht Bilanz
In Zusammenarbeit mit Carsten Tergast
Impressum
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2013
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Designbüro Gestaltungssaal
ISBN (E-Book) 978-3-451-80053-5
ISBN (Buch) 978-3-451-30909-0
Inhalt
Vorwort
Rote Haare, Sommersprossen sind des Teufels Artgenossen!Biografische Anmerkungen
Mit dem ersten Fall sofort in medias resDas Dolgenbrodt-Verfahren
Meine Arbeit als RichterDepressionen abseits des Mythos
Malen nach ZahlenWarum rosarote Statistiken mit Vorsicht zu genießen sind
Konservativ, links und ichDreierlei Sozialromantik und mein erster Schuss vor den Bug
Meine Kampfansage an die rechte SzeneKooperation macht stark
Mike, Heiko und andere SchlägerWarum Generalprävention ein Thema ist, das unbedingt ins Jugendrecht gehört
Der Fall DanielSchnelligkeit wirkt
Der Fall HeikeWas passiert, wenn die Strategie der Milde versagt
Eine Szene verschwindetErgebnisse konsequenten Handelns
Zu oft zu spätWarum ich statt Jugendrichter Erziehungsrichter sein müsste
WarnschussarrestMissverständnisse, konservative Sozialromantik und halbe Sachen
IntensivtäterWarum der Staat an ihrer Entstehung eine Mitschuld trägt
Richter der Kiffer?Wieso die Legalisierung von Cannabis kein Drama, sondern eine Wohltat für diesen Staat wäre
Der ÖffentlichkeitsarbeiterWarum es wichtig ist, auch als Richter den Mund aufzumachen
Eine Art von SeelenverwandtschaftWarum ich mich dem Erbe Kirsten Heisigs verpflichtet fühle
Christian Pfeiffer, die DVJJ und die Deutungshoheit im JustizwesenIm Reich der linken Sozialromantik
Was zu tun istModernes Jugendrecht
Nachwort
Vorwort
Seit 1994 bin ich Richter in der Bundesrepublik Deutschland. In diesen fast zwanzig Jahren war ich überwiegend als Jugendrichter tätig und habe in dieser Zeit etwa 12.000 Jugendstrafverfahren verhandelt. Seit 2000 bin ich regelmäßig in der Öffentlichkeit präsent und habe mich dabei immer auch öffentlich für ein modernes und funktionierendes Jugendstrafrecht stark gemacht.
Ich habe Vorträge gehalten, mit zahlreichen Justiz- und Innenpolitikern Gespräche geführt, darunter vor allem wiederholt auch mit den Justizministern der Bundesländer. Gleichzeitig habe ich immer wieder im Rahmen von Veranstaltungen wie auch in Talkshows mit vielen wichtigen und eindrucksvollen Menschen unserer Gesellschaft über mein Lebensthema gesprochen. Dieses Lebensthema ist das Jugendstrafrecht.
Ich habe härteste Skinheadgewalt und S-Bahn-Überfälle verhandelt, Wiederholungs- und Intensivtäter aller Art vor mir stehen gehabt und auch über Drogenfälle sowie sexuellen Missbrauch vor Gericht zu entscheiden gehabt. Die Fallbeispiele im Laufe des Buches werden vieles davon plastisch werden lassen, wobei Namen und Orte bei diesen Beschreibungen stets abgeändert sind.
Ich habe im Laufe all der Jahre immer wieder feststellen müssen, dass wir es in unserer Gesellschaft einfach nicht hinbekommen, ein vernünftiges, auf die Probleme der Gesellschaft ausgerichtetes jugendrichterliches System auf die Beine zu stellen. Diese Frustration prägt neben vielem anderen meine Richterkarriere.
Ich habe Kirsten Heisigs Buch Das Ende der Geduld kritisch begleitet und musste trotz alldem, was seither passiert ist, sehen, dass wir nach wie vor im Jugendstrafrecht immer und immer wieder die gleichen Fehler begehen. Darüber hinaus muss ich feststellen, dass das von Kirsten unter Einsatz ihrer ganzen Kraft und Hingabe Erarbeitete und Erdachte nach wie vor nicht umgesetzt wird. Drei Jahre nach Erscheinen ihres Buches hat sich ihre Hinterlassenschaft nahezu auf null reduziert.
Derzeit ist es in der Bundesrepublik Deutschland so, dass die Zahlen in den Statistiken zur Jugendkriminalität offiziell zurückgehen. Woran das in der Realität liegen mag, wird neben vielem anderen Gegenstand dieses Buches sein. Diese Zahlen berechtigen uns jedoch nicht, zu sagen: Wir reduzieren den Aufwand im Bereich des Jugendstrafrechtes und realisieren hier Einsparpotenziale. Im Gegenteil: Es ist gerade JETZT an der Zeit, zu sagen, wie wir Hunderttausende von Gewalttaten, die auch bei einem generellen statistischen Rückgang auf uns zukommen, in der Zukunft verhindern können. Denn hinter jeder dieser Gewalttaten steckt ein Opfer!
Es ist JETZT an der Zeit, das deutsche Jugendstrafrecht für die Zukunft zu wappnen. Es ist an der Zeit, es runder, besser, substanzieller und vor allem schneller zu machen.
Ich bin der festen Überzeugung, dass man durch WENIGE Änderungen im deutschen Jugendstrafrecht dahin kommen könnte, dass viele der extremen Gewalttätigkeiten, mit denen sich die Öffentlichkeit immer wieder beschäftigen muss, durch besser durchdachtes und organisiertes Eingreifen verhindert würden.
Das bedeutet, ganz konkret gesagt: Ich bin aus meiner Erfahrung heraus im festen Glauben, dass wir, ausgehend von den jetzigen Zahlen, die gesamte Jugendkriminalität innerhalb von einigen Jahren um mindestens die Hälfte reduzieren könnten. Dazu sind bisweilen nur kleine Veränderungen im juristischen Bereich notwendig, vor allem aber der politische Wille zur Änderung sowie »Runde Tische«, bei denen die Problematik schonungslos diskutiert wird.
Möglicherweise kann dieses Buch zu einer Veränderung im gesellschaftlichen und vor allem auch im politischen Denken und Handeln führen. Ich würde es mir zumindest wünschen.
Ich schreibe dieses Buch für die Menschen, die Opfer von Gewaltausbrüchen geworden sind. Für die, die in S-Bahnen oder anderswo im öffentlichen Raum verletzt oder gar getötet wurden. Und auch für diejenigen, die sich getraut haben, dazwischenzugehen, anschließend Traumata davontrugen und jahrelange Therapie nötig hatten. Gerade in diesem Sinne schreibe ich es auch für die Hinterbliebenen der Opfer, wie etwa Tina K., deren Leid nach dem gewaltsamen Tod ihres Bruders Jonny am Alexanderplatz mich letztendlich auch dazu gebracht hat, noch ein Mal meine gesamte Kraft zur Verbesserung des Jugendrechts und damit zur Vermeidung weiterer Opfer einzusetzen.
Ich schreibe es für diejenigen, die, weil sie nicht früh genug durch den Staat ihre Grenzen aufgezeigt bekommen haben, in den Knast gegangen sind. Ich schreibe es – mit dem Blick auf die Vergangenheit – für die Zukunft, in der Hoffnung, dass endlich etwas passiert.
Ich schreibe es auch für einige Menschen, denen ich nach wie vor verpflichtet bin. So zunächst für Kirsten Heisig, die vor etwa drei Jahren mit ihrem Buch versucht hat, die Dinge zu ändern. Ihr Erfolg ist leider nur mäßig geblieben und sie konnte ihr Werk nicht fortsetzen. Warum das so ist: Auch darum wird es hier gehen.
Ich schreibe es für eine junge Frau, die sich das Leben genommen hat, weil sie Opfer familiärer Gewalt wurde und die notwendige Hilfe sowie Genugtuung durch den Staat nicht rechtzeitig erhielt. Wären die Strukturen anders gewesen, könnte sie vielleicht noch leben.
Ich schreibe dieses Buch auch dafür, dass Menschen sich im öffentlichen Raum bewegen können, ohne Angst davor haben zu müssen, geschlagen, gedemütigt oder gar getötet zu werden. Damit sich gerade auch Kinder überall frei von Gewalt bewegen können und in Schulen keine Angst haben müssen, dass sie von Stärkeren angepöbelt und plattgemacht werden.
Ich schreibe es schließlich, um vor allem der deutschen Sozialromantik zu sagen, welche zum Teil verheerenden Fehler sie in den letzten zwei Jahrzehnten unter dem Deckmäntelchen der Menschlichkeit gemacht hat und immer noch macht. Verbunden ist das mit der Hoffnung, dass 16 Justizminister und 16 Innenminister der Bundesländer dieses Buch – am besten zusammen mit Kirsten Heisigs Buch – lesen und die notwendigen Veränderungen herbeiführen werden. Und ich schreibe es letztendlich, um vielleicht doch noch ein wenig an dieser Welt zu verändern.
Das sind viele gute Gründe, ein Buch zu schreiben. Es sind hohe Ansprüche, an denen ich scheitern kann, die ich aber unbedingt versuchen möchte, zu verwirklichen. Ich würde es mir jedenfalls nicht verzeihen, diesen Versuch nicht unternommen zu haben und ich bin froh, jetzt wieder die Kraft dazu zu haben. Denn wenn ich nur relativ kurze Zeit zurückdenke, sah es nicht so aus, als wenn ich überhaupt noch länger jener kämpferische Mensch sein könnte, zu dem das Leben, und insbesondere meine eigene Jugend, mich gemacht haben. Meine Kraft und mein Mut schienen dahin.
Am tiefsten Punkt
Ich erinnere mich, am Fenster meines Klinikzimmers in Bad Grönenbach zu stehen. Es war später Abend, die Landschaft, die die Klinik umgab, lag in tiefer Dunkelheit. Ich schaute in den sternenklaren Himmel und ließ mein Leben Revue passieren. Kirsten Heisigs Tod hatte mich hierher gebracht. Wäre ich diesen Schritt nicht gegangen, wäre die Gefahr groß gewesen, dass ich dem Impuls nachgegeben hätte, Kirsten in die Sterne zu folgen.
Einen Tag zuvor war ich hergekommen. In die Helios-Klinik für psychosomatische Medizin im Allgäu, weit weg vom Amtsgericht in Bernau, weit weg auch vom Tegeler Forst, wo man Kirsten fand, nachdem sie ihrem Leben ein Ende gesetzt hatte.
Der Tod von Kirsten Heisig, die als »Deutschlands bekannteste Jugendrichterin« galt, war etwas über ein halbes Jahr her und würde für mein Leben ein einschneidendes Ereignis bleiben, das war für mich in diesem Moment so sicher wie das Amen in der Kirche. Für mein Leben als Mensch, aber auch für mein Leben als Richter, insbesondere als Jugendrichter.
Dieses Leben ist bis zum heutigen Tage geprägt von der Auseinandersetzung mit den dunklen Seiten unserer Existenz. Sucht und Drogen spielen eine Rolle, Ausgrenzung, Kriminalität und Gewalt. Mit all diesen Dingen kam ich bereits als Kind in Berührung, in meinem engsten Familienumfeld musste ich erfahren, wie leicht es den Menschen auf Abwege verschlägt und dass man ihn manchmal auch nicht mehr von diesen Abwegen herunterbekommt.
Doch man kann, nein, man muss es versuchen. Auch das ist die Aufgabe eines Richters, der ich heute bin. Dass ich in diesem Klinikzimmer stand und in die Dunkelheit hinausschaute, ist auch diesen Abwegen geschuldet. Meine biografischen Erlebnisse spielen für meine Tätigkeit als Richter immer wieder eine wichtige Rolle. Nicht zuletzt deshalb sollte dieses Buch ursprünglich einen anderen Titel tragen. Ich hatte mir immer vorgestellt, dass es »Springerstiefel, Cannabis und Depressionen« heißen würde, weil dieser Dreiklang den Grundton meiner Richterexistenz sehr gut trifft und in ihm auch die biografische Erfahrung anklingt. Vieles, was meinen Angeklagten widerfährt, kenne ich nämlich aus eigener Anschauung und kann mich dadurch gut in sie hineinversetzen und ihre Motivation besser verstehen. Manchmal, wenn ich die Lebensgeschichte eines Angeklagten lese, denke ich daran, dass auch ich vielleicht irgendwann auf der anderen Seite des Richtertisches gestanden hätte, wenn es das Leben an ein paar Stellen schlechter mit mir gemeint hätte.
Rote Haare, Sommersprossen sind des Teufels Artgenossen!Biografische Anmerkungen
Ich bin Emsländer.
Das Emsland ist nach dem Landkreis Uckermark flächenmäßig der größte Landkreis in Deutschland, nicht jedoch hinsichtlich der Einwohnerzahl. Dementsprechend gibt es dort vor allem weite Landschaft, Felder, Moore, Natur, und der Begriff Stadt meint hier eine Größenordnung von maximal etwa 50.000 Einwohnern, die die Stadt Lingen bewohnen. Nach Lingen folgen Papenburg und Meppen mit jeweils etwa 35.000 Einwohnern.
Aus Meppen komme ich.
Der Katholizismus prägt die Region, Emsländer gelten allgemein als heimatverbunden, trinkfest, eher wortkarg, wenig überschwänglich und sehr geerdet. Wortkarg bin ich nicht.
Ich habe meine Herkunft aus diesem Landstrich in all den Jahren, die ich mittlerweile im Dunstkreis des Molochs Berlin verbracht habe, nie verleugnet, unter anderem deshalb, weil ich sehr genau weiß, dass es zu einem großen Teil die prägenden Erfahrungen der emsländischen Zeit waren, die mich zu dem gemacht haben, der ich heute bin.
Meine Eltern hatten eine Bäckerei in Meppen, zu der auch ein kleiner Tante-Emma-Laden gehörte. Ich wurde 1961 geboren, mitten in der Zeit des großen Wirtschaftswunders, und wuchs mit einer großen Schwester und einem großen Bruder auf. Gemeinhin hofft man, dass große Brüder für die Nachkömmlinge Vorbilder sind, sie schützen, ihnen zeigen, wie das Leben funktioniert und mit dafür sorgen, dass sie im Leben klarkommen. Oberflächlich betrachtet ist diese Hoffnung bei meinem Bruder und mir gründlich schiefgegangen.
Wer von außen auf uns zwei Brüder schaut, der sieht ein schwarzes Schaf und ein weißes. So hat es eine Journalistin des Berliner Tagesspiegels vor langer Zeit einmal definiert. Für mich war Hans allerdings nie ein schwarzes Schaf. Er war und ist mein Bruder, und meine Kindheitserinnerungen haben oft schon viel mit Recht und Gerechtigkeit zu tun. Das liegt unter anderem daran, dass mein Bruder sehr wohl seine »Funktion« erfüllte, indem er mich schützte. Gleichermaßen gilt das für meine Schwester, die ebenfalls dem kleinen Bruder zur Seite stand, wo es ihr nur möglich war.
Ich war nicht gerade das, was man »von der Natur bevorteilt« nennt. Ich war pummelig, blass, lispelte und hatte noch ein weiteres Problem, von dem ich bereits als kleiner Junge ahnte, dass es eines sein könnte: Ich war rothaarig. Die Nachbarskinder hänselten mich, und ich erlebte mehr als ein Mal, dass meine Eltern sich genötigt sahen, sich für meine Haarfarbe zu rechtfertigen. »Andreas ist zwar rothaarig, aber sonst ein gutes Kind«, hieß es dann. Glücklicherweise bekamen irgendwann auch die Nachbarn rothaarigen Nachwuchs, so dass gewissermaßen Gleichstand herrschte.
Dass die Haarfarbe sehr wohl ein Grund sein kann, ausgegrenzt zu werden, wurde mir vor allem in der Schule klar. Benahmen andere sich daneben, beließ es der Lehrer bei einer Ermahnung. Benahm ich mich daneben, war das für den Lehrer der Beweis, dass mit mir etwas nicht in Ordnung sein könne. Und schließlich wurde das wiederholt von verschiedenen Menschen in folgende Worte gekleidet: »Rote Haare, Sommersprossen sind des Teufels Artgenossen!«
Dieser Spruch ist mir ein Leben lang im Sinn geblieben, und vielleicht ziehe ich deshalb bis heute eine gewisse Befriedigung aus der Tatsache, dass mich immer mal wieder andere Menschen als »des Teufels Artgenossen« empfunden haben müssen, weil ich ihnen aus dem einen oder anderen Grund mächtig auf die Füße gestiegen bin. Auch der Umstand, dass ich im Rahmen meines Richterlebens regelmäßig besonders gegen Diskriminierungen vorgegangen bin, dürfte den meiner Rothaarigkeit zu verdankenden Erlebnissen geschuldet sein.
Meine Geschwister hänselten mich nicht wegen meiner roten Haare, sondern beschützten mich und setzten sich für mich ein, wenn andere mir an den Kragen wollten oder mich mit meinem Sprachfehler aufzogen. So war also mein Bruder genau der große Bruder, den ich mir wünschte. Doch während meine Schwester ihren Weg ins Leben fand, schmerzte es mich umso mehr, dass ich mit ansehen musste, wie mein Bruder sich langsam, aber sicher sein Leben versaute, indem er früh mit Drogen in Berührung kam. Aus dieser Berührung wurde schnell, viel zu schnell eine feste Umklammerung, aus der er sich nicht mehr zu lösen verstand. Wie gern wäre ich der große Bruder gewesen, der ihn rechtzeitig hätte schützen und retten können. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ich genau das stellvertretend heute mache. Indem ich als Jugendrichter damit beschäftigt bin, Jugendliche zum Nachdenken über ihren Lebenswandel zu bringen, mit welchem Mittel auch immer, mache ich genau das, was ich bei meinem Bruder nicht leisten konnte. Auch mein besonderes Interesse für die Cannabis-Problematik und meine spezielle Meinung dazu sind natürlich aus den Beobachtungen der Drogenprobleme meines Bruders gewachsen.
Doch nicht nur mein älterer Bruder begab sich auf Abwege; mein Vater hatte mit einem ernsten Alkoholproblem zu kämpfen. Kurz gesagt: Der eine kiffte, der andere soff.
Ich erwähnte eingangs, dass der Emsländer an sich als trinkfest gilt. Diese erst einmal harmlos klingende Beschreibung bringt es mit sich, dass Warnsignale, die den Weg in den Alkoholismus immer begleiten, nicht gesehen oder als unwichtig abgetan werden. Trinkfestigkeit wird nicht von heute auf morgen zur Alkoholsucht, wie so vieles ist das ein schleichender Prozess, der erkannt werden muss, um ihm Einhalt zu gebieten. Bei meinem Vater gab es niemanden, der es geschafft hätte, Einhalt zu gebieten. Seine Sauferei gehörte irgendwie zum Familienleben dazu; wenn er nüchtern war, war er für uns Kinder der liebste Papa der Welt, wenn er getrunken hatte, hatte er eben getrunken. Wir versuchten, ihm aus dem Weg zu gehen, so gut das ging, doch es ging natürlich nicht immer. Auch hier schützten mich meine älteren Geschwister bisweilen vor den unvermeidlichen Wutausbrüchen meines Vaters. Als jüngstes Kind der Familie erfuhr ich hier so etwas wie die Gnade der späten Geburt, was vielleicht mit dazu beigetragen hat, dass ich das »weiße Schaf« werden konnte. Mein Bruder und meine Schwester bekamen das Wüten meines Vaters wesentlich ungefilterter mit und hatten so vielleicht auch mehr zu kompensieren.
Zu den Methoden, Alkoholiker wieder auf den richtigen Weg zu bringen, gehörten auch zu jener Zeit schon Entziehungskuren. Die Orte, an denen diese Kuren stattfanden, hießen damals »Trinkerheilanstalt«, eine Bezeichnung, die sehr genau aussagt, was dort versucht wurde und aus genau diesem Grunde schon längst der Political Correctness anheimgefallen ist. Heute hat man verklärende Bezeichnungen für die Probleme, die doch die gleichen geblieben sind.
Mein Vater war mehrfach in solch einer Anstalt, der letzte Aufenthalt fand statt, kurz bevor ich auf die weiterführende Schule wechselte, ich war damals gerade elf Jahre alt. Sechs Monate lang hatten die Ärzte versucht, ihn wieder in die Spur zu bekommen, Körper und Psyche vom flüssigen Gift zu entwöhnen. Doch eins entzog sich ihrer Macht und ihrem Einfluss: die Tatsache, dass Menschen ohne Unterstützung in ihrem nächsten Umfeld kaum in der Lage sind, sich wirklich nachhaltig aus dem Dreck zu ziehen, in dem sie unterzugehen drohen. Der Untergang meines Vaters wurde kurz nach seiner Rückkehr aus der Trinkerheilanstalt in meinem Beisein eingeläutet. Er betrat seine Stammkneipe und bestellte in dem festen Willen, sich geläutert zu zeigen, eine Regina, das ist eine typisch emsländische Limonade. Daraufhin traf ihn der Spott seiner Kumpel am Tresen, denen sich der Unterschied zwischen Trinkfestigkeit und Alkoholismus niemals erschlossen hatte. »Mensch, Rudi«, höre ich diese Männer noch heute sagen, »Mensch, Rudi, was soll denn die Regina? Du bist ja wohl kein richtiger Mann mehr!« Nach dieser Ansage bestellte mein Vater um. Ließ die Regina zurückgehen, trank stattdessen ein Alster. Ich stand als kleiner Steppke daneben und sagte nur: »Bitte, Papa, mach das nicht.«
Sechs Monate später gab es keinen Aufenthalt in der Klinik mehr. Sechs Monate später war mein Vater tot.
Die Gefängnisstrafe des Bruders als Warnschussarrest fürs Leben
Der Tod meines Vaters war nicht die einzige dramatische Veränderung in unserer Familie, denn bereits kurze Zeit zuvor hatte sich meine Schwester, die eigentlich zur Kripo gehen wollte, aber auf Grund eines Einstellungsstopps nicht genommen werden konnte, in die Krankenschwesterausbildung nach Osnabrück begeben. Mein Bruder machte keine Ausbildung, sondern haute ab, anders gesagt: Er ging »auf Trebe«. Er ertrug den betrunkenen und gewalttätigen Vater nicht mehr länger. Auch im Emsland gab es zu jener Zeit so etwas wie eine Hippie-Szene mit all ihren Begleiterscheinungen, gerade auch im Hinblick auf den Drogenkonsum. Mein Bruder tauchte genauso tief in diese Szene ein wie in den Konsum verschiedener Betäubungsmittel.
Nachdem er das städtische Gymnasium wegen Cannabis-Konsums hatte verlassen müssen, schaffte er es gerade noch, den Hauptschulabschluss zu machen, wurde jedoch danach in der Johannesburg, einem Heim für schwer erziehbare Kinder, untergebracht, da er immer wieder strafrechtlich in Erscheinung getreten war. Die Johannesburg liegt nicht weit von der niederländischen Grenze, so dass mein Bruder seine längst vorhandenen Kontakte zu niederländischen Cannabis-Händlern weidlich nutzte, um halb Niedersachsen mit dem Stoff zu versorgen. Geld verdiente er damit nicht, da er nur vermittelte.
Trotzdem schaffte er es in dieser Zeit, doch noch eine Lehre zu absolvieren und zog für kurze Zeit zurück zur Mutter und dem kleinen Bruder. Allerdings war dieses Familienglück nicht von langer Dauer, da die Kripo ihn bald mit Haftbefehl suchte. Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde er schließlich zu einer mehrjährigen Jugendstrafe verurteilt. Diese saß er in Hameln und Vechta ab, wobei der Jugendstrafvollzug damals sicherlich wesentlich härter sowie unpädagogischer war und erzieherisch einer Tragödie gleichkam. Auch war der Jugendstrafvollzug noch nicht vom Resozialisierungsgedanken geprägt.
Durch die Haft meines Bruders und den Tod meines Vaters konnte ich nun »ungestört« meinen Weg finden. Der frühzeitige Tod meines Vaters war, so glaube ich heute, mein Glück, da mich die Alkoholexzesse nicht so heftig trafen, wie dies bei meinem Bruder der Fall gewesen war. Ich wohnte mit meiner Mutter allein, die Bäckerei war mittlerweile geschlossen. Die Rente meiner Mutter konnte uns beide nicht ernähren. Schließlich kam sie auf die Idee, das im Haus befindliche Ladenlokal an einen Nachtklubbesitzer zu vermieten, der schließlich an dieser Stelle die erste sogenannte »Animierbar« in Meppen betrieb.
Auch die Intervention des örtlichen katholischen Priesters konnte meine Mutter nicht von ihrer Entscheidung abhalten. Dieser stand eines Tages bei uns im Wohnzimmer, voller Sorge, nachdem er von den skandalösen Dingen gehört hatte, die sich bei uns zutrugen. Er appellierte an meine Mutter, sie könne doch nicht an einen derart unmoralischen Betrieb vermieten, woraufhin sie ihm in ihrer nüchternen Art entgegnete: »Gibt die katholische Kirche mir das Geld, mach ich das rückgängig, sonst nicht.« Nun, die Kirche gab natürlich kein Geld, und ich lernte, dass Bertolt Brecht mit seinem berühmten Zitat Recht gehabt hatte: »Erst kommt das Fressen, dann die Moral!« So lebten wir von einer guten Miete, der kleinen Rente und schließlich auch noch von einem Putzjob, den meine Mutter in eben jener Bar ausübte. Auch ich selbst profitierte vom Gewerbe in unserem Haus: Für zehn Mark pro Stunde brachte ich Werbezettel an parkenden Fahrzeugen an. Das war, wenn man so möchte, mein erster Kontakt zum Rotlichtmilieu. Wir lebten gut, Geldprobleme gehörten der Vergangenheit an.
Die durch nicht verarbeitete Kriegserlebnisse entstandene Alkoholsucht meines Vaters hatte meine Mutter noch irgendwie ertragen, der Knast-Aufenthalt ihres ältesten Sohnes jedoch war zu viel. Die Geschichte wurde totgeschwiegen, Hans war eben einfach »weg«, »woanders«, jedenfalls durfte er offiziell nicht dort sein, wo er wirklich war. Was zur Folge hatte, dass ich in dieser Hinsicht ständig lügen musste, denn natürlich wurde ich gefragt, wo sich denn mein Bruder aufhalte.
Lügen fiel mir schon damals schwer, und vielleicht liegt meine heutige Liebe zur Wahrheit und zur Direktheit auch mit in jener Zeit begründet, als ich so lange nicht sagen durfte, was ich eigentlich gerne mal losgeworden wäre.
Immerhin: Ich selbst war mir darüber im Klaren, dass meine Mutter nun nur noch einen der Männer in ihrer Familie hatte, der die Chance besaß, sie nicht bitter zu enttäuschen. Und ich war entschlossen, diese Chance zu nutzen.
In der Grundschule war ich ein Mathe-Ass und Super-Sportler, gleichzeitig jedoch festigte ich auch meinen Ruf als Deutsch-Versager. Mit der Rechtschreibung stand ich auf Kriegsfuß. Heute, in Zeiten der Übertherapierung, hätte ich den Stempel »Lese-Rechtschreib-Schwäche« (LRS) schneller aufgedrückt bekommen, als ich die Buchstaben hätte entziffern können. Damals jedoch war über die Gründe für derartige Probleme noch wenig bekannt und es gab für Schüler wie mich auch keine speziellen Hilfsangebote. Für den Übergang auf die weiterführende Schule war das ein ziemliches Problem, doch ich hatte Glück und machte zugleich eine Erfahrung, die ich mir immer mal wieder in meinem Leben ins Gedächtnis zurückrufe.
Meine Klassenlehrerin hatte rechtzeitig mit meinen Eltern, die mich eigentlich auf der Realschule anmelden wollten, gesprochen und ihnen eingeschärft: »Ihr müsst Andreas unbedingt aufs Gymnasium schicken. Er hat zwar nicht die Noten dafür, aber ich weiß: Er wird es schaffen!«
Das war mein Glück, und die Erfahrung, die ich machte, war die, dass Menschen mit ein wenig Unterstützung von außen und der wohlwollenden Hilfe anderer Menschen eine ganze Menge Dinge schaffen können, die sie aus den eigenen Möglichkeiten heraus vielleicht niemals geschafft hätten. Mein Vater, der aus seiner letzten Kur trocken zurückgekommen war, meldete mich stolz beim Maristenkloster in Meppen an, einer freien Schule, an der etwa achtzig Prozent der Lehrer katholische Pater waren. Der Leiter dieser Schule, Pater Licher, war zwar kein besonders fähiger Pädagoge, doch er war Mathelehrer. Pater Licher war meine Deutschnote egal, er sah meine Mathenote, hörte mich im Aufnahmegespräch begeistert von Mathematik reden und war überzeugt, dass er diesen Schüler auf seiner Schule haben wollte. Ein weiterer Lehrer, der sich, was damals selten war, mit LRS auskannte, half mir außerdem mit freiwilligen Zusatzstunden.
Doch natürlich bestand mein Leben an dieser Schule nicht nur aus glücklichen Fügungen. Mein Bruder, der das städtische Gymnasium besucht hatte, war im Zuge seines Abgleitens in die Drogen- und Hippieszene von der Anstalt geflogen, so dass der Name meiner Familie für manchen bereits einen gewissen »Klang« hatte. Zu diesen »manchen« gehörte etwa ein Lehrer, der kurze Zeit zuvor vom städtischen Gymnasium auf meine neue Schule gewechselt hatte und den Begriff der Sippenhaft mit Leben zu füllen verstand. Er begrüßte mich mit den Worten, ich sei doch »der Bruder von diesem stadtbekannten Kiffer« und verpasste dem elfjährigen Andreas, der gerade mal zwei Wochen vorher seinen Vater verloren hatte, direkt rechts und links eine Ohrfeige. Er konnte das folgenlos machen, denn damals hatten Lehrer noch ein Züchtigungsrecht. Offensichtlich glaubte er, mich nur so vor der Verderbnis meiner Familie retten zu können, indem er mich direkt »einnordete«.
Zugegebenermaßen war ich kein einfacher Schüler, sondern gab den Lehrern, wenn ich es für angebracht hielt, kräftige Widerworte, was mir manchen Strafdienst einbrachte. Heute würde man das Problem anders lösen: Man hätte mir gleich die Diagnose ADHS gestellt und mich mit Ritalin, Concerta oder anderen Medikamenten vollgestopft und aus mir so einen ruhigen, aber frühzeitig medikamentenabhängigen Schüler gemacht.
Während ich mich also als ziemlich hyperaktiver Schüler durch meine Zeit auf dem Gymnasium hangelte, legte mein Bruder eine veritable Kleinkriminellen-Karriere hin. Gewalt spielte nie eine Rolle, vielleicht hatten ihn die Erfahrungen mit unserem Vater davon abgehalten, doch die Drogensucht hatte ihn im Griff und infolgedessen auch die Beschaffungskriminalität in Form von Diebstählen und der Vermittlung großer Mengen Cannabis. All das führte immer wieder zu Aufenthalten in Besserungsanstalten und auch im echten Gefängnis, wo ich ihn bisweilen besuchte. So hatte ich ständig vor Augen, was ich meiner Mutter nicht antun durfte.
Mit Drogen hatte ich dann auch wirklich nichts zu schaffen, aber fast jeder Jugendliche gerät irgendwann doch einmal mit dem Gesetz in Konflikt. So war es auch bei mir, auch wenn ich meinem Vorsatz, nicht klauen zu wollen, treu blieb: Ich bezahlte stattdessen einen anderen Jungen dafür, dass er mir einen heiß ersehnten, aber zu teuren Zirkelkasten »besorgte«. Es kam, wie es kommen musste: Die Bande des Jungen, der den Zirkelkasten für mich geklaut hatte, flog auf, und mein Bekannter gab bei der Polizei wahrheitsgemäß zu Protokoll, dass er den Zirkel für mich geklaut habe. Die Folgen waren klar: Meine Mutter musste mit mir zur Polizei und zur Jugendgerichtshilfe, es gab ein Verfahren und ich hoffte inständig, einen ganz bestimmten Menschen nicht sehen zu müssen: den Jugendrichter.
Mein Verfahren wurde schließlich eingestellt. Der Rest der Bande erhielt zum Teil Arbeitsauflagen, die Rädelsführer mussten für zwei bis vier Wochen in den Arrest. Heute würde man die Entscheidung des Jugendrichters als Warnschussarrest bezeichnen, und wenn man sich anschaut, was aus den Jungs geworden ist, kann man nicht behaupten, dass es ihnen geschadet hat. Ich selbst war im Sinne dessen, was man heute Diversion nennt, noch einmal davongekommen, doch auch bei mir hatte der heilsame Schock gewirkt. Meinen privaten Warnschussarrest hatte ich zudem auch längst selbst gefunden: Diesen leistete stellvertretend mein Bruder ab. Ich sah, wie er im Knast litt, wie traurig das alles war, und ich wusste immer: Das ist genau das, was du niemals erleben möchtest. Und es ist auch das, was du gerne bei anderen Menschen verhindern würdest!
Richter werd’ ich sowieso nicht!
Noch heute wundere ich mich oft darüber, wie aus mir das werden konnte, was ich bin. Ein Jugendrichter, oder überhaupt: ein Richter. Denn das war, obwohl ich verhindern wollte, dass Menschen im Gefängnis landen, doch genau das, was ich nie werden wollte.
Nach dem Abitur leistete ich zunächst, da ich seit jeher jegliche Form der Gewalt ablehnte, sozusagen als »staatlich anerkannter Pazifist« meinen Zivildienst ab. Danach entschied ich mich gegen ein Publizistik- und für ein Jurastudium und ging nach West-Berlin. Das brachte für mich zunächst vor allem Frustration mit sich. Meine Kommilitonen schienen alle akzeptiert zu haben, dass dieses Studium daraus bestehen muss, Gesetzestexte genauso auswendig zu lernen wie ihre exakte Anwendung. Eigenständiges Denken beziehungsweise Nachdenken über den Sinn juristischer Regelungen, über die Anwendung von Gesetzen und über weitergehende Zusammenhänge erlebte ich verhältnismäßig selten.
Da ich nun mal ein impulsiver Mensch bin, führte das zwangsläufig dazu, dass ich nach ein paar Semestern erst mal keine Lust mehr hatte. Ich unterbrach, jobbte unter anderem als Telegrammbursche bei der Post. Trotz allem Frust nahm ich jedoch nach etwa einjähriger Auszeit das Studium wieder auf und kam erstaunlich gut durch. Nachdem meine damalige Freundin mir mitteilte, sie sei schwanger, bemühte ich mich um eine Referendariatsstelle in Bayern, wo Frau und Kind lebten. Daraus wurde jedoch nichts, da ich, wie man mir sagte kein »Landeskind« sei. Und nicht einmal mein spontan vorgetragenes Argument, ich hätte aber ja immerhin für ein weiteres Landeskind gesorgt, konnte die zuständige Stelle umstimmen.
Immerhin jedoch konnte ich meine sechsmonatige Wahlstation, die zum Referendariat dazugehörte, bei einem Rechtsanwalt in Bayern ableisten und fand zusätzlich eine Stelle als wissenschaftliche Hilfskraft an der Uni Würzburg. Diese hatte ich allerdings auch nur solange inne, bis ich mich mal wieder wegen unterschiedlicher Auffassungen genötigt sah, zu kündigen: Man wollte einen Studenten wegen Cannabis-Konsums von der Uni schmeißen. Das Referendariat selbst leistete ich in Berlin ab, so dass ich zum Dauerpendler wurde, um so mehr, als meine Mutter an Krebs erkrankte und neben Bayern und Berlin nun auch Meppen wieder als dritte Station auf meinem ständigen Reiseweg lag.
So seltsam es im ersten Moment klingen mag, so wahr ist es doch, dass gerade diese neuerliche Leidenszeit meiner Mutter mich letztlich dazu brachte, den Weg zum Richteramt einzuschlagen.
Um nach einem Jurastudium und anschließendem Referendariat Richter werden zu können, braucht es einen gewissen Notenschnitt. Obwohl ich mich nie besonders bemüht hatte und mir echtes Noten- und Karrierestreben fremd war, lag mein Schnitt schließlich in einem Rahmen, der den Richterposten in den Bereich des Möglichen rückte. Aber selbst, als ich in meiner Abschlussprüfung gefragt wurde, welchen Weg ich anstreben würde, antwortete ich noch im Brustton der Überzeugung: »Ich werde höchstens ein kleiner Anwalt irgendwo in Kreuzberg.«
Und dann doch: gute Noten, Bewerbungen und schließlich eine Stelle im Land Brandenburg. Im April 1994 fing ich zunächst beim Landgericht Münster an, da das Land Brandenburg Jungrichter erst einmal für ein Jahr nach Nordrhein-Westfalen abordnete. Im Gegenzug bekam Brandenburg gestandene Richter für den Aufbau der eigenen Justiz. Für mich war das auch die Voraussetzung für die Tätigkeit als Richter, denn so konnte ich meine damals schwerkranke Mutter noch bis zu ihrem Tod betreuen. Ich war nun zunächst für ein Jahr in Münster und fing dann im April 1995 in Frankfurt an der Oder an. Hier bekam ich als erstes Verfahren überhaupt einen Vorgang übertragen, der mich für mein weiteres Richterleben prägen sollte und mich auch bereits mit dem Thema Rechtsradikalismus in Berührung brachte. Das war insofern entscheidend, als dieses Thema meine ersten Jahre als Richter und meine Überzeugungen nachhaltig beeinflusst hat.
Mit dem ersten Fall sofort in medias resDas Dolgenbrodt-Verfahren
Der Ruf eines Quertreibers eilte mir voraus. Wie mir später der damalige Präsident des Landgerichtes Münster erzählte, wurde über kaum einen neuen Proberichter vom abgebenden Gericht mit dem aufnehmenden so lange und intensiv telefoniert wie über mich.
Ich wurde unter anderem Mitglied der Schwurgerichtskammer und der Jugendkammer, war also von Beginn an mit ausreichend Arbeit versorgt und wurde außerdem gleichzeitig von verschiedenen Vorsitzenden beäugt. Das Verfahren, von dem ich oben sprach, war das sogenannte Dolgenbrodt-Verfahren, das ich als sogenannter Berichterstatter für das Gericht, das mit zwei weiteren Berufsrichtern und zwei Schöffen besetzt war, vorbereiten musste. Dieses Verfahren beeinflusste meinen weiteren beruflichen Werdegang enorm.
Zunächst einmal fühlte ich mich erschlagen. 1200 Seiten waren bereits mit diversen Vorgängen gefüllt worden, 1200 Seiten, die bei mir auf dem Tisch lagen und durchgearbeitet werden wollten. Nach dem ersten Ohnmachtsgefühl setzte ich mich also hin und las und las und las.
Mir wurde schnell klar, wie viel Aufmerksamkeit diese Geschichte bereits erzeugt hatte und noch erzeugen würde; sie passte gut in die Zeit des explodierenden Rechtsradikalismus in den ostdeutschen Bundesländern. Zwar gab es zum Glück keine Opfer, die an Leib und Leben Schaden genommen hatten, deutlich wurde aber, dass genau das zu erwarten war, wenn man dem Treiben nicht sofort Einhalt gebieten würde.
Worum ging es? Der Angeklagte war beschuldigt, am 1.11.1992 gegen Bezahlung durch einige Dorfbewohner ein Asylbewerberheim im kleinen brandenburgischen Ort Dolgenbrodt mit einem Molotow-Cocktail in Brand gesteckt zu haben, und zwar einen Tag bevor dort Asyl suchende Menschen untergebracht werden sollten. Es war damals die Hochzeit der Brandanschläge, Rostock hatte bereits Angriffe des braunen Mobs erlebt, die verheerenden Brandanschläge in Mölln und Solingen sollten noch folgen. Da es erhebliche Zweifel am Freispruch im ersten Urteil gab, hatte der Bundesgerichtshof dieses aufgehoben, und das Verfahren musste neu aufgerollt werden. Und jetzt lag es vor mir.
Wie nach dem Umfang des Materials zu erwarten, hatten wir einen Marathon vor uns. 25 Verhandlungstage, das Ganze zog sich über Monate und war letztlich ein reines Indizienverfahren. Das zu erwähnen ist nicht ganz unwichtig, da wir Unmengen an Zeugen hörten, über 50 Leute sind es sicherlich gewesen. Man fühlte sich, als ob das halbe Dorf im Gerichtssaal erschienen wäre, um jeweils die eigene Version der Tat zum Besten zu geben. Der eine widersprach dem anderen, zusätzlich war der Angeklagte in einem Fernsehinterview aufgetreten und hatte in der scheinbaren Gewissheit, wieder einen Freispruch zu bekommen, frech in die Kamera gesagt, »vielleicht« sei er ja »dabei gewesen, vielleicht aber auch nicht«. Er verhöhnte also noch im Nachhinein die Menschen, die auf Grund solcher Taten Angst davor haben mussten, dieses Land überhaupt zu betreten. Denn das war die eigentliche Ansage, die hinter dem scheinbar vernachlässigenswerten Anschlag auf ein leer stehendes Haus steckte: »Wir wollen diese Ausländer nicht, und wenn sie trotzdem kommen, werden wir sie kriegen.«
So stützten wir uns also auf wenige wirklich gute Indizien, hatten allerdings gleichzeitig doch einen Zeugen, bei dem sich erhöhte Aufmerksamkeit lohnte.
Wie aus dem Nichts präsentierte die Sitzungsvertreterin der Staatsanwaltschaft plötzlich einen Kronzeugen: Carsten S., von dem im ganzen Verfahren bis zu jenem Zeitpunkt nie die Rede gewesen war, belastete den Angeklagten, und es schien endlich eine Möglichkeit gefunden, mit der das Gericht die Schuld feststellen und ein entsprechendes Urteil fällen konnte. Im Grunde spürte ich sofort, dass das zu schön war, um wahr zu sein.
S. war ein harter Fall, rechtsradikal bis ins Mark, tief in der Szene verwurzelt. Zum Zeitpunkt des Dolgenbrodt-Prozesses saß er selbst ein. Einige Jahre zuvor hatte er mit ein paar seiner rechtsradikalen Kameraden versucht, einen Nigerianer zu töten. Unter »Schlagt den Neger tot«-Rufen von S. war der Mann in einer Diskothek brutal zusammengetreten und anschließend bewusstlos in einen See geworfen worden. Nur der mutigen Rettungstat eines Türstehers, der ihn aus dem Wasser zog, war es zu verdanken gewesen, dass der Mann überlebte.
Das hatte S. eine achtjährige Haftstrafe wegen versuchten Mordes eingebracht, und eben jener Mann lief nun plötzlich als Hauptbelastungszeuge in unserem Verfahren auf. Von Anfang an stank hier etwas zum Himmel, so dass veranlasst wurde, S.’ Besuchslisten im Gefängnis zu den Akten zu reichen. Hieraus war bereits einiges zu entnehmen, insbesondere, mit wem er Kontakt pflegte. Auch räumte die als Zeugin gehörte Staatsanwältin ein, dass ein anderes Verfahren, in dem es um eine weitere Freiheitsstrafe von einem Jahr ging, plötzlich eingestellt worden war. Außerdem hatte sie den Zeugen auf eigene Faust und ohne das Gericht zu unterrichten im Knast besucht.
Das Ergebnis der Recherche: Der Kronzeuge stand, so muste ich denken, wohl auf der Lohnliste des brandenburgischen Verfassungsschutzes. Einer der sogenannten V-Männer, von denen auch heutzutage wieder so oft die Rede ist.