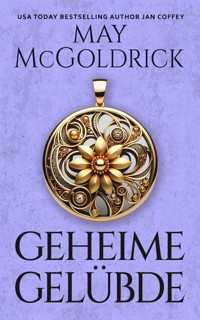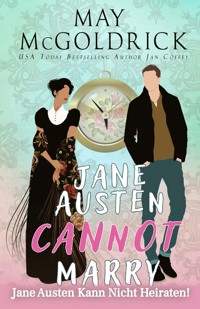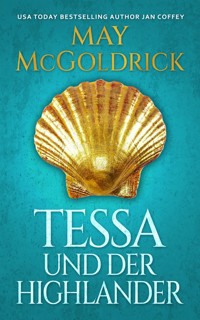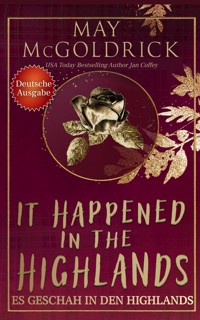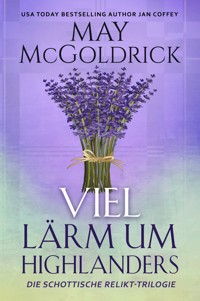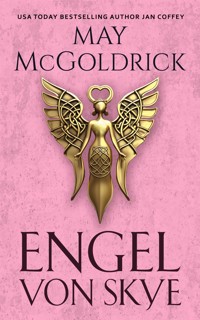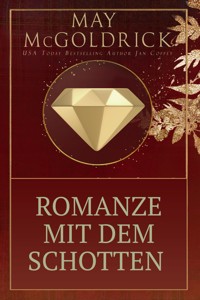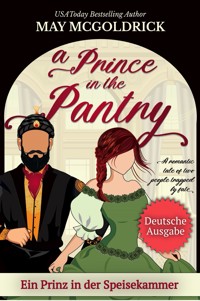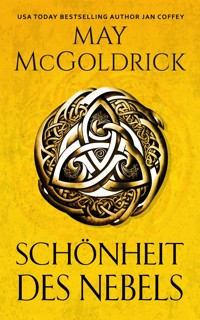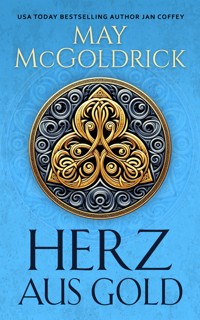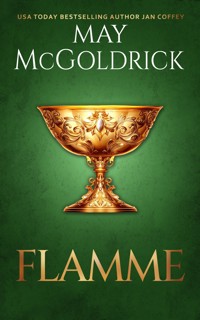Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Book Duo Creative
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: SCHOTTISCHEN TRAUM-TRILOGIE
- Sprache: Deutsch
DREI VOLLSTÄNDIGE ROMANE Geborgte Träume Millicent Wentworth will das Böse, das ihr toter Ehemann angerichtet hat, ungeschehen machen und muss einen Weg finden, ihr Anwesen zu retten und die unschuldigen Menschen zu befreien, die ihr Mann versklavt hat. Ihre einzige Hoffnung ist eine Vernunftehe mit dem berüchtigten Witwer Lyon Pennington, dem vierten Earl of Aytoun, der vielleicht der attraktivste und fürsorglichste Mann ist, der ihr je begegnet ist. Gefangene Träume Portia Edwards ist bereit, alles zu tun, um die Familie zu finden, die sie nie gekannt hat. Und als sie den Händler Pierce Pennington trifft, einen überzeugten, aber geheimnisvollen Sohn der Freiheit, hat Portia die perfekte Gelegenheit, ihn um Hilfe zu bitten. Doch ihr sturer Stolz lässt sie schweigen. Das heißt, bis sie erkennt, dass sie sich stark zu dem mutigen Mann hingezogen fühlt, der nachts als der berüchtigte Captain MacHeath bekannt ist und im Schutze der Dunkelheit Waffen auf dem Seeweg schmuggelt - alles im Namen der Freiheit... Träume des Schicksals David Pennington, der durch einen Skandal und den ungeklärten Mord an seiner Schwägerin verletzt wurde, ist nach außen hin frech und arrogant. Doch nichts wird ihn davon abhalten, seine Jugendfreundin Gwyneth Douglas nach Schottland zu begleiten und die schottische Erbin vor den Glücksjägern zu retten. Doch mit ihrer Ankunft in Schottland kommt eine schreckliche Gefahr. Wenn sie jemals ihre Sehnsucht befriedigen wollen, müssen sie das Böse vereiteln, das ihr beider Leben zu zerstören droht...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1579
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SCHOTTISCHEN TRAUM-TRILOGIE
Geborgte Träume, Gefangene Träume, Träume des Schicksals
2ND GERMAN EDITION
MAY MCGOLDRICK
withJAN COFFEY
Book Duo Creative
Urheberrecht
Vielen Dank, dass Sie die Schottische Träume-Trilogie gelesen haben. Falls Ihnen das Buch gefallen hat, sollten Sie es weiter empfehlen, indem Sie eine Rezension hinterlassen oder mit den Autoren in Kontakt treten.
Schottische Träume-Trilogie ; (Scottish Dreams Trilogy: Borrowed Dreams, Captured Dreams, and Dreams of Destiny). Copyright © 2015 von Nikoo K. und James A. McGoldrick
Deutsche Übersetzung © 2025 von Nikoo K. und James A. McGoldrick
Alle Rechte vorbehalten. Mit Ausnahme der Verwendung in einer Rezension ist die Vervielfältigung oder Verwertung dieses Werkes im Ganzen oder in Teilen in jeglicher Form durch jegliche elektronische, mechanische oder andere Mittel, die jetzt bekannt sind oder in Zukunft erfunden werden, einschließlich Xerographie, Fotokopie und Aufzeichnung, oder in jeglichem Informationsspeicher- oder -abrufsystem, ohne die schriftliche Genehmigung des Herausgebers untersagt: Book Duo Creative.
KEINE KI-TRAINING: Ohne die ausschließlichen Rechte des Autors [und des Verlags] gemäß dem Urheberrecht in irgendeiner Weise einzuschränken, ist jede Verwendung dieser Veröffentlichung zum „Trainieren“ generativer künstlicher Intelligenz (KI)-Technologien zur Generierung von Texten ausdrücklich untersagt. Der Autor behält sich alle Rechte vor, die Nutzung dieses Werks für das Training generativer KI und die Entwicklung von Sprachmodellen für maschinelles Lernen zu lizenzieren.
Erstmals erschienen bei Signet, einem Imprint von Dutton Signet, einer Abteilung von Penguin Books, USA, Inc.
Umschlag von Dar Albert, WickedSmartDesigns.com
Inhalt
Geborgte Träume
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Epilog
Anmerkung zur Ausgabe
Anmerkung des Autors
Gefangene Träume
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Anmerkung zur Ausgabe
Anmerkung des Autors
Träume des Schicksals
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Anmerkung zur Ausgabe
Anmerkung des Autors
Über den Autor
Also by May McGoldrick, Jan Coffey & Nik James
Für Judy Spagnola
Vielen Dank für alles, was Sie tun!
KapitelEins
London, Januar 1772
»Wir fahren in die falsche Richtung!«
Anstatt nach Westen in den Stadtbezirk Temple Bar zu fahren, war die Kutsche östlich in die Fleet Street abgebogen. Der Kutscher peitschte das Gespann durch den dichten Verkehr, der sich in Richtung Stadt bewegte. Um den Fahrer auf sich aufmerksam zu machen, pochte der Anwalt mit seinem Stock an das Wagendach, doch Millicent berührte ihn mit der behandschuhten Hand leicht am Ärmel. Sofort hielt er inne.
»Sir Oliver, der Mann fährt, wie ich ihn geheißen habe. Ich habe eine dringende Angelegenheit am Hafen zu erledigen.«
»Am Hafen? Aber … aber die Zeit drängt, wenn wir nicht zu spät zu Ihrer Verabredung erscheinen wollen, Mylady.«
»Es wird nicht lange dauern.«
»Nun, wenn uns ein wenig Zeit bleibt«, erwiderte er erleichtert und lehnte sich wieder zurück, »dann gestatten Sie mir vielleicht die Frage, was es mit dieser geheimnisvollen Unterredung auf sich hat, zu der wir für heute Vormittag geladen wurden.«
»Sir Oliver«, bat Millicent ruhig, »kann Ihre Frage warten, bis ich die geschäftliche Angelegenheit am Hafen hinter mich gebracht habe? Ich fürchte, ich bin im Moment zu zerstreut, um Ihnen zu antworten.«
Der Anwalt schwieg verbissen, während Lady Wentworth den Blick aus dem Fenster wandte und das rege Treiben auf der Straße betrachtete. Kurze Zeit später fuhr die Kutsche an der St. Paul’s Kathedrale vorüber und durchquerte eine raue und übel riechende Gegend in Richtung Themseufer. Als sie die Fish Street mit den verfallenen Baracken und Lagerhäusern passierten, konnte der Anwalt sich nicht länger beherrschen.
»Würden Sie mir wenigstens verraten, welche Art von Geschäft Sie am Hafen zu erledigen haben?«
»Wir fahren zu einer Auktion.«
Oliver Birch schaute aus dem Fenster. Arbeiter, Taschendiebe und Huren schoben sich dicht gedrängt durch die Straßen. »Mylady, ich hoffe, dass Sie die Absicht haben, im Wagen zu bleiben und mir erlauben, einen Diener zu beauftragen, die Dinge zu erstehen, die Sie kaufen möchten.«
»Bedaure, Sir. Es ist äußerst wichtig, dass ich mich persönlich um die Angelegenheit kümmere.«
Der Anwalt klammerte sich an der Innenseite der Kutsche fest, als das Gefährt um die Ecke preschte und in den Hof eines baufälligen Gebäudes am Brooke’s Wharf einbog. Draußen stand eine seltsame Mischung aus gut gekleideten Gentlemen, schäbigen Händlern und Seeleuten herum und beteiligte sich an der Versteigerung, die augenscheinlich schon in vollem Gange war.
»Erklären Sie mir wenigstens, was Sie hier suchen, Lady Wentworth.« Birch kletterte zuerst aus der Kutsche. Obwohl von der Themse her ein scharfer Wind blies, herrschte im Innenhof ein entsetzlicher Gestank.
»Ich habe heute Morgen in der Gazette gelesen, dass auf dieser Auktion der Nachlass eines verstorbenen Arztes namens Dombey versteigert wird. Der Mann war bankrott und kam vor einem Monat aus Jamaika zurück.« Sie schlug den Kragen ihres wollenen Umhangs hoch und nahm dankbar die dargebotene Hand des Anwalts, als sie ausstieg. »Bevor er ins Schuldgefängnis geworfen werden konnte, verschied er vor ungefähr zehn Tagen.«
Rasch bahnte sich Millicent den Weg durch die Menge in die erste Reihe. Birch musste sich beeilen, um mit ihr Schritt zu halten. »Und warum, wenn die Frage erlaubt ist, interessieren Sie sich für Dr. Dombeys Besitz?«
Sie antwortete nicht. Der Anwalt beobachtete, wie die grauen Augen seiner Mandantin ängstlich über das persönliche Eigentum des Verstorbenen glitten, das auf einer behelfsmäßigen Plattform ausgestellt worden war. »Hoffentlich komme ich nicht zu spät.«
Birch verkniff sich weitere Fragen, als Millicent plötzlich auf die weit geöffneten Türen aufmerksam wurde, die ins Gebäude führten. Der Auktionsgehilfe zerrte eine schwächlich wirkende Afrikanerin hinter sich her, die in eine zerlumpte Decke gehüllt war und lediglich ein verdrecktes Kleid darunter trug. Jemand stellte eine Kiste auf die Plattform, und die alte Frau, deren Nacken, Hände und Füße in Fesseln lagen, wurde grob hinaufgeschoben.
Einen Moment lang schloss Birch die Augen. Angestrengt unterdrückte er den Ekel, der jedes Mal in ihm aufstieg, wenn er ansehen musste, mit welch barbarischem und unwürdigem Handel der Ruf der ganzen Nation in den Schmutz gezogen wurde.
»Schauen Sie, Gentlemen, schauen Sie. Diese Sklavin hat Dr. Dombey höchstpersönlich bedient«, rief der Auktionator. »Die Frau ist die einzige Negerin, die der alte Quacksalber aus Jamaika mitgeschleppt hat. Jaaaaa, schon gut, sie sieht komisch aus mit den tiefen Furchen im Gesicht. Sie ist fast so alt wie Methusalem. Aber, meine Gentlemen, man sagt ihr nach, sie sei eine echte Negerkönigin, ja wahrlich, das ist sie, und sie soll ein helles Köpfchen haben. Die Alte ist gut dreißig Pfund wert, am besten, wir steigen ein bei … bei … einem Pfund.«
Die Menge johlte.
»Jaaaaa, schon gut, Gentlemen. Was halten Sie von zehn Shilling?«, schrie der Auktionator über die Köpfe der brüllenden Menschen hinweg. »Schauen Sie her, die Zähne sind einwandfrei.« Gewaltsam öffnete er der Frau den Mund. An den eingerissenen Lippen klebte verkrustetes Blut. »Zehn Shilling? Wer bietet mehr als zehn Shilling?«
»Wofür zum Teufel soll die Alte zu gebrauchen sein?«, kreischte jemand.
»Fünf Shilling. Wer bietet mehr als fünf?«
»Die Frau ist nichts als ein Haufen Dreck«, brüllte ein anderer. »In Port Royal hätte man sie an der Kaimauer verrecken lassen.«
Birch warf Millicent einen besorgten Blick zu und bemerkte einen schmerzlichen Ausdruck auf ihrem Gesicht. Tränen schimmerten ihr an den Wimpern.
»Mylady, das ist nicht der richtige Ort für Sie«, flüsterte er. »Sie sollten sich solche Szenen nicht mit eigenen Augen ansehen. Was auch immer Sie gesucht haben, hier werden Sie es sicher nicht mehr finden.«
»In der Annonce hieß es, sie sei ein erstklassiges afrikanisches Mädchen.« Ein Kaufmannsgehilfe mittleren Alters, der sich an der Ecke der Plattform platziert hatte, grinste höhnisch und schleuderte eine zusammengeknüllte Gazette nach der alten Frau. »Dabei ist sie sogar zu alt, um mit ihr noch …«
»Fünf Pfund«, rief Millicent laut.
Auf einen Schlag waren alle Blicke auf sie gerichtet, und den Leuten blieb das Geschrei im Hals stecken. Sogar dem Auktionator schien es für einen Moment die Sprache verschlagen zu haben. Birch bemerkte, dass die alte Frau die Lider ein wenig geöffnet hatte und Millicent anstarrte.
»Aye, aye, Lady, wie Sie wünschen. Ihr Gebot ist …«
»Sechs Pfund.« Das zweite Gebot kam mitten aus der Menge, und wie auf Befehl drehten die Leute den Kopf und wandten den Blick in den hinteren Bereich des Innenhofs. Erneut verstummte der Auktionator.
»Sieben«, erwiderte Millicent.
»Acht.«
Der Auktionator auf der Plattform verzog das Gesicht zu einem breiten Grinsen, als die Menge auseinander fuhr und die Sicht auf einen adrett gekleideten jungen Mann freigab, der eine zusammengerollte Zeitung in die Höhe streckte. »Aaah, wie ich sehe, geht Mr Hydes Gehilfe mit. Harry, danke für dein Gebot«
»Zehn Pfund«, sagte Millicent mit Nachdruck.
In Sekundenschnelle musterte Birch die Kutschen, die aufgereiht im Innenhof standen, und fragte sich, aus welcher Jasper Hyde wohl seine Befehle erteilte. Der Mann besaß ausgedehnte Plantagen auf den Westindischen Inseln und war angeblich ein guter Freund des jüngst verstorbenen Gutsherrn und Großgrundbesitzers Wentworth gewesen. Sofort nach Wentworths Tod hatte sich Hyde dessen gesamte Ländereien in der Karibik zu eigen gemacht, da sein Freund bei ihm enorme Schulden gemacht hatte. Als wäre das nicht genug gewesen, hatte Mr Hyde sich gleich nach seiner Ankunft in England Lady Wentworth gegenüber als oberster Schuldeneintreiber aufgespielt und die restlichen Wechsel und Schuldscheine aufgekauft, die der Großgrundbesitzer hinterlassen hatte.
»Zwanzig.«
Ungläubig schnappte die Menge nach Luft und bewegte sich unruhig hin und her.
»Dreißig.«
Der Anwalt wandte sich an Millicent. »Mylady, er treibt nur sein Spielchen mit Ihnen«, warnte er leise. »Ich glaube, es ist nicht klug, wenn Sie …«
»Fünfzig Pfund«, bot der Diener und verzog keine Miene.
Ein paar Matrosen am Rand der Plattform drehten sich herum und beschimpften den Mann lautstark, weil er den Preis schamlos in die Höhe trieb.
»Ich darf ihn auf keinen Fall gewinnen lassen. Dr. Dombey und diese Frau haben viel Zeit und Arbeit in die Plantage der Wentworths auf Jamaika investiert. Jonah und andere Leute auf Melbury Hall erzählen Geschichten, die mir klargemacht haben, dass ihm diese Frau mit den Jahren sehr wichtig geworden war.« Sie nickte dem Auktionator zu. »Sechzig Pfund.«
Birch bemerkte, dass Jasper Hydes Gehilfe leicht zuckte, sich umwandte und zu den Kutschen hinüberschaute. Die Hand mit der eingerollten Zeitung ging in die Höhe, bevor der Ausrufer das letzte Gebot wiederholte. »Siebzig.«
Die Menge raunte noch vernehmlicher als vorher. Einige Leute forderten unmissverständlich, dass der Gehilfe die Sklavin besser der Frau überlassen solle. Die Matrosen kamen bedrohlich nah auf den Mann zu und stießen obszöne Flüche aus.
»Für Mr Hyde ist die Auktion nichts anderes als ein grausames Spiel«, wisperte Millicent und drehte sich von der Plattform weg. »Es gibt zahllose Berichte über die unbarmherzige Gewalt, die auf seinen Plantagen herrschen soll. Noch schlimmer sind die Erzählungen darüber, was er getan hat, nachdem er das Land und die Sklaven meines Mannes an sich gerissen hatte. Er glaubt sich niemandem verantwortlich und denkt nicht einmal im Traum daran, sich an die wenigen Gesetze zu halten, die es dort gibt. Diese Frau dort kann all seine Grausamkeiten bezeugen. Er wird ihr wehtun. Vielleicht wird er sie sogar töten.« Sie ballte die Hand zur Faust. »Sir Oliver, ich bin es meinen Leuten schuldig. Nach all der Not und dem Elend, das sie unter Wentworth zu erdulden hatten. Wie soll ich ruhig schlafen, wenn ich diese Frau nicht retten kann? Denken Sie nur an die anderen, die ich im Stich gelassen habe. Hyde hat sie alle in der Hand!«
»Geben Sie auf, Mylady?«, drängte der Auktionator. »Geben Sie auf?«
»Achtzig«, erwiderte sie mit zittriger Stimme.
»Ausgeschlossen, Mylady«, widersprach Birch bestimmt. »Das können Sie sich nicht leisten. Denken Sie an die Schuldscheine Ihres Ehemannes, die Hyde aufgekauft hat. Sie haben die Rückzahlung schon einmal aufgeschoben. Aber im nächsten Monat ist wieder eine Rate fällig, und wenn Sie nicht zahlen können, haften Sie persönlich, mit all Ihrem Besitz. Einschließlich Melbury Hall! Sie dürfen nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen.«
»Einhundert Pfund!!!« Der Gehilfe schrie sein Gebot geradezu heraus, doch seine Stimme wurde von der aufgewühlten Menge förmlich verschluckt. Birch schaute zu, wie der Mann sich nervös in Richtung Kutsche zurückzog, während die wütenden Matrosen gefährlich nah kamen.
»Eins zehn, Mylady?«, rief der Auktionator von der Plattform herunter und grinste aufgeregt.
»Sie können nicht jede einzelne Seele retten, Millicent«, zischte Birch. Als er vor einem Jahr von Lord und Lady Stanmore gebeten worden war, sich um die geschäftlichen Angelegenheiten der Lady Wentworth zu kümmern, hatte man ihm berichtet, dass sie sich mit aller Kraft um die Sklaven bemühte, die für ihren verstorbenen Mann gearbeitet hatten. Aber das Ausmaß ihrer Treue übertraf seine kühnsten Erwartungen.
»Ich weiß, Sir Oliver.«
»Wir wissen noch nicht einmal, ob die Frau ihm nicht schon längst gehört. Vielleicht ist er mit Dombey genauso verfahren wie mit dem Land und dem Besitz Ihres verstorbenen Gatten. Es könnte sogar sein, dass Jasper Hyde mit allen Mitteln versucht, Sie finanziell zu ruinieren.«
Mutlos ließ Millicent die Schultern hängen, als sie die Vermutung des Anwalts begriffen hatte. Sie wischte sich eine Träne von der Wange, drehte sich herum und schob sich durch die Menge zur Kutsche. Auf halbem Weg wirbelte sie herum und hob die Hand.
»Einhundertzehn.«
Die Umherstehenden schrien auf und bahnten eine Gasse, als Millicent den Blick quer durch den matschigen Hof auf den blassen Diener richtete. Der Mann hatte sich bereits hinter die Menge zurückgezogen, gab dem Auktionator durch Kopfschütteln zu verstehen, dass er aussteigen wolle, und schaute Millicent an. »Lady Wentworth kann Ihre Negerin haben. Für einhundertzehn Pfund.«
Die Matrosen schäumten vor Wut, als sie den spöttischen Tonfall des Mannes vernahmen und sein verächtliches Grinsen bemerkten. Zwei Seeleute stürmten auf den Gehilfen zu, der fluchtartig den Hof verließ. Birch unterdrückte den Impuls, sich der Verfolgungsjagd anzuschließen, denn er zweifelte nicht eine Sekunde daran, dass der ganze Handel sorgfältig eingefädelt worden war. Kurz darauf kamen die beiden Matrosen allein zurück.
»Sir Oliver«, meinte Millicent und legte ihm sanft die Hand auf den Arm, »ich musste das Leben dieser Frau retten, egal was Mr Hyde im Schilde führt.«
Millicent Gregory Wentworth galt nicht gerade als Schönheit, und sie kleidete sich keineswegs nach der neuesten Mode, wie man es von einer Dame ihres Standes in London durchaus hätte erwarten können. Aber was ihr an Schönheit und Eleganz fehlte, konnte sie durch Würde und Warmherzigkeit mehr als ausgleichen. Und das, obwohl ihr bisheriges Leben eine Anreihung unglücklicher Vorfälle gewesen war.
Respektvoll nickte Birch seiner Mandantin zu. »Mylady, warum warten Sie nicht in der Kutsche auf mich? Ich kümmere mich inzwischen um die Einzelheiten.«
Genau an der Stelle, wo vorher die Sklavin gestanden hatte, wurde jetzt ein kleines Schreibpult aufgebaut. Millicent beobachtete, wie ein paar Leute nach vorn drängten, um das Möbelstück besser beäugen zu können. Offenbar waren sie weit mehr an dem Hausrat interessiert als an dem Menschenleben, das vor wenigen Minuten versteigert worden war. Einzig und allein der Wettstreit der Gebote hatte ihre Aufmerksamkeit erregt. Millicent drehte sich um und musterte die Frau, die, gefolgt von Sir Oliver, durch den Hof geführt wurde.
Angewidert von der herzlosen Auktion bahnte Millicent sich den Weg durch die Menge zur Kutsche.
»Ich werde die Sklavin heute Nachmittag in mein Büro bringen lassen«, bemerkte Sir Oliver, als er kurze Zeit später ebenfalls in den Wagen stieg. »Wenn Sie nicht wollen, dass sie zu Ihrer Schwester gebracht wird, kümmere ich mich um eine Unterkunft, bis Sie nach Melbury Hall zurückfahren.«
»Danke. Wir werden morgen früh abreisen«, erwiderte Millicent.
»Seien Sie versichert, Mylady, dass ich die Angelegenheit mit äußerster Diskretion behandeln werde.«
»Das weiß ich«, meinte sie und schaute aus dem Fenster der Kutsche hinüber zur Baracke, in die die alte Frau geleitet wurde. Unwillkürlich fragte sie sich, wie viel Leid diese schrecklichen Menschen der Frau noch zufügen würden, bis sie heute Nachmittag endlich ins Büro des Anwalts gebracht werden würde.
Schweigend fuhren sie durch die Stadt, und Millicent musste an das Geld denken, das sie gerade ausgegeben hatte. Einhundertzehn Pfund. Das entsprach sieben Monatsgehältern aller zwanzig Angestellten, die sie auf Melbury Hall beschäftigte, die Landarbeiter nicht mitgerechnet. Es stimmte, dass der Preis für die schwarze Frau empfindlich in ihr rasch schwindendes Budget schnitt. Dabei hatte sie nicht einmal die Summe berücksichtigt, die sie Jasper Hyde nächsten Monat würde zahlen müssen. Millicent fuhr sich mit den Fingerspitzen über den leise pochenden Schmerz in den Schläfen und rief sich ins Gedächtnis zurück, welche Wohltat es sein würde, diese Frau nach Hertfordshire zu bringen.
»Lady Wentworth«, sagte der Anwalt schließlich, als sie sich ihrem Ziel näherten, »wir müssen uns endlich über die Gräfinwitwe Aytoun unterhalten. Ich tappe immer noch vollkommen im Dunkeln, warum wir sie überhaupt aufsuchen.«
»Mir geht es genauso«, entgegnete Millicent müde und erschöpft. »Die Einladung traf vor drei Tagen auf Melbury Hall ein, und ihr Diener wollte das Haus nicht ohne eine Antwort verlassen. Ich bin gebeten worden, mich heute Vormittag um elf mit meinem Anwalt in Lord Aytouns Haus am Hanover Square einzufinden. Das ist alles.«
»Das klingt eilig. Kennen Sie die Lady?«
Millicent schüttelte den Kopf. »Nein. Aber vor einem Jahr kannte ich Mr Jasper Hyde auch noch nicht. Oder das halbe Dutzend Gläubiger, das nach Wentworths Tod aus allen Löchern gekrochen kam.« Sie zog den Umhang fester zusammen. »Eines habe ich in den letzten anderthalb Jahren gelernt. Mein Gatte schuldet diesen Leuten Geld, und ich kann mich vor ihnen nicht verstecken. Ich muss ihnen ins Gesicht sehen, einem nach dem anderen. Und ich muss versuchen, mich mit diesen Leuten vernünftig über die Rückzahlung der Schulden zu einigen.«
»Ihre Bemühungen sind bewundernswert, Mylady, doch wir beide wissen, dass Sie an dieser drückenden Last beinahe zerbrechen. Ich sehe kaum noch einen Ausweg.« Er hielt kurz inne. »Lady Wentworth, Sie haben großzügige Freunde. Wenn Sie mir gestatten, sie mit einem kleinen Wink über Ihre missliche Lage …«
»Nein, Sir«, unterbrach sie ihn scharf. »Ich schäme mich nicht für meine Armut. Aber Betteln empfinde ich als unwürdig. Ich will kein Wort mehr davon hören!«
»Wie Sie wünschen, Mylady.«
Millicent nickte ihrem Anwalt dankbar zu. Sir Oliver leistete ausgezeichnete Dienste, und sie vertraute darauf, dass er ihren Wunsch respektierte.
»Vielleicht beruhigt es Sie«, fuhr er fort, »dass die Gräfinwitwe Aytoun sich in anderen Kreisen bewegt als Mr Hyde oder Ihr verstorbener Ehemann. Sie ist überaus wohlhabend, und man sagt ihr nach, dass sie außerordentlich … nun ja, sehr vorsichtig mit ihrem Geld umgeht. Sie soll sogar so geizig sein, dass ihre eigene Dienerschaft mit ihr um den verdienten Lohn streiten muss. Kurz und gut, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einem Landadligen wie Wentworth jemals Geld geliehen hat.«
»Es freut mich, das zu hören. Ich hätte mir denken können, dass Sie mich nicht vollkommen unvorbereitet in die Unterredung gehen lassen. Was wissen Sie noch, Sir Oliver?«
»Es handelt sich um Lady Archibald Pennington, Gräfin Aytoun. Ihr Taufname ist Beatrice. Sie ist seit über fünf Jahren verwitwet. Geboren ist sie in Schottland, und in ihren Adern fließt das Blut der Highlander. Sie stammt aus einem alten Geschlecht und hat außerdem eine vorteilhafte Ehe geschlossen.«
»Hat sie Kinder?«
»Drei Söhne. Sie sind bereits alle erwachsen. Lyon Pennington ist der vierte Lord Aytoun. Der Zweitgeborene, Pierce, hat trotz der Handelsblockade offenbar ein großes Vermögen in den amerikanischen Kolonien gemacht. David Pennington, der jüngste Sohn, ist Offizier in der Armee Seiner Majestät Lady Aytoun hat ruhig und zurückgezogen gelebt – bis zu jenem Skandal im letzten Sommer, der ihre Familie auseinander gerissen hat.«
»Ein Skandal?«
Sir Oliver nickte. »In der Tat, Mylady. Es ging um eine junge Dame namens Emma Douglas. Mir ist zu Ohren gekommen, dass alle drei Brüder ein Auge auf sie geworfen hatten. Sie hat schließlich den ältesten geheiratet, und vor zwei Jahren wurde sie Lady Aytoun.«
Die Geschichte klang zwar nicht besonders skandalös, aber Millicent hatte keine Gelegenheit nachzufragen, da die Kutsche bereits vor einem eleganten Herrenhaus mit Blick auf den Hanover Square einfuhr. Ein Lakai in goldbetresster Livree öffnete den Schlag, und ein anderer Diener begleitete Millicent und den Anwalt die ausladenden Marmorstufen zum Eingang hinauf.
In der Empfangshalle wurden sie von einem weiteren Dienstboten begrüßt. Millicent legte den Umhang ab und sah sich um. Ihr Blick fiel auf den halbrunden Alkoven am anderen Ende der Halle sowie auf die kunstvoll vergoldeten Schnörkel und Rosetten, die an der hohen verzierten Decke prangten. In einem Empfangsbereich am Ende einer Reihe geöffneter Türen bemerkte sie geschmackvoll arrangierte, walnussbraune Polstermöbel von Sheraton und Chippendale, während das hell glänzende Parkett mit wundervollen Teppichen bedeckt war.
Ein großer älterer Butler kam zu ihnen und erklärte, dass die Witwe sie bereits erwartete.
»Was hat es mit diesem Skandal auf sich?«, wisperte Millicent, als sie dem Butler und einem weiteren Diener die geschwungene Treppe hinauf in den Salon folgten.
»Nichts als Gerüchte, Mylady«, flüsterte Birch zurück. »Man sagt, der Lord soll seine Frau ermordet haben.«
»Aber das ist …«
Sie brach ab, als die Tür zum Salon geöffnet wurde. Angestrengt versuchte Millicent, den Schreck und die Neugierde im Zaum zu halten, während der Butler den Besuch ankündigte.
Im behaglich eingerichteten Salon befanden sich vier Leute: die Gräfinwitwe, ein blasser Gentleman, der neben dem aufgeschlagenen Hauptbuch an einem Tisch stand, und zwei Zofen der Lady.
Lady Aytoun war eine ältere, offensichtlich kränkliche Dame. Sie saß auf einem Sofa, lehnte gegen mehrere Kissen und hatte eine Decke über den Schoß gebreitet. Aus ihren blauen Augen, die hinter den Augengläsern blitzten, musterte sie den Besuch.
Millicent machte einen leichten Knicks. »Bitte verzeihen Sie die Verspätung, Mylady.«
»War die Auktion erfolgreich?«, fragte Lady Aytoun unvermittelt, und ihre Schroffheit veranlasste Millicent, Sir Oliver einen überraschten Blick zuzuwerfen. Er schien ebenso überrascht wie sie. »Die afrikanische Frau. Haben Sie sie ersteigert?«
»Ich … ja«, stammelte Millicent. »Aber woher wissen Sie …?«
»Wie viel?«
Millicent sträubte sich gegen das Verhör, doch gleichzeitig empfand sie keinerlei Scham für das, was sie getan hatte. »Einhundertzehn Pfund. Obwohl ich nicht recht begreife, was Sie meine Angelegenheiten …«
»Schlagen Sie es auf den Gesamtbetrag, Richard«, befahl die Witwe und winkte dem Mann zu, der immer noch neben dem Tisch stand. »Eine teure Angelegenheit.«
Sir Oliver trat vor. »Gestatten Sie die Bemerkung, Mylady …«
»Junger Mann, sparen Sie sich Ihre Worte. Setzen Sie sich. Alle beide.«
Millicents Anwalt war schon seit Jahrzehnten nicht mehr mit ›junger Mann‹ angesprochen worden. Einen Moment lang starrte er die alte Dame mit offenem Mund an. Nachdem Millicent und er ihrer Anordnung nachgekommen waren, schickte sie die Zofen mit einer Handbewegung aus dem Zimmer.
»Ausgezeichnet. Ich kenne Sie beide, und Sie kennen mich. Der blasse Knochen dort drüben ist Sir Richard Maitland, mein Anwalt.« Mit hochgezogenen Augenbrauen wies die alte Dame auf den unscheinbaren Mann. Der Anwalt verbeugte sich steif und setzte sich ebenfalls. »Und jetzt sollen Sie erfahren, warum ich Sie eingeladen habe.«
Millicent hatte nicht die geringste Ahnung, was sie erwartete.
»Meine Leute erstatten mir seit einiger Zeit Bericht über Sie, Lady Wentworth. Sie übertreffen alle meine Erwartungen.« Lady Aytoun nahm die Augengläser ab. »Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Ich habe Sie eingeladen, weil ich Ihnen ein Geschäft vorschlagen möchte.«
»Ein Geschäft vorschlagen?«, murmelte Millicent.
»Allerdings. Ich will, dass Sie meinen Sohn, Lord Aytoun, heiraten. Mit einer Sondergenehmigung. Noch heute.«
KapitelZwei
Entrüstet sprang Millicent auf. Um keinen Preis der Welt würde sie noch einmal durch die Hölle gehen.
»Lady Aytoun, hier liegt ein schwerer Irrtum vor.«
»Nein, das glaube ich nicht.«
»Ihr Diener muss sich in der Adresse geirrt haben.«
»Nehmen Sie wieder Platz, Lady Wentworth.«
»Ich fürchte, dazu bin ich nicht in der Lage.« Millicent schaute zu ihrem Anwalt hinüber und stellte fest, dass er sich ebenfalls erhoben hatte.
»Ich bitte Sie, Lady Wentworth. Es gibt keinen Grund zur Panik.« Die Stimme der Witwe klang besänftigend. »Ich bin mir durchaus bewusst, dass Sie Angst haben. Man hat mich umfassend darüber informiert, welche Qualen Sie in Ihrer Ehe zu erdulden hatten. Aber das, was ich Ihnen anbiete, hat nichts mit der Tyrannei zu tun, in die Ihr gewalttätiger erster Ehemann Sie gezwungen hatte.«
Verwirrt starrte Millicent die alte Dame an und fragte sich, woher diese so genau Bescheid über ihre Umstände wusste. Die Witwe plauderte über das Leben ihrer Besucherin, als sei es der Öffentlichkeit bis in alle Einzelheiten bekannt, und Millicent verspürte ein mulmiges Gefühl in der Magengegend. Noch immer kämpfte sie gegen den Impuls, zur Tür zu rennen. Am liebsten wäre sie auf der Stelle aus dem Haus geflüchtet und nach Melbury Hall zurückgekehrt.
Für Millicent bedeutete die Ehe, dem Mann mit Haut und Haar zu gehören, als sei sie sein Eigentum. Fünf endlose Jahre lang hatte sie dieses zweifelhafte Glück auskosten dürfen. Eine verheiratete Frau konnte keinen Beistand erwarten. Verheiratet sein, das hieß für sie, seelisch und körperlich missbraucht zu werden. Darüber ließ Millicent nicht mit sich diskutieren. In ihren Ohren klang das Ehegelöbnis wie ein Fluch, den die Männer erfunden hatten, um ihre Herrschaft über die Frauen zu besiegeln. Nach Wentworths Tod hatte sie sich geschworen, sich nie wieder einem solchen Joch zu beugen.
Millicent machte einen Schritt in Richtung Tür.
»Gestatten Sie mir, dass ich Ihnen erkläre, was ich mit meinem Angebot bezwecke.« Die Witwe streckte ihr die Hand entgegen. »Ich weiß, dass ich Sie vorhin förmlich überfallen habe. Ich bin sicher, dass Sie besser verstehen werden, warum ich Ihnen das Angebot mache, wenn Sie mir die Gelegenheit geben, Ihnen darzulegen, in welch unangenehmer Situation meine Familie sich befindet.«
»Mylady, es ist vollkommen unnötig, mich über die Lage Ihrer Familie aufzuklären. Wenn Sie auch nur irgendetwas über meine Geschichte wüssten, dann hätten Sie begriffen, dass mein Abscheu vor der Ehe sich durch nichts verändern lässt, was Sie mir über Ihre eigene Familie erzählen könnten. Das Thema widert mich an, Lady Aytoun, und unter keinen Umständen bin ich bereit …«
»Mein Sohn ist ein Krüppel«, unterbrach die Witwe. »Im vergangenen Sommer hatte er einen schrecklichen Unfall erlitten. Seitdem kann er seine Beine nicht mehr bewegen, und in einem Arm fehlt ihm jegliche Kraft. Er ist in eine tiefe Melancholie versunken, aus der er sich nicht mehr selbst befreien kann. Ich danke Gott für die Treue und die Beharrlichkeit, mit der sein Leibdiener und ein halbes Dutzend anderer Leute sich um sein Wohlbefinden kümmern. Ohne sie wäre ich verloren gewesen und hätte keine andere Wahl gehabt, als ihn in ein Spital für Geisteskranke einzuweisen. Ich scheue mich nicht, Ihnen zu gestehen, dass mich ein solcher Schritt ganz sicher ins Grab gebracht hätte.«
Die Verzweiflung der alten Dame berührte Millicents Herz. »Sie können sich sicher sein, dass ich mit Ihnen fühle, Mylady, aber ich sehe nicht, wie ich Ihnen helfen kann.«
Mit zitternden Händen strich die Witwe sich die Decke auf dem Schoß glatt. »Lassen Sie sich durch mein forsches Auftreten nicht täuschen, Lady Wentworth. Ich bin krank. Offen gesagt, ich werde bald sterben. Und meine Ärzte, der Teufel soll sie holen, erinnern mich jeden Tag daran, dass ich den nächsten Sonnenaufgang nicht mehr erleben könnte.«
»Wirklich, Mylady, ich …«
»Verstehen Sie mich nicht falsch. Wegen mir braucht niemand eine Träne zu vergießen. Ich habe mein Leben in vollen Zügen genossen. Nein, meine größte Sorge gilt Lyon. Was soll aus ihm werden, wenn ich tot bin? Deswegen habe ich Sie heute zu mir eingeladen.«
»Aber … es gibt andere Möglichkeiten. Familie. Freunde. Menschen aus Ihren Kreisen, die Ihnen näher stehen als ich. Lord Aytoun ist eine begehrte Partie, und ich bin mir sicher, dass Sie sich vor Bewerberinnen kaum retten können.«
»Ich bitte Sie, Lady Wentworth, setzen Sie sich. Lassen Sie mich erklären.« Die strenge Miene, mit der sich die Witwe präsentiert hatte, als sie den Salon betreten hatten, war vollkommen verschwunden. Jetzt erblickte Millicent nur das Gesicht einer anderen Frau. Einer sterbenden Frau. Sie sah eine Mutter, die sich um das Wohl ihres Sohnes den Kopf zerbrach.
Zögernd setzte sich Millicent. Die Witwe schien offensichtlich erleichtert.
»Danke. Wir hatten über die Familie gesprochen. Die anderen sind der Meinung, dass Lyon ins Irrenhaus gehört, wenn mir etwas zustößt.« Die blauen Augen der alten Dame blitzten wütend. »Aber Lord Aytoun ist nicht geisteskrank. Er gehört nicht nach Bedlam. Ich werde es nicht zulassen, dass man ihn knebelt und quält, ihm Opium verabreicht und ihn dem Gespött der Londoner Gesellschaft ausliefert.«
»Es muss doch Möglichkeiten geben, Menschen in seinem Zustand zu behandeln. Mir scheint, es werden täglich neue Heilmittel gegen immer neue Beschwerden gefunden.«
»Ich habe alles probiert und große Summen ausgegeben«, erklärte Lady Aytoun. »Bis heute gibt es allerdings keinerlei Fortschritt. Und ich bin es leid, mich mit Scharlatanen und windigen Geschäftemachern herumzuplagen, die von den Lügen dieser Quacksalber profitieren und meinem Sohn seltsame Pillen verabreichen, die nicht die geringste Wirkung haben. Seine Beine und sein Arm waren gebrochen. Jetzt sind sie jedoch geheilt, und dennoch ist er nicht in der Lage, seine Gliedmaßen zu bewegen. Er kann nicht gehen. Diese selbst ernannten Ärzte behaupten, er habe sich heimlich mit einer Seuche infiziert. Diejenigen mit Universitätsabschluss haben lediglich eine einzige Empfehlung: den Aderlass und wieder nur den Aderlass. Aber es nützt nichts.«
»Das tut mir außerordentlich Leid, Mylady …«
»Mir auch«, entgegnete die Witwe und schaute Millicent direkt in die Augen. »Doch ich kann es nicht länger ertragen. Ich will verhindern, dass mein Sohn in eine Anstalt eingeliefert wird. Ich kann diese Kurpfuscher mit ihren widerlichen Tees nicht mehr sehen. Ich bin fertig mit ihnen.«
»Sie haben Recht, draußen auf der Straße tummeln sich viele Scharlatane. Aber es muss doch auch ein paar ehrenwerte Ärzte geben!«
»Ja, es gibt sie. Allerdings sind auch die ehrenwerten Ärzte, wie Sie sie nennen, mit ihrem Latein am Ende. Abgesehen von Aderlass schlagen sie nichts als Betäubungsmittel vor.«
»Warum? Ist er etwa gewalttätig?«
»Natürlich nicht«, versicherte die Witwe. »Aber auf Baronsford, dem Familiensitz südöstlich von Edinburgh, war er schrecklich unglücklich. Dort ist der Unfall geschehen. Diesen Herbst hat er sogar darauf bestanden, seinem Bruder Pierce die Verwaltung sämtlicher Güter zu übertragen. Pierce ist mein zweitgeborener Sohn. Lyons überstürzte Entscheidung hat niemandem genützt. Pierce hält sich zurzeit nicht in England auf, und er zeigt nicht das geringste Interesse am Familienbesitz. Außerdem ist Lyon der Lord. Er ist derjenige, zu dem die Untertanen aufschauen werden und …« Sie brach plötzlich ab und machte eine wegwerfende Handbewegung. »Baronsford ist im Moment das kleinste Problem. Ich habe unsere Unterhaltung nur darauf gelenkt, damit Sie wissen, warum ich ihn von dort wegbringen muss. Ich muss einen Ort für meinen Sohn Finden, an dem er nicht dauernd an die Vergangenheit erinnert wird und an das, was er verloren hat.«
Millicent hatte sich wieder beruhigt. Schließlich wusste sie, dass niemand sie zu irgendeiner Entscheidung zwingen konnte. Sie hatte die Wahl und musste die Konsequenzen tragen. »Ich begreife immer noch nicht, wie Ihr Angebot das Leben des Lords verbessern kann. Ich bin keine Ärztin, und ganz sicher bin ich nicht in der Lage …«
»Er muss Schottland dringend verlassen. Er braucht ein Zuhause, wo es Menschen gibt, die sich um ihn kümmern. Es ist kein Geheimnis, dass Sie den armen Seelen, die Wentworth als Sklaven gedient hatten, nach seinem Tod ein sicheres Obdach geboten haben.« Sie machte eine kleine Pause, bevor sie fortfuhr. »Vielleicht sollten Sie wissen, dass unser Arrangement für Sie ebenso vorteilhaft sein wird wie für meinen Sohn.«
Ohne die Antwort der jungen Millicent abzuwarten, veranlasste Lady Aytoun den Anwalt, ihr ein großes liniertes Papier zu überreichen.
»Meine Liebe, hier ist die Liste aller Anleihen und Schuldscheine, die Wentworth Ihnen vererbt hat. Wir hatten Schwierigkeiten, sie vollständig zu ermitteln. Möglicherweise fehlen noch ein paar Posten. Wenn Ihr Anwalt Zeit hat, kann er die Aufstellung prüfen. Wie Sie wissen, verschafft es manchen Zeitgenossen große Genugtuung, Seite für Seite in Ihrem Schuldbuch umzublättern und dabei zuzusehen, wie Sie langsam aber sicher kapitulieren.«
Millicent griff nach dem Papier und überflog die Auflistung der Schulden. Die Summe, die ganz am Ende notiert war, war enorm, aber Millicent verbot sich jede Regung. Schließlich wusste sie seit langem, dass ihr das Wasser bis zum Hals stand. Es spielte keine Rolle, wie hoch der Pegel zwischenzeitlich gestiegen war. Sie gab das Blatt an Sir Oliver weiter. »Was genau schlagen Sie vor, Lady Aytoun?«, fragte sie wie benommen.
»Eine Ehe, die nur auf dem Papier gültig ist. Nichts weiter als ein geschäftliches Arrangement. Wenn Sie den Bedingungen zustimmen, wird Lord Aytoun zwar bei Ihnen auf Melbury Hall wohnen, aber er wird seinen eigenen Butler und seine eigene Dienerschaft stellen. Wir haben einen neuen Arzt engagiert, der ihn regelmäßig von London aus aufsuchen kann. Sie müssen lediglich dafür sorgen, dass all die Leute genügend Platz bei Ihnen haben. Im Gegenzug wird sich mein Anwalt Maitland darum kümmern, dass die Schulden auf dieser Liste einschließlich derer, von denen wir noch keine Kenntnis haben, in voller Höhe von uns beglichen werden. Darüber hinaus wird Ihnen eine großzügige Summe zum Ausgleich für die Kosten zur Verfügung gestellt, die Ihnen auf Melbury Hall entstehen. Es wird mehr als genug sein. Dadurch können sie sich beruhigt weiter um Ihre Angelegenheiten kümmern.«
Die Worte der Witwe wirbelten Millicent im Kopf herum. Zahllose Nächte hatte sie grübelnd im Bett gelegen und wieder und wieder ihre Ausgaben durchgerechnet. Besonders das letzte halbe Jahr war schwierig gewesen, und jetzt bot Lady Aytoun ihr die Gelegenheit, sich ein für alle Mal von den Fesseln zu befreien, die die Schulden ihres verstorbenen Mannes ihr angelegt hatten. Aber der Gedanke an das Opfer, das sie würde erbringen müssen, bohrte sich tief in ihr Innerstes: Sie würde ein zweites Mal heiraten müssen.
»Was geschieht mit unserer Vereinbarung, wenn Lord Aytoun sich von seiner Krankheit erholt?«
»Ich fürchte, wir dürfen uns keinen falschen Hoffnungen hingeben. Keiner der Ärzte, die ihn zuletzt gesehen haben, glaubt daran, dass …« Die Witwe hielt kurz inne, um das Zittern in ihrer Stimme besser beherrschen zu können. »Keiner glaubt, dass er jemals wieder gesunden wird.«
»Doch es könnte sein.«
»Ich beneide Sie um Ihre Zuversicht.«
»Ich bestehe auf einer Klausel in der Vereinbarung, die vorsieht, dass im Fall der Genesung unverzüglich die Scheidung erfolgt.«
Die Witwe warf ihrem Anwalt einen forschenden Blick zu.
Sir Richard nickte kurz und erhob sich. »Wenn wir den Charakter der Abmachung und die gegenwärtige Gesundheit des Lords berücksichtigen, dürfte sich eine Annullierung der Ehe rasch arrangieren lassen.«
Sir Oliver stimmte ihm zu. »Bei seinem Geisteszustand läge nichts näher als eine Annullierung.«
Millicent konnte es kaum glauben, dass sie ihre Entscheidung praktisch schon gefällt hatte. Insgeheim stellte sie bereits Gewinn und Verlust gegenüber, und die Wange neigte sich deutlich nach einer Seite.
»Haben Sie noch weitere Fragen? Oder gibt es Zweifel, die Sie plagen?«
»Ja, Mylady.« Millicent hob das Kinn. »Warum ich? Ich bin Ihnen doch vollkommen fremd. Warum haben Sie mich gewählt?«
»Unsere Entscheidung ist nach reiflicher Überlegung gefallen. Die Suche war mühsam und langwierig, meine Anforderungen sind anspruchsvoll, und der Auftrag war für meinen Anwalt eine große Herausforderung. Aber nachdem mir zu Ohren gekommen war, dass Sie trotz Ihrer Vergangenheit ein warmherziger Mensch sind und Sir Richard mir alles berichtet hat, was er über Ihre derzeitige finanzielle Situation in Erfahrung zu bringen wusste, kann ich Ihnen versichern, dass ich Sie für die ideale Kandidatin halte.« Die alte Dame nickte beifällig. »Ich hoffe, Sie sind nicht zu sehr gekränkt, dass meine Leute Ihr Leben ausspioniert haben. Es gibt nur wenige Dinge, die ich nicht über Sie weiß.«
Überrascht hob Millicent eine Augenbraue. In der Vergangenheit hatte sie ausgesprochen zurückgezogen gelebt, und sie bezweifelte, dass Lady Aytoun irgendein Geheimnis zu Tage gefördert hatte.
»Mylady, ich bin neugierig. Was haben Ihre Leute über mich ausgegraben? Geben Sie mir ein Beispiel.«
»Wie Sie wünschen. Sie heißen Millicent Gregory Wentworth und sind neunundzwanzig Jahre alt. Seit anderthalb Jahren sind Sie verwitwet. Es war eine arrangierte Ehe, zu der Ihre Familie Sie gezwungen hat.«
»Das sind Fakten, die jedermann leicht herausfinden kann. Überdies sagen sie nichts über den Menschen aus.«
»Da muss ich Ihnen Recht geben. Doch meine heutige Begegnung mit Ihnen hat mich in meiner Meinung über sie bestätigt. Aber weiter: Wenn man davon absieht, dass Sie gelegentlich auf Ihrem Familiensitz übernachten, wie beispielsweise während dieser Reise nach London, sind Sie Ihrer Verwandtschaft praktisch vollkommen entfremdet. Ich mache Ihnen daraus keinen Vorwurf. Ihre Familie besteht aus zwei älteren Schwestern und einem Onkel, dem Sie nicht mehr vertrauen, seit er Sie mit Wentworth verkuppelt hat, ohne vorher Erkundigungen über den Charakter des Mannes einzuholen.« Die Gräfinwitwe strich die Decke über den Knien glatt. »Ihre Familienbande sind nicht besonders eng. In den fünf Jahren Ihrer Ehe haben Sie keinem ihrer Angehörigen anvertraut, dass Ihr Mann Sie schändlich misshandelt. Sie haben sehr wenige enge Freunde, und Ihr Stolz verbietet es Ihnen, sie in ihrer verzweifelten Lage um Hilfe zu bitten. Was noch? Ach ja, Sie befreien Ihre Sklaven …«
»Die Sklaven meines verstorbenen Mannes.«
»Allerdings. Wenn Sie dieser Tage von Ihren Schulden beinahe erschlagen werden, dann liegt es zum Teil an den Unkosten, die Ihnen zusätzlich dadurch aufgebürdet werden, dass Sie das Los dieser unglücklichen Menschen verbessern wollen.« Die Witwe ließ den Blick über Millicents Gesicht schweifen. »Kommen wir zu den einfachen Dingen des Lebens. Sie sind mit Ihrem schmucklosen Aussehen zufrieden und interessieren sich weder für Mode noch haben Sie jemals besonderen Wert darauf gelegt, zur Londoner Gesellschaft zu gehören. Und seit Sie verwitwet sind, haben Sie sich hinter die schützenden Mauern Ihres Landsitzes Melbury Hall in Hertfordshire zurückgezogen.«
»Mylady, ich glaube nicht, dass ich seitdem irgendetwas Wichtiges verpasst habe.«
»Sehr richtig«, entgegnete Lady Aytoun. »Und das halte ich für ausgesprochen vorteilhaft. Sie werden weder die Partys in der Stadt während der Saison vermissen noch werden Sie Ihrem Ehemann vorwerfen, Sie nicht nach London oder Bath zu begleiten oder nach welchem Ort auch immer die Gesellschaft gerade verrückt ist. Außerdem sind Sie eine kluge und leidenschaftliche Frau. Sie haben die Vorzüge der Unabhängigkeit entdeckt, und Sie genießen die Macht, die sie mit sich bringt. Aber wenn Sie Erfolg haben wollen, könnte Ihnen der Schutz nützlich sein, der Ihnen unser Name bietet. Damit sperren Sie manch hungrigen Wolf vor die Tür.«
Millicent rang hart mit sich. Sie konnte die Unterstützung, die der Name Aytoun barg, tatsächlich gut gebrauchen, wenn sie ihre Pläne weiterverfolgen wollte. Es war beinahe unmöglich gewesen, einen fähigen Verwalter zu engagieren, der in der Lage war, Melbury Hall zu bewirtschaften. Sogar die Fahrt zur Auktion an der Themse hatte ihr bewiesen, dass man Frauen in der Öffentlichkeit nur unter männlicher Aufsicht akzeptierte.
Krampfhaft bemühte sich Millicent, ihren Ärger zu zügeln. Sie erinnerte sich an ihre beste Freundin, die zehn Jahre in Philadelphia zugebracht hatte. Rebecca hatte sich den Namen Mrs Ford zugelegt und vorgegeben, verheiratet zu sein, um sich mit ihrem Neugeborenen in der Stadt niederzulassen.
»Was halten Sie von meinem Angebot, Lady Wentworth?«
Millicent schüttelte die Zweifel ab und erwiderte den Blick der Witwe. »Warum heute? Warum ist es so wichtig, noch heute zu heiraten?«
»Meistens bleiben Sie nicht länger als ein oder zwei Tage von Melbury Hall fort. Ich vermute, dass Sie morgen früh wieder abreisen.«
»In der Tat.«
»Meine Ärzte haben mir prophezeit, dass ich nicht mehr viele Sonnenaufgänge erleben werde. Ich bringe es nicht fertig, das Schicksal dadurch herauszufordern, dass ich noch länger abwarte. Es steht zu viel auf dem Spiel.«
»Wie denkt Seine Lordschaft über das Arrangement, das Sie eingefädelt haben?«
Die Witwe atmete tief durch und ließ die Luft langsam aus den Lungen entweichen, bevor sie antwortete. »Es war mir nicht klar, ob es mir gelingen würde, Sie zu überzeugen. Ich habe meinem Sohn versichert, dass Sie einer Ehe nur zustimmen werden, weil Sie dringend auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind und nicht, weil Sie ein mitfühlendes Herz haben. Danach hat er sich einverstanden erklärt. Er wünscht kein Mitleid. Was auch immer man über Lyon sagen will, seinen Stolz wird er niemals verlieren.«
Lyon Pennington, der vierte Lord Aytoun, saß regungslos in seinem Sessel vor dem Fenster. Die Muskeln im hageren Gesicht des Adligen traten unter dem dunklen unrasierten Bart hervor. Sein Blick fixierte einen unsichtbaren Punkt irgendwo jenseits der Fensterscheibe inmitten des trostlosen Treibens auf dem Hanover Square.
Die zwei Diener hatten einen Brokatmantel, eine seidene Weste, eine schwarze Krawatte, Stiefel, Strümpfe und Überschuhe mit silbernen Schnallen für die Hochzeit bereitgelegt. Keiner der beiden Männer wagte es, sich dem Lord zu nähern. Sie warteten bei der Tür und sahen sich nervös an.
»Sie ist da«, flüsterte eine junge Frau, die ein Tablett mit Tee in Händen hielt.
Hastig stellte sie das Teeservice auf dem Tisch neben dem Lord ab. Sie knickste und gesellte sich dann zu den beiden Dienern an der Tür.
»Die Witwe meint«, wisperte sie einem der Lakaien zu, »dass der Besuch noch vor der Zeremonie nach Seiner Lordschaft sehen wird.«
Eine weitere Hausangestellte trat ein und brachte ein Tablett mit Gebäck. Gibbs, der Leibdiener des Lords, folgte ihr.
»Worauf wartet ihr?«, knurrte er die Diener an. »Seine Lordschaft könnte längst angekleidet sein.«
Als Gibbs einen Schritt auf die beiden Lakaien zumachte, setzten sie sich in Bewegung, um den Befehl zu befolgen. Der Leibdiener von Lyon Pennington war groß und mächtig wie die alten Eichen im Hirschpark auf Baronsford. In der Vergangenheit hatten die beiden Diener seinen Unmut oft zu spüren bekommen. Einer der Lakaien griff nach der ledernen Reithose seines Herrn und beobachtete unsicher den anderen, eher schmächtigen Diener, der Lord Aytouns Hemd in der Hand hielt. Sie zögerten, sich ihrem Herrn zu nähern.
Der Diener namens John wandte sich an Gibbs. »Seine Lordschaft war heute Morgen nicht besonders erpicht darauf, angekleidet zu werden«, flüsterte er ihm ängstlich zu, während die beiden weiblichen Hausangestellten eilig das Zimmer verließen.
»Jawohl, Mr Gibbs«, bestätigte der zweite Diener bedächtig. »Auf Ehre und Gewissen, Sir. Lord Aytoun hätte uns beinahe umgebracht, als wir versuchten, ihm die Kleidung anzulegen. Er wollte sich erst wieder beruhigen, nachdem wir ihm den Sirup einflößten, den der neue Doktor für ihn da gelassen hat.«
»Seine Lordschaft hat heute bereits seine Medizin bekommen?« Gibbs schäumte vor Wut, mäßigte seinen Tonfall aber sofort wieder. »Was fällt euch ein, ihm die Arznei jedes Mal zu verabreichen, wenn es euch in den Sinn kommt?«
»Aye, Sir. Doch die Dosis heute früh war wohl nicht hoch genug.«
»Würde meine Zeit es erlauben, ich würde euch beiden den Hals umdrehen …« Gibbs rang um Fassung. »Die Gesellschaft wartet bereits unten, und Seine Lordschaft ist noch nicht einmal angekleidet.«
»Er hat sich erst vor ein paar Minuten beruhigt.«
Gibbs musterte die Diener grimmig und bedeutete ihnen mit einer Handbewegung, ihm zu folgen, als er sich seinem Herrn näherte. »Mylord?«
Lyon hielt den Blick starr auf das Fenster gerichtet, weder schlief er noch war er wach. Der Leibdiener zog die Vorhänge zu und trat vor den Lord.
»Mylord, wir müssen Sie für die Gesellschaft ankleiden.«
Mit ausdrucksloser Miene sah Lyon Pennington zu den drei Männern empor, die sich vor ihm aufgebaut hatten.
»Lady Wentworth und ihr Anwalt sind eingetroffen, Sir«, kündigte der Leibdiener ruhig an und schob die Decke von den bewegungslosen Beinen des Lords. »Der Bischof ist bereits seit einer Stunde in der Bibliothek. Mylord, man erwartet Sie.«
Einer der Diener beugte sich zu Lord Aytoun hinunter, um den doppelreihigen Morgenmantels aufzuknöpfen. Er hielt sofort inne, als er den verärgerten Blick seines kranken Herrn auf sich spürte, und trat einen Schritt zurück.
»Bringt mich zu Bett«, stieß der Lord dumpf hervor.
»Bedaure, Mylord. Das darf ich nicht. Die Gräfinwitwe besteht darauf, dass wir Sie ankleiden.«
Lord Aytoun verschwendete keinen Gedanken daran, dass seine Beine ihn seit Monaten nicht mehr getragen hatten, und stemmte sich aus dem Sessel. Bevor die entsetzten Diener nach ihm greifen konnten, stürzte er schwer zu Boden.
»Verdammt noch mal …«
»… er ist auf den rechten Arm gefallen!«
»Nun helft mir endlich!« Einen Moment später kniete Gibbs bereits neben dem Lord.
»Hab gehört, wie der Doktor sagte, dass der Chirurg amputieren muss, wenn er sich den Arm erneut bricht.«
Gibbs bestrafte die Bemerkung des Dieners mit einem vernichtenden Blick und drehte den Lord vorsichtig auf die Seite.
Lyon Pennington war ebenso groß wie Gibbs. Die Monate seiner schweren Krankheit hatten an seiner Kraft gezehrt, aber es brauchte immer noch mehrere Männer, um ihn zu tragen. Besonders dann, wenn er nicht in bester Stimmung war.
»Mylord, darf ich Sie daran erinnern …« Behutsam beugte und streckte Gibbs den rechten Arm seines Herrn. Anscheinend war der Knochen heil. »Eure Lordschaft haben der Gräfinwitwe versprochen, dass Sie sich an die Vereinbarung halten.«
»Bringt mich ins Bett zurück«, kam es Lyon wütend über die Lippen, während er die unverletzte Hand zur Faust ballte und kraftlos auf den Boden schlug. »Auf der Stelle!«
»Ihre Mutter erlitt letzte Nacht wieder einen Anfall, Mylord«, erklärte Gibbs. »Wir mussten den Arzt rufen.« Er setzte sich neben den Lord, da er genau wusste, wie man mit ihm umgehen musste, wenn er vor Wut beinahe explodierte. Lyon Aytouns blaue Augen durchbohrten den Leibdiener. »Sie hat sich heute Morgen nur deshalb von ihrem Krankenbett erhoben, weil Sie versprochen hatten, ihr ihren Wunsch zu erfüllen. Es könnte ihr den letzten Lebensmut rauben, wenn ihr zu Ohren käme, dass Sie sich entschlossen haben, den Plan über den Haufen zu werfen. Ich bitte Sie, Mylord, vergessen Sie nicht, dass Lady Aytoun viele Unannehmlichkeiten auf sich genommen hat, um das Arrangement für Sie einzufädeln. Sie sollten ihr ein klein weniileg Ruhe und Frieden gönnen, denn es sind wohl nicht mehr viele Tage, die sie noch auf dieser Welt verwen wird.«
Gibbs konnte nicht entscheiden, ob es an dem Beruhigungsmittel lag, das die beiden Diener ihrem Herrn zuvor eingeflößt hatten oder daran, dass ihm tatsächlich keine andere Wahl blieb. Jedenfalls setzte sich Lyon Pennington nicht zur Wehr, als sie ihn wieder in den Sessel hoben.
»Und was ist mit dieser Frau, Gibbs?«, murmelte der Lord. »Glaubst du, dass meine Braut auch nur eine einzige Minute Ruhe und Frieden finden wird?«
KapitelDrei
Jasper Hyde zog die Taschenuhr aus der Weste. Es war fast drei Uhr nachmittags, und immer noch kein Zeichen von diesem verdammten Gehilfen oder von Platt.
Wie gewöhnlich war der White’s Club überfüllt, und Hyde musterte die anderen Gentlemen. Ein paar der Gesichter an den Spieltischen kamen ihm bekannt vor. Das Gleiche galt für einige der anderen Männer, die herumstanden, tranken und ihr Vergnügen daran fanden, denjenigen zuzuschauen, die ihr Vermögen am Spieltisch riskierten. Hier schien es bedeutungslos, welche Tageszeit herrschte; die Tische mit den Karten- und Würfelspielen waren fast immer besetzt. Dennoch war Hyde bewusst, dass das Etablissement sich bald leeren würde. Die Männer würden zum Dinner oder zu Partys gehen und anderen Lastern frönen, die London in Hülle und Fülle zu bieten hatte.
Gebannt starrte Hyde auf den Würfelbecher in Lord Winchelseas Hand. Er selbst hatte schon mehr Geld verloren als er zugeben mochte, aber ihm war klar dass es sich lohnte, mit einem angesehenen Mitglied der Londoner Gesellschaft zu verkehren. Außerdem tat es nicht weh, sein Geld an solche Leute zu verlieren.
»Nichts geht mehr«, rief der Croupier mit der Perücke gelangweilt aus.
Hinter dem Mann spielten ein Harfenist und ein Hornist neben dem großen offenen Kamin. Der Geschäftsführer beschimpfte einen Kellner, der die Flasche Wein, die der Spieltisch in der Ecke bestellt hatte, zu langsam servierte.
Als wollte er sein Glück erzwingen, schüttelte Lord Winchelsea den Würfelbecher ein weiteres Mal und rollte die Würfel auf den Tisch.
»Sieben.« Die Männer, die sich um den Tisch drängten, stöhnten auf oder schrien triumphierend, je nach dem, wie sie gewettet hatten. Hyde beobachtete, dass Winchelsea arrogant lächelte, als ihm die Würfel erneut zugeschoben wurden.
»Das nenne ich ein Fest«, sagte Winchelsea zu Lord Carlisle links neben ihm. Der Edelmann schnaubte beifällig, und Winchelsea lächelte Jasper Hyde zu. »Wetten Sie immer noch auf meinen einstigen Freund, Hyde?«
Der Plantagenbesitzer überflog die schnell schwindende Summe. Er wusste, dass der junge Lord in dieser Woche mit Leichtigkeit an die dreitausend Pfund verloren hatte. Aber heute lächelte Fortuna ihm wieder zu.
»Wenn Sie gestatten, Mylord, dann schließe ich meine Wetten auf Sie ab«, entgegnete Jasper süßlich.
»Ein kluger Schachzug, Hyde. Übrigens, ich habe uns ein Separee in Clifton’s Chophouse reserviert, bevor wir zur Drury Lane weiterfahren. Wollen Sie uns zum Dinner Gesellschaft leisten?«
»Es wäre mir eine große Ehre.« Die Einladung schmeichelte Hyde, und er verdoppelte seinen Einsatz.
»Ihre Glückssträhne heute sollte Sie eigentlich veranlassen, jeden hier zum Dinner einzuladen«, sagte Lord Carlisle provozierend.
»Verdammt, Sie haben Recht, Carlisle. Sie sind alle eingeladen.« Winchelsea schüttelte den Würfelbecher, während die Männer um den Tisch herum in beifälliges Gelächter ausbrachen.
»Gestatten Sie die Frage, Mylord, um welche Art von Glückssträhne es sich handelt?«, wollte Winchelsea wissen.
»Gerüchteweise war zu hören«, antwortete Carlisle, »dass der Albtraum unseres Freundes heute in aller Herrgottsfrühe aufs Land geflüchtet ist.«
»Aytoun verlässt London?«, fragte jemand aus der anderen Ecke des Raumes.
»Um genau zu sein, er wird aus der Stadt fortgetragen«, erwiderte Lord Carlisle.
»Schicken sie ihn endlich nach Bedlam?«, erkundigte sich der Mann vom anderen Tisch.
»Nein, trotz meiner wärmsten Empfehlungen.« Winchelsea schüttelte den Becher heftiger. »Gleichwohl ist er mit lebenslanger Haft bestraft. Uns ist zu Ohren gekommen, dass er heute Nachmittag wieder heiratet.«
»Nichts geht mehr«, verkündete der Croupier.
»Welcher Dummkopf würde ihm seine Tochter anvertrauen?«, warf der Mann ein. »Hat er seine erste Frau nicht ermordet?«
»Das ist lediglich ein unbestätigtes Gerücht«, verteidigte Carlisle den abwesenden Adligen. »Die Wahrheit konnte nie bewiesen werden.«
»Ich muss Ihnen widersprechen«, entgegnete Winchelsea und rollte die Würfel auf den Tisch. »Ich habe die Gewaltausbrüche dieses Mannes mit eigenen Augen gesehen und behaupte, dass er durchaus in der Lage ist, seine Frau zu ermorden.«
»Sie haben Aytouns sogenannte Gewaltausbrüche ertragen müssen, weil Sie mit seiner Frau geflirtet haben«, spottete Carlisle. »Und Sie stellen solche Behauptungen nur deshalb auf, weil er der Einzige war, der Sie im Duell besiegen konnte. Erst vor kurzem haben Sie aufgehört, über die Schulterverletzung zu klagen, die er Ihnen zugefügt hatte. Wenn Sie gewonnen hätten, würden Sie wohl kaum solche Anschuldigungen gegen ihn in Umlauf bringen.«
»Sie erheben Vorwürfe gegen mich?«, stieß Winchelsea herausfordernd hervor.
»Nein … und Sie können mich nicht dazu zwingen, mich bei Anbruch der Morgendämmerung mit Ihnen im Park zu duellieren, mein Lieber.« Carlisle schob dem Lord die Würfel zu. »Ich schlage vor, dass wir unsere kleine Feier fortsetzen und Aytoun zusammen mit seiner neuen Frau zur Hölle fahren lassen.«
Die Männer rund um den Tisch murmelten zustimmend. Winchelsea warf seinem Freund einen grimmigen Blick zu, griff widerwillig nach den Würfeln und rollte sie aus dem Becher.
»Sechs«, verkündete der Croupier und gab die Würfel zurück.
Carlisle grinste selbstgefällig. »Hoffentlich bedeutet das nicht, dass Ihnen das Glück nicht mehr hold ist.«
»Pures Wunschdenken, soweit es Sie betrifft.«
»Demnächst klopft vielleicht Ihr Schneider an die Tür und möchte bezahlt werden.«
»Carlisle, in Ihnen steckt der Teufel persönlich, wenn Sie mir solche Strafen an den Hals wünschen.«
Hyde schenkte dem Scharmützel der beiden keine weitere Beachtung und konzentrierte sich auf die Würfel. Sieben. Winchelseas Fluch war harmlos im Vergleich zu den Gefühlen, die Hyde in diesem Augenblick durchfluteten. Der Verlust von fünfhundert Guineen mochte in dieser adligen Gesellschaft bedeutungslos sein, doch für ihn war es eine Fortführung der Pechsträhne, die ihn schon länger verfolgte.
Der Plantagenbesitzer hielt den Atem an, als plötzlich ein durchdringender Schmerz seine Brust und die Schultern durchfuhr. Hyde wartete, bis der quälende Stich nachließ. Er wusste, dass es vorübergehen würde, und wollte der Sache keine überflüssige Aufmerksamkeit widmen. Die beißenden Schmerzen kamen und gingen, in letzter Zeit allerdings immer häufiger, und sie tauchten jedes Mal ohne Vorwarnung auf. Aber noch nie hatten sie ihm vollkommen die Kraft aus den Gliedern gesogen. Er lehnte sich leicht gegen den Tisch.
Der Würfelbecher wurde an Lord Carlisle weitergereicht, und wieder wurden die Wetteinsätze auf den Tisch geschleudert. Als Hyde den Kopf zur Tür drehte, war er erleichtert, dass sein Anwalt endlich aufgetaucht war. Er entschuldigte sich bei den Gentlemen am Tisch und ging durch den Raum zu Platt. Wortlos führte der Anwalt ihn die Treppe hinunter, wo Hydes Gehilfe Harry direkt an der Innenseite der Eingangstür wartete.
Ein Diener half Hyde in den Mantel und reichte ihm den Stock, seinen Hut und die Handschuhe. Der Schmerz im Oberkörper hatte ein wenig nachgelassen, aber die Luft in den Lungen war immer noch knapp.
Mit einer Handbewegung bedeutete Hyde seinem Anwalt und Harry, ihm in eine kleine Kammer in die Nähe des Eingangs zu folgen. »Wo ist sie?«, fragte Hyde scharf.
Platt schloss die Tür, bevor er mit den Neuigkeiten herausrückte. »Harry ist es nicht gelungen, die Sklavin zu ersteigern.«
Wie ein starker Windstoß fuhr die Wut durch Jasper Hyde hindurch. Der Gehilfe stolperte rückwärts gegen die Wand, als Hyde ihm mit dem Stock hart in die Brust stieß. »Du hattest deine Anweisungen. Du hättest nur so lange mitbieten müssen, bis sie dir gehört. Das war alles, was du zu tun hattest!«
»Das habe ich auch getan, Sir. Aber der Preis ist immer höher geklettert!«
»Lady Wentworth ist unvermutet bei der Auktion aufgetaucht, Sir«, erklärte Platt aus sicherer Entfernung.
»Sir, ich konnte die Frau zwar nicht kaufen, doch ich habe dafür gesorgt, dass die Lady ein hübsches Sümmchen zahlen musste. Die Alte war nichts weiter als ein wertloser Haufen Dreck.«
Zornentbrannt versetzte Jasper Hyde seinem Diener einen harten Hieb mit dem Stock seitlich an den Kopf. »Du bist der wertlose Dreckhaufen. Ich sollte dich davonjagen! Hast du nicht zugehört, als ich dir die Sache vorher erklärte? Du hattest die klare Anweisung, mitzubieten und diese Sklavin zu ersteigern. Was zerbrichst du dir den Kopf über den Preis?«
»Aber sie ist für einhundertzehn Pfund weggegangen, Master«, platzte Harry heraus, rieb sich mit einer Hand den Kopf und machte sich bereit, mit der anderen den nächsten Schlag abzufangen. »Ich hatte die ganze Meute gegen mich. Sie haben geglaubt, dass ich den Preis nur in die Höhe treiben will und haben sich auf Lady Wentworths Seite geschlagen, Sir. Ich habe nach Ihrer Kutsche Ausschau gehalten, doch Mr Platt und Sie waren weit und breit nirgends zu sehen. Niemals hätte ich geglaubt, dass ich mehr als fünfzig Pfund bieten soll, und ich habe mich schon zusammengerissen und das Gebot verdoppelt, und …«
Der Stock schnellte erneut auf den Gehilfen zu, traf ihn am Handgelenk und ließ ihn vor Schmerz aufheulen.
»Das führt zu nichts«, wandte Platt nervös ein. »Es gibt andere Wege, die Sklavin zurückzubekommen.«
Jasper Hyde hatte Mühe zu atmen, als er sich auf einen Stuhl in der Nähe fallen ließ. Mit beiden Händen umklammerte er den Stock und kämpfte gegen den Schmerz, der wieder in ihm tobte.
»Es ist ein Glück, dass Lady Wentworth den Zuschlag bekommen hat«, erklärte Platt. »Sie schuldet Ihnen ein Vermögen, und niemand gibt ihr Kredit. Ihr Gebot übersteigt den Wert der Sklavin um das Fünffache. Möglicherweise hat sie noch nicht einmal genügend Geld, um die Rechnung zu begleichen. Ich könnte dafür sorgen, dass die Sklavin schon gegen Ende der Woche Ihnen gehört, entweder über Dombeys Gläubiger oder über Lady Wentworths Anwalt.«
Hyde dachte einen Augenblick über den Vorschlag nach und wartete darauf, dass der Schmerz verging. Als er sich erhob, drückte Harry sich angstvoll gegen die Wand.
»Sorgen Sie dafür«, befahl Jasper Hyde seinem Anwalt. »Die Zeit wird knapp.«
Die Gegenstände lagen vor ihr auf dem steinernen Sims des kleinen Kamins. Ohenewaa hatte nur wenige Dinge in den Ärmeln ihres zerlumpten Kleidungsstücks verstecken können. Ein paar Steine, ein Stück zerkrümelte Baumrinde, einige getrocknete Blätter und eine kleine Schatulle mit Haarsträhnen. Die alte Frau tröpfelte ein wenig Wasser auf den Kamin und platzierte ein kleines Stück Brot als Gabe neben die anderen Gegenstände. Sie hatte viele Gründe dankbar zu sein, und sie wusste, dass die Geister ihr Gehör schenken würden, als sie vor dem provisorischen Altar niederkniete.
Ohenewaa nahm eine Hand voll Asche aus der Feuerstelle und streute sie über ihr Gesicht, über die Hände und über ihre Arme. Der uralte Gesang kam von tief unten in ihrer Brust. Im Sitzen schaukelte sie sanft vor und zurück und dankte Onyame, dem Höchsten Wesen, für ihre Befreiung von Jasper Hyde. Singend drückte Ohenewaa ihre Dankbarkeit dafür aus, dass die Ketten ihr wieder von den Händen, Füßen und dem Nacken gelöst worden waren.
Es war ihr immer noch ein Geheimnis, was aus ihr werden sollte. Am frühen Nachmittag war sie in das Büro von Sir Oliver Birch gebracht worden. Der große Engländer trägt den Namen eines Baumes, war es der alten Frau in den Sinn gekommen. Vielleicht besitzt er auch ein mitfühlendes Herz.
Der Anwalt hatte später nach ihr gesehen und ihr erklärt, dass die Dame am Hafen die Papiere schon unterschrieben hatte, die ihr die Freiheit schenken würden. Eine ›freie Frau‹ hatte er sie genannt.
Aber der Anwalt hatte außerdem gesagt, dass diese Frau, Lady Wentworth, sich freuen würde, wenn Ohenewaa sie auf ihren Landsitz in Hertfordshire begleiten würde. Der Mann hatte hinzugefügt, dass viele befreite Sklaven auf Melbury Hall lebten und arbeiteten. Lady Wentworth vermutete, dass Ohenewaa einige dieser Leute von Jamaika her kannte.
Ohenewaa konnte sich an den Namen Wentworth sehr gut erinnern. Sie entsann sich bestens an den Jubel der Leute, als die Nachricht vom Tod des Großgrundbesitzers Wentworth auf den Zuckerplantagen eingetroffen war. Doch das hatte sich abgespielt, bevor Jasper Hydes eiserne Faust ihnen die Kehle zudrückte.
Als es klopfte, unterbrach Ohenewaa ihren Gesang. Die Tür wurde langsam geöffnet, und eine junge Frau erschien. »Darf ich eintreten?«, fragte sie und betrachtete neugierig die Gegenstände auf dem Kaminsims. Ihr Blick wurde sanft, und sie presste die Lippen zu einem dünnen Strich zusammen, da sie die zerlumpte Kleidung und die Decke sah, die Ohenewaa sich übergehängt hatte. Aber kein Stück Stoff war groß genug, um die hässlichen Quetschungen am Hals und an den Handgelenken zu verbergen.
»Ich heiße Violet«, sagte die junge Frau mit weicher Stimme und öffnete die Tür nun ganz. Ohenewaa bemerkte, dass die Frau ein Tablett trug, jedoch nicht sofort eintrat. »Ich bin die Zofe von Lady Wentworth. Sie hat mich geschickt, damit ich mich um Ihr Wohlergehen kümmere, bis wir morgen früh nach Melbury Hall abreisen. Darf ich eintreten?«
Ohenewaa musterte das hübsche Kleid der Zofe, das zweifellos ein Erbstück aus der Garderobe der Lady war. Die alte Frau nickte langsam, erhob sich aber nicht.
»Man hat mir gesagt, dass noch Brot und Wasser übrig sind, doch ich habe lieber für warmes Essen gesorgt. Ihre Ladyschaft meinte, wir dürfen einem alten Junggesellen wie Sir Oliver – so gutherzig er auch ist –, nicht zu sehr trauen.« Sie stellte das Tablett auf das schmale Bett und schaute sich um. Auf der kleinen Kommode am Fußende stand ein Krug Wasser und eine Waschschüssel.
»Es tut mir Leid, dass ich nicht daran gedacht habe, Ihnen ein Kleid zum Wechseln mitzubringen. Aber ich überlasse Ihnen meinen Umhang, und morgen Nachmittag werden wir schon auf Melbury Hall eingetroffen sein. Wenn wir erst einmal dort sind, werden Lady Wentworth – und natürlich Mrs Page und Amina – dafür sorgen, dass Sie alles haben, was Sie brauchen.«
Das Mädchen fuhr sich mit den Händen über die Arme. »Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich mehr Holz ins Feuer werfe? Es ist ziemlich kalt hier drinnen.«
Ohenewaa war überrascht, dass die Zofe fragte. Das Mädchen wartete wirklich, bis eine alte Sklavin ihr die Erlaubnis erteilte. »Wie Sie wollen.«
Ohenewaa rieb sich die wunde Haut an den Handgelenken, stand auf, ging zum Bett hinüber und setzte sich auf die Kante. Die junge Frau bewegte sich vorsichtig, vielleicht sogar respektvoll, um die Gegenstände auf dem Kaminsims, bevor sie niederkniete und mehr Holz ins Feuer legte.
»Sie haben gebetet«, bemerkte Violet. Goldene Locken umrahmten sanft das blasse Gesicht der Frau, als sie sich umdrehte und Ohenewaa über die Schulter einen aufmunternden Blick zuwarf. »Wie eindrucksvoll.«