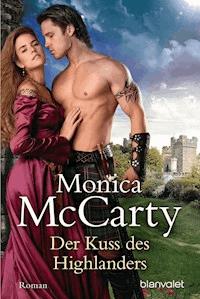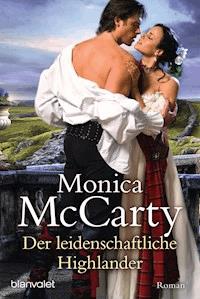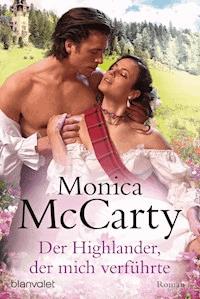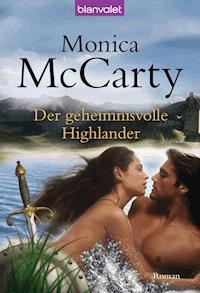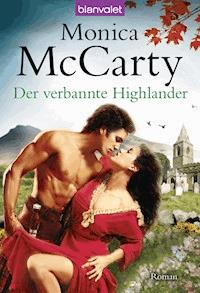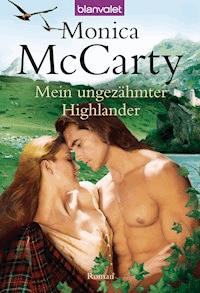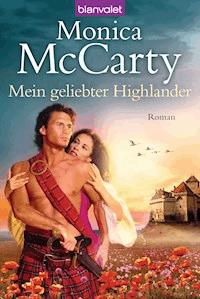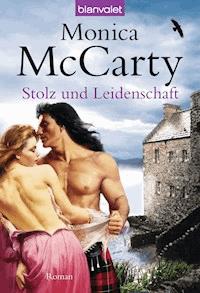5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Campbell-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Die Highlands – ungezähmt und voller Leidenschaft!
Einst als Verräter beschuldigt und aus den Highlands vertrieben, kehrt der verbittert auf Rache sinnende Duncan Campbell zehn Jahre später zurück, um seinen Namen reinzuwaschen. Nur die Frau, die er einst liebte und verlor, kann ihm dabei zur Seite stehen. Jeannie Grant traut ihren Augen nicht, als Duncan plötzlich vor ihr steht und ihre Hilfe erzwingen will. Vertraute Lust flammt zwischen ihnen auf, doch Jeannie hütet Geheimnisse, die ihrer beider Zukunft gefährden könnten …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 654
Ähnliche
Buch
Einst als Verräter beschuldigt und aus den Highlands vertrieben, kehrt der verbittert auf Rache sinnende Duncan Campbell zehn Jahre später zurück, um seinen Namen reinzuwaschen. Nur die Frau, die er einst liebte und verlor, kann ihm dabei zur Seite stehen. Jeannie Grant traut ihren Augen nicht, als Duncan plötzlich vor ihr steht und ihre Hilfe erzwingen will. Vertraute Lust flammt zwischen ihnen auf, doch Jeannie hütet Geheimnisse, die ihre Zukunft gefährden könnten …
Autorin
Monica McCarty studierte Jura an der Stanford Law School. Während dieser Zeit entstand ihre Leidenschaft für die Highlands und deren Clans. Sie arbeitete dennoch mehrere Jahre als Anwältin, bevor sie dieser Leidenschaft nachgab und zu schreiben anfing. Heute lebt sie mit ihrem Mann und ihren Kindern in Minnesota.
Von Monica McCarty ist bei Blanvalet bereits erschienen:
Mein ungezähmter Highlander (37035)Der geheimnisvolle Highlander (37061)Highlander meiner Sehnsucht (37062)Stolz und Leidenschaft (37403)Der verbannte Highlander (37540)
Monica McCarty
Schottisches Feuer
Roman
Aus dem Englischenvon Anita Nirschl
Für Maxine, mein eigenes kleines rothaariges Mädchen.Ich wünsche dir, dass dein Weg zur wahren Liebe dir viel leichter fällt als all den Charakteren, über die ich schreibe …Und dass du dir damit mindestens noch weitere fünfzehn Jahre Zeit lässt.
Kapitel 1
»Auf einen schwarzen Anfangfolgt auch ein schwarzes Ende.«
Schottisches Sprichwort
In der Nähe von Aboyne Castle, Aberdeenshire, Herbst 1608
Aus einer Laune heraus entschloss Jeannie sich, zum Schwimmen an den Loch zu gehen. Das an sich war schon bemerkenswert, denn sie gab selten einem spontanen Einfall nach. Wenn der Apfel für Evas Sündenfall verantwortlich gewesen war, dann war es für Jeannie »diese leise Stimme« in ihrem Hinterkopf, die sie mit »guten Einfällen« bombardierte. Im Laufe der Jahre hatte sie gelernt, diese Stimme zu ignorieren. Deshalb war nicht mehr viel übrig von dem impulsiven Mädchen, das einst dem Ruin so gefährlich nahe gekommen war. Wann immer Jeannie den Drang verspürte, etwas zu tun, zwang sie sich innezuhalten und nachzudenken, was damit endete, dass sie es sich schließlich anders überlegte.
Doch nicht dieses Mal. Der ungewöhnlich heiße Tag so kurz vor dem Samhain-Fest und die Aussicht auf ein erfrischendes Bad in den kühlen Fluten des Lochs, bevor die Sonne dem trüben Grau des Winters wich, waren einfach zu verlockend. Ebenso wie die Vorstellung zu entfliehen. Nur für eine Weile. Sich einen Augenblick des Friedens und der Einsamkeit zu stehlen, in dem die Sorgen der vergangenen Monate sie nicht finden konnten.
Nur ein wenig schwimmen. Eine Stunde, nicht länger. Sie würde auch eine Wache mitnehmen. Und ihre Pistole. Etwas, was sie in letzter Zeit stets an ihrer Seite hatte.
Sie konnte nicht länger wie eine Gefangene im eigenen Heim eingesperrt bleiben. Der kurze Ausflug zum Loch war genau das, was sie jetzt brauchte. Sie war fast schon aus der Tür, als sie eine Stimme hinter sich hörte und wie angewurzelt stehen blieb. »Willst du irgendwohin, Tochter?«
Beim scharfen Klang der von Tadel erfüllten Stimme ihrer Schwiegermutter biss Jeannie die Zähne zusammen. Als ob es nicht schon genug wäre, den Tod ihres Ehemannes betrauern zu müssen, war Jeannie in den vergangenen Monaten auch noch gezwungen gewesen, die erdrückende Gegenwart seiner Mutter, der Respekt einflößenden Marchioness of Huntly, zu ertragen.
Mit zusammengepressten Lippen schluckte sie die Erwiderung hinunter, die ihr auf der Zunge lag, nämlich dass sie das einen feuchten Kehricht anging. Stattdessen atmete sie tief durch, bevor sie sich umdrehte und sogar ein – wenn auch gequältes – Lächeln zustande brachte. »Es ist heute so herrliches Wetter draußen, also dachte ich, ich gehe kurz zum Schwimmen an den Loch. Ich nehme einen Wachmann mit«, fügte sie hinzu, da sie die Einwände ihrer Schwiegermutter bereits im Voraus ahnte.
Sie wusste nicht, warum sie sich eigentlich rechtfertigte. Nichts, was Jeannie tat, wurde von der Marchioness je gebilligt. Sie war ihres Sohnes schon nicht würdig gewesen, als er noch gelebt hatte, und nun, da er tot war, gab es keine Hoffnung mehr, dass sie es je sein würde. Warum Jeannie sich immer noch bemühte, sie zufrieden zu stellen, wusste sie nicht. Doch sie tat es dennoch. Denn andernfalls müsste sie sich eingestehen, ihrem Ehemann gegenüber in einer weiteren Hinsicht versagt zu haben, und daran durfte sie nicht denken.
Die Marchioness erwiderte das Lächeln ebenso gezwungen. Ihre Schwiegermutter mochte einmal eine attraktive Frau gewesen sein, aber im Lauf der Jahre hatte ihr säuerliches Gemüt seinen Tribut gefordert und sich auch in ihrem Äußeren niedergeschlagen. Die hängenden Mundwinkel und tiefen Falten, die ihr Gesicht durchzogen, verliehen ihr einen Ausdruck permanenter Missbilligung. Hochgewachsen und ausgezehrt – durch das ständige Fasten, mit dem sie sowohl ihre Disziplin als auch ihre Aufopferung unter Beweis stellen wollte – sah sie aus wie ein in der Sonne getrocknetes Stück Salzhering.
Jeannie hatte Hering noch nie gemocht.
»Hältst du das für eine kluge Idee?« Die Kritik war als Frage getarnt – eine Spezialität der Marchioness.
Die Frau schien es ausnehmend zu genießen, alles, was Jeannie tat, infrage zu stellen – und dadurch indirekt zu kritisieren. Es war lächerlich. Jeannie war fast achtundzwanzig, aber in Gegenwart der älteren Frau fühlte sie sich wie ein aufsässiges Kind. Kopfschüttelnd schnalzte die Marchioness mit der Zunge, ein kläglicher Versuch, mütterliche Zuneigung zu demonstrieren. »Du weißt, was beim letzten Mal passiert ist, als du alleine fortgingst.«
Bei diesem versteckten Vorwurf, dass der kürzliche Entführungsversuch auf irgendeine Weise ihre Schuld gewesen wäre, ballte Jeannie ärgerlich die Fäuste. Auch wenn sie nach Francis’ Tod von Viehdieben heimgesucht worden waren – denn Witwen wurden für leichte Ziele gehalten –, kam es kaum jemals zu einem Brautraub. Wie hätte Jeannie vorhersehen können, dass man ihren allmorgendlichen Ausritt als Gelegenheit nutzen könnte, sich ihr Vermögen und die Ländereien durch solch einen barbarischen Brauch anzueignen? »Ich habe meine Pistole dabei, und Tavish wird mich begleiten. Weitere zwanzig Wachmänner bleiben in Hörweite. Und der Loch liegt praktisch direkt vor den Burgtoren.«
»Eine Frau alleine ist immer eine Versuchung. Du brauchst mehr Schutz, als ein einfacher Wachmann bieten kann.«
Jeannie wusste, worauf sie hinauswollte, aber sie würde sich von der Marchioness nicht zu einer neuen Heirat drängen lassen, schon gar nicht mit einem Mann, den ihre Schwiegermutter für sie aussuchte. Bei ihrer ersten Ehe hatte Jeannie keine Wahl gehabt – es hieß entweder das oder Entehrung –, doch sie hatte nicht die Absicht, erneut zu heiraten. »Ich komme schon zurecht.«
»Natürlich, Liebes, du wirst es am besten wissen«, meinte ihre Schwiegermutter leichthin, doch Jeannie ließ sich nicht täuschen. »Wie Francis immer sagte: Wenn du dir einmal etwas in den Kopf gesetzt hast, ist es so, als wollte man einen angreifenden Eber aufhalten.«
Aber Francis hatte es voll Liebe und Zuneigung gesagt, nicht voller Verachtung. Einen Augenblick lang geriet Jeannie ins Wanken, doch dann wurde ihr bewusst, wie lächerlich das war. Sie hatte hart für die Wiedergutmachung ihrer früher begangenen Fehler gearbeitet, und sie wollte verdammt sein, wenn sie dafür ewig bezahlen sollte. »Es ist doch nur ein Bad im See.« Beinahe hätte sie noch »um Gottes willen« hinzugefügt, doch ihr war klar, dass die Genugtuung nur von kurzer Dauer wäre, denn sie würde für diese Gotteslästerung bei ihrer äußerst gottesfürchtigen Schwiegermutter eine ganze Woche lang Abbitte leisten müssen.
»Natürlich«, erwiderte die Marchioness gekränkt. »Ich hatte nur dein Wohlergehen im Sinn.«
Jeannie unterdrückte ein Stöhnen. Schuldgefühle waren eine weitere Spezialität ihrer Schwiegermutter. »Ich weiß deine Besorgnis zu schätzen, aber es gibt nichts, worüber du dir Sorgen machen müsstest. Mir wird schon nichts passieren.«
Und bevor sie ihre Meinung ändern konnte, trat Jeannie durch die Tür in den Sonnenschein hinaus. Schnell eilte sie die Stufen hinunter und überquerte den Burghof, wo Tavish schon auf sie wartete. Auf ihrem Weg durch das bewaldete Tal zum Loch versuchte Jeannie, nicht mehr an ihre Schwiegermutter zu denken. Die Marchioness mochte zwar der Spontaneität ihres Ausflugs einen Dämpfer erteilt haben, doch Jeannie hatte fest vor, dieses kleine bisschen freie Zeit zu genießen.
Kurze Zeit später erfüllte sich ihr Wunsch. Als sie von dem Felsen sprang, der ein paar Fuß über den See ragte, und in das eiskalte Wasser tauchte, fühlte sie sich wie neugeboren. Wie befreit vom Kummer und der Schuld, die sie seit dem Tod ihres Mannes umfangen hatten. Die warme Nachmittagssonne schien ihr aufs Gesicht, während sie träge auf den grünblauen Fluten dahintrieb, und sie fühlte sich völlig entspannt. Das sanfte, unablässige Auf und Ab der Wellen wiegte sie in einen Zustand des Friedens, wie sie ihn schon lange nicht mehr verspürt hatte.
Sie paddelte noch ein wenig länger auf dem Rücken, obwohl die Stunde, die sie eigentlich hatte bleiben wollen, schon vergangen war. Ein sanfter Windhauch wehte über sie hinweg und überzog ihre Brust mit einer prickelnden Gänsehaut. Mit einem Mal verschwand die Wärme von ihrem Gesicht und wich einem dunklen Schatten. Sie öffnete die Augen und sah zum Himmel empor, dessen klares Blau von einer dicken Wolkenwand verunziert wurde.
Ein Zeichen, wie es schien, dass ihr Augenblick des Friedens vorüber war.
Sie drehte sich herum, tauchte noch einmal tief unter und schwamm die etwa zwanzig Fuß zum Ufer des Sees, bevor sie in einer Explosion aus Wasser und Licht durch die schimmernde Oberfläche brach.
Sie watete durch das hüfttiefe Wasser ans Ufer, und bei dem Anblick des glitschigen Schlicks, der zwischen ihren Zehen hervorquoll, kräuselten sich ihre Mundwinkel im Anflug eines Lächelns. Sie fühlte sich freier. Glücklicher. Beinahe erfrischt. Zum ersten Mal, seit Francis gestorben war, fühlte sich Jeannie, als könnte sie wieder durchatmen. Die grausame, erstickende Enge in ihrer Brust hatte sich endlich ein wenig gelöst.
Es war richtig gewesen hierherzukommen. Ausnahmsweise einmal hatte eine plötzliche Regung sie nicht auf Abwege geleitet.
Sie stieg aus dem Wasser und schlang sich in einem vergeblichen Versuch, sich gegen die kalte Luft zu schützen, die Arme um die Brust. Zähneklappernd blickte sie an sich herab und wurde rot. Das klatschnasse elfenbeinfarbene Leinen, das ihr auf der Haut klebte, enthüllte sehr deutlich jeden Zoll ihres Körpers. Schnell sah sie sich um, in der Hoffnung, dass Tavish sein Versprechen gehalten und aus gebührendem Abstand über sie gewacht hatte. Falls nicht, dann bekam er jetzt eine Menge zu sehen. Ihr augenblicklicher Zustand überließ nur sehr wenig der Vorstellungskraft, wie ihre alte Amme gern sagte. Doch es war auffallend ruhig. Beinahe unnatürlich ruhig.
Ein Hauch des Unbehagens strich ihr über den Nacken.
Nein. Sie schob das Gefühl beiseite. Von der Schwarzmalerei der Marchioness würde sie sich diesen Tag nicht verderben lassen.
Schnell lief sie die letzten paar Schritte zu ihren Sachen, schnappte sich ein Handtuch von dem Haufen und schlang es um den Körper. Zügig trocknete sie sich Gesicht und Glieder so gut wie möglich ab, bevor sie sich mit dem Leinentuch das Wasser aus den Haaren drückte. Doch es würde Stunden dauern, bis die langen, dichten Flechten getrocknet waren, selbst wenn sie sich ans Feuer setzte.
Ihre seltsame Vorahnung verfluchend, die sie voll und ganz der Einmischung ihrer Schwiegermutter zuschrieb, sah sie sich noch einmal prüfend um, bevor sie das nasse Unterkleid über ihren Kopf zog, es zu Boden fallen ließ und nach einem frischen Hemd griff.
Vornübergebeugt stand sie da, nackt, wie Gott sie geschaffen hatte, und hörte plötzlich ein Geräusch hinter sich. Ein Geräusch, das ihr das Blut gefrieren und jedes einzelne Härchen im Nacken vor Angst zu Berge stehen ließ.
Der Wachmann hatte ihn nicht kommen sehen.
Er war so gefesselt vom Anblick der im See schwimmenden Frau, dass er bewusstlos wie ein nasser Sack vor Duncan zu Boden sank. Blut sickerte ihm aus der Platzwunde an der Schläfe.
Fast hatte Duncan Mitleid mit ihm. Es war nicht das erste Mal, dass wegen dieser Frau ein Mann in Ungnade fiel.
Das war natürlich keine Entschuldigung für solch eine unerhörte Pflichtverletzung. Wäre es einer von Duncans Männern gewesen, dann hätte er für diesen Fehler schwerwiegendere Konsequenzen als einen Schlag an den Kopf tragen müssen. Seine Männer wurden für ihre Disziplin und Selbstbeherrschung ebenso sehr bewundert, wie man sie für ihre Überlegenheit auf dem Schlachtfeld fürchtete.
Schnell beugte sich Duncan über den bäuchlings niedergestreckten Mann und nahm dem Krieger die Waffen ab, dann schob er den eigenen Dolch zurück in die goldene Scheide an seinem Gürtel. Der Hieb mit dem schweren, juwelenbesetzten Griff würde keinen bleibenden Schaden hinterlassen, aber sobald der Mann wieder aufwachte, würden die Kopfschmerzen ihm eine gehörige Lehre sein. Das würde allerdings nicht in absehbarer Zeit geschehen, was Duncan genug Zeit verschaffte, seine unangenehme Aufgabe zu Ende zu bringen.
Bei so einem Treffen war man besser allein – und ungestört.
Vom Loch her vernahm er ein Plätschern, doch er widerstand dem Drang nachzusehen, was den Wachmann so gefesselt hatte. Er wusste es. Stattdessen gab er seinen Männern, die am Waldrand Stellung bezogen hatten, stumm den Befehl, den Wachmann im Auge zu behalten. Dann schlich der Mann, der von Irland bis hinüber zum Festland als der Schwarze Highlander gefürchtet war – ein Beiname, der sich nicht nur auf seine Haarfarbe, sondern auch auf seine tödlichen Fertigkeiten im Kampf bezog –, in einem Bogen um den See zu der Stelle, an der sie ihre Kleider zurückgelassen hatte.
Da Jeannie die Burg nur mit einem nichtsnutzigen Wachmann als Schutz verlassen hatte, um im Loch zu planschen, hatte sie sich anscheinend kein bisschen verändert. Er hatte fast vermutet, dass sie sich mit einem Liebhaber zu einem Schäferstündchen treffen wollte, und deshalb gewartet, bevor er sich ihr näherte, nur um sicherzugehen. Doch sie war allein – diesmal zumindest.
Lautlos wie der Geist, für den ihn manche halten mochten, bewegte er sich zwischen den Bäumen hindurch. Er war lange Zeit fort gewesen.
Zu lange.
Erst jetzt, nach seiner Rückkehr, konnte er sich das eingestehen.
Zehn Jahre lang hatte er sich zurückgehalten, hatte sich ein neues Leben aufgebaut aus der Asche seines alten Lebens, das man ihm durch Geburt und Verrat verwehrt hatte, und auf den richtigen Augenblick für seine Rückkehr gewartet. Zehn Jahre lang hatte er in Kriegen gekämpft, sein Können vervollkommnet und auf zahllosen Schlachtfeldern Angst und Schrecken verbreitet.
Zehn Jahre im Exil wegen eines Verbrechens, das er nicht begangen hatte.
So lange Zeit hatte er alles, was ihn an die Highlands erinnerte, aus seinem Gedächtnis verbannt. Doch seit er vor zwei Tagen in Aberdeen an Land gegangen war, erinnerte ihn jeder seiner Schritte über die heidebewachsenen Hügel, die rauen Felsen und waldigen Hänge der Deeside auf brutale Weise daran, wie viel er verloren hatte.
Dieser Ort lag ihm im Blut. Er war ein Teil von ihm, und Duncan wollte verdammt sein, wenn er sich erneut davon vertreiben lassen würde.
Was auch immer es kostete, er würde seinen Namen reinwaschen.
Mit zusammengebissenen Zähnen wappnete Duncan sich gegen das, was vor ihm lag, und sein beherrschter Gesichtsausdruck verriet nichts von dem heftigen Aufruhr, der in ihm tobte, als er der Abrechnung entgegentrat, die zehn Jahre auf sich hatte warten lassen.
Wut, die zu zügeln es Jahre gebraucht hatte, kehrte mit überraschender Heftigkeit zurück. Doch er würde sich niemals wieder von Gefühlen beherrschen lassen, also verdrängte er sie sofort. Schon seit vielen Jahren war Jeannie Grant – nay, Jeannie Gordon, rief er sich bitter in Erinnerung – für ihn nichts weiter als eine bittere Erinnerung an sein eigenes Versagen. Er hatte sie aus seinen Gedanken verbannt, so wie ein Mann seine erste Lektion in Sachen Demut zu vergessen versuchte. Er gestattete sich kaum jemals, an sie zu denken, außer als Mahnung an einen Fehler, den er niemals wieder begehen würde.
Doch nun hatte er keine andere Wahl. So sehr er sich auch wünschte, sie begraben zu lassen in der Vergangenheit, wohin sie gehörte, er brauchte sie.
Das Plätschern wurde lauter. Er verlangsamte seine Schritte, während er sich den Weg durch das Labyrinth aus Bäumen und Unterholz bahnte, und achtete darauf, sich beim Annähern gut zu verbergen. Selbst im dichten Unterholz der Bäume sollte es ihm durch seine Körpergröße und die breiten Schultern eigentlich unmöglich sein, sich zu verstecken, doch im Lauf der Jahre war er sehr geschickt darin geworden, mit der Umgebung zu verschmelzen.
In der Nähe des Felsens, an dem sie ihre Kleider abgelegt hatte, blieb er gut getarnt hinter einer breiten Tanne stehen.
Jeder Muskel seines Körpers spannte sich an, als er die dunkle, moosgrüne Wasseroberfläche des Lochs absuchte …
Er erstarrte. Dort. Das blasse Oval ihres emporgewandten Gesichts fing das Sonnenlicht ein, das ihre vollkommenen Züge nur einen Augenblick lang erhellte, bevor sie unter Wasser verschwand.
Sie war es. Jean Gordon, geborene Grant. Die Frau, die er törichterweise einst geliebt hatte.
Er verspürte einen heftigen Stich in der Brust, als die Erinnerungen über ihn hereinbrachen: die Ungläubigkeit, der Schmerz, der Hass und schließlich die hart erkämpfte Gleichgültigkeit.
Sein Name war nicht das Einzige, was sie zerstört hatte. Sie hatte ihm sein Vertrauen genommen, und damit zugleich auch den Idealismus eines jungen Mannes von einundzwanzig Jahren. Ihr Betrug war eine harte Lektion gewesen. Niemals wieder würde er sich von seinem Herzen leiten lassen.
Doch all das war ein ganzes Leben lang her. Diese Frau hatte keine Macht mehr über ihn; sie war nur ein Mittel zum Zweck.
Mit einem Stirnrunzeln, das sein Unbehagen verriet, musterte er die Stelle eindringlicher, an der sie unter der Wasseroberfläche verschwunden war. Er wusste, dass sie eine gute Schwimmerin war, doch sie war bereits ziemlich lange unter Wasser. Er tat einen Schritt auf den See zu, doch schnell musste er sich wieder zurückziehen, als sie mit einem Mal wie eine Nixe in einem schimmernden Sprühnebel aus Licht und Wassertropfen die Oberfläche durchbrach. Sie war nahe am Ufer wieder aufgetaucht, vielleicht zwanzig Fuß von ihm entfernt. Er konnte sie deutlich sehen.
Viel zu deutlich.
Mit zurückgestrichenem Haar und perlenden Wassertröpfchen auf dem Gesicht stieg sie aus dem See wie Venus aus dem Meer und kam geradewegs auf ihn zu. Er hatte ganz vergessen, wie sie ging … Das sanfte Wiegen ihrer Hüften verführte mit jedem Schritt. Die Luft zwischen ihnen lud sich auf mit einer vertrauten Spannung, dieser jähen, intensiven Erregung, die er vom ersten Augenblick an verspürt hatte, als er sie am anderen Ende des großen Saals von Stirling Castle vor all diesen Jahren zum ersten Mal gesehen hatte.
Sein ganzer Körper versteifte sich. Das Hemd, das sie trug, war völlig durchsichtig und klebte eng an ihren Brüsten, die voller waren, als er sie in Erinnerung hatte, aber ebenso verlockend. Die kühle Luft auf der nassen Haut machte alles nur noch schlimmer, denn ihre Brustwarzen zogen sich zu zwei festen Knospen zusammen, wie reife Beeren, die darauf warteten, gepflückt zu werden.
Er schluckte, um den Geschmack aus seinem Mund zu bekommen. Zehn verdammte Jahre und er konnte sie immer noch auf der Zunge schmecken, sich immer noch an den süßen Druck ihrer Brüste erinnern, die sich gegen seine Lippen pressten, während er sie tief in den Mund saugte. Seine Nasenflügel bebten. Er konnte immer noch den süßen Honigduft ihrer Haut riechen.
Nicht einmal seine eiserne Kontrolle konnte verhindern, dass ihm das Blut plötzlich schneller durch die Adern rauschte. Wütend über diesen Mangel an Beherrschung fluchte er lautlos. Doch der derbe Fluch brachte seinen Ärger nicht annähernd zum Ausdruck, denn er erkannte: Ganz gleich, was er für sie empfand, er war nur ein Mann und ein sehr heißblütiger noch dazu, trotz seiner viel gerühmten Selbstbeherrschung.
Und Jeannie hatte einen Körper, der einen Eunuchen in Versuchung führen konnte.
Der Vergleich mit Venus – der Göttin, in Meerschaum geboren aus den Genitalien des kastrierten Uranus – war eine passende, brutale Erinnerung daran, wozu diese Frau in der Lage war.
Schon als unschuldiges Mädchen besaß sie eine unbestreitbare Sinnlichkeit. Eine ursprüngliche Anziehungskraft, die tiefer ging als ihre äußere Schönheit – die flammend roten Haare, die frechen grünen Augen, die elfenbeinfarbene Haut so geschmeidig wie Sahne und die weichen rosigen Lippen. Es lag etwas im schrägen Schnitt ihrer Augen, im Schwung des üppigen Mundes und der reifen Sinnlichkeit ihres Körpers, was einen Mann nur an eines denken ließ: Sex. Und nicht einfach nur Sex, sondern wilden, überwältigenden, den Verstand raubenden Sex.
Nun, da ihre jugendlichen Kurven zu voller, fraulicher Blüte gereift waren, war die Wirkung sogar noch ausgeprägter.
Und schlimmer noch, er wusste aus Erfahrung, dass der Schein nicht trog. Sie war durch und durch so lüstern, wie sie aussah.
Jeannie war ein einziger erotischer Traum – die fleischgewordene Sinnlichkeit.
Ihm war klar gewesen, dass ihr Wiedersehen nach all den Jahren unangenehm werden könnte, doch auf den rasenden Sturm der Gefühle in seinem Innern war er nicht vorbereitet. Gefühle, entfesselt durch den unbestreitbaren Sog dessen, was ihn ins Verderben gestürzt hatte: Verlangen.
Er wusste nicht, welche Gefühle er erwartet hatte: Wut … Hass … Traurigkeit … Gleichgültigkeit? Alles, außer Lust.
Vor Jahren hatte er sie begehrt, hatte geglaubt, sie haben zu können, und war hart in seine Schranken gewiesen worden.
Doch er war kein liebeskranker junger Bursche mehr, verführt von Liebesgeflüster und einem Körper, der tödlicher war als jede Waffe, der er im Krieg je gegenübergestanden hatte. Er war ein Mann, den der herbe Schlag der Enttäuschung hart gemacht hatte.
Der jähe Anflug von Lust schwand.
Doch dann zog sie das Hemd aus.
Sein Magen krampfte sich zusammen, und er stieß zischend den Atem aus. Jeder Muskel seines Körpers spannte sich an unter der Anstrengung, der Reaktion Einhalt zu gebieten. Ein heißes, schweres Ziehen erfasste seine Lenden, und sein Körper wollte hart werden, doch er kämpfte den Drang nieder. Er hatte nur eine einzige Verwendung für sie, und die war nicht die Befriedigung seiner niederen Instinkte.
Von Lust und Gefühlen würde er sich niemals wieder besiegen lassen.
Um das zu beweisen, zwang er sich, sie genau zu betrachten – kalt, leidenschaftslos, wie ein Mann, der eine schöne Stute begutachtet. Er ließ den Blick über ihren sanft geschwungenen Rücken hinunter zu der weichen Wölbung des runden Hinterteils gleiten, an den straffen Muskeln ihrer langen, wohlgeformten Beine entlang, er nahm jeden Zoll zarter nackter Haut in sich auf.
Aye, sie war wunderschön. Und begehrenswerter als jede Frau, die er je kennengelernt hatte. Einst hätte er sein Leben für sie gegeben. Teufel, das hatte er auch! Nur nicht auf die Art und Weise, wie er es erwartet hatte.
Er ließ den Blick noch etwas verweilen, dann wandte er ihn zufrieden ab. Was auch immer einst zwischen ihnen gewesen war, es war schon vor langer Zeit gestorben. Ihre beachtlichen Reize stellten keine Bedrohung mehr für ihn dar.
Duncan konzentrierte sich wieder auf die Aufgabe, die vor ihm lag, und erkannte, dass er ihre Nacktheit zu seinem Vorteil nutzen konnte. Er hatte sie in der Defensive, und das war bei Jeannie eine gute Ausgangsposition.
Mit hartem Blick wappnete er sich gegen die bevorstehenden Unannehmlichkeiten und trat hinter dem Baum hervor.
Jeannie dachte nicht nach. Sie hörte das Knacken eines Zweiges hinter sich, das Geräusch eines Schrittes, und reagierte.
Statt nach dem Hemd zu greifen, schlossen sich ihre Finger um den kalten Messinggriff ihrer Radschlosspistole. Sie murmelte ein stummes Dankgebet, dass sie sie in kluger Voraussicht geladen hatte, wirbelte herum und richtete die Waffe dorthin, woher das Geräusch gekommen war. Alles, was sie sehen konnte, war der riesige Schatten eines Mannes, der so groß und muskulös war, dass ihr Herz in nackter Panik einen Augenblick lang aussetzte.
Erst vor Kurzem war ihr das Ausmaß ihrer Verletzlichkeit nur zu deutlich vor Augen geführt worden, als sie dem Mackintosh-Schurken in die Hände gefallen war, der versucht hatte, sie zu entführen. Sie war stark, doch selbst die stärkste Frau war einem wilden Highland-Krieger körperlich nicht gewachsen – und diesem hier ganz besonders nicht.
Er wollte etwas sagen, doch sie gab ihm keine Gelegenheit dazu. Sie würde sich nicht noch einmal gefangen nehmen lassen. Jeannie drückte den Abzug, hörte das Radschloss klicken, roch den Zündfunken und wenige Sekundenbruchteile später ließ der Rückstoß des Schusses sie zurücktaumeln.
Der Räuber stieß einen üblen Fluch aus und ging, die Hände in den Bauch gekrallt, in die Knie. Ihre jüngsten Schießstunden machten sich bezahlt, sie hatte gut gezielt.
Er hatte den Kopf gesenkt, doch vage wurde ihr bewusst, dass er für einen Räuber viel zu gute Kleidung trug.
»Ein Messer in den Rücken war wohl noch nicht genug«, ächzte er. »Hast du beschlossen, mich diesmal endgültig zu erledigen?«
Jeder Muskel, jede Faser, jeder Nerv ihres Körpers krampfte sich zusammen – eine instinktive Schutzreaktion. Der volle, tiefe Klang seiner Stimme hallte in den entferntesten Winkeln ihres Gedächtnisses wider. In dem dunklen, vergessenen Ort, den sie für immer verschlossen hatte.
Alles Blut wich aus ihrem Gesicht, dem Körper, und mit einem dumpfen Pochen zog sich ihr Herz zusammen.
Das konnte nicht sein …
Ihr Blick flog zu seinem Gesicht und musterte das harte, kantige, von dunklen, rauen Bartstoppeln bedeckte Kinn, das wellige, rabenschwarze Haar, die kräftige Nase und den breiten Mund. Gut aussehend. Aber hart – zu hart. Er konnte es nicht sein. Doch dann sah sie seine Augen unter dem Metallrand des Helms. Glasklar, so blau wie der Sommerhimmel, durchbohrten sie sie mit einer eindringlichen Vertrautheit, die sich nicht leugnen ließ.
Die Brust wurde ihr so eng, dass es beinahe schmerzte und ihr der Atem stockte.
Der Schock war so groß, als hätte sie einen Geist gesehen. Doch das hier war kein Geist. Der verlorene Sohn war zurückgekehrt. Duncan Dubh Campbell war endlich nach Hause gekommen.
Einen lächerlichen Augenblick lang jubelte ihr Herz, und sie trat einen Schritt vorwärts. »Du bist zurückgekommen!«, rief sie aus, bevor sie die Worte zurückhalten konnte, und in ihrer Stimme schwang all die Hoffnung des unschuldigen, jungen Mädchens mit, das nicht glauben wollte, dass der Mann, den sie liebte, sie im Stich gelassen hatte. Einst hätte sie alles dafür gegeben, sein Gesicht wiederzusehen.
Einst. Sie zuckte zurück.
Das war, bevor er ihr das Herz gebrochen hatte. Bevor er ihr die Unschuld genommen, ihr die Ehe versprochen und sie ohne ein Wort verlassen hatte. Bevor sie tagelang am Fenster gesessen, zum Horizont gestarrt und mit jeder Faser ihres Seins dafür gebetet hatte, dass er zu ihr zurückkam – dass er an sie glaubte … an sie beide. Bevor sie so lange geweint hatte, bis ihre Seele auch von dem letzten Rest Liebe für ihn reingewaschen war.
Ihr Herz zog sich zusammen, als die Erinnerungen auf sie einströmten. Nicht ein einziges Wort in zehn Jahren. Nur im ersten hatte es wehgetan. Die anderen neun Jahre hatte sie zwischen Hass und Selbstvorwürfen hin- und hergeschwankt.
Duncan Campbell war der letzte Mann, den sie jemals wiedersehen wollte.
Oft hatte sie davon geträumt, ihm eine Bleikugel in den Bauch zu jagen; sie hatte nur nie geglaubt, dass das tatsächlich geschehen könnte. Im ersten Impuls wollte sie zu ihm laufen und ihm helfen, doch sie zwang sich, regungslos stehen zu bleiben. Einst hatte sie geglaubt, ihn besser zu kennen als jeder andere auf der Welt, doch heute war dieser Mann ein Fremder für sie.
Sie presste die Lippen zu einem schmalen Strich zusammen und weigerte sich, über das Blut nachzudenken, das zwischen seinen Fingern hervorquoll und einen tiefroten Fleck an seiner Seite bildete, während er versuchte, die Blutung zu stoppen. Er würde nicht sterben … oder etwa doch? Sie schüttelte die Angst ab und fand ihre Stimme wieder. »Was willst du?«
Trotz der Blässe seiner Haut brannte sein Blick, als seine Augen über ihren Körper wanderten, bei ihren Brüsten und zwischen ihren Beinen verweilten.
Mit einem Schlag wurde ihr klar, warum. Gütiger Gott, sie war nackt!
Ihre Wangen glühten eher vor Wut als vor Scham, als sie sich schnell ein trockenes Hemd über den Kopf zog. Sie hatte es so eilig, sich vor seinem Blick zu schützen, dass sie das Kleid auf dem Stapel liegen ließ und stattdessen nach dem Plaid griff, das sie als Unterlage mitgebracht hatte, und es wie ein behelfsmäßiges arisaidh um sich schlang.
»Wie ich sehe, schwimmst du immer noch gern«, meinte er.
Sie zuckte zusammen. Der triefende Sarkasmus in seiner Stimme bei dieser betonten Anspielung auf eine Nacht, die sie liebend gern vergessen würde, war ihr nicht entgangen. Wut wallte in ihr auf. Wie konnte er es wagen, nach allem, was er ihr angetan hatte, sie mit der Erinnerung an ihre naive Torheit zu quälen? Ihre Finger krampften sich fester um die Pistole, die sie noch immer in der Hand hielt. Wäre sie nachgeladen, hätte sie am liebsten noch einmal auf ihn geschossen. Sie begegnete seinem Blick ebenso eindringlich und lächelte kalt. »Und du bist immer noch ein Bastard.«
Das Aufblitzen in seinen blauen Augen verriet ihr, dass der Stich gesessen hatte. Wenn Duncan Dubh – ein treffender Name, wenngleich er ihn eher wegen seines schwarzen Herzens als wegen des schwarzen Haars verdient hätte – eine Schwachstelle in dem stählernen Panzer hatte, der ihn umgab, dann waren es die Umstände seiner Geburt.
Er verbarg seine Reaktion so schnell, dass sie ihr entgangen wäre, wenn sie nicht genau gewusst hätte, worauf sie achten musste. Doch sie wussten beide sehr gut, wie sie einander verletzen konnten. Diese Fertigkeit hatten sie vor Jahren perfektioniert.
Das Lächeln, das seine Mundwinkel kräuselte, war ungefähr so warm wie die eisbedeckten Berggipfel der Cairngorms. »Manche Dinge ändern sich nie«, entgegnete er nüchtern.
Doch er hatte sich verändert.
Stumm starrte sie in das Gesicht, das zugleich schmerzlich vertraut und doch völlig verändert war. Aus dem Jungen war ein Mann geworden. Wenn überhaupt, dann hatte der Lauf der Zeit ihn nur noch attraktiver gemacht – etwas, was sie für unmöglich gehalten hätte. Das schwarze Haar und die blauen Augen waren schon immer eine auffallende Kombination gewesen, doch mit dem Alter waren seine jungenhaften Züge schärfer und ausgeprägter geworden. Er trug sein Haar jetzt kürzer – die sanften Wellen, die ihm bis zum Kinn gereicht hatten, waren auf Ohrhöhe gestutzt. Die tief gebräunte Haut war von Wind und Wetter gegerbt und vom Krieg gezeichnet und ließ ihn nur noch schonungslos männlicher wirken – Ehrfurcht gebietend, beinahe gefährlich.
Doch trotz seiner unbestreitbaren Anziehungskraft regte sich nichts in ihr. Wenn sie ihn ansah, fühlte sie nicht das Geringste. Er hatte alles, was zwischen ihnen gewesen war, schon vor langer Zeit getötet.
»Wir haben nicht viel Zeit«, sagte er. »Man hat den Schuss sicher gehört.« Ungläubig schüttelte er den Kopf. »Ich kann nicht glauben, dass du tatsächlich auf mich geschossen hast.«
Er versuchte, sich seine Schmerzen nicht anmerken zu lassen, und verzog die Lippen zu einem Schmunzeln, was das Grübchen in seiner linken Wange hervortreten ließ. Erschrocken über die qualvolle Vertrautheit und die Erinnerungen hielt sie den Atem an. In wilder Panik begann ihr Herz zu pochen, als die Erkenntnis, was sie durch seine Rückkehr verlieren könnte, mit Gewalt über sie hereinbrach. »Warum bist du hier, Duncan?«
»Ich bin zurückgekommen, um meine Unschuld zu beweisen.« Er sah sie an. »Ich brauche deine Hilfe.«
Seine Miene war teilnahmslos, doch sie wusste, wie viel ihn diese Worte kosteten.
»Warum sollte ich dir helfen? Ich dachte, ich hätte dich verraten.« Sie konnte nicht verhindern, dass ein Hauch Bitterkeit in ihrer Stimme mitschwang.
In seiner Miene regte sich nichts. »Und ich dachte, du hättest das Gegenteil behauptet«, gab er herausfordernd zurück.
Kraftlos sackte er nach hinten und sank zu Boden, doch sie machte keine Anstalten, ihm zu helfen. Jede Spur Mitleid, die sie möglicherweise empfand, weil sie auf ihn geschossen hatte, verblasste angesichts der Gefahr, die seine Rückkehr darstellen konnte. Er hatte sie schon einmal beinahe vernichtet, und er würde niemals die Gelegenheit bekommen, es wieder zu tun.
Und nun war es nicht mehr nur allein ihr Leben, das auf dem Spiel stand.
Ihre Augen wurden schmal. »Jetzt willst du mir also zuhören?« Sie lachte schroff. »Dafür bist du zehn Jahre zu spät. Du hättest niemals zurückkommen sollen, Duncan. Das Einzige, was auf dich wartet, ist eine Schlinge. Und ich werde mit Freuden dafür sorgen, dass man sie dir um den Hals legt.«
Kapitel 2
Zehn Jahre früherStirling Castle, Stirlingshire, Spätsommer 1598
Vielleicht würde das hier gar nicht so schlimm werden.
Jeannie Grant stand zwischen ihrem Vater und ihrer Tante in der Mitte des großen Saals von Stirling Castle und spürte, wie sich ihre Anspannung in Schultern und Nacken allmählich löste. Eine kurze Weile später ertappte sie sich sogar dabei, dass sie einen der Höflinge, denen sie vorgestellt wurde, anlächelte – wirklich anlächelte –, und sie stellte fest, dass sie sich tatsächlich amüsierte.
Hatte sie sich umsonst Sorgen gemacht?
Als ihr Vater, der Chief of Grant of Freuchie, darauf bestanden hatte, dass sie ihn begleitete, wenn er der Vorladung von King James nachkam, hatte sie sich gesträubt, da sie das Schlimmste befürchtete. Heimliche Blicke. Verstohlene Bemerkungen. Geflüster, das sie verfolgte wie damals, als sie noch ein Mädchen gewesen war.
Doch seit ihre Mutter in Ungnade gefallen war, waren acht Jahre und viele, viele Skandale ins Land gegangen. So unausweichlich wie die Morgendämmerung waren neue Unglücke am Horizont aufgetaucht und hatten ihren Platz eingenommen. Tatsächlich sprach bei ihrer Ankunft die ganze Burg über eine Hofdame der Königin, die in Schande vom Hof verbannt worden war.
Jeannie wusste nichts über die näheren Umstände, doch sie könnte niemals Vergnügen am Leid eines anderen empfinden. Ihr halbes Leben hatte sie im Schatten des Skandals ihrer Mutter gelebt. Janet Grant war mit einem »verdammtenEngländer« (für ihren Vater waren die beiden Wörter untrennbar verbunden) durchgebrannt, als Jeannie gerade neun Jahre alt war.
Sie hatte nur allzu deutlich am eigenen Leib erfahren, wie Klatsch und Skandale jeden, den sie berührten, ins Elend stürzten – sogar die Unschuldigen. Ganz besonders die Unschuldigen.
Da ihr Vater und ihre Tante gerade in eine Unterhaltung mit einem alten Bekannten vertieft waren, nutzte Jeannie den freien Augenblick, um tief durchzuatmen. Neugierig sah sie sich in dem riesigen, funkelnden Saal um, der bis unter die hölzernen Dachsparren mit farbenprächtig gekleideten Höflingen vollgestopft war – ein wahrer Augenschmaus aus Samt und Seide. Um ihre Mundwinkel zuckte es. So viel zu der »kleinen Gesellschaft«, die ihr Vater versprochen hatte.
Immer noch darauf wartend, ihren ersten Blick auf King James und Queen Anne werfen zu können, sah sie zu der Menschenmenge am anderen Ende des Saales hinüber. Doch bisher hatte sie noch keine Lücke in der seidenen Mauer aus den Reifröcken und Pluderhosen der Höflinge entdecken können, die das schottische Königspaar umringten.
Über dem lauten Stimmengewirr vernahm sie schwach die sanften Klänge der Laute und die bewegende Melodie von »Greensleeves«, ihrem Lieblingslied – auch wenn es von einem Engländer geschrieben worden war. Die vertrauten Worte klangen ihr durch den Kopf:
O weh, mein Lieb, tust Unrecht mir,grob fortzustoßen mich im Streit.So lange hielt ich treu zu Dirvoll Glück an Deiner Seit.
Sie wedelte sich mit dem Fächer ein paarmal vor den geröteten Wangen, um Bewegung in die stehende, warme Luft zu bringen. Vier gewaltige Kronleuchter hingen von der Decke, beladen mit Unmengen von Kerzen, die einen magischen Schimmer über den Raum warfen. Doch so schön all diese Kerzen auch waren, sie heizten den Raum auf. Und die Hitze und der Lärm trugen nur noch zu dem Gefühl der Aufregung bei, das den Saal erfüllte.
»Das muss Eure Tochter sein«, sagte ein Mann.
Automatisch wandte Jeannie sich um, damit sie den Neuankömmling begrüßen konnte, und ihr Blick begegnete den funkelnden grauen Augen eines vornehm aussehenden Gentlemans mittleren Alters, vielleicht ein paar Jahre älter als ihr Vater mit seinen achtundvierzig Jahren. Er war klein, nicht viel größer als sie selbst mit ihren fünf Fuß und ein paar Zoll, und hatte die Statur eines Fasses. Sein weißes Haar hatte sich gelichtet, und der Haaransatz wich an der Stirn zurück, doch diesen Verlust machte er weiter unten im Gesicht mehr als wett. Sein beeindruckender Schnurrbart war lang und dicht und ringelte sich an den Enden zu zwei perfekt geformten Spitzen. Er erinnerte sie an einen Seelöwen, allerdings ohne dessen Verdrießlichkeit. Das heitere Lächeln auf seinem Gesicht strafte jeden derartigen Gedanken Lügen.
»Aye«, antwortete ihr Vater. »Meine älteste Tochter, Jean.« Ihr Vater wandte sich zu ihr. »Tochter, ich möchte dir gerne einen alten Freund vorstellen, den Laird of Menzies.«
Menzies. Castle Menzies lag in Perthshire, in der Nähe des Ortes, wo ihre Mutter aufgewachsen war.
»Nicht zu alt, um ein schönes Mädchen zu bewundern«, lachte der Laird glucksend und nahm mit einer galanten Verbeugung ihre Hand. Kopfschüttelnd sagte er sanft: »Dieses Haar würde ich überall wiedererkennen.«
Instinktiv versteifte Jeannie sich und wappnete sich gegen das, was als Nächstes kommen würde. Einer Bemerkung über ihr Haar folgte unweigerlich ein wissendes Kopfschütteln und das unvermeidliche »genau wie ihre Mutter«. Als wäre rotes Haar ein untrügliches Anzeichen für ein lebhaftes und abenteuerlustiges – wenn auch gelegentlich unüberlegtes – Temperament.
Sie war nicht die Einzige, die die Bemerkung des Laird of Menzies getroffen hatte. Ihr Vater verkrampfte sich ebenfalls.
Doch statt einer subtilen Spitze sagte der alte Laird zu ihrer Überraschung: »Eure Mutter konnte mit ihrer Schönheit und ihrem Lächeln einen Raum erhellen. So viel Energie, so viel Licht. Sie war wie ein frischer Wind, Eure Mutter.« Wehmütig lächelnd schüttelte er den Kopf. »Ich war betrübt zu hören, dass sie von uns gegangen ist.« Er begegnete Jeannies Blick, und die Fältchen um seine Augen vertieften sich. »Ich habe niemals wieder jemanden wie sie getroffen, aber wie ich sehe, habt auch Ihr etwas von dieser Energie an Euch.«
In seiner Stimme lag keine Spur von Feindseligkeit, die eine andere Bedeutung vermuten ließe, und als sie ihm in die Augen sah, entdeckte sie nichts als Güte.
Sie errötete und murmelte einen schnellen Dank. Es war so lange her, dass jemand etwas Nettes über ihre Mutter zu ihr gesagt hatte, dass sie nicht wusste, was sie darauf antworten sollte. Sie wurde so oft an das Schlechte erinnert, dass sie das Gute dabei vergaß.
Die Erinnerung an ihre Mutter war nur schwach und bruchstückhaft. Ihr perlendes Lachen. Der Duft nach Rosenwasser und den französischen Wein aus der Champagne, den sie liebte. Das dichte kastanienbraune Haar, das Jeannies Haar so ähnlich war und im Kerzenlicht flammend rot leuchtete. Die wunderschönen Ballkleider, die die englische Königin Elizabeth vor Neid hätten erblassen lassen.
Janet Grant hatte den Hof des jungen King James in Holyrood Palace geliebt, und sie war nicht gerne in die unwirtliche »Wildnis« der Highlands zurückgekehrt – also hatte sie es vermieden. Sie war wie ein wunderschöner Schmetterling immer wieder in und aus Jeannies Leben geflattert.
Flattern, das war ein gutes Wort dafür. Ihre Mutter hatte niemals einen Weg verfolgt, sondern hatte sich stets nur von ihren Launen leiten lassen. Aus einer Laune heraus hatte sie geglaubt, in Grant, den Laird of Freuchie, verliebt zu sein, also hatte sie ihn geheiratet. Vier Kinder später, als ihr der Ehemann, den sie liebte, nicht mehr jeden kleinsten Wunsch von den Augen ablas, glaubte sie wiederum aus einer Laune heraus, in den »verdammtenEngländer« – einen anderen Namen hatte dieser Mann in ihrer Familie nicht – verliebt zu sein, also war sie mit ihm durchgebrannt.
Für Jeannie ließ der Schmerz über ihr Fortgehen niemals nach. Es hatte auch nichts geholfen, dass ihre Mutter es schnell wieder bereute. Der Schaden war bereits angerichtet. Donald Grant weigerte sich, sie zurückzunehmen. Die Liebe, die er für seine Frau empfand, hatte dem Schlag, den sie seinem Stolz versetzt hatte, nicht standhalten können. Trotz seiner normannischen Vorfahren war ihr Vater durch und durch ein stolzer Highland-Chief, und Vergebung kam in seinem Wortschatz nicht vor.
Ihre schöne, ungestüme Mutter war kaum ein Jahr später bei einem Kutschunfall ums Leben gekommen – das Ergebnis einer tollkühnen, betrunkenen Wette –, und Jeannie, die Älteste, hatte die Scherben aufsammeln und mit dem belastenden Vermächtnis weiterleben müssen, welche Gefahr Impulsivität bedeutete.
»Jean ist überhaupt nicht wie ihre Mutter«, entgegnete ihr Vater scharf.
Als der Laird of Menzies seinen Fehltritt erkannte, murmelte er eine Entschuldigung und entfernte sich.
Jeannie hatte den verteidigenden Tonfall in der Stimme ihres Vaters bemerkt und versuchte, sich davon nicht ärgern zu lassen. Ihr Vater mochte zwar darauf bestanden haben, dass sie sich nicht länger auf dem Land versteckte und ihn an den Königshof begleitete, doch das bedeutete nicht, dass es ihm keine Sorgen bereitete, sie auf die Umgebung loszulassen, die ihre Mutter so geliebt hatte. Die Anwesenheit ihrer mürrischen Tante als Anstandsdame war ein Beweis dafür.
Sie zweifelte nicht daran, dass ihr Vater sie liebte, doch manchmal ertappte sie ihn dabei, wie er sie mit einem seltsamen Ausdruck in den Augen beobachtete. Es wirkte beinahe so, als wartete er mit angehaltenem Atem darauf, dass sie einen Fehler machte.
Schlimmer noch, sie wusste, dass seine Angst nicht völlig unbegründet war. Wenn sie einen plötzlichen Einfall hatte, dann setzte er sich so hartnäckig in ihrem Kopf fest, dass sie ihn nicht mehr loswurde. Es erschien ihr zu dem Zeitpunkt stets das Richtige zu sein. Wie damals, als sie diesem schrecklichen Billy Gordon die Kleider versteckt hatte, als er im See schwimmen war, sodass er nackt nach Hause laufen musste, oder als sie mit sechs Jahren beschlossen hatte, nach Inverness zu gehen, weil es da einen Laden gab, der ihre Lieblingssüßigkeiten verkaufte, oder damals, als sie ihren Hündchen den besten Wein ihres Vaters zu trinken gegeben hatte und die Tiere daraufhin betrunken bewusstlos geworden waren.
Doch solche Dinge machte sie inzwischen nicht mehr.
Sie wollte den besorgten Ausdruck auf dem Gesicht ihres Vaters mildern und ihm versichern, dass er die Wahrheit sagte, dass sie überhaupt nicht wie ihre Mutter war. Dass nichts sie je dazu bewegen könnte, so unüberlegt zu handeln.
Doch das würde ihm nur noch mehr Schmerz bereiten, deshalb behielt Jeannie ihr Versprechen für sich und wechselte das Thema.
Das Warten hatte ein Ende. Der Laird of Grant war angekommen.
Aufmerksam musterte Duncan Campbell die Menschenmenge, die in den Hof geströmt war und dadurch den Eingang zum Burgsaal blockierte. Doch das schreckte ihn nicht ab. Auch wenn er viel lieber die Ställe der Burg ausmisten als noch einen weiteren Abend höfischer Unterhaltung über sich ergehen lassen würde – wo sich die Dramen viel zu oft nicht nur auf der Bühne abspielten –, er hatte einen Auftrag zu erledigen.
So entschlossen wie ein birlinn, das sich durch die Wellen kämpfte, bahnte er sich seinen Weg durch das Gedränge. Mehr als nur eine junge Frau sah ihn kommen und stolperte ihm »aus Versehen« in den Weg, murmelte eine Entschuldigung und warf ihm dabei einladende Blicke zu. Dass ihn ein paar davon mit etwas mehr als nur einer Tändelei im Sinn ansahen, war eine neue Erfahrung für ihn. Neuigkeiten verbreiteten sich schnell am Königshof, und die Nachricht, dass sein Vater ihn zum Captain der Wache und zum Burgvogt von Castleswene ernannt hatte, war nicht unbemerkt geblieben. Offensichtlich war dieser neue Rang für manche genug, um den Makel seiner Geburt verblassen zu lassen.
Doch keine Verlockung, so kühn sie auch sein mochte, würde ihn von seinem Kurs abbringen. Die letzten paar Tage hatte er damit zugebracht, die Füße stillzuhalten und auf Grants Ankunft zu warten, und nun, da er endlich hier war, brannte Duncan darauf, sich seiner Aufgabe zu widmen. Sein Vater, der mächtige Campbell of Auchinbreck, hatte ihn an den Königshof geschickt, um den Chief of Grant dazu zu bewegen, sich dem König und den Campbells bei der bevorstehenden Schlacht gegen den Earl of Huntly anzuschließen. Sein Vater bot ihm eine weitere Gelegenheit, sich zu beweisen, und Duncan hatte nicht die Absicht, diese Chance ungenutzt verstreichen zu lassen. Deshalb entschuldigte er sich mit einem höflichen Lächeln und setzte seinen Weg entschlossen fort.
Als er den großen Saal betrat, schlug ihm eine Welle aus Hitze und dem widerlich süßen Gestank von Schweiß übertüncht mit zu viel Parfüm entgegen. Gequält verzog er das Gesicht. Was würde er nicht für einen frischen Hauch der nach Heidekraut duftenden Luft der Highlands geben!
Aufmerksam suchte er mit den Augen den Saal nach Grant ab. Wie auf dem Schlachtfeld erwies sich seine erstaunliche Körpergröße als äußerst nützlich, und er konnte den Blick ungehindert über das Meer aus sich dicht drängenden Höflingen schweifen lassen.
Sein jüngerer Bruder Colin, dem es ein wenig schwerer fiel, sich den Weg durch die Menge zu bahnen, kämpfte sich zu ihm durch. »Verdammt, Duncan, nicht so schnell! Du musst wirklich blind sein, Bruder. Lady Margaret hat dir ihre bezaubernden Brüste so fest an den Arm gedrängt, dass sie sie dir praktisch auf einem Silbertablett präsentiert hat.«
Duncan sah seinen Bruder an. Mit seinen achtzehn Jahren gab es nur wenige Dinge, die Colin mehr interessierten als ein Paar bezaubernde Brüste. Zum Teufel, Duncan war mit einundzwanzig selbst auch nicht gerade uninteressiert daran. Er zog eine Augenbraue hoch. »Ich habe sie gesehen.«
»Und da bleibst du nicht stehen und sagst etwas Ermutigendes zu ihr?«, fragte Colin ungläubig. »Das Feld mag ja schon gut gepflügt sein, aber die Ernte lohnt sich trotzdem. Sie ist ein lüsternes Mädchen. Ein richtiger Schreihals, wie ich höre. Thomas sagte, er musste ihr die Hand über den Mund legen, damit sie nicht die ganze Burg aufweckt.«
Duncan runzelte die Stirn. Ob sie nun mit ihrer Gunst freigiebig umging oder nicht, es gefiel ihm nicht, wenn sein Bruder so derb von einem Mädchen sprach. »Ich habe keine Zeit, mit Mädchen herumzutändeln, Colin. Es gibt andere Angelegenheiten, um die ich mich kümmern muss.«
»Wie viel Zeit brauchst du denn?« Colin verstummte kurz, als die besagte junge Frau näher kam und ihr Blick die beiden Brüder interessiert streifte. Er sah ihrem runden Hinterteil nach, als sie mit verführerisch wiegenden Hüften an ihnen vorbeischlenderte, und erst als sie verschwunden war, kehrte Colins Blick wieder zu ihm zurück. »Die Kleine lechzt regelrecht nach dir. Und Grant ist gerade erst angekommen. Deine Unterredung kann doch sicher noch eine Stunde warten, oder etwa nicht?«
»Je eher ich mit ihm spreche, umso eher kann ich ihn überreden, Vernunft anzunehmen.« Und umso eher konnte er wieder nach Castleswene zurückkehren und seine Männer auf die Schlacht vorbereiten.
»Du hast nur eine einzige Sache im Kopf«, meinte Colin kopfschüttelnd.
Der angewiderte Gesichtsausdruck seines Bruders entlockte Duncan ein schiefes Lächeln, und als er sah, wie Colins Augen einem weiteren ansehnlichen Mädchen folgten, lachte er: »Genauso wie du, kleiner Bruder.«
Colin grinste. Er machte sich nicht einmal die Mühe, es zu leugnen.
Duncan verfolgte sein Ziel, sich einen Namen zu machen, unerbittlich, denn er konnte sich den Luxus nicht leisten, es nicht zu tun. Duncan beneidete Colin nicht um die Freiheit, die ihm sein Rang bot. Er akzeptierte seinen Platz mit demselben Pragmatismus, mit dem er alles andere hinnahm, was er nicht ändern konnte.
Für einen Bastard hatte er mehr Glück als die meisten. Nachdem seine Mutter ihn weggegeben hatte, nahm sein Vater ihn in seinen Haushalt auf, zog ihn zusammen mit seinen Halbbrüdern und -schwestern auf und behandelte ihn nicht anders als seine Geschwister. Wenn überhaupt, dann war es seinem Vater eher schwergefallen zu verbergen, dass er seinen unehelichen Sohn vorzog. Doch der Erbe des Lairds of Auchinbreck und sein tanaiste, sein ernannter Nachfolger, war der drei Jahre jüngere Colin. Nicht einmal die Liebe seines Vaters konnte daran etwas ändern.
Aber Duncan hatte sich von den Umständen seiner Geburt nicht hindern lassen. Er hatte hart gearbeitet für das, was er erreicht hatte, und in gewisser Weise vermutete er, dass es dadurch nur noch befriedigender war. Er war zum Captain ernannt und die rechte Hand seines Cousins, des Earls of Argyll geworden, trotz und nicht wegen seiner Geburt.
Das war ein guter Anfang, aber noch längst nicht alles, was Duncan erreichen wollte.
Er wandte sich wieder der vor ihm liegenden Aufgabe zu und setzte seine Suche nach Grant fort.
Plötzlich hielt er inne.
Es war das Lachen, das seine Aufmerksamkeit auf sich zog. Weich und süß, erfüllt von einer natürlichen Ausgelassenheit, die in der Menge abgestumpfter Höflinge völlig fehl am Platz zu sein schien.
Sein Blick fand den Ursprung des Lachens, und er erstarrte. Mit einem scharfen Zischen sog er den Atem ein und sein Körper war wie elektrisiert, erfüllt von einer Wachheit, wie er es noch nie zuvor erlebt hatte.
Wie gelähmt starrte er sie an, und nur ein einziges Wort kam ihm in den Sinn: atemberaubend.
Das Mädchen war eine Schönheit, das ließ sich nicht leugnen, mit dichten Wellen tizianroten Haars, großen grünen Augen, makelloser Haut und feinen Gesichtszügen.
Doch der Saal war voll von schönen Frauen. Da war noch etwas anderes. Etwas, was sein Innerstes erfasste und mit der Feinfühligkeit eines Mahlstroms aufwühlte. Etwas Heißes und Ursprüngliches.
Ein Bild blitzte vor seinen Augen auf, wie sie nackt in seinen Armen lag, mit geröteten Wangen, leicht geöffneten Lippen und vor Lust verdunkelten Augen. Das Bild war so scharf, so real, dass sein Körper darauf reagierte. Blut rauschte ihm durch die Adern und sammelte sich in seinen Lenden. Das harte Resultat kam ebenso schnell wie unerwünscht.
Was zum Teufel war nur los mit ihm? Er benahm sich wie ein unerfahrener Junge.
»Was ist los?«, fragte Colin.
»Nichts«, entgegnete Duncan aus seiner vorübergehenden Benommenheit gerissen. Sein Bruder musterte ihn neugierig. »Das Mädchen«, fragte er mit einem Nicken in ihre Richtung. »Wer ist sie?«
Colin sah ihn merkwürdig an. »Kannst du dir das nicht denken?«
»Wie meinst du das?«
»Sie steht neben dem Mann, auf dessen Ankunft du die ganze Woche ungeduldig gewartet hast.«
Verblüfft darüber, dass ihm etwas so Wichtiges entgangen war, blickte Duncan wieder in ihre Richtung, gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie sie dem älteren Mann, der beschützend an ihrer Seite stand, einen liebevollen Blick zuwarf. Ebenjenem Mann, nach dem er gesucht hatte, dem Laird of Grant. Es war deutlich, dass die beiden sich nahestanden.
»Das muss seine Tochter sein«, fügte Colin hinzu. »Du weißt ja, was mit seiner Frau geschehen ist.«
Grants Tochter? Verdammt. Duncan verspürte einen überraschend scharfen Stich der Enttäuschung, denn er wusste, auch ohne dass man es ihm sagen musste: Die Tochter eines mächtigen Highland-Chiefs lag weit außerhalb der Reichweite eines unehelichen Sohnes, daran änderte auch der Rang eines Captains der Wache nichts.
Hart biss er die Zähne zusammen. Es hatte keinen Sinn, sich über Dinge zu ärgern, die er nicht ändern konnte. Er hatte Grant gefunden und Tochter hin oder her, er hatte eine Aufgabe zu erledigen.
Duncan hatte jedoch erst ein paar Schritte auf sie zugetan, als ihm sein Cousin Archibald Campbell, der mächtige Earl of Argyll, in den Weg trat.
»Da bist du ja, Duncan. Ich habe schon nach dir gesucht. Komm mit, da gibt es jemanden, der mit dir sprechen möchte.«
Duncan runzelte die Stirn. »Aber Grant ist angekommen.«
»Grant kann warten«, entgegnete sein Cousin, dann lächelte er. »Der König nicht.« Als er Colin neben ihm stehen sah, fügte Archie nachträglich hinzu: »Du kannst auch mitkommen.«
Duncan folgte seinem Cousin in ein kleines Vorzimmer, das an den Saal angrenzte. Er sollte eigentlich begeistert über diese Gelegenheit sein – vor wenigen Augenblicken wäre er das auch noch gewesen. Doch stattdessen verspürte er einen unmissverständlichen Anflug von Enttäuschung.
Enttäuschung, die nichts mit Grant, aber alles mit seiner Tochter zu tun hatte.
Da war es wieder, dachte Jeannie. Dieses eigenartige Gefühl, beobachtet zu werden. Sie hatte es auch schon vorhin gespürt, doch als sie sich umsah und nichts Ungewöhnliches entdeckte, fragte sie sich, ob sie es sich möglicherweise nur eingebildet hatte.
Mit nur halbem Ohr hörte Jeannie der Frau neben sich zu – Elizabeth Ramsey, die ihr bereits keine zwei Minuten, nachdem sie sich kennengelernt hatten, begeistert jedes Detail des neuesten Skandals bei Hofe erzählt hatte – und versuchte erneut, die Ursache für dieses unheimliche Gefühl zu finden.
Plötzlich erstarrte sie, denn sie bemerkte ihn sofort – obwohl er nicht in ihre Richtung blickte. Es war schlicht unmöglich, ihn nicht zu bemerken. Groß und breitschultrig, mit schlankem, muskulösem Körperbau so straff wie eine Bogensehne, stand er inmitten der Lowland-Höflinge und den vereinzelten Highlandern wie ihrem Vater, die der Vorladung des Königs Folge geleistet hatten.
Eine seltsame Spannung kribbelte in ihrem Körper.
Zuerst fragte sie sich wegen seiner Größe und muskulösen Statur, ob er vielleicht ein Wachmann war – der Krieger eines hohen Lords. Doch die Qualität seiner feinen Kleidung widersprach dieser Theorie ebenso wie die Aura von Konsequenz und Autorität in seiner stolzen Haltung. Sie dachte immer noch darüber nach, als er sich umdrehte.
Heftig sog sie den Atem ein. Die Minnesänger verstummten. Das chaotische Wirbeln um sie herum kam zum Stillstand. Jeder Nerv, jede Faser ihres Seins erzitterte wie unter einem elektrischen Schlag. Ein sinnlicher Schauer durchlief sie von Kopf bis Fuß, und in der Brust spürte sie ein seltsames Ziehen.
Sie hatte die Barden davon singen hören, dass die Liebe einen Menschen wie ein Blitz treffen konnte, doch sie hatte es für romantische Übertreibung gehalten. Nun war sie sich da nicht mehr so sicher.
Er fing ihren Blick auf und hielt ihn fest.
Ein zweiter elektrisierender Schlag folgte rasch auf den ersten. Seine Augen waren nicht von dieser Welt – ein klares Kobaltblau, das in den Himmel gehörte. Der Kontrast zwischen dem dunklen ebenholzfarbenen Haar, das ihm in weichen Wellen bis zum Kinn hinunterfiel, reichte aus, um ihr Herz das Schlagen vergessen zu lassen.
Gut aussehend schien nicht annähernd auszureichen, um ihn zu beschreiben.
Fragend zog er eine Augenbraue hoch, und ihr wurde errötend bewusst, dass sie ihn anstarrte. Doch sie konnte den Blick einfach nicht von ihm abwenden.
Ganz offensichtlich amüsiert über ihren Mangel an mädchenhafter Sittsamkeit erschien die schwache Andeutung eines Lächelns auf einem Gesicht, das diesen Ausdruck ansonsten nicht gewohnt zu sein schien, wodurch sich in seiner linken Wange ein tiefes Grübchen zeigte. Zu so einem ernsten Gesicht bildete es einen bezaubernden Gegensatz, und Jeannies Herz stolperte noch etwas heftiger.
Er wandte den Blick wieder zurück zu dem Mann an seiner Seite, der etwas zu ihm gesagt hatte, und unterbrach die Verbindung zwischen ihnen.
»Wer ist dieser Mann dort drüben?«, fragte sie Elizabeth. Bevor die andere Frau antworten konnte, erkannte Jeannie den Mann neben ihm und fügte hinzu: »Der neben dem Earl of Argyll steht.«
Elizabeth folgte der Richtung ihres Blicks und stieß einen verträumten Seufzer aus. »Sein Cousin, Duncan Campbell. Ist er nicht hinreißend?«
»Argylls Cousin?«, antwortete Jeannie, wobei sie ihr Interesse ganz offensichtlich nicht so gut verbarg, wie sie sollte, denn Elizabeth Ramsays Augen funkelten schelmisch. »Komm besser nicht auf dumme Gedanken. Nun, zumindest auf keine dauerhaften.« Sie kicherte. »Gegen einen kleinen Ritt auf diesem Hengst hätte ich selber auch nichts einzuwenden.« Bei diesen groben Worten riss Jeannie die Augen auf, doch Elizabeth bemerkte es gar nicht. Sie starrte immer noch hungrig auf den Mann, den sie Duncan genannt hatte. »Er ist der uneheliche Sohn des Campbells of Auchinbreck.«
Enttäuschung flackerte in Jeannie auf. Elizabeths Worte waren zwar derb, doch sie hatte recht. Ein Bastard – sogar der eines so mächtigen Mannes wie des Campbells of Auchinbreck – war keine geeignete Partie für die Tochter des Grants of Freuchie.
Die Entdeckung, dass er ein Bastard war, sollte sie eigentlich entmutigen, doch er hatte irgendetwas an sich. Etwas, was über die Umstände seiner Geburt hinausging. Den Ausdruck von Autorität und die unverkennbare Aura eines Mannes, der wusste, was er wert war.
»Dort ist sie«, flüsterte die Frau neben ihr, nicht in der Lage, ihre Schadenfreude zu verbergen.
»Wer?«, fragte Jeannie abwesend, immer noch auf Duncan Campbell konzentriert.
»Die, von der ich dir erzählt habe«, antwortete Elizabeth mit einem gequälten Augenrollen. »Lady Catherine Murray. Lady Annes Schwester.« Lady Anne war die Hofdame, die in Schande vom Königshof fortgeschickt worden war. »Ich kann nicht glauben, dass sie nicht zusammen mit ihrer Schwester gegangen ist.«
Jeannie runzelte die Augenbrauen. »Warum denn? Das Mädchen hat doch nichts falsch gemacht.«
Elizabeth starrte sie an, als könnte sie nicht glauben, dass jemand so begriffsstutzig sein konnte. »Aber ihre Schwester, und dadurch ist ihr Ruf ebenfalls beschmutzt. So was liegt im Blut, weißt du?«
Jeannie presste die Lippen zu einem harten Strich zusammen und errötend erkannte Elizabeth ihren Fehler.
»Natürlich meinte ich damit nicht …«
Mich. Über Jeannie mochte zwar im Augenblick nicht geklatscht werden, doch es war deutlich, dass der Fehltritt ihrer Mutter nicht vergessen war. Und ebenso wenig hatte Jeannie vergessen, wie es sich anfühlte, im Mittelpunkt übler Nachrede zu stehen.
Also entschuldigte Jeannie sich, straffte die Schultern, reckte das Kinn und ging hinüber zu dem Mädchen, das sich alle Mühe gab, so zu tun, als wüsste sie nicht, dass alle über sie flüsterten.
Obwohl Duncan sich mit seinem Cousin unterhielt, bemerkte er am Rande, dass das Stimmengewirr im Saal stärker wurde. Die flüsternden Stimmen rauschten wie Blätter, die von einem Windstoß aufgewirbelt wurden. Und Grants Tochter schien sich mitten im Auge des Sturms zu befinden.
Nachdem er sie dabei ertappt hatte, wie sie ihn mit solch erfrischender Freimütigkeit anstarrte, wollte er zu ihr gehen – trotz der Tatsache, dass sie nicht länger bei ihrem Vater stand.
Doch dann hatte sie offensichtlich etwas aufgebracht, und sie war sehr entschlossen zu einer anderen jungen Frau hinübermarschiert.
Das Merkwürdige war, dass sich niemand sonst zu ihnen gesellte.
»Hast du eigentlich irgendetwas von dem gehört, was ich gerade gesagt habe?«, fragte Argyll, und die Verärgerung in seiner Stimme drang tatsächlich bis zu Duncan durch.
»Was geht da drüben vor sich?«, erwiderte er, wobei er auf die zwei Mädchen deutete.
Ironisch zog Argyll eine Augenbraue hoch. »Ich dachte, du magst keinen Klatsch.«
Duncan bedachte seinen Cousin mit einem harten Blick; er wusste genau, dass er Klatsch verachtete.
Da Duncan auf seine Stichelei nicht anbiss, zuckte Archie kopfschüttelnd die Schultern. »Nur der neueste Skandal am Hofe. Offensichtlich hatte eine der Hofdamen der Königin beim Zubettgehen ihre Kerze zu dicht an die Bettvorhänge gestellt. Das Feuer konnte zwar schnell gelöscht werden, doch es verursachte ziemliche Aufregung. Als die Diener ins Zimmer stürzten, um den Brand zu löschen, war die Lady splitternackt.« Der junge Earl machte eine dramatische Kunstpause. »Zu ihrem Unglück war der Mann in ihrem Bett nicht ihr Ehemann.«
»Und was hat das mit den Mädchen zu tun?«
»Die Dunkelhaarige ist ihre Schwester, Lady Catherine Murray.« Archie beobachtete ihn aufmerksam – zu aufmerksam. »Die andere ist Grants Tochter. Aber ich vermute, das weißt du bereits.«
Duncan warf ihm einen bezwingenden Blick zu, dann wurden seine Augen schmal. Also wurde die Schwester geschnitten und Grants Tochter hatte sich entschlossen, für sie einzustehen. Alle Achtung!
»Ungewöhnliche Gesellschaft«, bemerkte Archie. »Man sollte meinen, dass Grants Tochter eine Verbindung mit ihr lieber meiden würde.«
»Wie meinst du das?«
»Erinnerst du dich nicht mehr an Grants Frau? Sie verursachte ein ganz schönes Aufsehen, als sie mit diesem Engländer durchbrannte.«
Duncans Blick wurde hart, und er schluckte die Wut hinunter, die in ihm aufwallte. Er verstand nur zu gut. »Stell mich ihr vor«, sagte er.
Aufmerksam sah sein Cousin ihn an. »Warum?«
Duncan drehte sich zu ihm um. »Weil du Lady Catherine zum Tanz auffordern wirst.«
Archie gab sich keine Mühe, seine Belustigung zu verbergen. »Und warum sollte ich wohl etwas so Edelmütiges tun wollen?«
Um Duncans Mundwinkel zuckte es. »Weil du eben ein edelmütiger Mann bist.« Er machte eine kurze Pause. »Ich muss dich nur ab und zu daran erinnern.«
Es war entsetzlich. Niemand redete mit ihnen. Jeannie konnte deutlich sehen, wie es der zerbrechlichen Haltung des anderen Mädchens zusetzte. Sie wusste aus Erfahrung, dass ihr Stolz das Einzige war, was Lady Catherine noch davon abhielt, in Tränen auszubrechen.
All die Erinnerungen an jene Jahre nach dem Skandal um ihre Mutter brachen heiß und schmerzhaft wieder über sie herein. Die Schmach. Die Scham. Die Einsamkeit.
Doch dann sah sie auf, und er stand vor ihr – Duncan Campbell – und mit ihm sein Cousin, einer der mächtigsten Männer Schottlands.
Sie hörte kaum, wie Argyll sie einander vorstellte, weil sie den Blick von dem Mann, der vor ihr stand, nicht abwenden konnte, ebenso wenig hielt sie die Welle der Dankbarkeit zurück, die ihm entgegenströmte.