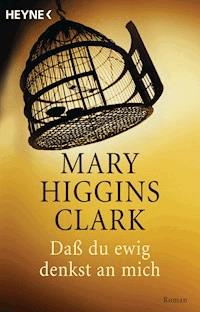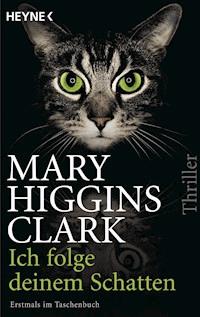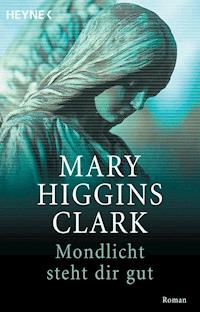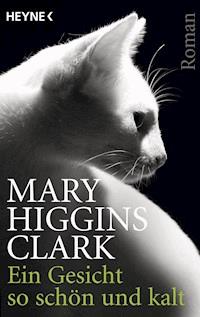8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Eine einstmals harmonische Ehe verwandelt sich in ein Szenario des Grauens, als Jenny ihrem Mann in die Wälder Minnesotas folgt. Unheimliche Dinge ereignen sich. Als Jennys Töchter verschwinden, begibt sie sich auf die Suche. In einer Jagdhütte macht sie eine furchtbare Entdeckung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 471
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Meinen Eltern und Brüdern gewidmet,Luke, Nora, Joseph und John Higgins, zum Dankfür eine glückliche Kindheit.
Prolog
Bei Tagesanbruch begann Jenny die Hütte zu suchen. Wie gelähmt von der Stille des Hauses hatte sie die ganze Nacht wach gelegen, wach und regungslos in dem großen Himmelbett.
Jennys Gehör war immer noch auf das hungrige Schreien des Babys geeicht, ihre Brüste waren immer noch voll, bereit, die winzigen begierigen Lippen zu begrüßen, obwohl sie schon seit Wochen wußte, daß alles Warten vergeblich war.
Schließlich knipste sie die Nachttischlampe an: Es wurde hell, und die Kristallschale auf der Frisierkommode sammelte das Licht und warf es gebündelt zurück. Die kleinen runden Stücke Fichtennadelseife, mit denen die Schale gefüllt war, verliehen der antiken silbernen Toilettengarnitur einen unheimlichen grünen Schimmer.
Jenny stand auf und begann sich anzuziehen, nahm die lange Unterwäsche und den dicken Pullover, den sie gewöhnlich unter ihrem Skianzug trug. Sie hatte das Weckradio auf vier Uhr gestellt. Der Wetterbericht für das Gebiet von Granite Place, Minnesota, war unverändert; die Temperatur war elf Grad unter Null. Die Windgeschwindigkeit lag bei vierzig Kilometern in der Stunde. Der Windkältefaktor betrug einunddreißig Grad minus.
Es war egal. Alles war egal. Sie mußte die Hütte finden, und wenn sie dabei erfror — irgendwo dort im Wald, unter Ahorn und Eichen, Tannen, Kiefern und überwuchertem Gehölz. Jenny hatte sich in jenen schlaflosen Stunden alles genau überlegt: Erich ging viel schneller als sie. Wegen seiner langen Schritte eilte er ihr immer unwillkürlich voraus. Sie machten sich beide darüber lustig. »He, warte bitte auf das Stadtmädchen«, protestierte sie dann gern.
Einmal hatte er auf dem Weg zur Hütte den Schlüssel vergessen und war sofort bei der Ankunft umgekehrt, um ihn zu holen. Vierzig Minuten insgesamt hatte er gebraucht. Also war die Hütte für ihn etwa zwanzig Minuten vom Waldrand entfernt.
Er hatte Jenny nie mitgenommen. »Versteh das bitte, Jenny«, bettelte er. »Jeder Künstler braucht einen Platz, wo er ganz alleine ist.«
Sie hatte noch nie versucht, die Hütte zu finden. Den Farmarbeitern war es streng verboten, in den Wald zu gehen. Selbst Clyde, seit dreißig Jahren Verwalter des Anwesens, wußte angeblich nicht, wo die Hütte war.
Der tiefe, verharschte Schnee machte sicher jeden Pfad unkenntlich, erlaubte es aber Jenny immerhin, die Langlaufskier zu benutzen. Sie mußte aufpassen, daß sie sich nicht verlief. Bei dem dichten Unterholz und ihrem katastrophalen Richtungssinn konnte es leicht passieren, daß sie im Kreis ging.
Jenny hatte darüber nachgedacht und beschlossen, einen Kompaß, einen Hammer, kleine Nägel und Lappen mitzunehmen. Wenn sie die Lappen einfach an Bäume nagelte, konnte sie den Rückweg finden.
Ihr Skianzug war im Wandschrank neben der Küche. Während das Kaffeewasser heiß wurde, streifte sie den Anzug über. Der Kaffee half ihr, sich zu konzentrieren. In der Nacht hatte sie kurz erwogen, zu Sheriff Gunderson zu fahren. Aber er würde sich bestimmt weigern, ihr zu helfen, und sie nur mit jenem halb skeptischen, halb verächtlichen Gesichtsausdruck anstarren.
Sie wollte eine Thermosflasche Kaffee mitnehmen. Sie hatte zwar keinen Schlüssel zu der Hütte, aber mit dem Hammer konnte sie ein Fenster einschlagen.
Obwohl Elsa schon seit über zwei Wochen nicht mehr gekommen war, blitzte das große alte Haus noch vor Sauberkeit, ein sichtbarer Beweis ihrer strengen Maßstäbe. Sie hatte die Gewohnheit, beim Weggehen den jeweiligen Tag vom Kalender über dem Wandtelefon abzureißen. Jenny hatte mit Erich darüber gescherzt. »Sie putzt nicht nur das, was nie schmutzig war, sie löscht auch noch jeden Abend in der Woche aus.«
Jetzt riß Jenny ›Freitag, 14. Februar‹ ab, knüllte die Seite zusammen und starrte auf die leere Fläche unter dem fettgedruckten Datum: ›Sonnabend, 15. Februar‹. Sie zuckte zusammen. Seit jenem Tag in der Galerie, als sie Erich kennengelernt hatte, waren fast vierzehn Monate vergangen. Nein, das konnte nicht sein. Da lag ein ganzes Leben dazwischen. Sie rieb sich die Stirn.
Ihr kastanienbraunes Haar war während der Schwangerschaft beinahe schwarz geworden. Es fühlte sich stumpf und leblos an, als sie es unter die wollene Skimütze stopfte. Der Spiegel mit dem Perlmuttrahmen links von der Tür paßte eigentlich nicht in die altmodisch-gediegene Küche mit den Eichenbalken. Sie starrte hinein. Ihre Augen, normalerweise von einem Farbton irgendwo zwischen Aquamarin und Blau, starrten ihr ausdruckslos und mit geweiteten Pupillen entgegen. Sie hatte Ringe unter den Augen, und ihre Wangen waren eingesunken. Sie war seit der Geburt schrecklich abgemagert. Ihre Halsschlagader pulsierte, als sie den Reißverschluß des Skianzugs ganz zuzog. Siebenundzwanzig Jahre. Doch sie fand, daß sie mindestens zehn Jahre älter aussah, und sie fühlte sich hundert Jahre älter. Wenn nur diese Benommenheit weggehen würde. Wenn das Haus nur nicht so still, so beängstigend, erschreckend still wäre.
Sie schaute zu dem gußeisernen Herd an der Ostwand der Küche. Die Wiege, nun mit Holz gefüllt, stand wieder daneben, war wieder zu etwas nütze.
Sie zwang sich, die Wiege zu betrachten und den Schock zu verarbeiten, den sie immer spürte, sobald sie die Küche betrat. Dann griff sie nach der Thermosflasche und goß Kaffee hinein, holte den Kompaß, Hammer, die Stiftnägel und Scheuerlappen. Sie warf alles in einen Rucksack, schlang sich ihren Schal vors Gesicht, zog die Langlaufschuhe an, schlüpfte in fellgefütterte Fäustlinge und machte die Tür auf.
Der scharfe, peitschende Wind durchdrang den Schal im Nu. Das dumpfe Muhen der Kühe im Stall klang in Jennys Ohren wie das erschöpfte Schluchzen aus tiefstem Kummer. Die Sonne ging auf, wurde in ihrer rotgoldenen Schönheit grell vom Schnee zurückgeworfen, ein ferner Gott, der nichts gegen die bittere Kälte ausrichten konnte.
Inzwischen machte Clyde sicher seinen ersten Gang durch den Kuhstall. Die Knechte gabelten Heu in die Raufen im Freien, um die schwarzen Angusrinder zu füttern, die unter dem harten Schnee nicht grasen konnten und dort gewohnheitsmäßig Schutz und Nahrung suchten. An die sechs Männer arbeiteten gerade auf dieser großen Farm, aber keiner war in der Nähe des Hauses; sie waren alle nur winzige dunkle Gestalten, wie Scherenschnitte vor dem Horizont.
Die Langlaufskier standen neben der Küchentür. Jenny trug sie die sechs Verandastufen hinunter, warf sie hin, trat in die Bindungen und rastete sie ein. Gott sei Dank hatte sie letztes Jahr gut Ski laufen gelernt.
Als sie anfing, die Hütte zu suchen, war es kurz nach sieben. Sie beschränkte sich darauf, in jeder Richtung höchstens dreißig Minuten zu laufen. Sie begann an dem Punkt, wo Erich immer im Wald verschwand. Die Zweige über ihr waren so dicht, daß die Sonne kaum durchdrang. Wenn sie in einer möglichst geraden Linie gelaufen war, bog sie nach rechts ab, legte noch etwa hundert Meter zurück, bog wieder nach rechts und lief zum Waldrand zurück. Der Wind verwehte ihre Spuren schon nach wenigen Metern, aber jedesmal, wenn sie die Richtung änderte, nagelte sie einen Lappen an einen Baum.
Um elf kehrte sie zum Haus zurück, machte Suppe warm, zog trockene Socken an, zwang sich, den kribbelnden Schmerz in Kopf und Händen zu ignorieren, und lief wieder los.
Um fünf, als die tiefen Strahlen der Sonne verblaßten, war sie, halb erfroren, drauf und dran, die Suche fürs erste aufzugeben, beschloß dann aber, noch eine weitere Kuppe zu untersuchen. Und da entdeckte Jenny sie plötzlich — die kleine rindengedeckte Blockhütte, die Erichs Urgroßvater 1869 gebaut hatte. Jenny starrte hin und biß sich auf die Lippen. Grausame Enttäuschung durchfuhr sie schneidend wie ein Stilett.
Die Rouleaus waren geschlossen; die Hütte wirkte abweisend, als wäre sie lange nicht benutzt worden. Der Schornstein war schneebedeckt; kein Licht drang heraus.
Hatte sie wirklich zu hoffen gewagt, dieser Schornstein würde rauchen, Licht durch die Vorhänge schimmern, und sie könnte einfach zur Tür gehen und aufmachen, wenn sie erst einmal vor der Hütte stand?
An der Tür war ein Metallschild. Die Buchstaben waren verblichen, aber noch lesbar: Zutritt verboten. Zuwiderhandelnde werden strafrechtlich verfolgt. Die Unterschrift lautete: Erich Fritz Krueger, das Datum: 1903.
Links von der Hütte stand ein Pumpenhaus, eine Außentoilette, zur Hälfte von barmherzigen, dichten Fichten verborgen. Jenny versuchte, sich vorzustellen, wie der kleine Erich mit seiner Mutter hierhergekommen war. »Caroline liebte die Hütte, so wie sie war«, hatte Erich ihr erzählt. »Mein Vater hätte das alte Ding gern renoviert, aber sie wollte nichts davon wissen.«
Der Kälte nicht mehr bewußt, lief Jenny zum nächsten Fenster. Sie griff in den Rucksack, nahm den Hammer heraus, holte aus und schlug die Scheibe ein. Scherben streiften ihre Wange. Sie spürte das Blut nicht, wie es über ihr Gesicht lief und gefror. Vorsichtig, um sich nicht an den scharfen Zacken zu verletzen, langte sie hinein, löste den Riegel und schob das Fenster hoch.
Sie strampelte ihre Skier los, kletterte über das niedrige Sims, schob das Rouleau zur Seite und betrat die Hütte.
Sie bestand aus einem einzigen Raum, etwa sechs Meter im Quadrat. Neben einem eisernen Kaminofen an der Nordwand war Holz gestapelt. Ein verschossener Orientteppich bedeckte den größten Teil der hellen Fichtendielen. Ein breites, samtbezogenes Sofa mit hoher Lehne und passende Sessel waren vor dem Ofen gruppiert. An den vorderen Fenstern stand ein langer Eichentisch mit zwei Bänken. Ein Spinnrad sah aus, als würde es noch funktionieren. Auf einer Anrichte aus massiver Eiche standen Petroleumlampen und Porzellan mit chinesischem Weidenmuster. Links führte eine steile Treppe hoch. Daneben waren reihenweise ungerahmte Bilder in Gestelle sortiert.
Die Wände waren aus heller Fichte ohne Astlöcher, seidenglatt, mit Gemälden bedeckt. Wie benommen ging Jenny von einem zum anderen. Die Hütte war das reinste Museum! Nicht einmal das ungenügende Licht konnte die erlesene Schönheit der Ölbilder und Aquarelle, der Kohle- und Federzeichnungen mindern. Erich hatte noch nicht einmal angefangen, seine besten Arbeiten auszustellen. Sie fragte sich, wie die Kritiker reagieren würden, wenn sie erst diese Meisterwerke sahen.
Einige der Bilder an der Wand waren bereits gerahmt. Das mußten die Arbeiten sein, die er als nächstes zeigen wollte. Eine Heuraufe im Schneesturm. Was war daran so anders? Eine Damhirschkuh, die mit geneigtem Kopf witterte, im Begriff, in den Wald zu fliehen. Ein Kalb, das sich nach der Mutter reckte. Blaue, erntereife Luzernefelder. Die Kongregationalistenkirche mit herbeieilenden Gläubigen. Die Hauptstraße von Granite Place, scheinbar unberührt vom Lauf der Zeit.
Die ruhige Schönheit der Sammlung schenkte Jenny bei aller Verzagtheit kurz ein Gefühl von Frieden.
Schließlich beugte sie sich über die ungerahmten Bilder im vordersten Gestell. Wieder war sie hingerissen vor Bewunderung. Die unfaßbare Bandbreite von Erichs Talent, seine Fähigkeit, Landschaften genauso meisterhaft zu malen wie Menschen und Tiere, die Unbeschwertheit des sommerlichen Gartens mit dem alten Kinderwagen, die...
Und dann sah sie es. Verständnislos begann sie, wie gejagt die Bilder und Skizzen in den Ordnern zu durchblättern.
Sie lief von einem Gemälde an der Wand zum nächsten. Ihre Augen weiteten sich ungläubig. Kaum wissend, was sie tat, stolperte sie zur Treppe und rannte zum Speicher hinauf. Wegen der Dachschräge mußte sie sich auf der obersten Stufe bücken, ehe sie den Raum betreten konnte. Als sie sich aufrichtete, wurde sie geblendet von einer alptraumhaft intensiven Farbenfülle an der hinteren Wand. Entsetzt starrte sie auf ihr eigenes Bild. Ein Spiegel?
Nein. Das gemalte Gesicht bewegte sich nicht, als sie sich näherte. Das trübe Licht, das durch das schmale Lukenfenster drang, spielte auf der Leinwand mit Schattenstreifen wie ein geisterhaft zeigender Finger. Unfähig, sich von der Leinwand loszureißen, starrte sie das Bild minutenlang an, nahm jede groteske Einzelheit auf, spürte, wie sich ihr Mund in grenzenloser Pein verkrampfte, hörte den keuchenden Ton, der sich ihrer Kehle entrang.
Endlich zwang sie ihre tauben, widerstrebenden Finger, die Leinwand zu packen und von der Wand zu reißen.
Sekunden später entfernte sie sich mit dem Gemälde unter dem Arm von der Hütte. Der Wind war heftiger geworden und peitschte ihr ins Gesicht, nahm ihr den Atem, erstickte ihren verzweifelten Schrei.
1
Die Ausstellung der Gemälde von Erich Krueger, dem neuentdeckten Künstler aus dem Mittelwesten, war offensichtlich ein sensationeller Erfolg. Der Empfang für Kritiker und andere geladene Gäste begann um vier, doch angelockt von ›Erinnerung an Caroline‹, dem großartigen Ölbild im Fenster, waren Neugierige schon durch die Galerie gestreift.
Jenny widmete sich geschickt einem Kritiker nach dem anderen und stellte den Maler vor, wechselte einige Worte mit Sammlern, achtete darauf, daß die Kellner die Häppchen herumreichten und Sekt nachschenkten.
Vom frühen Morgen an war alles schiefgelaufen. Erst wollte die sonst so fügsame Beth partout nicht zur Kindertagesstätte, nachdem schon Tina, die mit zwei Jahren Backenzähne bekam, nachts ständig mit Geschrei aufgewacht war. Dann hatte der Schneesturm vom Neujahrstag New York in einen Alptraum steckengebliebener Autos und matschiger, dreckiger Schneehaufen auf den Randsteinen verwandelt. Als sie die Kinder in der Tagesstätte hatte, war sie eine Stunde zu spät dran. Mr. Hartley war entsprechend außer sich.
»Nichts klappt mehr, Jenny. Nichts ist fertig. Ich warne Sie. Ich brauche jemanden, auf den ich mich verlassen kann.«
»Tut mir schrecklich leid.« Sie hängte hastig ihren Mantel in den Wandschrank. »Wann kommt Krueger?«
»Gegen eins. Und drei der Bilder sind erst vor ein paar Minuten gebracht worden, ob Sie’s glauben oder nicht!«
Jenny hatte immer den Eindruck, daß sich der kleine, etwa sechzigjährige Herr wie ein Siebenjähriger aufführte, wenn er die Fassung verlor. »Jetzt sind doch aber alle da, oder?« fragte sie besänftigend.
»Ja, ja, aber als Krueger gestern abend anrief, habe ich ihn gefragt, ob er die drei letzten geschickt hätte. Er war furchtbar wütend, weil er fürchtete, sie seien verlorengegangen. Und er besteht darauf, daß das von seiner Mutter ins Fenster kommt, obgleich es nicht verkäuflich ist. Ich sage Ihnen eines, Jenny: Es ist, als hätten Sie für das Bild Modell gesessen.«
»Hab’ ich leider nicht.« Jenny widerstand dem Impuls, Hartley die Schulter zu tätscheln. »Da nun alles da ist — wollen wir nicht die Bilder fertig hängen?«
Geschickt machte sie sich ans Verteilen, gruppierte die Ölbilder, die Aquarelle, die Federzeichnungen, die Kohlezeichnungen.
»Sie haben ein gutes Auge, Jenny«, sagte Hartley, sichtlich besser gelaunt, als das letzte Werk hing. »Ich wußte, daß wir es schaffen.«
Natürlich! dachte sie und versuchte, nicht zu seufzen.
Die Galerie öffnete um elf. Um fünf vor elf stand das auf den Plakaten reproduzierte Bild im Fenster, daneben in stilvoller, klarer Schrift eine samtgerahmte Ankündigung: Erich Krueger. Zum erstenmal in New York. Das Gemälde erregte sofort die Aufmerksamkeit der Passanten auf der 57. Straße. Jenny beobachtete von ihrem Schreibtisch, wie die Leute stehenblieben, um es zu betrachten. Viele kamen auch herein und sahen sich die Ausstellung an, und oft fiel die Frage: »Sind Sie das auf dem Bild im Fenster?«
Jenny verteilte Faltblätter mit Erich Kruegers Biographie:
»Krueger, vor zwei Jahren mit einem Schlag in der Kunstwelt bekannt geworden, lebt in Granite Place, Minnesota, und hat seit seinem 15. Lebensjahr gemalt, aus Berufung, wie er erklärt. Sein Heim ist eine Farm, die schon in der vierten Generation im Besitz der Familie ist. Er züchtet dort preisgekrönte Rinder. Er ist auch Vorstandsvorsitzender der Krueger-Kalkwerke. Ein Kunsthändler aus Minneapolis entdeckte sein Talent. Krueger hat seither in Minneapolis, Chicago, Washington und San Francisco ausgestellt. Er ist 34 Jahre alt und Junggeselle.«
Jenny betrachtete sein Foto auf dem Umschlag. Und er sieht fabelhaft aus, dachte sie.
Um halb zwölf kam Hartley zu ihr. Sein gehetzter Gesichtsausdruck war beinahe verschwunden. »Alles okay?«
»Bestens«, beruhigte sie ihn und kam gleich seiner nächsten Frage zuvor: »Mit dem Party-Service geht alles in Ordnung. Und von der Times, vom New Yorker, von Newsweek, Time und Art News kommt bestimmt jemand. Wir werden mindestens acht Kritiker beim Empfang haben, und zusammen mit denen ohne Einladung kommen sicher an die hundert Leute. Wir schließen um drei für das allgemeine Publikum. Dann haben die Leute vom Party-Service reichlich Zeit, um alles herzurichten.«
»Sie sind ein tüchtiges Mädchen, Jenny.« Jetzt, wo alles geregelt war, entspannte sich Hartley und zeigte sich von seiner gütigen Seite. Was er wohl sagen würde, wenn sie ihm schon jetzt eröffnete, daß sie nicht bis zum Ende des Empfangs bleiben konnte? »Lee ist gerade gekommen«, fuhr Jenny fort. Sie meinte ihren Teilzeitassistenten. »Es läuft also alles bestens.« Sie lächelte ihn an. »Und nun hören Sie bitte auf, sich Sorgen zu machen.«
»Ich werd’s versuchen. Sagen Sie Lee, daß ich vor eins wieder da bin, um mit Krueger zu lunchen. Sie gehen am besten gleich und sehen zu, daß Sie etwas in den Magen bekommen.«
Sie beobachtete, wie er mit flinken Schritten den Raum verließ. Momentan war gerade niemand in der Galerie. Sie wollte das Gemälde im Fenster in aller Ruhe betrachten. Ohne ihren Mantel anzuziehen, schlüpfte sie hinaus und blieb in einigem Abstand vom Schaufenster stehen, um das Werk gut überblicken zu können. Die Passanten machten nach einem kurzen Blick auf sie und das Bild rücksichtsvoll einen Bogen um sie.
Die junge Frau auf dem Gemälde saß in einer Schaukel auf der Veranda und blickte zur untergehenden Sonne. Das Licht war gebrochen, rote, purpurne und malvenfarbene Töne. Die schlanke Gestalt war in ein dunkelgrünes Cape gehüllt. Feinste blauschwarze Haarsträhnen umspielten ihr Gesicht, das schon im Halbschatten lag. Ich sehe jetzt, was Hartley meint, dachte Jenny. Die hohe Stirn, die dichten Brauen und die großen Augen, die feine, gerade Nase und die vollen Lippen glichen ihren eigenen Zügen. Die Holzveranda war weiß lakkiert und hatte einen zierlichen Eckpfosten. Die Backsteinmauer des Hauses im Hintergrund war nur angedeutet. Ein kleiner Junge, der sich scharf im Sonnenlicht abzeichnete, lief über ein Feld auf die Frau zu. Verharschter Schnee deutete die durchdringende Kälte der bevorstehenden Nacht an. Die Gestalt auf der Schaukel wirkte starr und hatte den Blick auf den Sonnenuntergang geheftet.
Trotz des herbeieilenden Kindes, der vertrauenerweckenden Solidität des Hauses, der Weite der Landschaft kam es Jenny vor, als sei die Frau auf sonderbare Weise einsam oder isoliert. Warum? Vielleicht lag es an dem traurigen Ausdruck ihrer Augen. Oder war es nur, weil das ganze Bild bittere Kälte heraufbeschwor? Wieso saß sie bei dieser Kälte draußen? Warum betrachtete sie den Sonnenuntergang nicht von einem Fenster aus?
Jenny erschauerte. Ihr Rollkragenpullover war ein Weihnachtsgeschenk von ihrem Ex-Mann Kevin. Er war Heiligabend überraschend aufgekreuzt, mit dem Pulli für sie und Puppen für die Mädchen. Kein Wort über die Tatsache, daß er nie Unterhaltszahlungen überwies und ihr sogar noch über zweihundert Dollar schuldete, die sie ihm gepumpt hatte. Der Pullover war billig und wärmte so gut wie gar nicht. Aber er war wenigstens neu, und die Türkisfarbe war ein guter Fond für Nanas goldene Kette mit dem Medaillon. Ein Vorteil der Kunstwelt bestand natürlich darin, daß die Leute sich sehr unkonventionell kleideten, und ihr zu langer Wollrock und die zu weiten Stiefel waren nicht unbedingt ein Armutsgeständnis. Trotzdem sollte sie besser wieder hineingehen. Die Grippe, die gerade in New York grassierte, war das letzte, was sie jetzt brauchen konnte.
Sie starrte wieder auf das Bild und bewunderte das Geschick, mit dem der Maler den Blick des Betrachters von der Gestalt auf der Veranda zu dem kleinen Jungen und dann auf den Sonnenuntergang richtete. »Wunderschön«, flüsterte sie. »Wirklich wunderschön.« Unbewußt trat sie einen Schritt zurück, während sie vor sich hin redete, glitt auf dem rutschigen Pflaster aus und fühlte, wie sie gegen jemanden fiel. Starke Arme hielten sie an den Ellbogen fest und richteten sie wieder auf.
»Stehen Sie oft bei solchem Wetter ohne Mantel draußen und führen Selbstgespräche?« Aus der Stimme klangen Ärger und Belustigung zugleich.
Jenny fuhr herum. Verwirrt stammelte sie: »Tut mir schrecklich leid, entschuldigen Sie bitte. Habe ich Ihnen weh getan?« Sie trat zurück und erkannte, daß sie das Gesicht betrachtete, das auf dem Umschlag des Katalogs war, den sie den ganzen Vormittag verteilt hatte. Großer Gott, dachte sie, daß ich ausgerechnet Erich Krueger anrempeln muß!
Sie sah, wie er erbleichte, die Augen aufriß, die Lippen aufeinanderpreßte. Er ist wütend, dachte sie, zumindest pikiert. Ich habe ihn praktisch umgerannt. Zerknirscht streckte sie die Hand aus. »Es tut mir so leid, Mr. Krueger. Ich hoffe, Sie werden mir verzeihen. Ich hatte einfach nur Augen für das Bild Ihrer Mutter. Es ist... es ist unbeschreiblich. Oh, kommen Sie doch herein. Ich bin Jenny MacPartland. Ich arbeite in der Galerie.«
Eine ganze Zeitlang verweilte sein Blick auf ihrem Gesicht, studierte jeden einzelnen Zug. Sie wußte nicht, was sie tun sollte, und stand betreten da. Allmählich wurde sein Ausdruck weicher. »Jenny.« Er lächelte und wiederholte: »Jenny.« Dann fügte er hinzu: »Ich wäre nicht überrascht gewesen, wenn Sie gesagt hätten... Aber, lassen wir das.«
Das Lächeln machte ihn unendlich liebenswert. Ihre Augen waren praktisch auf gleicher Höhe, und ihre Stiefel hatten sieben Zentimeter hohe Absätze, so daß sie ihn auf gut einen Meter sechsundsiebzig schätzte. Sein ebenmäßiges Gesicht wurde von tiefliegenden blauen Augen beherrscht. Dichte, gut geformte Brauen ließen die Stirn nicht zu breit erscheinen. Lockiges, bronzeblondes Haar erinnerte sie an Bildnisse auf alten römischen Münzen. Er hatte die gleichen schmalen Nasenflügel und den gleichen sensiblen Mund wie die Frau auf dem Bild. Er trug einen kamelhaarfarbenen Kaschmirmantel und hatte einen Seidenschal um. Was habe ich eigentlich erwartet? fragte sie sich. Auf das Wort Farm hin hatte sie sich sofort vorgestellt, wie der Maler mit Jeansjacke und schmutzigen Stiefeln in die Galerie gestapft kam. Bei dieser Vorstellung mußte sie lächeln und kehrte in die Realität zurück. Die Situation war recht absurd. Sie stand da und zitterte vor Kälte. »Mr. Krueger...«
Er unterbrach sie. »Jenny, Sie frieren. Es tut mir furchtbar leid.« Seine Hand war unter ihrem Arm. Er führte sie zur Tür der Galerie und machte ihr auf.
Er fing sofort an, die Anordnung seiner Bilder zu prüfen und bemerkte, was für ein Glück es sei, daß die letzten drei noch rechtzeitig eingetroffen waren. »Ein Glück für den Spediteur«, fügte er lächelnd hinzu.
Jenny folgte ihm bei der eingehenden Begutachtung, zweimal blieb er stehen, um Gemälde zurechtzurücken, die kaum merklich schief hingen. Als er fertig war, nickte er sichtlich zufrieden. »Warum haben Sie ›Pflügen im Frühling‹ neben ›Die Ernte‹ gehängt?« fragte er.
»Es ist doch dasselbe Feld, nicht wahr?« fragte Jenny. »Ich empfand einfach die Kontinuität zwischen dem Pflügen des Bodens und der Ernte. Ich wünschte nur, es gäbe auch eine Sommerszene.«
»Es gibt eine«, antwortete er. »Aber ich habe beschlossen, sie nicht zu schicken.«
Jenny warf einen Blick auf die Uhr über der Tür. Es war kurz vor zwölf. »Mr. Krueger, wenn es Ihnen recht ist, bringe ich Sie jetzt in Mr. Hartleys Büro. Er hat für ein Uhr einen Tisch im Russian Tea Room bestellt. Er kommt sicher gleich. Ich verschwinde für ein paar Minuten und esse irgendwo ein Sandwich.«
Erich Krueger half ihr in den Mantel. »Mr. Hartley muß heute leider allein essen«, erklärte er. »Ich sterbe vor Hunger und gehe mit Ihnen zum Lunch. Das heißt natürlich, wenn Sie nicht schon verabredet sind?«
»Nein, ich wollte nur schnell in den Drugstore.«
»Versuchen wir’s doch im Tea Room. Um diese Zeit ist sicher noch etwas frei.«
Sie akzeptierte widerstrebend, weil sie wußte, daß Hartley sauer sein würde — und sie zunehmend Gefahr lief, gekündigt zu werden. Sie kam viel zu oft zu spät. Sie hatte letzte Woche zwei Tage zu Hause bleiben müssen, weil Tina krank war. Aber ihr blieb jetzt nichts anderes übrig, als mitzugehen.
Im Restaurant überhörte er den mißbilligenden Hinweis, daß er nicht reserviert hätte, und schaffte es, eben den Ecktisch zu bekommen, den er haben wollte. Jenny lehnte den vorgeschlagenen Wein ab. »Dann wäre ich in einer Viertelstunde am Einschlafen. Ich habe gestern nacht nicht viel Schlaf bekommen. Für mich bitte Perrier.«
Sie bestellten Club-Sandwiches, dann beugte er sich vor. »Erzählen Sie mir etwas von sich, Jenny MacPartland.«
Sie versuchte, nicht zu lachen. »Haben Sie schon mal den Dale-Carnegie-Kurs gemacht?«
»Nein, warum?«
»Sie sagen einem immer, man solle genau diese Frage stellen, wenn man jemanden kennenlernt. Interesse für den anderen zeigen. Ich möchte etwas über Sie wissen.«
»Zufällig möchte ich das wirklich.«
Die Getränke kamen, und sie begann zu berichten: »Ich bin alleinstehendes Familienoberhaupt, wie man so schön sagt. Ich habe zwei kleine Töchter, Beth, drei Jahre, und Tina, neulich zwei geworden. Wir haben eine Wohnung in einem Brownstone — einem Haus aus braunem Sandstein — in der siebenunddreißigsten Straße, Eastside. Wenn ich einen Flügel hätte, würde er die Wohnung praktisch ausfüllen. Ich arbeite seit vier Jahren in Hartleys Galerie.«
»Wie ist das möglich, mit so kleinen Kindern?«
»Ich habe ein paar Wochen freigenommen, als sie geboren wurden.«
»Mußten Sie denn so schnell wieder arbeiten?«
Jenny zuckte die Achseln. »Ich lernte Kevin MacPartland im Sommer nach meinem Collegeexamen kennen. Ich hatte an der Fordham University im Lincoln Center Kunst studiert. Kev hatte eine kleine Rolle in einer Off-Broadway-Show. Nana sagte, ich mache einen großen Fehler, aber ich hörte nicht auf sie.«
»Nana?«
»Meine Großmutter. Sie hat mich seit meinem ersten Lebensjahr aufgezogen. Nun, sie hatte recht. Kev ist ein netter Kerl, aber er ist unreif. Zwei Kinder in zwei Jahren Ehe, das paßte nicht in sein Konzept. Als Tina kam, zog er sofort aus. Wir sind jetzt geschieden.«
»Zahlt er für die Kinder?«
»Schauspieler verdienen hier durchschnittlich dreitausend Dollar im Jahr. Kev ist eigentlich ganz gut, und wenn der berühmte Zufall hilft, könnte er es sogar schaffen. Aber im Augenblick kann ich die Frage nur mit nein beantworten.«
»Sie haben die Kinder doch sicher nicht von Geburt an in einer Tagesstätte gehabt?«
Jenny spürte, wie sich der Kloß in ihrer Kehle zu formen begann. Sie sagte hastig: »Meine Großmutter hat sich um sie gekümmert, während ich arbeitete. Sie ist vor drei Monaten gestorben. Aber ich möchte jetzt nicht von ihr sprechen.«
Sie fühlte, wie seine Hand sich über ihrer schloß. »Entschuldigen Sie. Es tut mir leid. Normalerweise bin ich nicht so plump.«
Sie brachte ein Lächeln zustande. »Und jetzt sind Sie an der Reihe. Erzählen Sie etwas über sich.«
Sie knabberte ohne Appetit an ihrem Sandwich, während er redete. »Sie haben wahrscheinlich die Kurzbiographie im Katalog gelesen — ich bin ein Einzelkind. Meine Mutter kam bei einem Unfall auf der Farm ums Leben, als ich zehn war — an meinem zehnten Geburtstag, um genau zu sein. Mein Vater ist vor zwei Jahren gestorben. Die Farm wird von einem Verwalter geführt. Ich verbringe die meiste Zeit in meinem Atelier.«
»Es wäre ein Verlust, wenn Sie es nicht täten«, sagte Jenny. »Sie haben gemalt, seit Sie fünfzehn waren, nicht wahr? Haben Sie nicht gewußt, wie gut Sie sind?«
Krueger schwenkte den Wein in seinem Glas, zögerte, zuckte dann die Achseln. »Ich könnte jetzt das Übliche sagen: daß ich gemalt habe, weil es die einzige Möglichkeit war, mich zu verwirklichen, aber das wäre nicht die ganze Wahrheit. Meine Mutter war Künstlerin. Ich fürchte, sie war nicht überragend, aber ihr Vater war ziemlich bekannt. Everett Bonardi.«
»Ich kenne ihn natürlich«, rief Jenny aus. »Aber warum haben Sie das nicht in der Biographie geschrieben?«
»Wenn meine Sachen gut sind, werden sie für sich selbst sprechen. Ich hoffe, ich habe etwas von seinem Talent geerbt. Mutter hat eigentlich nur zum Spaß Skizzen gemacht, aber mein Vater war schrecklich eifersüchtig auf ihre Kunst. Ich nehme an, er kam sich vor wie ein Elefant im Porzellanladen, als er ihrer Familie in San Francisco vorgestellt wurde. Vermutlich behandelten sie ihn wie einen Tölpel aus dem Mittelwesten mit Grassamen in den Schuhen. Er revanchierte sich, indem er Mutter drängte, ihr Talent für nützliche Dinge zu verwenden, etwa Steppdecken zu machen. Aber er betete sie trotzdem an. Ich wußte jedenfalls, daß er außer sich gewesen wäre, hätte er gewußt, daß ich meine ›Zeit mit Malen verschwende ‹. Also hielt ich es vor ihm geheim.«
Die Mittagssonne hatte die Dunstdecke durchbrochen, und einige durch die bleigefaßten Fensterscheiben bunt gefärbte Strahlen tanzten auf dem Tisch. Jenny blinzelte und wandte den Kopf zur Seite.
Erich betrachtete sie aufmerksam. »Jenny«, sagte er plötzlich, »Sie müssen sich über meine Reaktion gewundert haben, als wir uns vorhin begegneten. Ich glaubte, offen gesagt, einen Geist zu sehen. Ihre Ähnlichkeit mit Caroline ist wirklich verblüffend. Sie war ungefähr so groß wie Sie. Ihre Haare waren allerdings dunkler, und ihre Augen waren strahlend grün. Ihre sind blau und haben nur einen grünen Schimmer. Aber es gibt andere Dinge. Ihr Lächeln. Die Art, wie Sie den Kopf neigen, wenn Sie zuhören. Sie sind so schlank, genau wie sie. Mein Vater kam nicht darüber hinweg, daß sie so dünn war. Er drängte sie immer, mehr zu essen. Und ich würde jetzt am liebsten sagen: ›Jenny, essen Sie bitte das Sandwich auf. Sie haben es ja kaum angerührt.‹«
»Ich habe genug«, sagte Jenny. »Aber wenn Sie mir bitte einen Kaffee bestellen würden? Hartley wird einen Schlaganfall bekommen, wenn er sieht, daß Sie gekommen sind, während er weg war. Und ich muß unauffällig gehen, ehe der Empfang zu Ende ist, was ihm auch nicht gerade gefallen wird.«
Erichs Lächeln schwand. »Sie haben abends etwas vor?«
»Das kann man wohl sagen. Wenn ich die Mädchen zu spät von Mrs. Curtis’ progressiver Kindertagesstätte abhole, werde ich mein blaues Wunder erleben.« Sie zog die Augenbrauen hoch, schürzte die Lippen und machte Mrs. Curtis nach: »Ich pflege um fünf Uhr zu schließen, Mrs. MacPartland, aber ich mache eine Ausnahme für berufstätige Mütter. Halb sechs ist jedoch das Äußerste. Erzählen Sie mir bloß nichts von verpaßten Bussen oder dringenden Anrufen in letzter Minute. Sie sind um halb sechs hier, oder Sie behalten Ihre Kinder ab morgen zu Haus, verstanden?«
Erich lachte. »Ich verstehe. Erzählen Sie mir jetzt etwas über die Mädchen.«
»Oh, das ist ganz einfach«, sagte sie. »Sie sind hochintelligent und niedlich und liebenswert und...«
»Und konnten mit sechs Monaten laufen und mit neun Monaten sprechen. Sie klingen genau wie meine Mutter. Es heißt, sie hätte auch immer so über mich geredet.«
Sein Gesicht bekam plötzlich einen sehnsüchtigen Ausdruck, und Jenny fühlte ein eigenartiges Ziehen in der Brust. »Ich bin sicher, daß es so war«, sagte sie.
Er lachte. »Und ich bin sicher, daß es nicht so war. Jenny, New York macht mich irgendwie benommen. Wie ist es eigentlich, wenn man hier aufwächst?«
Sie redeten weiter, während sie den Kaffee tranken. Sie unterhielten sich über das Leben in der Stadt: »Es gibt in Manhattan kaum ein Gebäude, das ich nicht liebe.« Er trocken: »Das kann ich nicht glauben. Aber Sie haben schließlich nie das andere Leben kennengelernt.« Dann sprachen sie über Jennys Ehe. »Wie haben Sie sich gefühlt, als alles vorbei war?«
»Seltsamerweise nicht schlechter, als man sich fühlt, wenn die erste Liebe in die Brüche gegangen ist. Der Unterschied ist, daß ich die Kinder habe. Für sie werde ich Kev immer dankbar sein.«
Als sie zur Galerie zurückkamen, wartete Hartley schon ungeduldig. Nervös musterte Jenny die hektischen roten Flecken auf seinen Wangenknochen und bewunderte dann, wie gut Erich ihn beruhigte. »Sie finden doch sicher auch, daß das Essen im Flugzeug nicht genießbar ist. Da Mrs. MacPartland gerade zum Lunch ging, habe ich sie überredet, mich mitzunehmen. Ich habe aber nur ein paar Bissen probiert und freue mich jetzt, mit Ihnen essen zu gehen. Und ich darf Sie dazu beglückwünschen, wie gut Sie die Bilder gehängt haben.«
Die roten Flecken verblaßten. Jenny dachte an das üppige Sandwich, das Erich verzehrt hatte und sagte ernst: »Ich habe Mr. Krueger das Hähnchen à la Kiew empfohlen, Mr. Hartley. Sorgen Sie bitte dafür, daß er es bestellt.«
Erich zog eine Augenbraue hoch und flüsterte, als er an ihr vorbeiging: »Vielen Dank.«
Später bereute sie den impulsiven Scherz. Sie kannte doch den Mann kaum. Wieso dann dieses Gefühl der Verbundenheit? Er war so einfühlsam und schien zugleich eine verborgene Kraft auszustrahlen. Nun, wenn man sein Leben lang an Geld gewöhnt ist und noch dazu gut aussieht und Talent hat, muß man ja selbstsicher und gelassen sein, sagte sie sich.
In der Galerie war den ganzen Nachmittag lebhafter Betrieb. Jenny paßte auf, ob wichtige Sammler kamen. Sie waren alle zum Empfang eingeladen worden, aber sie wußte, daß viele von ihnen vorher hereinschauen würden, um die Bilder in Ruhe betrachten zu können. Die Preise waren hoch für einen neuen Maler, sehr hoch sogar. Aber es schien Krueger einigermaßen gleichgültig zu sein, ob die Bilder verkauft wurden oder nicht.
Hartley kam zurück, als die Galerie gerade für das Laufpublikum geschlossen wurde. Er sagte ihr, Krueger sei zu seinem Hotel gefahren, um sich zur Vernissage umzuziehen. »Sie scheinen großen Eindruck auf ihn gemacht zu haben«, sagte er nachdenklich. »Er wollte etwas über Sie wissen.«
Gegen fünf lief der Empfang auf Hochtouren. Jenny führte Erich zu den einzelnen Kritikern und Sammlern, stellte ihn vor, tauschte Nettigkeiten aus, gab ihm Gelegenheit, ein paar Worte zu sagen, und eiste ihn dann los, um ihn mit einem weiteren Gast bekannt zu machen. Mehrmals bekamen sie zu hören: »Ist die junge Dame das Modell für ›Erinnerung an Caroline‹?« Erich amüsierte sich darüber: »Langsam glaube ich selbst, daß sie es ist.«
Hartley konzentrierte sich darauf, die eintreffenden Gäste zu begrüßen. Aus seinem verklärten Lächeln folgerte Jenny, daß die Ausstellung schon jetzt ein Erfolg war.
Offensichtlich waren die Kritiker von Erich Krueger als Persönlichkeit ebenso beeindruckt wie von dem Maler Krueger. Er hatte seinen Sportsakko und die Flanellhose gegen einen gutgeschnittenen dunkelblauen Anzug eingetauscht; sein feines weißes Manschettenhemd war offensichtlich Maßarbeit: Eine kastanienbraune Krawatte unter dem makellosen weißen Kragen setzte einen harmonischen Akzent zu seinem gebräunten Gesicht, den blauen Augen und den Silbertönen in seinem Haar. Am kleinen Finger der linken Hand trug er einen schmalen goldenen Ring, den sie schon beim Essen bemerkt hatte. Jetzt wurde ihr bewußt, warum er ihr so vertraut vorkam. Die Frau auf dem Bild trug ihn. Es mußte der Ehering seiner Mutter sein.
Sie ließ Erich im Gespräch mit Alison Spencer zurück, der schicken jungen Kritikerin von Art News. Alison trug ein eierschalenfarbenes Kostüm von Adolfo, das ausgezeichnet zu ihren aschblonden Haaren paßte. Jenny wurde sich unvermittelt ihres schäbigen Wollrocks bewußt und blickte verlegen auf ihre Stiefel hinunter: Obgleich sie frisch besohlt und geputzt waren, sahen sie immer noch abgewetzt aus. Sie wußte, daß ihr Pullover genau wie das aussah, was er war, ein billiger, reizloser Polyesterfummel.
Sie versuchte, sich ihre plötzliche Niedergeschlagenheit irgendwie zu erklären: Es war ein langer Tag gewesen, und sie war hundemüde. Es wurde Zeit, daß sie ging, und sie fürchtete sich beinahe davor, die Mädchen abzuholen. Als es Nana noch gab, war es immer ein Vergnügen gewesen, nach Hause zu kommen.
»Und jetzt setz dich hin und entspann dich mal«, pflege Nana zu sagen. »Ich mach uns einen kleinen Cocktail.« Dann erkundigte sie sich gern und mit ungeheucheltem Interesse, was in der Galerie passiert war, und las den Kindern immer vor dem Einschlafen eine Geschichte vor, während Jenny das Abendessen machte. »Du warst schon mit acht Jahren eine bessere Köchin als ich, Jen.«
»Nana«, zog Jenny sie auf, »wenn du die Würstchen nicht so lange kochen würdest, sähen sie auch nicht wie Hockeyschläger aus!«
Seit sie Nana verloren hatte, holte Jenny die Kinder von der Tagesstätte ab, brachte sie mit dem Bus nach Hause und lenkte sie mit Keksen ab, während sie schnell etwas zurechtbrutzelte.
2
Vereiste Stellen auf dem Bürgersteig machten das Laufen zu einem Abenteuer. Avenue of the Americas, Fifth Avenue, Madison Park, Lexington und Third Avenue. Second. Lange, lange Häuserblocks. Wer auch immer behauptete, Manhattan sei nur eine schmale Insel, hatte es bestimmt noch nie bei diesem Wetter durchquert. Aber die Busse fuhren so langsam, daß sie zu Fuß besser vorankam. Trotzdem würde sie zu spät kommen.
Die Kindertagesstätte war in der 49. Straße, bei der Second Avenue. Es war viertel vor sechs, als Jenny außer Atem und keuchend bei Mrs. Curtis läutete. Mrs. Curtis öffnete, verschränkte die Arme und kniff die Lippen zornig zu einem dünnen Strich zusammen. »Mrs. MacPartland!«
»Es war ein schlimmer Tag«, fuhr die strenge Dame nach einer Pause fort. »Tina hat in einer Tour gebrüllt. Und Sie haben mir gesagt, daß Beth trocken ist, aber ich kann Ihnen flüstern, das stimmt nicht!«
»Sie ist trocken, ich meine, sie geht aufs Klo«, protestierte Jenny. »Aber die beiden haben sich wahrscheinlich noch nicht richtig daran gewöhnt, hier zu sein.«
»Und sie werden auch keine Gelegenheit dazu haben. Ihre Kinder sind einfach zuviel für mich. Verstehen Sie meine Lage, eine Dreijährige, die noch nicht trocken ist, und eine Zweijährige, die den ganzen Tag schreit, sind allein schon Arbeit genug für einen!«
»Mami.«
Jenny ignorierte Mrs. Curtis. Beth und Tina saßen auf der altersschwachen Couch in der dunklen Diele, die Mrs. Curtis großartig als ›Spielzimmer‹ bezeichnete. Jenny fragte sich, wie lange sie da wohl schon in ihren Wintersachen hockten. »Hallo, Maus, grüß dich, Tinker Bell.« Tinas Wangen waren tränennaß. Liebevoll strich Jenny das weiche rötlichbraune Haar zurück, das den Kindern über die Stirn hing. Sie hatten beide nicht nur Kevs Haarfarbe, sondern auch seine rehbraunen Augen und seine dichten, beinahe schwarzen Wimpern geerbt.
»Sie hat immer Angst gehabt!« berichtete Beth und zeigte auf Tina. »Immer geweint.«
Tinas Unterlippe zuckte. Sie streckte beide Arme nach Jenny aus.
»Und Sie sind schon wieder zu spät gekommen«, bemerkte Mrs. Curtis im Tonfall eines Staatsanwalts.
»Entschuldigung.« Jenny sagte es zerstreut. Tinas Augen waren glanzlos, ihre Wangen stark gerötet. Wurde sie schon wieder krank? Es lag an dieser schrecklichen Umgebung. Jenny hätte sich nie damit zufriedengeben sollen.
Sie nahm Tina hoch. Aus Angst, zurückgelassen zu werden, rutschte Beth schnell von der Couch. »Da Sie es sind, werde ich die beiden noch bis Freitag nehmen«, sagte Mrs. Curtis. »Aber dann ist Schluß. Endgültig.«
Ohne sich zu verabschieden, öffnete Jenny die Tür und trat in die Kälte hinaus. Es war inzwischen stockdunkel, und ein eisiger Wind wehte. Tina drückte den Kopf an Jennys Hals. Beth versuchte, das Gesicht in Jennys Mantel zu verbergen. »Ich hab’ mich nur einmal naß gemacht«, gestand sie.
Jenny lachte. »Oh, Maus, Liebes! Halt aus. In einer Minute sitzen wir in dem schönen, geheizten Bus.«
Aber drei Busse fuhren vorbei, da sie besetzt waren. Schließlich gab sie auf und begann, in südlicher Richtung zu laufen. Tina war eine schwere Last. Da Jenny sich beeilte, mußte sie auch Beth halb mitzerren. Nach zwei Blocks beugte sie sich hinunter und nahm sie hoch. »Ich kann gehen, Mami«, protestierte Beth. »Ich bin schon groß.«
»Ich weiß, daß du groß bist«, versicherte Jenny ihr, »aber wir sind schneller zu Haus, wenn ich dich auch trage.« Sie verschränkte die Hände und brachte es irgendwie fertig, die beiden kleinen Pos auf ihren Armen zu balancieren.
»Haltet euch fest«, sagte sie. »Das Marathon kann losgehen.«
Es waren noch zehn Blocks nach Süden und dann zwei weitere Blocks quer durch die Stadt. Sie sind ja nicht schwer, sagte sie sich. Es sind deine Kinder. Wo um Himmels willen sollte sie bloß bis Montag eine andere Tagesstätte finden? Oh, Nana, Nana, wir brauchen dich so sehr! Sie konnte nicht riskieren, Hartley schon wieder um einen freien Tag zu bitten. Ob Erich Alison Spencer zum Essen eingeladen hat? fragte sie sich dann unvermittelt.
Jemand holte sie ein und trabte neben ihr her. Jenny sah erschrocken hoch, als Krueger herüberlangte und ihr Beth abnahm. Beths Mund öffnete sich halb überrascht, halb ängstlich. Auf lautstarken Protest gefaßt, lächelte er sie an. »Wir sind viel schneller zu Haus, wenn ich dich trage und wenn wir Mami und Tina ein bißchen antreiben.« Seine Stimme klang verschwörerisch.
»Aber. . .« begann Jenny.
»Sie lassen mich doch sicher helfen?« sagte er. »Am liebsten würde ich Ihnen die Kleine auch abnehmen, aber ich fürchte, das hätte sie nicht gern.«
»Das stimmt«, antwortete Jenny. »Ich bin Ihnen sehr dankbar, Mr. Krueger, aber . . .«
»Jenny, würden Sie bitte aufhören, Mr. Krueger zu sagen? Warum haben Sie mich mit dieser penetranten Person von Art News allein gelassen? Ich habe dauernd gehofft, Sie würden mich von ihr erlösen. Als ich merkte, daß Sie gegangen waren, fiel mir die Tagesstätte ein. Die schreckliche Frau sagte, Sie seien schon fort, aber ich habe sie überredet, mir Ihre Adresse zu geben. Ich beschloß, einfach hinzugehen und zu läuten, aber da sah ich auf einmal ein hübsches Mädchen vor mir, das Hilfe brauchte, und, nun ja, da bin ich.«
Sie fühlte, wie er sie am Arm ergriff. Plötzlich waren ihre Müdigkeit und Niedergeschlagenheit wie fortgeblasen, und sie fühlte sich unsinnig froh. Sie warf einen Blick auf sein Gesicht.
»Geht das jeden Abend so?« fragte er. Sein Ton war ungläubig und besorgt.
»Meist schaffen wir es auch bei schlechtem Wetter, einen Bus zu bekommen«, sagte sie. »Aber heute waren sie so voll, daß selbst der Fahrer kaum noch Platz hatte.«
Der Block zwischen Lexington Avenue und Park Avenue bestand aus hohen, schmalen Reihenhäusern. Jenny zeigte auf das dritte an der nördlichen Straßenseite. »Da ist es.« Sie betrachtete die Straße beinahe zärtlich. Ihr gaben diese Häuser ein Gefühl der Geborgenheit: Sie waren fast hundert Jahre alt, erbaut zu einer Zeit, als es in Manhattan noch Viertel gab, wo jede Familie ein Haus für sich bewohnte. Die meisten dieser Brownstones waren inzwischen verschwunden, abgerissen, um Hochhäusern oder Wolkenkratzern Platz zu machen.
Vor der Haustür versuchte sie, Erich gute Nacht zu sagen, aber er ließ sich nicht abwimmeln.
»Ich bringe Sie hinein«, erklärte er.
Widerstrebend führte sie ihn in das Apartment, das im Erdgeschoß lag. Sie hatte fröhlich wirkende, gelb-orange gemusterte Bezüge für die uralten Polstermöbel genäht; ein dunkelbrauner Teppichboden bedeckte den größten Teil des abgetretenen alten Parketts; die Kinderbetten standen in dem kleinen Ankleidezimmer, das vom Bad abging, und wurden von der Falttür verdeckt. Chagall-Drucke verbargen einige der Stellen, an denen die Farbe von der Wand blätterte, und Jennys Pflanzen verschönerten das Sims über dem Spülbekken in der Kochnische.
Froh, endlich erlöst zu sein, liefen Beth und Tina hinein. Beth drehte sich um. »Es ist schön, daß wir wieder zu Hause sind, Mami«, sagte sie. Sie blickte zu Tina. »Tina freut sich auch.«
Jenny lachte. »Oh, Maus, ich weiß, was du meinst. Sehen Sie«, fuhr sie, zu Erich gewandt, fort. »Es ist klein hier, aber wir mögen es.«
»Das kann ich verstehen. Es ist sehr hübsch hier.«
»Na, sehen Sie nicht zu genau hin« sagte Jenny. »Die Hausverwaltung läßt es verkommen. Das Haus wird demnächst in Eigentumswohnungen umgewandelt, also geben sie kein Geld mehr dafür aus.«
»Wollen Sie die Wohnung kaufen?«
Jenny öffnete den Reißverschluß von Tinas Schneeanzug. »Daran ist leider nicht zu denken. Sie verlangen für dieses eine Zimmer fünfundsiebzigtausend Dollar, ob Sie es glauben oder nicht. Wir bleiben einfach so lange, bis sie uns hinausklagen, und suchen uns dann etwas anderes.«
Erich nahm Beth auf den Arm. »Nun aber raus aus den dikken Sachen.« Schnell machte er ihre Jacke auf, und dann sagte er: »Und jetzt werden wir Nägel mit Köpfen machen. Ich habe mich zum Essen eingeladen, Jenny. Wenn Sie andere Pläne haben, werfen Sie mich bitte raus. Sonst sagen Sie bitte, wo der nächste Supermarkt ist.«
Sie standen da und sahen sich an. »Nun, was ist?« fragte er. »Supermarkt oder Tür?«
Sie glaubte einen verzagten Unterton herauszuhören. Ehe sie etwas sagen konnte, zupfte Beth an seinem Hosenbein. »Du kannst mir vorlesen, wenn du willst«, forderte sie ihn auf.
»Damit wäre die Frage beantwortet«, sagte er fest. »Ich bleibe. Man hat Ihnen die Entscheidung abgenommen, Mami.«
Er möchte wirklich bleiben, dachte Jenny. Er wünscht sich tatsächlich, den Abend bei uns zu verbringen. »Sie brauchen nicht einzukaufen«, sagte sie. »Wenn Sie Hackbraten mögen, ist alles da.«
Sie schenkte kalifornischen Chablis ein, stellte dann für ihn die Nachrichten an, während sie die Kinder badete und fütterte. Als sie den Tisch deckte und einen Salat machte, blickte sie ein paarmal verstohlen zum Sofa. Erich saß da, unter jedem Arm ein Mädchen, und las mit wildem Minenspiel aus ›Die drei Bären‹ vor. Tina fing an einzudösen, und er zog sie sanft auf seinen Schoß. Beth lauschte hingerissen und wandte den Blick keinen Moment von seinem Gesicht. »Das war sehr, sehr gut«, verkündete sie, als er fertig war. »Du kannst fast so gut vorlesen wie die Mami.«
Er blickte Jenny an, zog eine Augenbraue hoch und lächelte triumphierend.
Als die Kinder im Bett waren, aßen sie an dem kleinen Eßtisch in der Ecke, wo man in den kleinen Garten sehen konnte. Dort war der Schnee noch weiß. Die Bäume glitzerten in dem Licht, das er reflektierte. Dichte Nadelsträucher verdeckten fast den Zaun, der das Grundstück abgrenzte.
»Sehen Sie«, erklärte Jenny. »Das Land in der Stadt. Wenn die Mädchen schlafen, sitze ich hier und trinke meinen Kaffee und stelle mir vor, ich betrachtete meinen Park. Turtle Bay, etwa zehn Blocks weiter oben, ist ein wunderschönes Viertel. Die Brownstones dort haben herrliche Gärten. Das hier ist so etwas wie Mock-Turtle Bay, nur ein Ersatz, aber an dem Tag, an dem ich ausziehen muß, werde ich sehr traurig sein.«
»Wohin gehen Sie denn dann?«
»Ich habe keine Ahnung, aber ich habe noch mindestens sechs Monate, um mir den Kopf darüber zu zerbrechen. Wir werden schon etwas finden. Wie wäre es mit einem Kaffee?«
Es läutete. Erich runzelte die Stirn. Jenny biß sich auf die Lippen. »Das ist wahrscheinlich Fran, meine Nachbarin von oben. Sie hat im Moment gerade keinen Freund und besucht mich alle paar Abende.«
Aber es war Kevin. Er stand in der Tür, ein großer, gutaussehender Junge mit einem teuren Skipullover und einem langen, lässig über die Schultern geworfenen Schal, die braunroten Haare sorgfältig frisiert, das Gesicht gleichmäßig gebräunt.
»Komm doch rein, Kevin«, sagte sie und gab sich Mühe, nicht ärgerlich zu klingen. Instinkt für den richtigen Zeitpunkt, dachte sie. Bei Gott, den hat er wirklich.
Er schritt ins Zimmer, gab ihr einen schnellen Kuß. Sie war plötzlich befangen, denn sie wußte, daß Erichs Blick auf ihnen ruhte.
»Die Kinder schon im Bett, Jen?« fragte Kevin. »Schade. Ich hätte sie gern gesehen. Oh, du hast Besuch.«
Seine Stimme änderte sich, wurde höflich, fast britisch. Der unverbesserliche Schauspieler, dachte Jenny. Eine Boulevardkomödie — der Ex-Mann trifft den neuen Freund seiner Ex-Frau. Sie machte die beiden miteinander bekannt, und sie nickten sich zu, ohne zu lächeln.
Kevin beschloß offenbar, die Atmosphäre zu entspannen. »Riecht lecker bei dir, Jen. Was hast du gekocht?« Er inspizierte die Herdplatte. »Mein Gott, was für ein toller Hackbraten.« Er probierte ihn. »Ausgezeichnet. Warum hab’ ich dich bloß gehen lassen?«
»Ein schrecklicher Fehler«, sagte Erich mit eisiger Stimme.
»Das war es«, stimmte Kevin aufgekratzt zu. »Nun, ich will nicht länger stören. Ich wollte nur kurz vorbeischauen, da ich sowieso in der Gegend war. Oh, Jen, könnte ich dich kurz draußen sprechen?«
Sie wußte genau, warum er sie sprechen wollte. Es war Zahltag. Sie hoffte, daß Erich nicht bemerkte, wie sie sich die Handtasche unter den Arm schob, bevor sie ihm in die Diele folgte. »Kevin, ich habe wirklich keine...«
»Jen, es ist nur, weil ich Weihnachten zuviel für dich und die Kinder ausgegeben habe. Meine Miete ist fällig, und der Hauswirt wird langsam fies. Leih mir bitte dreißig Dollar für eine Woche oder so.«
»Dreißig Dollar! Kevin, es geht nicht.«
»Jen, ich brauche es.«
Widerwillig holte sie ihr Portemonnaie heraus. »Kevin, wir müssen miteinander reden. Ich glaube, ich bin dabei, meinen Job zu verlieren.«
Er griff hastig nach den Scheinen, steckte sie in die Tasche und wandte sich zur Haustür. »Der alte Onkel läßt dich bestimmt nicht ziehen, Jen. Er weiß, was Qualität ist. Dreh einfach den Spieß um und verlang Gehaltserhöhung. Er wird nie jemand anderen für das bekommen, was er dir zahlt. Du wirst schon sehen!«
Sie ging in die Wohnung zurück. Erich räumte den Tisch ab und ließ Wasser ins Spülbecken laufen. Er nahm die Kasserolle mit dem restlichen Hackbraten und ging damit zum Mülleimer.
»He, warten Sie«, protestierte Jenny. »Das können die Kinder morgen abend essen.«
Er warf die Reste trotzdem in den Eimer. »Nicht, nachdem Ihr Ehemaliger es angefaßt hat!« erklärte er bestimmt und sah sie an.
»Wieviel haben Sie ihm gegeben?«
»Dreißig Dollar. Er wird es zurückzahlen.«
»Sie meinen, Sie erlauben, daß er hier hereinspaziert, Sie küßt, dumme Witze darüber reißt, daß er Sie sitzengelassen hat, Sie anpumpt und mit Ihrem Geld zu irgendeiner Bar läuft?«
»Er ist mit der Miete im Rückstand.«
»Machen Sie sich doch nichts vor, Jenny. Wie oft zieht er diese Nummer ab? Ich nehme an, jedesmal, wenn Sie Gehalt bekommen.«
Jenny lächelte müde. »Nein, letzten Monat hat er einen Zahltag ausgelassen. Hören Sie, Erich, lassen Sie das Geschirr bitte stehen. Das mache ich selbst.«
»Sie haben sowieso schon zuviel Arbeit.«
Schweigend nahm Jenny ein Geschirrtuch. Warum hatte Kevin sich ausgerechnet diesen Abend ausgesucht? Was für eine dumme Gans sie war, ihm dauernd Geld zu geben!
Der mißbilligende Ausdruck schwand allmählich aus Erichs Gesicht, und er lächelte sie an und nahm ihr das Tuch ab. »Reden wir von etwas anderem«, sagte er.
Er schenkte Wein in saubere Gläser und brachte sie zum Sofa. Sie setzte sich neben ihn und merkte ihm eine unbestimmte, aber starke Spannung an. Sie versuchte, ihre Gefühle zu analysieren, konnte es aber nicht. Erich würde schon morgen früh nach Minnesota zurückfliegen. Morgen abend um diese Zeit saß sie dann wieder alleine hier. Sie dachte an das glückliche Gesicht der Kinder, als Erich ihnen vorgelesen hatte, an die Erlösung, die sie empfunden hatte, als er auf einmal neben ihr erschienen war und ihr Beth abgenommen hatte. Der Lunch und das Abendessen hatten so viel Spaß gemacht, als könnte er durch seine bloße Gegenwart Sorgen und Einsamkeit vertreiben.
»Jenny.« Seine Stimme war zärtlich. »Worüber denken Sie nach?«
Sie bemühte sich zu lächeln. »Ich glaube, über gar nichts. Ich ... ich glaube, ich bin einfach grenzenlos zufrieden.«
»Und ich weiß nicht, wann ich schon einmal so zufrieden war wie jetzt. Jenny, sind Sie sicher, daß Sie nicht mehr in Kevin MacPartland verliebt sind?«
Sie war so erstaunt, daß sie auflachte. »Großer Gott, nein.«
»Warum geben Sie ihm dann so bereitwillig Geld?«
»Aus falschem Verantwortungsgefühl, nehme ich an. Vielleicht braucht er es wirklich für die Miete.«
»Jenny, ich habe morgen einen frühen Flug gebucht. Aber ich kann am Wochenende wieder nach New York kommen. Sind Sie Freitagabend frei?«
Er will zurückkommen, um mich zu sehen. Wieder durchströmte sie das köstliche Gefühl der Erleichterung, das sie in der Second Avenue empfunden hatte, als er plötzlich neben ihr aufgetaucht war. »Ja, ich besorge einen Babysitter.«
»Und Samstag? Glauben Sie, die Kinder würden gern in den Zoo im Central Park gehen, wenn es nicht zu kalt ist? Und dann könnten wir mit ihnen gemeinsam beim Rumpelmayer essen.«
»Das fänden sie bestimmt herrlich, aber. . .«
»Es tut mir nur leid, daß ich nicht gleich länger in New York bleiben kann, aber ich habe in Minneapolis eine Besprechung über Investitionen, die ich machen möchte. Oh, darf ich?«
Er hatte das Fotoalbum auf dem unteren Boden des Beistelltisches entdeckt.
»Wenn Sie möchten. Es ist aber nicht sehr aufregend.«
Sie tranken Wein, während er die Bilder betrachtete. »Das bin ich, wie ich im Waisenhaus abgeholt wurde«, erzählte sie. »Ich bin adoptiert worden. Dies sind meine neuen Eltern.«
»Ein hübsches junges Paar.«
»Ich kann mich überhaupt nicht an sie erinnern. Sie hatten einen Autounfall, als ich vierzehn Monate alt war. Danach gab es nur noch Nana und mich.«
»Ist das Ihre Großmutter?«
»Ja. Sie war dreiundfünfzig, als ich geboren wurde. Ich weiß noch, wie ich in der ersten Klasse war und einmal mit einem langen Gesicht nach Hause kam, weil die anderen Kinder Geschenke für Vatertag bastelten, und ich hatte keinen Vater. Sie sagte: ›Hör zu, Jenny, ich bin deine Mutter, ich bin dein Vater, ich bin deine Großmutter und dein Großvater. Ich bin alles, was du brauchst. Du kannst mir etwas zum Vatertag basteln.‹«
, Sie fühlte Erichs Arm um ihre Schultern. »Kein Wunder, daß sie Ihnen so fehlt.«
Hastig redete sie weiter: »Nana arbeitete in einem Reisebüro. Wir haben ein paar herrliche Reisen gemacht. Sehen Sie, da waren wir in England. Ich war fünfzehn. Und das war die Reise nach Hawaii.«
Als die Fotos von der Hochzeit mit Kevin kamen, klappte Erich das Album zu. »Es ist spät«, sagte er. »Sie sind sicher müde.«
An der Tür nahm er ihre beiden Hände und hielt sie an die Lippen. Sie hatte die Stiefel ausgezogen und stand in Strümpfen da. »Selbst jetzt sind Sie wie Caroline«, sagte er lächelnd.
3
Punkt acht klingelte das Telefon. »Jenny? Wie haben Sie geschlafen?«
»Sehr gut.« Sie war tatsächlich in einer beinahe seligen Vorfreude eingeschlafen: Erich kam zurück! Sie würde ihn wiedersehen. Zum erstenmal seit Nanas Tod war sie nicht in aller Frühe mit dem üblen Gefühl schweren Kummers aufgewacht.
»Das freut mich. Ich auch. Und ich könnte hinzufügen, daß ich ein paar sehr angenehme Träume hatte. Übrigens, ich habe dafür gesorgt, daß Sie und die Kinder ab heute morgen von einer Limousine abgeholt werden. Der Fahrer wird die Mädchen zur Tagesstätte bringen und Sie dann zur Galerie fahren. Und er holt sie nachmittags um zehn nach fünf ab.«
»Erich, das geht nicht!«
»Jenny, bitte. Es ist eine Kleinigkeit für mich. Sonst muß ich unablässig daran denken, wie Sie sich mit den beiden durch dieses schreckliche Wetter quälen.«
»Aber . . .«
»Ich muß mich jetzt beeilen. Ich rufe wieder an.«
Mrs. Curtis empfing sie mit ausgesuchter Höflichkeit. »Das ist wirklich ein Herr, Ihr Bekannter, Mrs. MacPartland. Er hat heute morgen angerufen. Ich möchte Ihnen sagen, daß Sie keinen neuen Platz für die Kinder suchen müssen. Ich denke, wir müssen uns nur ein bißchen besser kennenlernen und ihnen die Chance geben, sich einzugewöhnen. Stimmt’s Mädels?«
Er rief sie in der Galerie an. »Ich bin eben in Minneapolis gelandet. Ist der Wagen gekommen?«
»Erich, es war unfaßbar. Was für einen Unterschied es macht, nicht mit den beiden hetzen zu müssen! Und was haben Sie bloß zu Mrs. Curtis gesagt? Sie war zuckersüß, wie umgewandelt.«
»Kann ich mir vorstellen. Übrigens, wo möchten Sie Freitagabend essen?«
»Oh, das spielt keine Rolle.«
»Suchen Sie ein Restaurant aus, wo Sie schon immer mal hingehen wollten — eins, wo Sie noch nie waren.«
»Erich, es gibt Tausende von Restaurants in New York. Ich mag vor allem die in der Second Avenue und in Greenwich Village.«
»Sind Sie schon mal im Lutèce gewesen?«
»Großer Gott, nein.«
»Sehr gut. Dann essen wir dort.«
Jenny fühlte sich den ganzen Tag über wie benommen. Hartleys wiederholte Bemerkungen über Erich halfen auch nicht gerade: »Liebe auf den ersten Blick, meine Beste. Den hat es wirklich erwischt.«
Fran, die Stewardeß, die in Apartment 4 E wohnte, kam am Abend vorbei. Sie verzehrte sich vor Neugier. »Ich hab’ gestern abend diesen umwerfenden Typ im Eingang gesehen. Ich nahm an, er wollte zu dir. Und du bist Freitag mit ihm verabredet. Sagenhaft!«
Sie bot Jenny an, auf die Mädchen aufzupassen. »Ich würde ihn wahnsinnig gern kennenlernen. Vielleicht hat er einen Bruder oder einen Cousin oder meinetwegen einen alten Kumpel vom College!«
Jenny lachte. »Fran, er überlegt es sich wahrscheinlich noch mal und ruft dann an, ich soll’s vergessen.«
»Nein, bestimmt nicht.« Fran schüttelte ihren üppig gelockten Kopf. »Ich hab’ da so ein Gefühl.«
Die Woche zog sich endlos dahin. Mittwoch, Donnerstag. Und dann war es wie durch ein Wunder endlich Freitag.