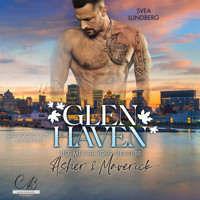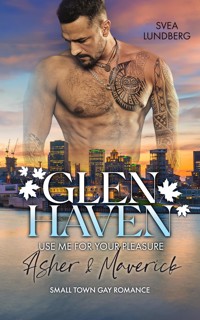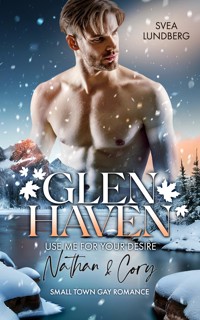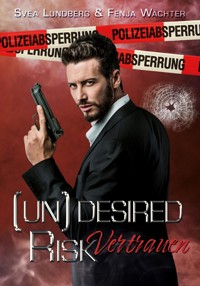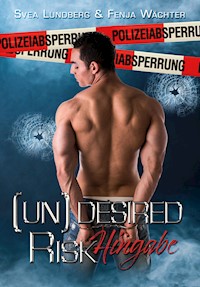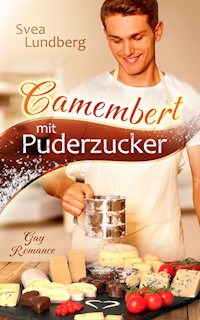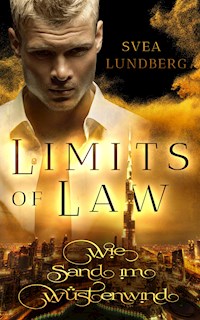4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Zwei Dinge weiß Sascha sicher: Er will ein guter Vater für sein Kind sein und er wird den Mann, den er liebt, kein weiteres Mal nach hinten schieben. Denn auch Domenico braucht jemanden, an den er sich anlehnen und auf den er sich verlassen kann. Vor allem, da die dienstlichen Ereignisse der Vergangenheit ihn nicht loslassen. Doch um zu seiner neuen Liebe zu stehen, muss Sascha den Mut aufbringen, sich selbst zu hinterfragen und zu sich finden. Aber wie soll eine Beziehung funktionieren, die zwischen Ex, ungeborenem Kind und Selbstzweifeln auf so brüchigen Pfeilern steht? Kann Sascha Domenico im Privaten dasselbe sichere Fundament bieten wie im Dienst? Noch dazu, wenn ihre Gefühle füreinander es ihnen eigentlich verbieten, weiterhin gemeinsam auf Streife zu fahren. ~~~~~ Band 5 der Polizei-Romance-Reihe "Sheltered in blue". Die Bände 1 bis 3 sind in sich abgeschlossen und können unabhängig voneinander gelesen werden. Die Bände 4 und 5 bauen aufeinander auf. ~~~~~ Bislang innerhalb der Reihe erschienen sind: »Sheltered in blue – Wenn Barrikaden brennen« (Erik & Nils) »Sheltered in blue – Wenn Erinnerungen lähmen« (Jan & Kadir) »Sheltered in blue – Wenn Vertrauen aus Verrat erwächst« (Elián, Ben & János) »Sheltered in blue – Wenn wir verletzen« (Domenico & Sascha) »Sheltered in blue – Wenn wir verzeihen« (Domenico & Sascha)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Sheltered in blue
Wenn wir verzeihen
Ein Roman von Svea Lundberg
Inhalt
Zwei Dinge weiß Sascha sicher: Er will ein guter Vater für sein Kind sein und er wird den Mann, den er liebt, kein weiteres Mal nach hinten schieben. Denn auch Domenico braucht jemanden, an den er sich anlehnen und auf den er sich verlassen kann. Vor allem, da die dienstlichen Ereignisse der Vergangenheit ihn nicht loslassen.
Doch um zu seiner neuen Liebe zu stehen, muss Sascha den Mut aufbringen, sich selbst zu hinterfragen und zu sich finden. Aber wie soll eine Beziehung funktionieren, die zwischen Ex, ungeborenem Kind und Selbstzweifeln auf so brüchigen Pfeilern steht? Kann Sascha Domenico im Privaten dasselbe sichere Fundament bieten wie im Dienst? Noch dazu, wenn ihre Gefühle füreinander es ihnen eigentlich verbieten, weiterhin gemeinsam auf Streife zu fahren.
Anmerkung:
Bei »Sheltered in blue – Wenn wir verzeihen« handelt es sich um Teil 2 einer Dilogie. Die Geschichte beginnt in »Sheltered in blue – Wenn wir verletzen« und wird in »Wenn wir verzeihen« abgeschlossen.
Die übrigen Bände der »Sheltered in blue«-Reihe können vollkommen unabhängig voneinander gelesen werden.
Bislang innerhalb der Reihe erschienen sind:
»Sheltered in blue – Wenn Barrikaden brennen« (Erik & Nils)
»Sheltered in blue – Wenn Erinnerungen lähmen« (Jan & Kadir)
»Sheltered in blue – Wenn Vertrauen aus Verrat erwächst« (Elián, Ben & János)
»Sheltered in blue – Wenn wir verletzen« & »Sheltered in blue – Wenn wir verzeihen« (Domenico & Sascha)
Impressum
Copyright © 2021 Svea Lundberg
Julia Fränkle-Cholewa
Zwerchweg 54
75305 Neuenbürg
www.svealundberg.net
Buchsatz: Annette Juretzki / www.annette-juretzki.de
Covergestaltung:
Minelle Chevalier/ www.mc-coverdesign.de
Bildrechte:
(c) Alex Rutz / www.alexrutz.com
Models: Alessio Impedovo & Calum Flynn
(c) markovskiy / depositphotos.com
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte sind vorbehalten.
Die in diesem Buch geschilderten Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Vorwort
Liebe Leser*innen,
nach dem offenen Ende des Vorgängerbandes »Sheltered in blue – Wenn wir verletzen« hoffe ich, ich habe euch nicht zu lange auf die Fortsetzung warten lassen. Und ich verspreche euch an dieser Stelle, dass es am Ende von »Wenn wir verzeihen« keinen Cliffhänger geben und die Geschichte abgeschlossen sein wird.
Weiterhin viele emotionale Lesestunden mit Domenico und Sascha wünsche ich euch!
Wie gewohnt zu Beginn noch eine Triggerwarnung: In diesem Roman werden Komplikationen im Schwangerschaftsverlauf beschrieben, außerdem wird ein homophob motivierter verbaler Angriff geschildert. Des Weiteren wird im Rahmen der Polizeiarbeit ein (vermeintlicher) sexueller Missbrauch thematisiert.
Widmung
Für all jene, die täglich mit ihrem Leib und Leben für unser aller Sicherheit einstehen. Für ihre Familien und Freunde.
~~~~~
Die »thin blue line« – eine dünne blaue Linie auf schwarzem Grund – hat sich, ausgehend vom angelsächsischen Raum, weltweit als Zeichen der Verbundenheit zwischen Gesetzeshütern und Bevölkerung etabliert und hebt den Auftrag der Beamten im Dienst hervor, die Bevölkerung vor kriminellen Elementen zu bewahren. Vor dem schwarzen Hintergrund erinnert die »thin blue line« an all jene Kollegen, die im Dienst verletzt oder getötet wurden.
Ausgehend von diesem Symbol entstand der Reihen-Titel »Sheltered in blue«. Stets in der Hoffnung, die Beamten mögen unverletzt aus dem Dienst zurückkehren. In ihr Zuhause, zu ihren Familien und Freunden.
Kapitel 1 – Sascha
Mittwoch, 4. Dezember 2019
»Warum wollten Sie die Pille denn überhaupt wieder nehmen? Sagten Sie nicht, Sie hätten sie vor ein paar Wochen erst abgesetzt?« Über seinen PC-Bildschirm hinweg, wirft Dr. Saalbacher Marie einen fragenden Blick zu. Aus dem Augenwinkel kann ich sehen, wie sie ihre Finger in ihrem Schoß ineinander windet. Ich weiß, ich sollte ihre Hand nehmen. Bei ihr sein. Aber ich kann es nicht. Bin körperlich anwesend, doch in Gedanken meilenweit entfernt. Kann keinen einzigen klaren Gedanken fassen.
»Nun ja, wir ... wollten eigentlich langsam mit der Kinderplanung anfangen und ich dachte, es wäre gut, die Pille frühzeitig abzusetzen, damit sich alles erst mal regulieren kann, bevor ich schwanger werde.« Von der Seite wirft Marie mir einen kurzen Blick zu. »Aber Sascha hat momentan sehr viel Stress auf der Arbeit – er ist Polizist, wissen Sie – und daher ... Tja, nun ist es zu spät, was?«
Ihr Lachen klingt ein wenig unsicher, vermutlich nicht nur dem Umstand der unerwarteten Schwangerschaft geschuldet, sondern auch dem, dass ich hier neben ihr sitze und den Mund nicht aufbekomme. Eisern schweige, um nichts zu sagen, was sie noch mehr verunsichern oder verletzen würde.
Vorhin, als Marie auf dem Untersuchungsstuhl lag und Dr. Saalbacher etwas von »hoch aufgebauter Gebärmutterlschleimhaut« und »Frühstadium« erzählt hat, wäre mir beinahe die Frage herausgerutscht, ob es nicht ein Versehen sein kann. Ein falsch-positiver Test. Aber das Urteil des Gynäkologen ist eindeutig: dritte Schwangerschaftswoche.
In den Händen halte ich den bildlichen Beweis, auch wenn ich auf dem Ultraschallfoto eigentlich nur Grautöne in verschiedenen Schattierungen erkennen kann. Nichts davon sieht wie ein Baby aus.
Unser Baby.
Mein Kind.
Ein Kind, das nun da ist – oder kommen wird, je nachdem, wie man es betrachten möchte – und das verdammt noch mal nichts für all das kann.
»Sie wollten, dass Ihre Partnerin die Pille wieder nimmt?« Dr. Saalbachers Stimme reißt mich aus meinen Gedanken. Die Frage ist direkt an mich gerichtet, nicht an Marie, und sein Blick, mit dem er mich mustert, hat etwas Durchdringendes an sich.
»Ja«, würge ich mühsam über die Lippen. Weil ich vor ein paar Stunden noch mit dem Mann geschlafen habe, den ich liebe. Im nächsten Atemzug korrigiere ich mich selbst: »Nein.« Zumindest habe ich das so direkt nie zu Marie gesagt. Kommunikationsproblem. Hatten wir ja so einige in der letzten Zeit.
Ich zwinge mich zu so etwas wie einem Lächeln. »Wie gesagt, Stress. Aber wir werden das gemeinsam hinbekommen.« Die Worte rinnen bitter wie flüssiges Arsen über meine Lippen. Es kostet mich nahezu innere Gewalt, eine Hand nach Marie auszustrecken und ihre zu ergreifen. Sacht zuzudrücken. Ihre Finger sind so schmal und vor Aufregung kühl in meinen.
»Wir freuen uns natürlich trotzdem.«
Hatte ich gedacht, Marie bislang eiskalt wegen Domenico belogen zu haben, so treibe ich meine Lügen nun auf die Spitze.
Ich freue mich nicht. Bin schlichtweg unter Schock.
»Gut.« Noch einen langen Moment liegt Dr. Saalbachers Blick prüfend auf mir, ehe er sich wieder dem PC-Bildschirm zuwendet und irgendetwas in Maries Akte tippt. Oder zumindest vermute ich, dass er das tut.
»Mal angenommen, der Test hätte keine Schwangerschaft angezeigt, weil es noch zu früh gewesen wäre, und ich hätte die Pille wieder angefangen, hätte das Auswirkungen auf die Schwangerschaft haben können?« Bei ihren Worten legt Marie eine Hand auf ihren Bauch, die andere liegt nach wie vor in der meinen. Abwesend streichle ich mit dem Daumen über ihre Haut und fühle dabei ... nichts.
»Nun, da Sie die Pille ja ohnehin erst zu Beginn Ihrer Regelblutung hätten nehmen sollen, hoffe ich doch, dass es dazu gar nicht gekommen wäre«, entgegnet der Gynäkologe, inzwischen wieder mit einem schmalen Lächeln. »Aber ich kann Sie dennoch beruhigen: Es gibt inzwischen einige Studien und Beobachtungen, dass die Einnahme der Pille im Frühstadium einer Schwangerschaft keine negativen Auswirkungen auf Kind oder Mutter hat. Schließlich gibt es auch Pillenunfälle«, mit den Fingern malt er Anführungszeichen in die Luft, »und genügend werdende Mütter, die wochenlang gar nichts von ihrer Schwangerschaft wissen und weiterhin hormonell verhüten.«
»Das stimmt natürlich.« Von der Seite grinst Marie mich schief an. Eine Geste, die ich einmal so geliebt habe, doch nun beschert sie mir Übelkeit. Bei uns war es kein Pillenunfall, sondern schlicht ein Kommunikationsproblem. Gewissermaßen ein Mein-Kopf-läuft-Amok-Unfall. Es gibt nur eine einzige Situation, in der Marie schwanger geworden sein könnte. Das ist der verfluchte Abend, nachdem ich bei Domenico war und deswegen so durch den Wind, dass ich sie ohne Gummi gevögelt und das nicht hinterfragt habe, weil ich dachte ...
»Schatz, alles okay bei dir?« Maries Schmunzeln hat sich zu einer besorgten Miene verzogen.
Nein, nichts ist okay. Gar nichts.
Ich nicke eisern. »Bin nur erledigt von der Fahrt die Nacht durch, sorry.« Rasch hauche ich ihr einen Kuss auf die Wange.
»Willst du nicht gegenüber zum Bäcker gehen, dir einen Kaffee holen?« Sanft drückt sie meine Hand. Gottverdammt, sollte nicht ich derjenige sein, der gerade für sie da ist?
»Ich weiß nicht ...« Fragend sehe ich zwischen ihr und Dr. Saalbacher hin und her, der gerade irgendetwas in ein kleines, dünnes Büchlein einträgt. Vermutlich Maries Mutterpass.
»Das müssen Sie beide entscheiden. Ich werde noch ein paar Dinge mit Frau Riemer besprechen.«
»Geh schon.« Marie stupst mich leicht an. »Du siehst echt fertig aus. Ich kann dir ja nachher erzählen, was wir besprochen haben. Oder heute Mittag, nachdem du dich hingelegt hast.«
»Schlaf würde Ihnen vermutlich wirklich guttun. In neun Monaten bekommen Sie nicht mehr allzu viel davon.«
Falls das ein Scherz aus Dr. Saalbachers Mund sein sollte, war es ein denkbar schlechter. Gezwungen lächelnd nicke ich ihm zu.
»Bin ich ja gewohnt als Polizist.« Und genau deshalb ist es auch eine bescheuerte Ausrede, ich sei von einer mehrstündigen nächtlichen Autofahrt so dermaßen durch den Wind. Aber was soll ich Marie sagen? Dass ich schon gestern aus Hamburg zurückgekommen bin, aber erst mal bei meinem Lover war, ehe ich zu meiner schwangeren Freundin nach Hause gekommen bin?
Es wäre nichts als die Wahrheit – und eben auch nicht. Denn Domenico ist weit mehr als nur mein Liebhaber und Marie ...? Ist schwanger. Von mir.
Ich kann sie jetzt nicht allein lassen.
Kann ihr nicht sagen, dass ...
Ich dich liebe, Nico. Auch wenn ich’s nicht wahrhaben wollte, seit gestern ...
»Okay, dann ... Willst du auch was vom Bäcker?«
»Du könntest Brötchen holen, dann frühstücken wir nachher zu Hause noch. Nach der Nachricht werde ich heute nicht arbeiten gehen.« Sie strahlt mich regelrecht an und ich schnaufe energisch gegen die Übelkeit an. »Oder willst du dich gleich hinlegen?«
»Nee, gemeinsames Frühstück klingt gut«, murmele ich in Maries Haare und drücke ihr einen Kuss auf die Stirn, ehe ich mich erhebe. Keine Ahnung, ob ich nachher in der Lage sein werde, irgendetwas zu essen, ohne zu kotzen. Wäre Übelkeit nicht eigentlich Maries Ding?
Nach einem weiteren Kuss für sie verlasse ich fluchtartig das Behandlungszimmer. Vom Empfangstresen aus lächelt Nazan mir zu, doch ehe sie aufstehen und nachfragen kann, ob Marie tatsächlich schwanger ist, reiße ich die Haupttür zur Gynäkologiepraxis auf.
Ich muss hier raus.
~*~*~*~*~*~
Erstaunlicherweise bekomme ich tatsächlich ein Brötchen mit Fleischkäse hinunter, ohne dass es mir gleich wieder hochkommt. Selbst die Übelkeit hat sich verzogen. Stattdessen scheint in meinem Bauch trotz Nahrung ein Vakuum zu herrschen. Überall in mir drinnen ist Leere.
Ich kann mich nicht über Maries Schwangerschaft freuen, aber ebenso wenig kann ich mir wünschen, es wäre nicht dazu gekommen. In meinem Kopf ist nur Platz für einen einzigen Gedanken: Was jetzt?
»Wollen wir es heute schon meinem Papa sagen?« Nachdenklich dreht Marie ihre Teetasse in den Händen. Auf ihrem Teller liegt noch ein halbes Croissant, wobei sie zuvor schon ein Käsebrötchen verdrückt hat. Noch scheint von morgendlicher Übelkeit keine Spur zu sein. Allerdings ist es inzwischen auch schon fast elf.
»Keine Ahnung«, gebe ich zögernd zurück, greife nach meiner eigenen Tasse. Der wievielte Kaffee ist das heute schon für mich? »Eigentlich wird ja geraten, die ersten drei Monate ...«
»Na, meinem Vater werde ich es sicher sagen.« Marie zieht die Stirn kraus. »Du deinen Eltern etwa nicht?«
»Doch, denke schon.«
»Und ich werde es Jana sagen, und Marco.«
Und ich Kyrill. Aber nicht, weil ich mich freue wie verrückt. Und ... Ich wage es nicht mal, Domenicos Namen in diesem Zusammenhang zu denken.
»Wir könnten heute Abend kochen und ihn zum Essen einladen? Also, meinen Papa, meine ich.«
Alles in mir wehrt sich gegen diese Idee. Dennoch nicke ich. »Klar, warum nicht?«
Maries Miene wird wieder weicher und sie schiebt eine Hand über den Tisch, zwischen Wurstbox und Frischkäsepackung hindurch. »Du bist echt fertig, was? Geh dich doch hinlegen.«
Kurz lasse ich zu, dass Maries Finger meinen Arm umschließen, sacht zudrücken, ehe ich mich zurückziehe und mich erhebe. »Ich glaube, ich kann jetzt eh nicht pennen.« Ganz sicher nicht. »Nach diesen Neuigkeiten ...«
Maries Lächeln lässt erahnen, dass sie sich nicht ausmalen kann, was in mir vorgeht. Nicht im Ansatz.
»Ich geh stattdessen ’ne Runde biken, ja? Nicht zu lange, nur eine Stunde oder so. Danach bin ich hoffentlich wieder denkfähig.«
»Okay.«
Ich habe mich schon halb abgewandt, als Maries Stimme mich erneut aufhält. »Sascha?«
»Hmm?«
Sie lächelt noch immer, aber ich kenne sie gut genug, um zu sehen, dass Unsicherheit in der Geste mitschwingt. Kein Wunder, so wie ich mich verhalte.
»Freust du dich wirklich? Ich meine, es war ja nicht geplant, du wolltest ...«
»... immer ein Kind mit dir.« Das ist nicht gelogen. Oder vielmehr: Das war es nicht. Bis vor einigen Wochen. »Ob jetzt oder in einem halben Jahr ... ist doch gleichgültig.«
Ihr Lächeln wird breiter und ich frage mich, wie es sein kann, dass ich mit so falschen Worten, eine so richtige Geste auszulösen vermag?
~*~*~*~*~*~
Während Marie und ich gefrühstückt haben, hat es draußen wieder zu schneien begonnen, sodass meine Tour nun von dicken Schneeflocken begleitet und zu einer ziemlich rutschigen Partie wird. Selbst im Wald fallen die Flocken durch die Kronen der immergrünen Tannen und kahlen Laubbäume hindurch, legen sich kühl und feucht auf meine erhitzte Haut, nur um dort binnen eines keuchenden Atemzuges zu schmelzen. Mein Atem geht rasselnd, meine Beine und meine Lunge brennen, und es ist sicherlich nicht einem plötzlichen Mangel an Kondition geschuldet. Mein Körper läuft Amok, ebenso wie meine Gedanken. Dennoch schaffe ich es ohne Sturz den Trail hinunter. Auf dem dort kreuzenden Wanderweg angekommen, bringe ich mein Bike zum Stehen, lehne mich mit beiden Armen auf den Lenker. Schnee fällt auf meinen Nacken, prickelt nur für Sekundenbruchteile kühl auf meiner Haut. Ich will nicht mehr denken und wünsche mir auf seltsam dringliche Weise Emotionen zurück ins Gefühlsvakuum.
Und sie kommen zurück.
Mit einer Wucht, die mich beinahe in die Knie zwingt.
Mit zittrigen Fingern löse ich den Kinnverschluss des Helms und streife diesen ab, lehne die Stirn auf meine Unterarme. Kralle die Finger in meine durchfeuchtete Jacke, ringe nach Atem. Schmerz und bittere Scham brennen kalt in meinem Inneren. Das schlechte Gewissen Marie gegenüber schnürt mir die Kehle zu, doch nicht nur ihr gegenüber empfinde ich Schuld. Auch Domenico gegenüber. Und meinem Kind, über das ich mich nicht freuen kann. Von dem ich beinahe wünschte, es wäre nicht da, und das ist der schlimmste Gedanke von allen. Das ist der Gedanke, der mich letzten Endes doch in die Knie zwingt.
Mit einem gepressten Schluchzen in der Kehle rutsche ich neben meinem Bike, das zur Seite kippt, auf den Boden. Hocke auf dem feuchten und von einer dünnen Schneeschicht überzogenen Schotterweg. Die Kälte kriecht binnen Sekunden durch meine Klamotten hindurch und setzt sich beißend auf meiner schweißfeuchten Haut fest. Ich zittere – doch das nicht nur vor plötzlicher Kälte.
Ich zittere, weil ich in dieser Minute erst vollumfänglich begreife, wie verdammt feige ich in den letzten Tagen und Wochen war. Wie sehr ich Menschen, die ich liebe, verletzt habe – und noch verletzen werde. Doch dieses Mal werde ich ehrlich sein. Wenigstens jetzt.
~*~*~*~*~*~
So leise ich kann, stecke ich den Hausschlüssel ins Schloss und drehe ihn um. Streife mir noch vor der Tür die Radschuhe ab und husche hinein in den Flur, lausche für einen Moment. Aus der Küche erklingen gedämpfte Musik und das Klappern von Geschirr. Eigentlich hatte ich gehofft, Marie würde sich hinlegen, solange ich biken bin. Nicht weil ich hoffte, sie würde schlafen und ich somit ungesehen ins Haus kommen, sondern einfach, weil ich denke, dass sie hätte Ruhe gebrauchen können. Als ob ein kurzes Nickerchen irgendetwas an dem, was ich ihr zu sagen habe, besser machen könnte ...
Ich habe eine Scheißangst, dass unser Gespräch gleich aus dem Ruder laufen wird. Nicht, weil ich mich vor Maries Zorn fürchte oder davor, was sie mir alles an den Kopf werfen könnte. Nein, verdammt, ich habe Angst um sie. Und um das Baby. Habe Angst, sie mit meiner Beichte so sehr aufzuregen, dass dem winzigen Ding in ihrem Bauch, das man auf dem Ultraschall noch nicht mal sehen konnte, irgendetwas zustößt. Denn auch wenn ich mich nach wie vor unmöglich über dieses Kind freuen kann, so will ich doch nur das Beste für es. Und das Beste – auch wenn es beschissen ist – was ich in diesem Moment tun kann, ist endlich ehrlich zu Marie zu sein.
Tief atme ich durch, bemühe meine Miene um so etwas wie Ruhe, und strecke den Kopf durch die nur angelehnte Küchentür. »Hey, bin zurück.«
An der Spülmaschine stehend, die sie offensichtlich gerade aus- und wieder einräumt, sieht Marie zu mir. Lächelt mich an. Hübsch sieht sie aus, wie immer. Hübsch in Schlabberpullover und engen Leggings und mit Wollsocken an den Füßen. Genau so habe ich sie immer geliebt. Genau so habe ich mir immer vorgestellt, dass sie aussehen würde, wenn sie mal schwanger ist.
Mit Mühe presse ich die nächsten Worte an dem Kloß in meiner Kehle vorbei: »Ich geh schnell duschen, dann komm ich runter, ja?«
Ich sage nicht so etwas wie »wir müssen reden«. Was würde es bringen, sie behutsam auf den Schock vorbereiten zu wollen, der sie so oder so eiskalt erwischen wird? Ihr Lächeln zeigt, dass sie keine Ahnung hat, was auf sie zukommt.
»Alles klar. Soll ich dir auch einen Tee machen?«
»Nein, danke. Leg dich doch rüber aufs Sofa. Ich mach das später.« Als ob sich nachher noch irgendjemand von uns für das benutzte Geschirr interessieren würde.
Gespielt genervt verdreht Marie die Augen. »Wie heißt es so schön: Ich bin schwanger ...«
»... nicht krank, schon klar. Trotzdem. Ich komm gleich.« Mit diesen Worten verschwinde ich aus der Küche. Meine Beine fühlen sich bleischwer an, als ich die Treppe ins Obergeschoss hinaufsteige. Die Minuten unter der Dusche sind meine letzte Gnadenfrist – und gewissermaßen auch Maries. Mir wäre es wirklich lieber, sie würde diese mit Tee auf dem Sofa verbringen. Aber um meine Befindlichkeiten geht es hier nicht.
Keine Viertelstunde später sitzt Marie dann tatsächlich auf dem Sofa, im Schneidersitz, eine Wolldecke über den Beinen. Dampf steigt aus der Tasse hoch, die ich vor ihr auf dem Couchtisch abstelle. Den Tee habe ich ihr gemacht und ich weiß nicht einmal genau, weshalb. Tee wird es nicht besser machen.
»Du könntest aber auch einen vertragen, hmm?«, meint Marie mit einem fragenden Blick zu mir nach oben. »Siehst besser aus als vorhin, aber immer noch platt.«
Das bin ich auch. Innerlich erschöpft und gleichzeitig ruhelos. Vage nicke ich ihr zu. »Geht schon.«
Sekundenlang stehe ich unschlüssig vor dem Sofa, sehe Marie an, die meinem Blick begegnet und augenscheinlich darauf wartet, dass ich mich zu ihr setze. Doch in dem Moment, in dem sie eine Hand nach mir ausstreckt, weiche ich einen Schritt zurück.
»Marie, ich ...«
»Willst du nicht herk...«
»... muss dir was sagen.«
Ihr Grinsen über unser zeitgleiches Losbrabbeln verflüchtigt sich zu einer in Falten gelegten Stirn.
»Okay. Klingt ernst. Was ist los?« Sie zieht die Beine an ihren Körper, schlingt die Arme um ihre angezogenen Knie. Fast scheint es mir, als würde sie unbewusst eine Schutzhaltung einnehmen. Für sich und ihr Kind.
Zur Hölle, ich will den beiden nicht wehtun. Marie nicht und schon gar nicht diesem winzigen Etwas in ihrem Bauch. Aber ich muss. Kann nicht länger schweigen und so tun, als wäre ich einfach nur ein wenig emotional verwirrt.
Ich bin emotional bei weitem nicht so klar, wie ich es in der vergangenen Nacht war. Bei Domenico. Aber klar genug, um zu wissen, dass ich es so, wie es ist, nicht laufen lassen kann. Es wäre keinem gegenüber fair.
»Geht’s um meine Schwangerschaft?«, hakt Marie leise nach, als ich offenbar zu lange schweige.
»Nein«, presse ich rasch hervor, erschrocken über den furchtsamen Unterton in ihrer Stimme. In einem tiefen Atemzug stoße ich die Luft aus, schiebe leiser hinterher: »Zumindest nicht in erster Linie.«
Ihre großen, weit geöffneten Augen, die Art, wie sie die Finger um ihre Knie klammert ... Sei endlich ehrlich, Sascha.
Es sind sicherlich nur drei, fünf, maximal sieben Sekunden, die vergehen, doch sie scheinen sich zu einer Ewigkeit zu dehnen. In meiner Kehle sammle ich Worte. Verwerfe sie wieder. Forme sie neu.
»Marie ...« Nie zuvor ist es mir so schwer gefallen, ihren Namen auszusprechen. Überhaupt etwas zu ihr zu sagen. Mit roher, innerer Gewalt peitsche ich die Silben über meine Lippen. »Ich hab dich betrogen.«
Es sind nur vier Worte. Und obwohl ich selbst sie ausgesprochen habe und wusste, was ich mit ihnen anrichten würde und mir tausendfach Maries mögliche Reaktionen auf sie ausgemalt habe, treffen sie mich selbst mit einer Wucht, die tief in meinen Eingeweiden schmerzt. Sie tun weh, weil ich Maries Reaktionen direkt vor mir sehen kann. Erst Verwirrung. Dann Überraschung. Unglauben. Erkenntnis. Schock.
Es sind nur vier Worte. Doch sie haben die Macht, Maries Welt binnen Herzschlägen aus den Angeln zu heben. Ich sehe ihr dabei zu. Habe ungeschönt vor Augen, was diese vier Worte ihr antun. Was ich ihr angetan habe. Wissentlich.
»Marie«, setze ich erneut an, flüsternd dieses Mal nur, »ich ...«
Doch es gibt keine Entschuldigung dafür, keine Wiedergutmachung, und daher ist es wohl nur fair, dass ich ihren Schmerz in all seinen Facetten mitansehen kann. Dabei zusehen muss, wie ihre Welt auseinanderbricht. Weil ich sie ihr in Trümmern vor die Füße werfe.
»Wer?« Sie flüstert nur. Ihre Stimme dabei schneidend kühl, doch unter diesem eisigen Schutzwall bröckelt sie auseinander.
»Marie, das ist ...«
»WER, VERDAMMT?«
Angesichts ihres Schreis zucke ich zusammen, im selben Moment, in dem sie aufspringt. Reflexartig strecke ich eine Hand aus, doch Marie schlägt sie fort. »Mit wem du gefickt hast, will ich wissen!«
Es ist nicht ihre Wortwahl, die mich dermaßen trifft, sondern der Schmerz, der unter ihren Angriffen brach liegt. Diese enttäuschte Verzweiflung, die in ihrer Stimme und vor meinen Augen schwelt.
»Verdammt, Sascha, rede! Wer und wann? Sag’s mir! Ist sie ...?«
»Domenico.«
Für wenige Sekunden hängt Stille zwischen uns. Bis Marie ein Keuchen entweicht. »Was?«
Für einen kurzen Moment schaffen es Unglauben und erneuter Schock tatsächlich, den Schmerz in ihrer Miene zu überlagern.
»Ich hab was mit Domenico«, sage ich langsam. Jedes Wort eine Qual und im selben Moment seltsam befreiend. »Seit ein paar Wochen schon, wir ...«
»Spinnst du? Bist du schwul?«
Wäre die Situation nicht so beschissen, würde ich vermutlich lachen, weil dieser Disput so unglaublich klischeehaft anmutet. So jedoch ringt sich nur ein bitterer, erstickter Laut aus meiner Kehle. »Nein, bin ich nicht. Es ist ...«
»Du hast deinen Streifenpartner gefickt?«
Genau das. Oder eher: eben nicht.
Binnen eines Herzschlages wird Marie noch bleicher, als sie es ohnehin schon war. »Scheiße ...« Sie hebt eine Hand vor den Mund. Ihre Finger zittern so sehr, dass ich dem Reflex kaum widerstehen kann, erneut zu versuchen, nach ihr zu greifen. »Er hat dich gefickt.«
Keine Ahnung, wie sie es in diesem Moment zu einer solch treffsicheren Schlussfolgerung bringt. Es ist irrwitzig, vollkommen abstrus, dass sie nicht gemerkt hat, wie ich sie wochenlang verarscht habe, sie aber anscheinend anhand meines Mienenspiels ablesen kann, was genau zwischen Domenico und mir passiert ist.
»Das ist doch vollkommen irrelevant«, stoße ich hervor. Marie sieht in einer Art zu mir auf, die mich fürchten lässt, wir würden hier gleich, statt über uns zu sprechen, darüber debattieren, was die Rollenverteilung im Bett zwischen zwei Männern aussagt – oder vielmehr nicht aussagt.
Doch dann wechselt Maries Gesichtsausdruck von Schock und Abscheu wieder zurück zu Schmerz. Tränen steigen binnen Sekunden in ihren Augen auf. Die noch immer zitternden Finger presst sie sich auf den Mund. Ein einzelnes Schluchzen dringt zwischen ihnen hindurch.
»Du ... verdammtes Arschloch ...« Sie flüstert nur. Die ersten Tränen rinnen. Dann dreht sie sich um. Drängt sich so hastig an mir vorbei, dass sie sich das Knie am Couchtisch stößt und stolpert.
Ich greife nach ihr, erwische ihren Arm. Streife ihn nur.
»Fass mich nicht an!«
Als sie sich endgültig losreißt, meine Hand kraftlos herabsinkt, treffen sich unsere Blicke noch einmal für Sekunden.
Es tut mir leid, hämmert die Stimme in meinem Kopf. Es – tut – mir – so – leid. Doch ich weiß, es bringt nichts, es jetzt auszusprechen.
Und dann dreht Marie sich um und geht. Aus dem Wohnzimmer. Das Rumoren im Flur dröhnt in meinen Ohren. Mit einem bebenden Ausatmen schließe ich die Augen.
Die Haustür fällt ins Schloss.
Kapitel 2 – Domenico
Mittwoch, 4. Dezember 2019
Seit Monaten war ich nicht mehr auf dem Großmarkt und im Grunde habe ich diese Aufgabe auch in der Zeit, in der ich noch regelmäßig in der Pizzeria meiner Eltern ausgeholfen habe, nur zu gern meinem Vater überlassen. Heute jedoch kommt mir die Ablenkung gerade recht. Aus den sicher zwei Dutzend Sorten Oliven genau die auszusuchen, die Alfredo haben möchte, ist gerade allemal besser, als an Sascha zu denken. Darüber nachzugrübeln, ob er mit Marie gesprochen hat und wann er sich melden wird. Ich vertraue darauf, dass er es tut. Beides. Aber auf eine Nachricht oder einen Anruf von ihm zu warten, zerrt dennoch an meinen Nerven, und wenn ich ehrlich bin, hatte ich gehofft, er würde sich noch am Mittag melden.
Seit er jedoch am frühen Morgen meine Wohnung verlassen hat, habe ich nichts mehr von ihm gehört und ich bete einfach, dass ihn nicht doch wieder der Mut verlassen hat. Er nicht doch wieder ins Zweifeln gekommen ist. Nicht nach der Nacht, die wir miteinander hatten.
Natürlich kann ich verstehen, wie schwer es ihm fällt, Marie alles zu erzählen und sich von ihr zu trennen. Drei Jahre sind keine ellenlange Zeit, aber auch nichts, was man einfach wegwirft. Schon gar nicht, nachdem man für den Partner – oder eben die Partnerin – umgezogen ist, die Dienststelle gewechselt hat und dachte, diese Beziehung wäre die Eine. Die, die vielleicht ein Leben lang hält.
Ob Sascha das wirklich dachte, ob er wirklich so viel für Marie empfunden hat, kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, was ich für ihn empfinde, und ich weiß, was ich in der vergangenen Nacht gesehen und gespürt habe. Mit ihm. In seinem Blick, wenn er mich angesehen hat.
Wehe, du machst noch mal einen Rückzieher, Sascha Jansen!
Kurz entschlossen greife ich drei Kilopackungen der Oliven, von denen ich mir zumindest zu neunzig Prozent sicher bin, dass es die sind, die in unserer Pizzeria auf die Antipasti-Platte kommen. Mit randvollem Einkaufswagen steuere ich in Richtung Kassen. Zum Glück herrscht dort gerade kein zu großer Andrang, sodass ich den Großmarkt rasch verlassen kann. Ich bin gerade dabei, die Lebensmittel in den VW Kombi zu laden, mit welchem die beiden Minijobber, die mein Vater für den Lieferservice eingestellt hat, normalerweise die Bestellungen ausfahren, als mein Handy in meiner Hosentasche vibriert. Mit einem großen Laib Parmesan unter dem Arm, angle ich es mit der freien Hand hervor. Die Nachricht ist tatsächlich von Sascha.
›Hi, sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Können wir uns sehen?‹
Mein Herz macht einen Satz in meiner Brust – oder wenigstens fühlt es sich so an – und beginnt prompt, schneller zu schlagen. Fieberhaft versuche ich, aus seinen geschriebenen Worten herauszulesen, wie das Gespräch mit Marie verlaufen ist. Ob er mit ihr geredet hat. Gott, ich hoffe es wirklich.
›Klar‹, tippe ich umständlich mit einer Hand, lege das Handy dann doch kurz beiseite und lade den Parmesanlaib in den Kofferraum, ehe ich vollends antworte. ›Bin gerade noch beim Großmarkt, man hat als freigestellter Beamter ja sonst nichts zu tun. ;-) Willst du in die Pizzeria kommen?‹
Natürlich könnten wir uns auch woanders treffen, sobald ich die Lebensmittel abgeliefert habe. Aber eigentlich hatte ich versprochen, noch ein wenig bei den Vorbereitungen für den Mittagstisch zu helfen, und es wäre schlichtweg schneller, wenn Sascha auch direkt losfährt und ...
›Okay. Zwanzig Minuten?‹
Zufrieden lächle ich mein Handy an und schicke Sascha ein glückliches Emoji und einen Daumen nach oben. Ich freue mich, ihn gleich zu sehen. Mein Herz allerdings pocht weiterhin nervös. Das wird sich wahrscheinlich erst beruhigen, wenn er vor mir und keine Freundin mehr zwischen uns steht.
Als ich den Kombi rund eine viertel Stunde später auf den Parkplatz der Pizzeria lenke, ist von Saschas Auto noch nichts zu sehen. Stattdessen kommen Greta und Cookie aus der offenstehenden Restauranttür gestürmt, sobald ich aussteige. Glücklicherweise sind die beiden bei Autos erst mal vorsichtig und bleiben auf Abstand. Sie rennen nur so tollwütig herum, wenn bekannte Menschen aussteigen. Da neben der Pizzeria direkt der Sportplatz liegt, herrscht hier zumindest am Wochenende und zur frühen Abendzeit ordentlich Betrieb. Nicht auszudenken, wenn die beiden kopflos auf dem Parkplatz herumrennen würden.
»Na, ihr zwei Verrückten. Gleich kommt noch ein Lieblingsmensch«, murmele ich meinen beiden Frenchie-Damen zu, kraule beiden einmal kurz über den Kopf. Wann genau habe ich beschlossen, dass Sascha einer ihrer Lieblingsmenschen ist? Wohl eher meiner. Kopfschüttelnd richte ich mich auf und öffne den Kofferraum.
Mein Vater und Giulia sind bereits in der Küche beschäftigt, Sanita deckt die Tische für das Abendgeschäft ein und wo meine Mutter und Alessia stecken, weiß ich nicht. Robert, unser Pizzabäcker, wird erst später kommen, und die Aushilfen arbeiten in der Regel nur an Wochenendabenden. Daher mache ich mich allein daran, die Einkäufe in die Küche und den Kühlraum zu schleppen. Ich bin gerade beim zweiten Sack Pizzamehl angelangt, als ein Auto von der Vaihinger Landstraße in Richtung der Parkplätze abbiegt. Es ist Saschas BMW.
Den Mehlsack wuchte ich zurück in den Kofferraum, die Hände wische ich mir kurz an der Jeans ab. Dank der Schlepperei ist mir ordentlich warm, sodass ich die Zeit nutze, in der Sascha sein Auto parkt, um den Reißverschluss an meiner Jacke aufzuziehen.
Sascha selbst trägt wie in der vergangenen Nacht seinen dunklen Mantel – und er sieht noch viel geschaffter aus als heute Morgen. Die Ringe unter seinen Augen lassen auf Schlafmangel und Stress gleichermaßen schließen, sein Gang wirkt schleppend und seine Schulterlinie angespannt, als er auf mich zukommt. Er sieht mich an und doch kommt es mir auf seltsame Weise vor, als schaue er durch mich hindurch. Greta kommt angedonnert und springt an seinen Beinen hoch. Trotz eines Stolperns scheint er von meiner Hündin kaum Notiz zu nehmen.
»Hey«, murmelt er nur, als er schließlich vor mir steht. Mit Abstand. Ohne Kuss, ohne Umarmung. Ohne Berührung.
Binnen eines Atemzuges schnürt sich meine Brust zusammen. »Hallo«, entgegne ich gedehnt und setze nach einem kurzen Moment, in dem wir beide schweigen, hinzu: »Du siehst echt fertig aus.«
Er nimmt meine Feststellung nahezu reglos und emotionslos hin, sieht mich nur weiter an. Irgendwie blicklos. Mir war klar, dass er die Trennung von Marie nicht einfach so wegstecken würde. Doch damit, dass er augenscheinlich so durch den Wind ist, habe ich nicht gerechnet, und wenn ich ehrlich bin, versetzt es mir einen Stich. Sollte in seiner Miene nicht wenigstens ein Hauch Erleichterung sein? Darüber, reinen Tisch gemacht zu haben? Oder Freude darüber, mich zu sehen? Auch wenn wir uns nicht direkt um den Hals fallen. Ich glaube nicht, dass er nur zögert, weil potenziell ein Mitglied meiner Familie uns zusehen könnte. Zumindest vor ihnen sollte es Sascha wenig ausmachen, mir – einem Mann – nahezukommen.
»Ich hab mit Marie gesprochen«, bringt er nach endlos erscheinenden Sekunden hervor, doch noch immer spiegelt sich keine Erleichterung in seiner Miene.
Ich jedoch kann nicht anders, als in einem langen Atemzug die Luft auszustoßen. »Gut.«
Sascha atmet ebenfalls aus, schnaubend allerdings. »Wie man’s nimmt. Sie ist abgehauen. Schätze mal, sie ist zu ihrer besten Freundin und ein Aufeinandertreffen mit der überlebe ich nicht.«
Keiner von uns hat wohl damit gerechnet, dass das Gespräch, die Trennung, einfach werden würde. Für Marie muss es schlimm sein, und ja, irgendwo tut es mir leid, doch mein schlechtes Gewissen wird gerade von meiner eigenen Erleichterung und Sehnsucht verdrängt.
Oder vielmehr: Würde verdrängt werden, wenn Sascha nicht so verdammt emotionslos dort stehen würde.
»Du kannst später zu mir kommen«, murmele ich ihm zu. »Statt mit Marie unter einem Dach ...«
Leicht schüttelt er den Kopf und ich verstumme.
»Wir müssen erst mal sehen, wie ... wir jetzt weitermachen.«
Im ersten Moment will ich lächeln. Lächeln darüber, dass er nichts überstürzen will. Uns Zeit geben will. Geleitet von Gefühlen haben wir beide immerhin schon genug angerichtet. Die Geste ziept bereits an meinen Mundwinkeln. Doch dann registriere ich mit einem Mal, dass Saschas Gesichtszüge nicht bar von Emotionen sind. Er sieht mich nicht ausdruckslos an, sondern es ist dieser mühsam unterdrückte, unter Schutt begrabene Schmerz, der in seiner Miene flackert. Ich begreife, dass er mit wir nicht uns beide gemeint hat.
»Ich kann nicht zu dir kommen, Nico«, flüstert er und spätestens jetzt, bei der Art, wie er das sagt, zieht sich das unsichtbare Band um meinen Brustkorb erbarmungslos zusammen.
»Wie jetzt ... Hast ... du hast dich doch von Marie getrennt.« Ich formuliere es als Aussage, weil es keine Frage sein sollte. Keine, auf deren Antwort ich so sehr hoffen und sie gleichsam so fürchten muss.
Sascha schweigt.
Meine Stimme hingegen bebt, als ich nachhake: »Ob du dich von ihr getrennt hast, Sascha?«
Es ist nur eine winzige Geste, die er vollführt, aber sie ist unmissverständlich als Kopfschütteln zu erkennen. Mein Herz donnert so heftig gegen meinen Brustkorb, dass es die Enge eigentlich sprengen müsste. Doch mir entkommt nur ein Keuchen.
»Scheiße ... und jetzt?«, entfährt es mir und ich weiche einen Schritt zurück, trete gleich darauf wieder einen auf ihn zu. »Warum nicht, Sascha? Ich dachte, du ... ich ...« Von einer plötzlichen Hilflosigkeit gepackt, deute ich zwischen ihm und mir hin und her. Ich will gerade zu einem weiteren Fluch ansetzen – einem echten, italienischen dieses Mal –, doch bereits der erste Laut verhallt in Saschas Flüstern.
»Sie ist schwanger.«
Erneut keuche ich auf. »Was?«
»Deswegen ... ich ...« Er bringt kein weiteres Wort heraus. Stattdessen scheinen die Emotionen mit einem Mal aus seiner Miene zu brechen. Als würde er erst jetzt selbst begreifen, was er gerade gesagt hat, steht der Schock in seinem Gesicht geschrieben.
»Gott, Sascha ...«
»Ich kann nicht, Nico. Ich kann sie jetzt nicht verlassen, sie ist ...«
»Schwanger! Hab ich verstanden!« Ich schreie ihn an und kann – oder will – nichts dagegen tun. Würde ihm in diesem Moment am liebsten meine geballte Faust in den Magen rammen und ihn gleichzeitig an mich ziehen, sein Gesicht mit meinen Händen umfassen und die Tränen fort streicheln, die in seinen Augenwinkeln schwimmen. Doch statt irgendetwas davon zu tun, fahre ich ihn an: »Zur Hölle ... sie weiß von uns, ja? Und trotzdem wollt ihr ... das zusammen durchziehen?«
Fassungslos starre ich ihn an. Unter meinem Blick löst sich eine Träne aus seinem Augenwinkel. Mit dem Handrücken wischt er sie fort und ich sehe, wie sehr seine Finger zittern. Meine allerdings auch, nur halte ich sie zu Fäusten geballt.
»Das ... keine Ahnung. Das ist unser Kind. Nico, ich ... kann jetzt nicht ... Marie, sie ...«
»Was ist mit uns, Sascha?« Ich muss diese Frage stellen. Kann nicht anders und ich brauche verdammt noch mal eine Antwort von ihm. Eine Entscheidung. Jetzt.
Doch er schweigt.
»Ein letztes Mal, Sascha: Was – ist – mit – uns?«
Wieder Schweigen.
Sekundenlang.
Eine weitere Träne rollt und ich kann das Brennen auch hinter meinen eigenen Lidern spüren.
In einer zutiefst hilflosen Geste hebt er die Schultern. »Es tut mir leid, Nico.«
Es sind die schlimmsten Worte, die er in diesem Moment aussprechen könnte. Eine Entschuldigung an mich, dafür, dass er sich offenbar doch mal wieder umentschieden hat.
»Okay, dann geh.« Ich bin selbst überrascht, wie kühl meine Stimme klingt. »Hau ab. Aber wenn du jetzt gehst, brauchst du auch nicht wiederzukommen, du ...«
»Nico ...«
»Ich mein’s ernst, Sascha. Geh.« Unter der Kühle bricht Schmerz hervor, so als würden sich die schmerzenden Splitter durch eine Eisdecke bohren. »Geh zu deiner kleinen, beschissenen, verlogenen Familie und ...«
»Nico, verdammt! Du begreifst es nicht, oder? Marie ist schwanger. Von mir. Wir bekommen ein Kind und ich werde ...«
»Was? Zur Hölle, was wirst du, Sascha? Ich bin nicht blöd, okay? Ich habe begriffen, dass ihr ein Kind bekommt, aber du begreifst anscheinend nicht, dass dieses Kind rein gar nichts daran ändern wird, dass eure Beziehung am Ende ist. Und es ist mir scheißegal, ob ich das Recht habe, das festzustellen oder nicht. Ich weiß, dass es so ist, und du weißt es auch. Du weißt, dass das zwischen uns echt war. Dass wir einander was bedeuten. Und Marie wird das auch sehen. Das zwischen euch wird nicht mehr funktionieren, und das sage ich nicht, weil ich dich zu irgendetwas überreden will. Das werde ich nicht tun. Es liegt bei dir, Sascha.«
Er nickt. Immer wieder. Währenddessen gleiten Tränen über seine Wangen. So lange, bis er sie wieder fortwischt – und noch einmal nickt.
»Ich weiß«, murmelt er. Und dann tut er das Schlimmste, was er mir und sich selbst und vielleicht auch Marie antun kann: Er dreht sich um und geht.
Kapitel 3 – Sascha
Mittwoch, 4. Dezember 2019
Obwohl eine Begegnung mit Jana aktuell mein kleinstes Problem sein sollte, erwische ich mich dabei, scharf die Luft einzuziehen, als ich ihr Auto vor dem Haus stehen sehe. Im nächsten Moment jedoch atme ich beinahe erleichtert aus, denn wenn Jana hier ist, ist Marie wenigstens nicht allein, und ich bin nun wirklich nicht in der Position, mich vor der unweigerlich folgenden Konfrontation zu drücken.
Zu meiner Überraschung ist die Haustür nur angelehnt und als ich sie vollends aufschiebe, kommt Jana die Treppe aus dem Obergeschoss herunter – mit einem Stapel Klamotten in den Händen, obenauf Maries Kulturbeutel.
Wie angewurzelt bleibt Jana mitten auf der Treppe stehen. »Du.«
Mehr sagt sie nicht. Muss sie auch nicht. Das einzelne Wort sagt alles aus, was sie über mich denkt.
Glückwunsch, scheint ganz so, als würden wir langsam alle zu Experten der minimalistischen Kommunikation werden.
Genervt von meinem eigenen Sarkasmus presse ich die Lippen aufeinander, ehe ich weiter in den Flur trete.
»Ist Marie bei dir? Wie geht’s ...?« Ich bringe die Frage nicht zu Ende, denn Jana fällt mir regelrecht fauchend ins Wort: »Wie soll es ihr schon gehen, nachdem sie erfahren hat, dass sie von einem schwulen Mann schwanger ist?«
»Gott ...« Das abfällige Schnauben kann ich mir nicht verkneifen. Ich weiß, dass unser aller Nerven gerade blankliegen, dennoch kotzt mich diese verfluchte Engstirnigkeit so an. Dieses klischeehafte, abfällige Schwarz-Weiß-Denken.
»Ich bin nicht ...«, setze ich an, unterbreche mich jedoch selbst. »Lassen wir das. Das ist eine Sache zwischen Marie und mir und ...«
»Du«, fällt Jana mir ins Wort und wieder spricht aus dieser einzelnen Silbe nichts als Abscheu, »hast meine beste Freundin betrogen. Mit einem Mann.«
Als ob ich das nicht wüsste. Und als ob es einen so riesigen Unterschied machen würde. Als ob wir uns alle in den Armen liegen und gemeinsam über meinen dummen Fehler lachen würden, wäre es eine Frau gewesen.
»Gottverdammt, Marie ist schwanger von dir, Sascha, und du ... du ...« Hätte Jana nicht beide Hände voll, würde sie vermutlich wild herumfuchteln, doch so bleibt es bei einem Heben des Klamottenstapels und einem zutiefst anklagenden Gesichtsausdruck. Den habe ich definitiv verdient. Mehr als das.
Von einer plötzlichen Müdigkeit gepackt gehe ich noch einen Schritt beiseite, lehne mich mit einer Schulter gegen die Wand. »Ist mir alles klar«, entgegne ich lahm. »Sag Marie bitte, dass ...«
»Ich werde ihr gar nichts sagen«, zischt Jana und kommt vollends die Treppe herunter. »Und wag es nicht, heute noch bei uns vorbeizukommen.«
Mit diesen Worten rauscht sie an mir vorbei und aus der Haustür, lässt diese offen stehen.
Sekundenlang starre ich hinaus. Hinaus in den Garten, den Marie und ich in diesem Frühling miteinander herrichten wollten. Dieser Garten, in dem eines Tages unsere Kinder hätten spielen sollen. Vielleicht hätte ich ihnen ein Klettergerüst gebaut oder ...
Mit einem leisen Fluch auf den Lippen trete ich vor und werfe die Haustür mit einem Knall ins Schloss.
~*~*~*~*~*~
Tatsächlich bekomme ich Marie den restlichen Tag und in der Nacht nicht zu Gesicht. Auch von Domenico höre ich keinen Ton. Verständlicherweise. Dennoch tut es weh. Wobei mehr der Schmerz über meine eigenen Worte an ihn in mir brennt, als sein Schweigen das tut. Es ist verdammt noch mal nicht an ihm, sich zu melden. Ich bin derjenige, der die Krater zwischen uns überbrücken und in mühevoller Kleinarbeit zuschütten muss. Krater, die überwunden schienen. Bis ich von Maries Schwangerschaft erfahren und sie erneut aufgerissen habe.
Es ist nicht fair.
Weder, dass ich mein Fehlverhalten insgeheim in Teilen auf ein ungeborenes Kind schiebe, noch dass ich Domenico nun warten lasse. Ich will ihn. Ich vermisse ihn. Will und muss um ihn kämpfen und doch sträubt sich alles in mir dagegen, das jetzt zu tun. Jetzt, wo Marie bei Jana sitzt und die Welt nicht mehr versteht und sich verarscht und betrogen und hintergangen fühlt.
Ich weiß, dass ich mich bei Domenico melden sollte, allein schon um seinetwillen – auch wenn er gesagt hat, dass ich nicht noch mal bei ihm anzukommen brauche. Ich weiß nicht, ob er mir noch eine Chance geben würde. Und selbst wenn ... Es fühlt sich so mies an, mich um mein eigenes Seelenheil kümmern zu wollen, während ich noch vor wenigen Stunden Maries Herz zerrupft vor ihre Füße geworfen habe. Als würde ich weiter in ihrer Wunde stochern, indem ich dafür sorge, dass es mir besser geht. Und Nico.
Darüber hinaus befürchte ich auch einfach, gerade so aufgewühlt zu sein, dass ich ohnehin kein sinnvolles Gespräch mit ihm zustande bekommen würde. Dass ich Sachen sagen würde, die ihn verletzen oder wieder Mal falsche Hoffnungen wecken würden. Worte, die ich nicht mehr rückgängig machen könnte. Andererseits ... bin ich mir sicher, ich würde keine falschen Hoffnungen wecken. Denn was ich ihm vor weniger als vierundzwanzig Stunden gesagt habe, gilt nach wie vor: Ich will Nico. Nicht nur fürs Bett. Ich will ihn als meinen Partner.
Aber ich will ihm eben auch nicht so emotional aufgewühlt gegenüberstehen. Ich will nicht, dass er schon wieder derjenige sein muss, der mich auffängt und erdet.
An diesem Abend versacke ich mit zwei oder möglicherweise auch drei Gläsern Whiskey auf dem Sofa.