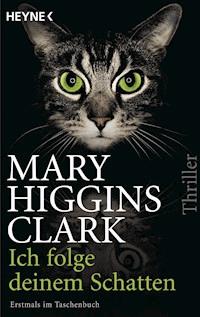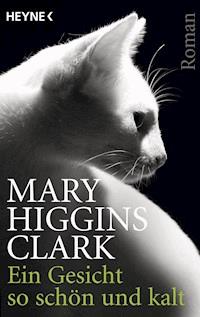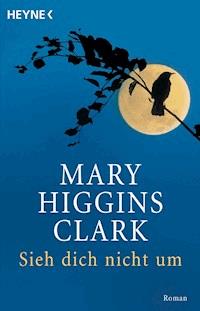
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Lacey Farrell ist eine erfolgreiche junge Immobilienmaklerin, deren Leben sich schlagartig ändert, als sie zur unfreiwilligen Zeugin eines Mordes wird. Warum musste Isabelle Waring sterben? Und was hat es mit dem rätselhaften Tagebuch ihrer Tochter Heather auf sich? Lacey ahnt nicht, in welche Gefahr sie sich begibt, denn der Mörder setzt sich jetzt auf ihre Spuren. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Das Buch
Lacey Farrell hat es geschafft – sie gehört zu den erfolgreichsten Immobilienmaklerinnen New Yorks. Dann aber nimmt ihr Leben eine dramatische Wende: Sie wird Zeugin eines Mordes. Als sie ihre Klientin Isabelle Waring in deren Wohnung aufsuchen will, sieht sie den Mörder flüchten. Im Sterben bittet Isabelle Lacey, das Tagebuch ihrer Tochter zu lesen, in dem sie offensichtlich Hinweise auf deren Tod, angeblich einen Unfall gefunden hat. Musste Isabelle sterben, weil sie nicht an den Unfall glaubte und hartnäckig nach dem Mörder ihrer Tochter suchte?
Als Zeugin des Mordes gerät Lacey selbst in tödliche Gefahr. Nachdem in ihre Wohnung eingebrochen und auf sie geschossen wurde, bringt die Polizei sie in einem Zeugenschutzprogramm unter. Mit dem neuen Namen Alice Carroll und neuer Identität soll sie in Minneapolis abwarten, bis der Täter gefasst ist. Doch auch dort scheint sie nicht sicher zu sein …
Die Autorin
Mary Higgins Clark, geboren in New York, lebt und arbeitet in Saddle River, New Yersey. Sie zählt zu den erfolgreichsten Thrillerautorinnen weltweit. Ihre große Stärke sind ausgefeilte und raffinierte Plots und die stimmige Psychologie ihrer Heldinnen. Mit ihren Büchern führt Mary Higgins Clark regelmäßig die internationalen Bestsellerlisten an.
Inhaltsverzeichnis
Für meinen Mann John Conheeny
und unsere Kinder
Marilyn Clark
Warren und Sharon Meier Clark
David Clark
Carol Higgins Clark
Patricia Clark Derenzo und Jerry Derenzo
John und Debbie Armbruster Conheeny
Barbara Conheeny
Patricia Conheeny
Nancy Conheeny Tarleton und David Tarleton
In Liebe.
DANKSAGUNG
Oft werde ich gefragt, woher ich die Ideen zu meinen Büchern bekomme.
In diesem Fall muß ich bei der Antwort ein wenig ins Detail gehen. Ich hatte verschiedene Romanhandlungen im Kopf, von denen allerdings keine meine Phantasie beflügelte. Eines Abends dann ging ich zum Essen in ein berühmtes New Yorker Restaurant, Rao’s Bar and Grill.
Als der Abend sich seinem Ende näherte, griff Frank Pellegrino, einer der Besitzer und ein professioneller Sänger, zum Mikrophon und trug ein Lied vor, das Jerry Vale vor vielen Jahren populär gemacht hatte: »Pretend You Don’t See Her.« Während ich mir den Text anhörte, nahm ein vager Gedanke, mit dem ich bereits gespielt hatte, Gestalt an: Eine junge Frau wird Zeugin eines Mordes und muß zur Rettung ihres Lebens in das Zeugenschutzprogramm aufgenommen werden.
Grazie, Frank!
Weiterhin verbeuge ich mich vor meinen Lektoren Michael Korda und Chuck Adams. Schon in meiner Schulzeit konnte ich nur unter Zeitdruck arbeiten, und daran hat sich bis heute nichts geändert. Michael und Chuck, die Korrektorin Gypsy da Silva und die Assistentinnen Rebecca Head und Carol Bowie – ihr wart meine Rettung und habt es verdient, daß man euch heiligspricht.
Auch meiner Pressereferentin Lisl Cade und meinem Agenten Gene Winick, deren Freundschaft ich sehr schätze, schulde ich einen Blumenstrauß.
Die Recherchen eines Autors werden um einiges einfacher, wenn man Experten zu Rate zieht. Ich bedanke mich bei Robert Ressler, Autor und pensionierter Abteilungsleiter beim FBI, der mir das Zeugenschutzprogramm erklärte; bei Rechtsanwalt Alan Lippel, der verschiedene juristische Probleme mit mir klärte, die im Rahmen der Romanhandlung auftraten; bei Jack Rafferty, einem pensionierten Detective, der meine Fragen zum Polizeialltag beantwortete; und bei Jeffrey Snyder, der selbst einmal unter dem Zeugenschutzprogramm gelebt hat. Ich danke Ihnen allen dafür, daß Sie Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen mit mir geteilt haben!
Außerdem ziehe ich meinen Hut vor dem Computerfachmann Nelson Kina, der im Four Seasons Hotel in Maui arbeitet. Er hat wichtige Kapitel wieder zu Tage gefördert, die ich schon verloren glaubte.
Dank auch an Carol Higgins Clark, meine Tochter und ebenfalls Romanautorin, auf deren konstruktive Kritik ich stets besonders viel gebe.
Ich grüße meinen guten Freund Jim Smith aus Minneapolis, der mir die nötigen Informationen über diese Stadt zugänglich machte.
Ich bedanke mich auch bei meinem Fanclub, meinen Kindern und Enkeln. Selbst die Kleinsten fragten mich ständig: »Hast du das Buch schon fertig, Mimi?«
Und schließlich einen Orden für meinen Mann John Coheeny, der eine Schriftstellerin mit Abgabeterminen geheiratet hat und sich mit unendlicher Geduld und viel Humor dieser schweren Aufgabe stellt.
Seid alle bedankt! Und um nun einen Mönch aus dem fünfzehnten Jahrhundert zu zitieren: »Das Buch ist fertig. Laßt den Schriftsteller spielen.«
Später versuchte Lacey sich mit dem Gedanken zu trösten, daß sie zusammen mit Isabelle getötet worden wäre, wenn sie nur wenige Sekunden früher gekommen wäre. Sie hätte ihr auch nicht helfen können.
Aber es war ohnehin ganz anders abgelaufen. Mit dem Schlüssel, über den sie als Immobilienmaklerin verfügte, hatte sie die Maisonettewohnung in der 70. Straße Ost betreten und Isabelles Namen gerufen. »Nicht…!« schrie Isabelle im selben Augenblick, und dann knallte ein Schuß.
Sollte Lacey weglaufen oder sich verstecken? Sie hatte die Wohnungstür zugeschlagen und war rasch in einen Wandschrank im Flur geschlüpft. Es blieb ihr nicht einmal die Zeit, die Schranktür ganz zu schließen, denn im nächsten Moment kam ein blonder, gutgekleideter Mann die Treppe hinuntergerannt. Durch den Türspalt erkannte Lacey deutlich sein Gesicht, das sich unauslöschlich in ihr Gedächtnis einprägte. Sie hatte es schon einmal gesehen, erst vor wenigen Stunden. Obwohl das Gesicht jetzt wutverzerrt war, handelte es sich eindeutig um denselben Mann, dem sie an jenem Vormittag die Wohnung gezeigt hatte: den liebenswürdigen Curtis Caldwell aus Texas.
Lacey beobachtete, wie er an ihr vorbeistürzte, eine Pistole in der rechten und eine Ledermappe in der linken Hand. Er riß die Tür auf und eilte aus der Wohnung.
Aufzüge und Feuertreppe befanden sich am hinteren Ende des Flurs. Caldwell würde mit Sicherheit sofort merken, daß die Person, die in die Wohnung gekommen war, noch hier sein mußte. Ganz instinktiv stürzte Lacey aus dem Schrank und stieß die Tür hinter ihm zu. Er wirbelte herum, und einen beängstigenden Moment lang trafen sich ihre Blicke. Er fixierte sie mit blaßblauen, eisigen Augen. Dann warf er sich gegen die Tür, aber nicht schnell genug. Sie knallte zu, und Lacey schob den Riegel vor, während ein Schlüssel schon ins Schloß gesteckt wurde.
Mit klopfendem Herzen lehnte Lacey sich an die Tür und beobachtete zitternd, wie sich der Türknauf drehte. Hoffentlich schaffte Caldwell es nicht, wieder hereinzukommen.
Sie mußte die Polizei anrufen.
Sie mußte Hilfe holen.
Isabelle! dachte sie. Bestimmt war sie es gewesen, die geschrien hatte. Lebte sie noch?
Eine Hand auf das Geländer gestützt, eilte Lacey die mit dickem Teppich bedeckten Stufen hinauf ins elfenbein- und pfirsichfarben ausgestattete Wohnzimmer. Wie oft hatte sie in den letzten Wochen dort mit Isabelle gesessen und der trauernden Mutter zugehört, die einfach nicht glauben konnte, daß ihre Tochter Heather bei einem Unfall ums Leben gekommen war.
Voller Angst stürzte Lacey ins Schlafzimmer. Isabelle lag zusammengesunken und mit weit aufgerissenen Augen auf dem Bett. Mit ihrer blutverschmierten Hand tastete sie verzweifelt nach einem Papierbündel, das neben ihr unter einem Kissen gelegen hatte. Der Wind, der durchs offene Fenster hereinwehte, trug eine der Seiten durchs Zimmer.
Lacey fiel auf die Knie. »Isabelle«, flehte sie. Sie wollte noch mehr sagen – daß sie einen Krankenwagen holen würde, daß Isabelle sich keine Sorgen zu machen brauche –, aber sie brachte die Worte nicht über die Lippen. Es war zu spät. Das war nicht zu übersehen. Isabelle lag im Sterben.
Später erschien diese Szene leicht abgewandelt in dem Alptraum, der sie mit zunehmender Häufigkeit heimsuchte. Der Traum war immer derselbe: Sie kniete neben Isabelle und hörte die letzten Worte der Sterbenden. Isabelle sprach von dem Tagebuch und bat Lacey, die Seiten an sich zu nehmen. Dann legte sich eine Hand auf ihre Schulter, und als sie aufsah, stand vor ihr der Mörder mit eiskaltem, ernstem Blick. Er zielte mit der Pistole auf ihre Stirn und drückte ab.
1
Es war Anfang September, die Woche nach dem Labor Day. Das unaufhörliche Klingeln der Telephone im Büro von Parker und Parker sagte Lacey, daß die Sommerflaute endlich vorbei war. Manhattans Immobilienmarkt war im letzten Monat ziemlich träge gewesen, doch jetzt tat sich wieder etwas.
»Wurde auch Zeit«, sagte sie zu Rick Parker, der ihr gerade eine Tasse schwarzen Kaffee auf den Schreibtisch stellte. »Seit Juni habe ich keinen anständigen Abschluß mehr gemacht. Alle Interessenten hatten sich in die Hamptons oder nach Cape Cod abgesetzt, aber zum Glück kommen sie jetzt allmählich zurück. Ein Monat Urlaub ist zwar nicht schlecht, aber jetzt muß der Rubel wieder rollen.«
Sie griff nach der Tasse. »Danke. Es ist nett, vom Juniorchef bedient zu werden.«
»Gern geschehen. Du siehst großartig aus, Lacey.«
Lacey versuchte, nicht auf Ricks Gesichtsausdruck zu achten. Sie hatte immer das Gefühl, daß er sie mit den Augen auszog. Rick war verwöhnt, sah gut aus und verfügte über einen künstlichen Charme, den er nach Gutdünken einschalten konnte. Lacey fühlte sich in seiner Gesellschaft äußerst unwohl. Sie bedauerte es sehr, daß sein Vater ihn aus der Filiale in der West Side hierher versetzt hatte. Sie wollte zwar ihren Job nicht gefährden, aber in letzter Zeit wurde es immer schwieriger, sich Rick vom Leibe zu halten.
Als ihr Telephon klingelte, nahm sie erleichtert den Hörer ab. Gerettet! »Lacey Farrell«, meldete sie sich.
»Miss Farrell, hier spricht Isabelle Waring. Wir haben uns kennengelernt, als Sie letztes Jahr in dem Haus, in dem ich wohne, eine Eigentumswohnung verkauft haben.«
Eine potentielle Kundin, dachte Lacey. Bestimmt wollte Mrs. Waring ihre Wohnung verkaufen.
Lacey überlegte, woher sie Mrs. Waring kannte. Im Mai hatte sie zwei Wohnungen in der 70. Straße Ost verkauft. Doch sie hatte außer mit dem Hausverwalter mit niemandem gesprochen. Das zweite Haus, das in Frage kam, lag in der Nähe der Fifth Avenue. Die Wohnung hatte einer Familie Norstrom gehört, und Lacey erinnerte sich vage an eine attraktive Rothaarige in den Fünfzigern, die sie im Aufzug um ihre Visitenkarte gebeten hatte.
»Die Wohnung von Norstroms?« fragte sie auf gut Glück. »Sind wir uns im Aufzug begegnet?«
Mrs. Waring klang erfreut. »Genau! Ich möchte die Wohnung meiner Tochter verkaufen, und wenn es Ihnen paßt, würde ich mich freuen, wenn Sie die Angelegenheit für mich abwickeln.«
»Es paßt mir sehr gut, Mrs. Waring.«
Lacey vereinbarte einen Termin für den folgenden Vormittag und drehte sich zu Rick um. »Glück gehabt! 70. Straße Ost, Nummer drei. Ein lohnendes Objekt.«
»Nummer drei auf der Siebzigsten Ost? Welche Wohnung?« fragte er rasch.
»Zehn B. Kennst du sie etwa?«
»Woher sollte ich?« antwortete er barsch. »Schließlich hat mein Vater in seiner unendlichen Weisheit mich fünf Jahre lang die West Side bearbeiten lassen.«
Lacey hatte den Eindruck, daß Rick sich bemühte, freundlich zu sein, als er hinzufügte: »Hat sich angehört, als wärst du jemandem begegnet, dem du gefallen hast und der dir jetzt den Verkauf seiner Wohnung überträgt. Wie mein Großvater schon immer sagte, Lacey: Man muß in diesem Geschäft nur das Glück haben, daß die Leute sich an einen erinnern.«
»Mag sein, obwohl ich es nicht unbedingt immer als Glück bezeichnen würde«, entgegnete Lacey in der Hoffnung, durch ihre abweisende Reaktion das Gespräch beenden zu können. Warum schaffte es Rick nicht, sie zu behandeln wie jede andere Angestellte des Familienimperiums?
Achselzuckend trollte er sich in sein Büro, dessen Fenster die Zweiundsechzigste Straße Ost überblickten. Von Laceys Fenstern aus konnte man die Madison Avenue sehen. Ihr machte es Spaß, das Verkehrschaos, die Touristenhorden und die gutbetuchte Schickeria zu beobachten, die die Designerboutiquen frequentierte.
»Einige von uns sind in New York geboren«, pflegte sie den zuweilen verängstigten Ehefrauen der Manager zu erklären, die nach Manhattan versetzt wurden. »Andere ziehen nur ungern hierher, doch ehe sie sich’s versehen, stellen sie fest, daß New York trotz aller Probleme die Stadt mit der höchsten Lebensqualität ist.«
Wenn jemand danach fragte, antwortete sie: »Ich bin in Manhattan aufgewachsen und habe – abgesehen von meiner Zeit am College – immer hier gewohnt. New York ist meine Stadt, mein Zuhause.«
Jack Farrell, ihr Vater, hatte genauso empfunden. Schon von frühester Kindheit an hatte sie mit ihm die Stadt erkundet. »Wir beide sind Kumpel, Lace«, pflegte er zu sagen. »Du bist eine Stadtpflanze wie ich. Deine liebe Mutter würde ja so gern wie alle anderen in eine der Vorstädte flüchten. Es ist ihr hoch anzurechnen, daß sie es hier aushält, denn da draußen würde ich eingehen wie eine Primel.«
Lacey hatte nicht nur Jacks Liebe zu New York geerbt, sondern auch sein irisches Aussehen: helle Haut, blaugrüne Augen und dunkelbraunes Haar. Ihre Schwester Kit wirkte eher englisch wie ihre Mutter: porzellanblaue Augen und Haare so blond wie Winterweizen.
Jack Farrell war Musiker gewesen und hatte meistens in Theaterorchestern gespielt. Manchmal war er auch in Clubs aufgetreten oder hatte Konzerte gegeben. Als Kind hatte Lacey die Lieder jedes Broadway-Musicals mitsingen können. Den plötzlichen Tod ihres Vaters, kurz nach ihrem Abschluß am College, hatte sie noch immer nicht verwunden, und sie fragte sich, ob sie wohl je darüber hinwegkommen würde. Wenn sie durchs Theaterviertel schlenderte, erwartete sie manchmal sogar fast, ihm auf der Straße zu begegnen.
»Dein Vater hatte recht. Ich werde nicht in der Stadt bleiben«, hatte ihre Mutter nach der Beerdigung wehmütig gesagt. Sie war Kinderkrankenschwester und hatte sich eine Eigentumswohnung in New Jersey gekauft, um in der Nähe von Laceys Schwester Kit und deren Familie zu sein. Inzwischen arbeitete sie dort in einem Krankenhaus.
Die frischgebackene College-Absolventin Lacey hatte eine kleine Wohnung in der East End Avenue und eine Stelle bei der Immobilienfirma Parker und Parker gefunden. Heute, acht Jahre später, gehörte sie zu den erfolgreichsten Maklern des Unternehmens.
Vor sich hinsummend, griff sie nach den Unterlagen zu dem Haus 70. Straße Ost, Nr. 3, und fing an zu lesen. Ich habe eine Maisonettewohnung im ersten Stock verkauft, fiel ihr ein. Gutgeschnittene Zimmer, hohe Decken, die Küche mußte modernisiert werden. Jetzt brauche ich nur noch Informationen über Mrs. Warings Wohnung.
Wenn möglich, versuchte Lacey, im voraus etwas über das angebotene Objekt zu erfahren. Dazu war es hilfreich, die Leute zu kennen, die in den verschiedenen von Parker und Parker betreuten Häusern arbeiteten. Glücklicherweise hatte sie sich mit Tim Powers, dem Hausmeister des betreffenden Gebäudes, angefreundet. Also rief sie ihn an und hörte mehr als zwanzig Minuten zu, während er in allen Einzelheiten seinen Sommerurlaub schilderte. Leider hatte sie vergessen, was für ein Schwätzer Tim war. Es dauerte eine Weile, bis sie das Gespräch auf Mrs. Warings Wohnung bringen konnte.
Tim erzählte, daß Isabelle Waring die Mutter von Heather Landi war, einer jungen Sängerin und Schauspielerin, die sich gerade einen Namen in der Theaterszene gemacht hatte. Dann aber war Heather, Tochter des prominenten Restaurantbesitzers Jimmy Landi, Anfang letzten Winters bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ihr Wagen war auf dem Heimweg von einem Skiwochenende in Vermont eine Böschung hinuntergestürzt. Die Wohnung hatte Heather gehört, und nun wollte die Mutter sie offenbar verkaufen.
»Mrs. Waring glaubt nicht, daß Heathers Tod ein Unfall war«, sagte Tim.
Als Lacey ihn endlich losgeworden war, saß sie eine Weile da und überlegte. Sie hatte Heather Landi im vergangenen Jahr in einem erfolgreichen Off-Broadway-Musical gesehen. Sie war ihr sogar besonders aufgefallen.
Heather hatte das Zeug zum Star gehabt, dachte Lacey: Schönheit, Ausstrahlung und einen glockenreinen Sopran. »Eine Traumfrau«, hätte Dad gesagt. Kein Wunder, daß ihre Mutter ihren Tod nicht wahrhaben will.
Lacey erschauderte und stand auf, um die Klimaanlage herunterzuschalten.
Am Dienstag morgen schlenderte Isabelle Waring durch die Wohnung ihrer Tochter und versuchte, sie mit dem kritischen Blick einer Immobilienmaklerin zu sehen. Sie war froh, daß sie Lacey Farrells Visitenkarte behalten hatte. Jimmy, ihr Ex-Mann und Heathers Vater, hatte verlangt, daß sie die Wohnung verkaufte. Und fairerweise mußte man sagen, daß er ihr genug Zeit gelassen hatte.
Als sie Lacey Farrell im Aufzug begegnet war, hatte sie die junge Frau auf Anhieb sympathisch gefunden. Sie erinnerte sie an Heather.
Zugegeben, Lacey sah nicht aus wie Heather, die kurze hellbraune Locken mit goldenen Strähnchen und braune Augen gehabt hatte. Sie war klein gewesen, nur knapp eins zweiundsechzig, mit weiblichen Rundungen. Die Familienzwergin hatte sie sich immer genannt. Lacey hingegen war hochgewachsen, schlank und hatte blaugrüne Augen und dunkles, langes Haar, das ihr bis zu den Schultern reichte. Doch in ihrem Lächeln und ihrer Art ähnelte sie Heather sehr.
Isabelle sah sich um. Ihr war klar, daß Birkenpaneele und eine Eingangshalle aus glänzendem Marmor nicht jedermanns Geschmack waren. Heather hatte diese Details geliebt, aber man konnte sie leicht ändern. Andererseits waren die Küche und die Bäder, allesamt renoviert, ein gutes Verkaufsargument.
Monatelang war Isabelle zwischen Cleveland und New York hin und her gefahren, hatte die fünf großen Wandschränke und die vielen Schubladen in der Wohnung geleert und sich mit Heathers Freunden getroffen. Nun mußte sie endlich einen Schlußstrich ziehen. Sie mußte aufhören, nach Gründen zu suchen, und ihr Leben weiterführen.
Allerdings wurde sie den Gedanken nicht los, daß Heathers Tod kein Unfall gewesen war. Ihre Tochter wäre nie so leichtsinnig gewesen, mitten in der Nacht mit dem Auto loszufahren – und das noch dazu in einem Schneesturm. Doch der Gerichtsmediziner hatte nichts Verdächtiges gefunden. Auch Jimmy hatte offenbar keine Zweifel. Andernfalls hätte er, wie Isabelle genau wußte, ganz Manhattan auf den Kopf gestellt, um sich Klarheit zu verschaffen.
Beim letzten ihrer seltenen gemeinsamen Mittagessen hatte er Isabelle wieder einmal zu überreden versucht, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Wahrscheinlich habe Heather in jener Nacht nicht schlafen können und sich Sorgen gemacht, weil der Wetterbericht Schnee angekündigt hatte. Schließlich mußte sie am nächsten Tag rechtzeitig zu den Proben zurück sein. Er lehnte die Möglichkeit, daß bei ihrem Tod nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein könnte, rundheraus ab.
Isabelle aber konnte sich nicht damit abfinden. Sie erzählte Jimmy von einem merkwürdigen Telephonat, das sie mit ihrer Tochter kurz vor deren Tod geführt hatte. »Jimmy, Heather war am Telephon ganz anders als sonst. Sie machte sich über irgend etwas Sorgen. Schreckliche Sorgen. Ich habe es ihrer Stimme angehört.«
Das Mittagessen war zu einem abrupten Ende gekommen, als Jimmy der Geduldsfaden riß: »Isabelle, laß es endlich gut sein! Hör bitte auf damit! Es ist schon ohne dein Gerede schwer genug für mich. Ständig mußt du alles noch einmal durchkauen. Du verhörst sogar all ihre Freunde. Bitte, laß unsere Tochter in Frieden ruhen.«
Als Isabelle an diese Worte dachte, schüttelte sie unwillkürlich den Kopf. Jimmy Landi hatte Heather über alles geliebt. Aber an zweiter Stelle kam bei ihm die Macht, überlegte sie bitter. Daran war ihre Ehe gescheitert. Sein berühmtes Restaurant, seine Investitionen und nun sein Casino-Hotel in Atlantic City. Für mich hat er nie Zeit gehabt. Vielleicht wäre es nicht zur Scheidung gekommen, wenn er sich schon vor Jahren mit einem Geschäftspartner zusammengetan hätte. Inzwischen teilte er sich die Arbeit mit Steve Abbott. Ihr fiel auf, daß sie durch die Räume gegangen war, ohne sie wahrzunehmen. Also blieb sie am Fenster stehen und sah auf die Fifth Avenue hinaus.
Im September ist New York besonders schön, dachte sie bei sich. Sie beobachtete die Jogger auf den Pfaden im Central Park, die Kindermädchen mit ihren Schützlingen, die alten Leute, die sich auf Parkbänken sonnten. An solchen Tagen bin ich auch mit Heather im Kinderwagen ausgefahren, erinnerte sie sich. Es hat zehn Jahre gedauert, und ich habe drei Fehlgeburten durchgemacht, bis ich sie endlich bekam. Aber es hat sich gelohnt. Sie war ein ganz besonderes Baby. Ständig blieben Leute stehen, um sie anzusehen und zu bewundern. Und natürlich wußte sie genau, wie sie wirkte. Sie setzte sich auf und betrachtete ihre Umgebung. Sie war so klug, so aufmerksam, so begabt. So vertrauensselig …
Warum hast du das alles weggeworfen, Heather? fragte sich Isabelle wohl schon zum hundertsten Mal seit dem Tod ihrer Tochter. Nachdem du als Kind miterlebt hattest, wie ein Auto von der Fahrbahn abkam und sich überschlug, hattest du immer Angst vor Glatteis. Du wolltest sogar nach Kalifornien ziehen, weil es dort keinen Winter gibt. Aus welchem Grund bist du um zwei Uhr morgens mit dem Auto über einen verschneiten Berg gefahren? Du warst doch erst vierundzwanzig und hattest dein ganzes Leben vor dir. Was ist in jener Nacht geschehen? Was hat dich dazu gebracht, dich hinters Steuer zu setzen? Wer hat dich dazu gebracht?
Die Haussprechanlage riß Isabelle aus ihren quälenden Grübeleien und Zweifeln. Der Pförtner meldete, daß Miss Farrell zu ihrem Termin um zehn Uhr eingetroffen sei.
Lacey war nicht auf Isabelle Warings fahrige, überschwengliche Begrüßung gefaßt. »Mein Gott, Sie sehen viel jünger aus, als ich Sie in Erinnerung habe«, sprudelte die ältere Frau hervor. »Wie alt sind Sie denn? Dreißig? Meine Tochter wäre nächste Woche fünfundzwanzig geworden. Diese Wohnung gehörte ihr. Ihr Vater hat sie für sie gekauft. Es ist eine schreckliche Umkehrung der natürlichen Ordnung, finden Sie nicht? Normal wäre es, wenn ich zuerst sterbe und sie meinen Haushalt auflöst.«
»Ich habe zwei Neffen und eine Nichte«, antwortete Lacey. »Nicht auszudenken, wenn einem von ihnen etwas zustoßen sollte. Ich glaube, ich kann nachfühlen, was Sie durchmachen.«
Isabelle folgte, während Lacey ihren geschulten Blick durch die Räume schweifen ließ. Das Untergeschoß bestand aus einer Eingangshalle, einem großen Wohnzimmer, einem Eßzimmer, einer kleinen Bibliothek, einer Küche und einer Toilette. Im oberen Stockwerk, das man über eine Wendeltreppe erreichte, lagen ein weiteres Wohnzimmer, Ankleidezimmer, Schlafzimmer und Bad.
»Eine Menge Platz für eine junge Frau«, sagte Isabelle. »Ihr Vater hat ihr die Wohnung geschenkt. Er konnte gar nicht genug für sie tun. Doch sie ist trotzdem keine verwöhnte Göre geworden. Als sie nach dem Studium nach New York zog, wollte sie zuerst eine kleine Wohnung in der West Side kaufen. Da ist Jimmy fast an die Decke gegangen. Er fand, daß sie in einem Haus mit Portier besser aufgehoben wäre, denn ihre Sicherheit lag ihm sehr am Herzen. Jetzt möchte er, daß ich die Wohnung verkaufe und das Geld behalte. Er sagt, Heather hätte es sicher so gewollt. Außerdem verlangt er, ich soll mit dem Trauern aufhören und weitermachen mit meinem Leben. Es ist so schwer, loszulassen … Ich gebe mir solche Mühe, aber ich schaffe es einfach nicht…« Tränen traten ihr in die Augen.
»Sind Sie sicher, daß Sie verkaufen wollen?« fragte Lacey, die in diesem Punkt Gewißheit brauchte.
Hilflos sah sie zu, wie Isabelle Waring die mühsam gewahrte Fassung verlor und zu schluchzen anfing. »Ich wollte herausfinden, warum meine Tochter gestorben ist. Warum sie in jener Nacht Hals über Kopf das Skihotel verlassen hat. Warum sie nicht gewartet hat und wie geplant am nächsten Morgen mit ihren Freunden abgefahren ist. Warum hat sie ihre Pläne geändert? Ich bin sicher, daß jemand die Antwort kennt. Ich möchte den Grund erfahren. Ich weiß, daß sie sich wegen irgend etwas schreckliche Sorgen machte, aber sie hat es mir nicht verraten. Ich dachte, ich könnte hier in ihrer Wohnung oder bei ihren Freunden eine Erklärung finden. Aber ihr Vater will nicht, daß ich weiter andere Menschen belästige. Wahrscheinlich hat er recht. Wir müssen weiterleben. Und deshalb, Lacey, will ich die Wohnung verkaufen.«
Lacey nahm Isabelles Hand. »Ich glaube, Heather hätte das auch gewollt«, sagte sie leise.
An diesem Abend fuhr Lacey die vierzig Kilometer nach Wyckoff in New Jersey, wo ihre Schwester Kit und ihre Mutter lebten. Seit Anfang August, als sie zu ihrem einmonatigen Urlaub in die Hamptons aufgebrochen war, hatte sie die beiden nicht mehr gesehen. Kit und ihr Mann Jay besaßen ein Ferienhaus auf Nantucket und drängten Lacey ständig, den Urlaub doch lieber mit ihnen zu verbringen.
Als Lacey die George Washington Bridge überquerte, bereitete sie sich innerlich schon auf die Vorwürfe vor, die sicher gleich auf die Begrüßung folgen würden. »Du warst nur drei Tage lang bei uns«, würde ihr Schwager ihr vorhalten. »Was gibt es denn in East Hampton, das es in Nantucket nicht gibt?«
Zumindest gibt es dich dort nicht, dachte Lacey mit einem schwachen Grinsen. Ihr Schwager Jay Taylor, Inhaber eines florierenden Unternehmens für Gastronomiebedarf, gehörte nicht zu den Menschen, die ihr besonders sympathisch waren. Doch sie hielt sich vor Augen, daß Kit ihn über alles liebte. Außerdem hatten sie drei wunderbare Kinder. Es stand ihr also nicht zu, abfällig über ihn zu urteilen. Wenn Jay nur nicht so geschwollen daherreden würde, dachte Lacey. Einige seiner Verlautbarungen hörten sich an wie ein päpstlicher Erlaß.
Als sie in die Route 4 einbog, wurde ihr klar, wie sehr sie sich auf das Wiedersehen mit den anderen Familienmitgliedern freute. Ihre Mutter, Kit und die Kinder – der zwölfjährige Todd, der zehnjährige Andy und ihr besonderer Liebling, die schüchterne vierjährige Bonnie. Als sie an ihre Nichte dachte, fiel ihr auf, daß ihr die arme Isabelle Waring und ihre Worte den ganzen Tag nicht aus dem Kopf gegangen waren. Es war kaum zu ertragen, die Trauer dieser Frau mitanzusehen. Sie hatte darauf bestanden, daß Lacey zum Kaffee blieb, und dabei weiter über ihre Tochter gesprochen. »Nach der Scheidung bin ich wieder in meine Geburtsstadt Cleveland gezogen. Damals war Heather fünf. Als Kind pendelte sie zwischen mir und ihrem Dad hin und her, was großartig geklappt hat. Ich habe wieder geheiratet. Bill Waring war zwar viel älter als ich, aber wir führten eine gute Ehe. Vor drei Jahren ist er gestorben. Ich habe so gehofft, daß Heather den Richtigen kennenlernt und eine Familie gründet. Aber sie beharrte darauf, zuerst Karriere zu machen. Allerdings hatte ich kurz vor ihrem Tod den Eindruck, daß es einen Mann in ihrem Leben gab. Vielleicht irre ich mich, aber ich glaubte es an ihrer Stimme zu hören.« Dann schlug Isabelle einen mütterlichen Ton an: »Was ist mit Ihnen, Lacey? Sind Sie verheiratet? Haben Sie einen Freund?«
Beim Gedanken an diese Frage huschte ein gequältes Lächeln über Laceys Lippen. Nicht daß ich wüßte, dachte sie. Seit ich die magischen Dreißig überschritten habe, höre ich meine biologische Uhr ticken. Ja, ich liebe meinen Beruf, meine Wohnung, meine Familie und meine Freunde. Ich führe ein angenehmes Leben. Also habe ich kein Recht, mich zu beklagen. Irgendwann passiert es schon.
Ihre Mutter öffnete die Tür. »Kit ist in der Küche, und Jay holt die Kinder ab«, erklärte sie, nachdem sie Lacey liebevoll umarmt hatte. »Und drinnen sitzt jemand, mit dem ich dich gern bekannt machen möchte.«
Lacey war überrascht und auch ein wenig schockiert, als sie vor dem großen Kamin im Wohnzimmer einen fremden Mann stehen sah, der einen Drink in der Hand hielt. Verlegen stellte ihre Mutter ihn als Alex Carbine vor und sagte, sie hätten einander vor vielen Jahren gekannt. Durch Jay, der Alex’ neues Restaurant in der 46. Straße West ausgestattet habe, seien sie einander vor kurzem wieder begegnet.
Lacey schüttelte dem Mann die Hand und sah ihn prüfend an. Etwa sechzig, dachte sie. So alt wie Mom. Macht einen guten, seriösen Eindruck. Und Mom ist vollkommen aufgekratzt. Was wird hier gespielt? Sobald sie sich loseisen konnte, ging sie in die modern ausgestattete Küche, wo Kit gerade den Salat anmachte. »Wie lange läuft das schon?« fragte sie ihre Schwester.
Mit ihrem blonden Pferdeschwanz sah Kit aus wie eine Vorzeigehausfrau. Sie grinste. »Seit ungefähr einem Monat. Er ist sehr nett. Jay hat ihn zum Essen mitgebracht, als Mom gerade bei uns war. Alex ist Witwer und schon seit vielen Jahren in der Gastronomie. Aber ich glaube, das hier ist sein erstes eigenes Restaurant. Wir waren schon dort. Ein gut geführtes Lokal.«
Als die Vordertür krachend ins Schloß fiel, zuckten die beiden Schwestern zusammen. »Vorsicht«, warnte Kit. »Da kommen Jay und die Kinder.«
Seit Todd fünf Jahre alt war, unternahm Lacey mit ihm und später auch mit den anderen Kindern regelmäßig Streifzüge durch Manhattan. Sie wollte, daß sie die Stadt so erlebten wie sie damals mit ihrem Vater. Diese Ausflüge nannten sie Jack-Farrell-Tage, und sie besuchten Matineen am Broadway (inzwischen hatte sie Cats schon fünfmal gesehen) und Museen (das Museum of Natural History mit seinen Dinosaurierskeletten gefiel den Kindern mit Abstand am besten). Sie durchwanderten Greenwich Village, fuhren mit der Straßenbahn nach Roosevelt Island, nahmen die Fähre nach Ellis Island, aßen oben im World Trade Center zu Mittag und liefen auf der Rockefeller Plaza Schlittschuh.
Wie immer wurde Lacey von den Jungen stürmisch begrüßt. Die schüchterne Bonnie kuschelte sich an sie. »Ich habe dich sehr vermißt«, sagte sie. Jay verkündete, daß Lacey wirklich hinreißend aussah, und fügte hinzu, der Monat in East Hampton habe ihr offenbar gutgetan.
»Es war wirklich affengeil«, sagte Lacey und bemerkte schadenfroh, daß er zusammenzuckte. Jay hatte eine Abneigung gegen Slang, die schon an Snobismus grenzte.
Beim Essen wollte Todd, der sich für Immobilien und den Beruf seiner Tante interessierte, alles über den New Yorker Wohnungsmarkt wissen.
»Es wird wieder besser«, antwortete sie. »Heute habe ich einen vielversprechenden neuen Auftrag bekommen.« Sie erzählte ihrer Familie von Isabelle Waring und sah, daß Alex Carbine plötzlich aufmerkte. »Kennen Sie Mrs. Waring?« fragte sie.
»Nein«, erwiderte er. »Aber Jimmy Landi, und ich bin ihrer Tochter Heather begegnet. Eine wunderschöne junge Frau. Es war eine schreckliche Tragödie. Jay, Sie hatten doch geschäftlich mit Landi zu tun. Sicher haben Sie Heather auch kennengelernt. Sie war oft im Restaurant.«
Zu ihrem Erstaunen stellte Lacey fest, daß ihr Schwager puterrot anlief.
»Nein, nie gesehen«, entgegnete er gereizt. »Meine Geschäftsbeziehungen mit Jimmy Landi liegen schon ein paar Jahre zurück. Wer möchte noch eine Scheibe Lammbraten?«
Es war sieben Uhr abends. An der Bar herrschte großer Andrang, und allmählich trafen die Gäste ein, die fürs Abendessen reserviert hatten. Eigentlich hätte er hinuntergehen und die Leute begrüßen müssen, aber er konnte sich nicht dazu aufraffen. Heute war kein guter Tag für ihn gewesen. Nach Isabelles Anruf hatte er sich niedergeschlagen gefühlt und wieder an Heather denken müssen, wie sie eingeschlossen in dem umgestürzten Auto verbrannte. Es hatte eine Weile gedauert, dieses schreckliche Bild zu verscheuchen.
Das tiefe Licht der untergehenden Sonne fiel durch die hohen Fenster seines holzgetäfelten Büros. Es lag in einem Backsteingebäude in der 56. Straße West, ebenso wie das Venezia, das Restaurant, das Jimmy vor dreißig Jahren eröffnet hatte.
Drei Vorgänger hintereinander hatten hier Pleite gemacht, bevor er das Lokal übernommen hatte. Er und Isabelle waren jung verheiratet gewesen und lebten – damals noch zur Miete – in einer Wohnung im ersten Stock. Inzwischen gehörte Jimmy das ganze Haus, und das Venezia war eines der beliebtesten Restaurants in Manhattan.
Jimmy saß an seinem massiven Schreibtisch, der noch aus den Beständen der Postkutschengesellschaft Wells Fargo stammte. Er überlegte, warum es ihm so schwerfiel, nach unten zu gehen. Es lag nicht nur am Anruf seiner geschiedenen Frau. Das Lokal war mit Wandgemälden dekoriert, eine Idee, die er bei der Konkurrenz, dem Restaurant La Côte Basque, abgeschaut hatte. Die Gemälde stellten venezianische Szenen dar, und Heather war auf einigen davon abgebildet. Sie blickte als zweijähriges Mädchen aus einem Fenster des Dogenpalastes, wurde als Teenager von einem Gondoliere angehimmelt und schlenderte als Zwanzigjährige, ein Notenblatt in der Hand, über die Seufzerbrücke.
Jimmy wußte, daß er die Bilder übermalen lassen mußte, um seinen Seelenfrieden wiederzufinden. Doch wie Isabelle nicht von dem Gedanken loskam, daß ein Dritter die Schuld an Heathers Tod trug, brauchte er die ständige Gegenwart seiner Tochter. Wenn er durchs Lokal ging, spürte er ihren Blick auf sich und hatte das Gefühl, daß sie ganz nah bei ihm war.
Jimmy war ein dunkelhäutiger Mann von siebenundsechzig Jahren. Sein schwarzes Haar war noch nicht ergraut, seine grüblerischen Augen unter den buschigen Brauen gaben seinem Gesicht einen zynischen Ausdruck, und durch seine mittelgroße, untersetzte Gestalt wirkte er wie ein Mann, der sich auf seine Körperkraft verläßt. Böse Zungen lästerten, daß Maßanzüge bei ihm reine Verschwendung seien. Auch im teuren Zwirn sehe er noch aus wie ein einfacher Arbeiter. Jimmy mußte schmunzeln, als er sich erinnerte, wie entrüstet Heather gewesen war, als ihr diese Bemerkung zugetragen wurde.
Aber ich habe ihr gesagt, sie sollte nicht hinhören, dachte Jimmy lächelnd. Ich habe ihr erklärt, daß ich diese Kerle finanziell alle in die Tasche stecken könnte, und nur das zählt.
Er schüttelte den Kopf und hing weiter seinen Erinnerungen nach. Inzwischen wußte er besser denn je, daß nicht allein das zählte, obwohl es ihm einen Grund gab, morgens überhaupt aufzustehen. Die letzten Monate hatte er nur überstanden, indem er sich mit Leib und Seele dem neuen Casino-Hotel in Atlantic City widmete. »Jetzt kann Donald Trump einpacken«, hatte Heather gesagt, als er ihr das Modell zeigte. »Warum nennst du es nicht ›Bei Heather‹, und ich trete dann exklusiv nur dort auf, Papa.«
Seit sie im Alter von zehn Jahren in Italien gewesen war, nannte sie ihn bei diesem Kosenamen, nie mehr Daddy.
Jimmy wußte noch genau, was er geantwortet hatte: »Natürlich würde ich deinen Namen am liebsten sofort in Großbuchstaben über den Eingang schreiben. Aber du solltest zuerst mit Steve sprechen. Er hat eine Menge Geld in Atlantic City investiert, und ich überlasse ihm viele Entscheidungen. Übrigens: Wie wär’s, wenn du deine Karriere an den Nagel hängst? Warum heiratest du nicht, damit ich endlich Enkelkinder bekomme?«
Heather hatte nur gelacht. »Ach, Papa, laß mir noch ein paar Jahre Zeit. Es macht mir so viel Spaß.«
Seufzend erinnerte er sich an ihr Lachen. Nun würde er niemals Enkelkinder haben, dachte er. Kein kleines Mädchen mit goldenem Haar und haselnußbraunen Augen und keinen Jungen, der einmal sein Lokal übernehmen würde.
Ein Klopfen an der Tür riß Jimmy aus seinen Gedanken.
»Komm rein, Steve«, sagte er.
Wie gut, daß ich Steve Abbott habe, dachte er. Vor fünfundzwanzig Jahren hatte der gutaussehende blonde Cornell-Student an die Tür des Restaurants geklopft, bevor sie aufmachten. »Ich möchte bei Ihnen arbeiten, Mr. Landi«, hatte er gesagt. »Von Ihnen kann ich mehr lernen als auf dem College.«
Jimmy hatte nicht gewußt, ob er amüsiert oder verärgert sein sollte. Er hatte den jungen Mann eingehend gemustert: Ein grüner Junge und ein Besserwisser, war sein erster Eindruck gewesen. »Sie möchten für mich arbeiten?« hatte er gefragt und dann in Richtung Küche gezeigt. »Gut, ich habe dort angefangen.«
Dieser Tag war mein Glückstag, dachte Jimmy. Er hat zwar wie ein verwöhnter Musterschüler gewirkt, doch er war ein irischer Junge, dessen Mutter sich als Kellnerin hatte durchschlagen müssen, um ihn zu ernähren. Wie sich herausstellte, hatte er genausoviel Energie wie sie. Damals hielt ich es zwar für einen schweren Fehler, daß er sein Studium abgebrochen und auf das Stipendium verzichtet hatte, aber ich habe mich geirrt. Er war für die Gastronomie geboren.
Steve Abbott öffnete die Tür und knipste beim Hereinkommen das Licht an. »Warum sitzt du hier im Dunkeln? Hältst du eine Séance ab, Jimmy?«
Mit einem wehmütigen Lächeln blickte Jimmy auf und sah den besorgten Blick seines Kompagnons. »Ich grüble.«
»Eben ist der Bürgermeister mit vier Freunden gekommen.«
Jimmy schob seinen Stuhl zurück und stand auf. »Mir hat niemand gesagt, daß er einen Tisch reserviert hat.«
»Hat er auch nicht. Offenbar konnte der hohe Herr unseren Hot dogs nicht widerstehen…« In langen Schritten durchquerte Abbott das Zimmer und legte Landi die Hand auf die Schulter. »Hast wohl keinen guten Tag hinter dir.«
»Stimmt«, antwortete Jimmy. »Heute morgen hat Isabelle angerufen und gesagt, daß eine Immobilienmaklerin wegen Heathers Wohnung da war. Die Frau denkt, daß sie sich gut verkaufen läßt. Und natürlich mußte Isabelle wie bei jedem Telephonat wieder mit der alten Geschichte anfangen. Sie kann sich einfach nicht vorstellen, daß Heather freiwillig bei Glatteis mit dem Auto nach Hause gefahren ist. Sie glaubt nicht, daß ihr Tod ein Unfall war. Sie kann es einfach nicht auf sich beruhen lassen, und sie macht mich damit wahnsinnig.«
Er starrte an Abbott vorbei ins Leere. »Ob du es glaubst oder nicht, als ich Isabelle kennenlernte, war sie eine wirkliche Schönheit. Das tollste Mädchen von Cleveland und außerdem verlobt. Ich habe ihr den Verlobungsring dieses Typen vom Finger gezogen und das Ding aus dem Autofenster geschmissen.« Er kicherte. »Ich mußte zwar einen Kredit aufnehmen, um dem anderen Typen das Geld für den Ring zu ersetzen, aber das Mädchen habe ich trotzdem bekommen. Isabelle hat mich geheiratet.«
Abbott kannte diese Geschichte, und er wußte, warum sie Jimmy im Kopf herumging. »Auch wenn die Ehe nicht gehalten hat, wenigstens hast du eine Tochter wie Heather bekommen.«
»Entschuldige, Steve. Manchmal wiederhole ich mich wie ein Tattergreis. Du weißt ja, wie es weitergegangen ist. Isabelle hat sich in New York nie wohl gefühlt. Sie war hier nicht glücklich. Sie hätte nie aus Cleveland wegziehen sollen.«
»Aber sie hat es getan, und du bist ihr begegnet. Und jetzt komm, Jimmy, der Bürgermeister wartet.«
Titel der Originalausgabe Pretend you don‘t see her
Einmalige Sonderausgabe Mai 2011
Copyright © der Originalausgabe 1997 by Mary Higgins Clark Copyright © 1997 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlagillustration:
Getty Images / Amadeo Ochoa / Flickr
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
eISBN 978-3-641-10065-0
www.heyne.de
www.randomhouse.de
Leseprobe