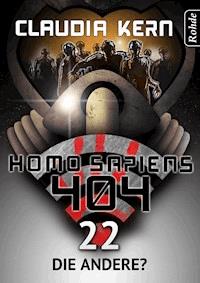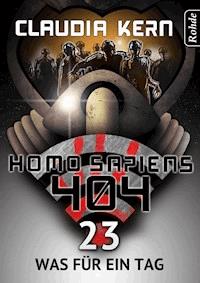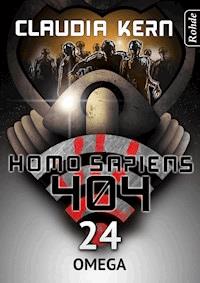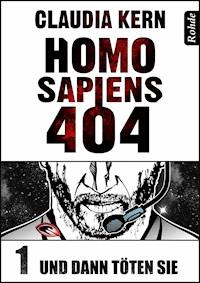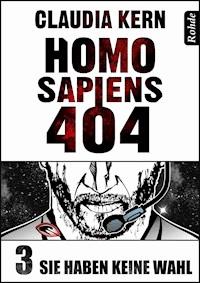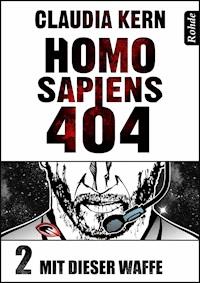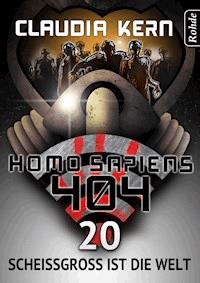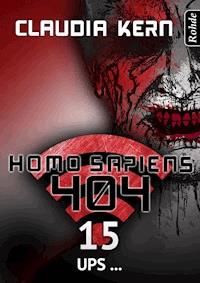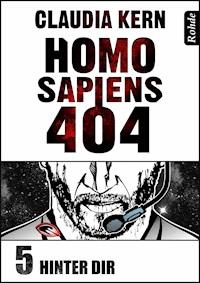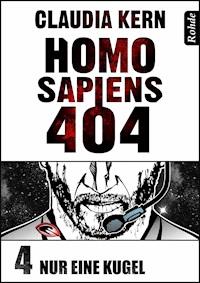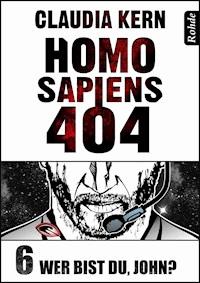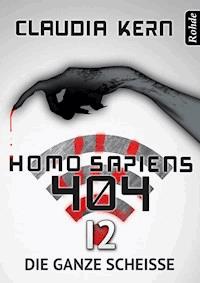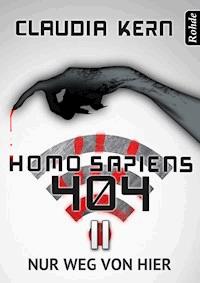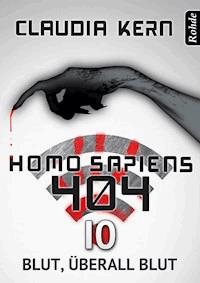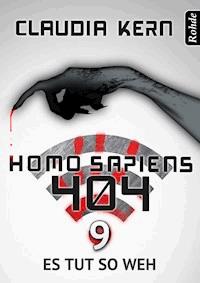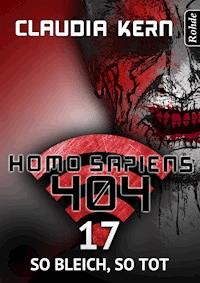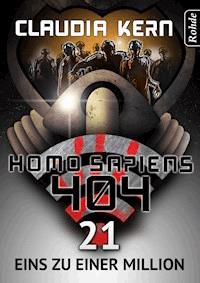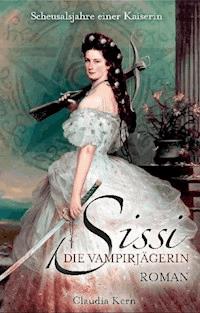
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Panini
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wien - Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Donaumonarchie erholt sich von den Ereignissen der Märzrevolution und ist peinlichst darauf bedacht, das Reich von Anarchisten freizuhalten. Es ist die Zeit des sogenannten "rothosigen Leutnants", Franz-Joseph I. Soldat, Kaiser und ... Vampir. Nur wenige Eingeweihte wissen, dass nahezu der gesamte Hochadel Europas von uralten Vampirclans durchsetzt ist, die unerkannt von ihren Untertanen, die Geschicke der Welt lenken. Toleriert und unterstützt von menschlichen Handlangern, achten sie auf die Einhaltung jahrhundertealter Machtgefüge. Doch es gibt eine kleine Gruppe von Menschen, die sich zum Ziel gesetzt hat, dem Treiben der Blutsauger ein Ende zu bereiten. Zu ihnen gehört Herzog Max Joseph in Bayern, der seine beiden Töchter Helene und Elisabeth insgeheim zu tödlichen Waffen gegen die Untoten ausbildet. Sie sollen direkt in das Herz der Vampir-Monarchie vorstoßen und sie vernichten. Eine zunächst unscheinbare Romanze der jungen Elisabeth hat das Potenzial die Fundamente einer ganzen Welt zu erschüttern ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
von Claudia Kern
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
SISSI – Die Vampirjägerin von Claudia Kern
Copyright © 2011 Panini Verlags GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Panini Verlags GmbH, Rotebühlstraße 87, 70178 Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten.
Lektorat: Caspar D. Friedrich, Luitgard Distel, Claudia Weber
Redaktion: Mathias Ulinski, Holger Wiest
Chefredaktion: Jo Löffler
Umschlaggestaltung: tab indivisuell, Stuttgart
Titelillustration: Jürgen Speh
Satz und eBook: Greiner & Reichel, Köln
PROLOG
Wien, 18. Februar 1853
Er schwitzte. Der Dolch in seiner Hand, halb verborgen unter dem schweren Wintermantel, fühlte sich fremd an. János Libényi war weder besonders groß noch besonders klein, weder dick noch auffällig dünn. Trotzdem hatte er an diesem Winternachmittag das Gefühl, als starre die ganze Welt ihn an. Er stand auf der Kärtnertor-Bastei am Rande einer breiten Allee und wartete. Befehle hallten von einem der Exerzierplätze zu ihm herüber. Menschen gingen an ihm vorbei, die Hüte tief ins Gesicht gezogen, die Hände in den Taschen vergraben. Der Wind stach wie mit Nadeln in seine Haut und trocknete die Schweißperlen auf seiner Stirn.
János warf einen Blick in den Himmel. Graue Wolken hingen über den Mauern und Türmen der Festung. Die Sonne war bereits untergegangen. Es würde nicht mehr lange dauern.
Er schluckte und spielte mit dem Dolch in seiner Hand. Zwischen den Spaziergängern und Boten patrouillierten Soldaten, manche allein, andere in kleinen Gruppen. Seit der gescheiterten Revolution war das überall in der Stadt so. Vielleicht hatte der Orden seinen Plan deshalb nicht gebilligt, ihn stattdessen gebeten, umsichtiger vorzugehen und auf bessere Zeiten zu warten.
János biss die Zähne zusammen. Die Haare seines buschigen Schnauzbarts kitzelten auf seiner Unterlippe. Bessere Zeiten … Die waren längst vorbei und der Orden hatte sie nicht nutzen können, weder in Österreich noch in Preußen. Die Köpfe der Despoten saßen fester denn je auf ihren Schultern und die, die sich ihnen hätten entgegenstellen können, waren am Strang oder im Kerker geendet. Eine ganze Generation war verloren.
Bessere Zeiten, dachte János. Bitter wie Galle stiegen die Worte in ihm auf. Sie kommen nicht einfach so. Jemand muss sie erschaffen. Ich muss sie erschaffen.
Er wusste, dass er seine Tat nicht überleben würde. Den Tod hatte er einkalkuliert. Solange auch der andere starb, war ihm das egal.
Mit der freien Hand tastete er nach der Flasche in seiner Manteltasche. Das heilige Wasser darin hatte er im Stephansdom abgefüllt, dort, wo so viele Kämpfer von den Truppen der Despoten umgebracht worden waren. Diesen Helden wollte er seine Tat widmen.
Und dann sah er ihn. Er trug Uniform, so wie immer, wenn er sich in der Öffentlichkeit sehen ließ. Hinter seinem Rücken nannten die Leute ihn den »rothosigen Leutnant«. Er war unbeliebt, auch bei denen, die nicht wussten, was er war. Trotzdem zogen die Männer den Hut und verneigten sich scheinbar andächtig, als er an ihnen vorbeiging, und die Frauen knicksten so tief, dass es aussah, als würden sie in ihren Röcken verschwinden.
»Euer Majestät.«
Der Gruß sprang wie eine Flamme von einem Passanten zum nächsten. Der junge Mann in der Leutnantsuniform mit der schräg sitzenden Kappe beachtete die Worte nicht. Er war in eine Unterhaltung mit dem älteren Uniformträger, der neben ihm ging, vertieft. Ein Trupp Soldaten folgte den beiden Männern in einiger Entfernung. János war lang genug Husar gewesen, um zu erkennen, dass sie unaufmerksam und gelangweilt waren.
Er griff in seine Manteltasche und zog die Weihwasserflasche hervor. Mit den Zähnen entkorkte er sie. Niemand beachtete ihn, als er das Wasser über die Klinge seines Dolches schüttete. Die Menschen um ihn herum starrten den rothosigen Leutnant an, nicht ihn.
Er stellte die Flasche neben einen Baum. Seine Hände zitterten. Sein Herz schlug so schnell, dass ihm übel wurde. Langsam ging er den beiden Männern entgegen, den Dolch in den Falten seines weiten Mantels verborgen. Er hatte den Mantel selbst geschneidert, das Gesellenstück für eine Prüfung, die er niemals ablegen würde. Die Luft wirkte plötzlich klarer als zuvor. Alles erschien ihm lauter. Der knirschende Kies unter seinen Sohlen, das Schreien der Krähen über seinem Kopf, die Stimmen der Passanten und sein eigener donnernder Herzschlag.
Dreißig Schritte trennten ihn noch von den beiden Männern, dann zwanzig, zehn, fünf …
»… können wir uns ein solches Fiasko nicht noch einmal leisten«, hörte er den jüngeren Mann durch das Rauschen des Blutes in seines Ohren sagen.
Der ältere nickte mit gesenktem Kopf. János war ihm so nah, dass er ihn mit ausgestrecktem Arm hätte berühren können.
Jetzt!, dachte er.
Im gleichen Moment hob der ältere den Kopf. Seine Augen weiteten sich, als er János sah, so als habe dieser eine Blick gereicht, um ihn zu durchschauen.
János wandte sich von ihm ab, hin zu dem jüngeren Mann, der immer noch redete. Er riss den Dolch in die Höhe und hätte vor Entsetzen beinah aufgeschrien, als er den Mantel mitzog. Die Klinge musste in einer seiner schlecht verarbeiteten Nähte hängen geblieben sein. János schüttelte den Dolch und zog an ihm, hörte Fäden reißen.
»Majestät!«, schrie der ältere Mann, während der Leutnant bereits zurückwich und sich umdrehte.
Nein, nein, nein! Nicht so! Oh Gott, lass mich nicht so scheitern!
Die Klinge kam frei. János warf sich nach vorn, den Dolch in der ausgestreckten Hand. Ein Stoß traf seine Schulter, ließ ihn stolpern. Seine Klinge glitt durch Stoff, bohrte sich in Fleisch. Dann wurde er auch schon zu Boden gerissen. Der ältere Mann schlug ihm den Dolch aus der Hand. János wand sich unter ihm weg, aber ein zweiter Mann trat ihm ins Gesicht. Verschwommen sah er Hände wie Pranken und eine Metzgerschürze. Es war ein Passant, der nicht wusste, was er tat. Eine Schwertspitze wurde plötzlich gegen János’ Hals gedrückt.
Er hob den Blick. Der rothosige Leutnant stand breitbeinig über ihm. Eine schwarze Flüssigkeit sickerte aus seinem Hemdkragen über seine Brust. Es roch nach verbranntem Fleisch.
Ich habe versagt, dachte János. Wut und Scham trieben ihm Tränen in die Augen. Um ihn herum schrien Soldaten Befehle. Irgendjemand betete.
»Seht, wie das feige Schwein heult, Majestät«, hörte er den Metzger sagen. Dann tauchte direkt über ihm ein Gesicht auf. Kalte blaue Augen musterten ihn.
»Er wird noch viel mehr heulen«, sagte Kaiser Franz-Josef I. von Österreich-Ungarn. »Bis zum Strang.« Er lächelte. Lange Eckzähne schoben sich über seine Lippen.
János schloss die Augen.
KAPITEL EINS
An seinem neunundachtzigsten Geburtstag tanzte Ramses der Große vor seinem Volk. Vielleicht war dies der Tag, an dem sich erste Zweifel regten. An dem Männer und Frauen einander flüsternd fragten: »Was für ein Ungeheuer beten wir da an?« Als sie sich schließlich gegen ihren fremden Herrn erhoben, als Echnaton, der letzte menschliche Pharao, die Sonne zum Gott erklärte und ihn anflehte, die Nacht zu vertreiben, war es längst zu spät. Und doch ist sein Name bis heute unvergessen unter denen, die sich dem Widerstand verschrieben haben, die für eine immer noch ahnungslose Menschheit kämpfen und nicht aufgeben werden, bis das letzte Ungeheuer zu Staub zerfallen ist. Sie selbst nennen sich »die Kinder Echnatons«. Ihre Feinde nennen sie »die Pfähler«.
– Die geheime Geschichte der Welt von MJB
»Grüß Gott, Prinzessin.«
»Grüß Gott, Frau Huber.«
Sissi zügelte ihr Pferd im Hof des Schlosses, sprang aus dem Sattel und übergab es einem Stallknecht. Der Mann lächelte freundlich und führte die Stute zu den Ställen im hinteren Teil des Hofs. Das Haupthaus lag rechts. Trotz der Morgensonne wirkte es mit seinen dunklen Holzfassaden und den kleinen Fenstern düster. Sissi sah, dass die Eingangstür offen stand, und eilte darauf zu. Wenn sie Glück hatte, erwischte sie ihren Vater noch vor einem seiner morgendlichen Ausflüge.
»War’ns scho zu Besorgungen in Possenhofen, Prinzessin?« Frau Huber stützte sich schwer auf ihren Besen. Sie schien den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als den Hof zu fegen, aber Sissis Vater ließ sie gewähren. Ihr Leben lang hatte sie für die Familie gearbeitet, da würde er sie im Alter nicht fallen lassen.
»Nur ein Telegramm.« Sissi tastete nach dem Stück Papier in ihrer Weste. Ihr Vater musste so schnell wie möglich davon erfahren. Sie wollte weitergehen, aber Frau Huber winkte ab, schien ihre Eile nicht zu bemerken.
»Neimodisch’s Zeig«, sagte sie. »Heut muas immer ois schnell geh’n. Wia mei Onkel Loisl damals vom Schlag troffa worn is, ham wir das erst fünf Joahr später erfahr’n, weil er ja zu dene Preiß’n gangen is und sei Vetter, der Klaus, dann erst wieder in d’ Heimat z’ruck kemma is.«
Sissi nickte und lächelte. »Ich muss jetzt wirklich …«
»Und hat’s uns g’schadt? Naa. Ganz andersrum. Des woar, ois hätt der lieba Herrgott ihn no fünf Joahr leb’n lass’n für uns. ’s is no koana glücklich word’n, der wo schneller schlechte Nachricht’n g’hört hod.«
»Da haben Sie recht.« Sissi nickte erneut. »Ich werd’s dem Papili gleich sagen.«
Wenn ich je zu ihm komme, fügte sie in Gedanken hinzu.
»Passt scho, Prinzessin.« Frau Huber hob den Zeigefinger wie eine aufgebrachte Lehrerin, obwohl sie in ihrem ganzen Leben keine Schule besucht hatte. Das Kreuz, das sie um den Hals trug, blitzte in der Sonne. »Und sagt’s eahm, in da Bibel kriagt a koana a Telegramm.«
Sissi wusste nicht, was sie darauf sagen sollte, also lächelte sie nur. Bevor sie sich abwenden konnte, machte Frau Huber einen Schritt auf sie zu. Erstaunlich schnell streckte sie die Hand aus. Sissi hob instinktiv den Arm, als wolle sie einen Schlag abwehren, ließ ihn jedoch wieder sinken, bevor die alte Frau etwas merkte.
Frau Huber tätschelte ihr mit rauen, groben Fingern die Wange. »Bist a guat’s Kind, Prinzessin. Lass dir von koanam net wos anders sag’n.«
Sissi runzelte die Stirn. »Wer sagt denn was anderes?«, fragte sie, aber Frau Huber winkte nur ab und machte sich daran, weiter den Hof zu fegen. Sissi wollte nachhaken, aber eine hell flötende Stimme unterbrach sie.
»Sissi? Sissi, da bist du ja. Schau doch nur, was die Mutter hat kommen lassen.«
Sie drehte sich um. Helene, ihre ältere Schwester, stand auf dem Treppenabsatz vor der Eingangstür und drehte sich im Kreis. Das Kleid, das sie trug, bauschte sich im Wind. Es hatte die Farbe einer Aprikose und war mit Rüschen besetzt. Helene lachte bei jeder Drehung.
»Oh Néné!«, zwitscherte Sissi zurück. »Wie wundervoll du darin aussiehst. Ich freue mich ja so für dich!«
Frau Huber lächelte, nickte und wollte gerade etwas sagen, doch Sissi kam ihr hastig zuvor: »Das sollten wir gleich dem Va… dem Papili zeigen. Ist er im Haus?«
Helene unterbrach abrupt ihre Drehung, stolperte und musste sich an einem Balken festhalten, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren.
»Nein, wieso?«, fragte sie zurück. Auf Sissis warnenden Blick räusperte sie sich und flötete: »Der Vater ist mit den Buben zum See gegangen. Er wollte nachschauen, ob die Fische heute beißen.«
Sissi lachte gekünstelt. »Sie beißen doch nie, wenn die Buben dabei sind.«
Scheinbar aufgeregt klatschte Néné in die Hände. »Dann wird er sich umso mehr freuen, wenn wir ihn besuchen. Komm, lass uns gleich loslaufen, bevor die Mutter mir verbietet, das Kleid anzubehalten.«
Sie sprang die breite, geschwungene Steintreppe hinunter, ergriff Sissis Hand und zog sie auf den Weg zu, der am Haus vorbei hinunter zum See führte.
»Wos is der Herr Herzog doch g’segnet, dass er a solcherde Familie hod«, hörte Sissi Frau Huber noch sagen, dann ließen sie den Hof hinter sich.
»Was ist passiert?«, fragte Helene, aber Sissi schüttelte nur den Kopf.
»Ich weiß es nicht. Das Telegramm ist an Vater gerichtet.« Sissi zog ihre Jacke enger um den Körper. Der Winter war mild, der Schnee fast geschmolzen. Trotzdem war ihr kalt. »Es stammt vom Cousin aus Wien«, fügte sie nach einem Moment hinzu.
Helene schwieg, raffte ihr Kleid zusammen und ging schneller. Sissi folgte ihr den steilen Weg hinunter. An seinem Ende lag ein Steg, der auf den See hinausführte. Das Wasser glitzerte in der Wintersonne. Eisschollen trieben träge dahin. Dazwischen ankerten Boote mit ausgeworfenen Netzen. Der Wind trug vereinzelte Worte zu Sissi herauf. Die Fischer sprachen übers Wetter, den Fang und die kleinen Skandale im Dorf.
»Da ist er«, sagte Helene. Sie zeigte auf einen kleinen Schuppen neben dem Steg.
Herzog Max Joseph saß auf einem Schemel vor der offenen Tür, die Buben standen aufgereiht wie Soldaten vor ihm. Er trug einen langen Wollmantel, aber keinen Hut. Sein Gesicht war rund und gütig, eher das eines Mönchs als eines Feldherrn. Er winkte, als er seine Töchter sah.
Helene winkte zurück. »Er sollte nicht mit ihnen allein sein«, sagte sie. »Das ist zu gefährlich.«
»Ach was.« Sissi sprang über eine Baumwurzel. »Wenn etwas mit ihnen nicht stimmen würde, hätte sich das schon längst gezeigt.«
»Das weißt du nicht.« Helene stieg vorsichtig über die Wurzel. »Niemand weiß es.«
Sissi ging nicht darauf ein. So wie Frau Huber den ganzen Tag den Hof fegte, schienen ihre Schwester und ihre Mutter den ganzen Tag lang nichts anderes zu tun, als sich Sorgen zu machen. Ihr Vater zog sie deswegen oft auf. Zu Recht, wie Sissi fand.
Ein wenig außer Atem blieb sie vor dem Schuppen stehen.
Die Buben begrüßten sie höflich, zogen sich aber nach einer knappen Geste des Herzogs zum Steg zurück. Dort konnten die Fischer auf den Booten sie sehen, also begannen sie zu spielen und zu lachen, als seien sie ganz normale Kinder.
»Was ist geschehen?«, fragte Herzog Max.
Sissi zog das Telegramm aus ihrer Westentasche. »Es stammt von Vetter Roland.«
Ihr Vater nahm es wortlos entgegen und riss das Kuvert mit dem Daumen auf. Er musste die Augen zusammenkneifen, um den Inhalt zu lesen.
Er wird alt, dachte Sissi. Es war ein erschreckender Gedanke.
Nach einem Moment knüllte ihr Vater das Papier zusammen. »Dieser verdammte Narr«, knurrte er leise. Ein seltsamer Unterton schwang in seinen Worten mit.
»Wer?«, fragte Helene. Sie hatte eine Hand auf ihr Herz gelegt, als wolle sie es beruhigen.
»János.«
»Er hat es getan?«
»Er hat es versucht.« Herzog Max fuhr sich mit dem Zeigefinger über den breiten Schnauzbart. »Alles in seinem Leben hat er nur versucht. Zum Husaren taugte er nicht, zum Schneider nicht und zum Attentäter erst recht nicht. Der Kaiser lebt und er? Er ist tot.«
Sissi erinnerte sich an János, einen unauffälligen kleinen Mann, den Vetter Ronald ihrem Vater empfohlen hatte. Er war zweimal mit ihnen auf die Jagd gegangen, nicht in Possenhofen, sondern an einem Ort, an dem sie keiner kannte. Es hatte ihr gefallen, unter falschem Namen zu reisen, als eine Bürgerliche namens Regina. Nach dem zweiten Jagdausflug war János nicht mehr aufgetaucht.
»Ist er gefoltert worden?«, fragte Néné.
Ihr Vater hob die Schultern. »Wahrscheinlich, aber für uns spielt das keine Rolle. Er hat nichts gewusst, was uns gefährlich werden könnte.« Er schüttelte den Kopf und nahm ein Päckchen Streichhölzer aus der Tasche. »Was für ein Dummkopf.«
Sissi sah zu, wie er das Telegramm verbrannte. Sie hielt es nicht für dumm, sich Kaiser Franz-Josef entgegenzustellen. Zu handeln, anstatt die ganze Zeit nur zu reden und Pläne zu schmieden, die vielleicht nie Früchte tragen würden. Wenigstens hatte János versucht, wovon sie alle träumten. In Sissis Augen war er ein Held, wenn auch ein gescheiterter. Doch das sagte sie nicht. Weder ihr Vater noch ihre Schwester hätten ihr zugestimmt.
»Beeinträchtigt das unseren Plan?«, fragte Néné. Sie klang nervös.
»Das werden wir bald erfahren.« Herzog Max ließ das brennende Telegramm fallen und wischte sich die Hände an der Hose ab. Ein Windstoß trieb die Asche auseinander. »Erst einmal machen wir weiter wie bisher.« Er sah Sissi an. »Wonach steht dir heute der Sinn?«
Sie musste nicht lange überlegen. »Die Beidhänder.«
Néné verdrehte die Augen. »Nicht schon wieder.«
Ihr Vater lächelte. »Dann geh sie holen. Und vergiss nicht die Kurzschwerter für die Buben«, rief er Sissi nach, die bereits den Weg hinauflief.
Sie winkte, ohne sich umzudrehen.
KAPITEL ZWEI
Die Existenz als Vampir ist weder erstrebenswert noch in irgendeiner Weise nostalgisch. Vampire sind nicht in der Lage, ihre Existenz zu reflektieren. Ihre Langlebigkeit wirkt auf sie nicht widernatürlich und doch haben sie kein Mitleid mit Wesen, denen weniger Zeit zugestanden wurde. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie erschaffen keine Kunst, sie erfinden nichts. Ihre Existenz dient nur einem einzigen Zweck: sich am Leid anderer zu laben – metaphorisch und buchstäblich. Kann es also etwas Armseligeres auf dieser Welt geben als einen Vampir?
– Die geheime Geschichte der Welt von MJB
»Eine mit Weihwasser bestrichene Klinge? Wie theatralisch.« Sophie verharrte einen Moment in ihrem Sessel, bevor sie sich vorbeugte und auf dem Schachbrett den Läufer setzte.
Karl, der ihr gegenüber auf einem mit Büffelhaar gepolsterten Hocker saß, schnalzte mit der Zunge, so wie er es immer tat, wenn er über etwas nachdachte. Im Hintergrund, irgendwo zwischen schweren Vorhängen, Kissen und Decken, schmatzte jemand vernehmlich.
»Aber es ist natürlich deine eigene Schuld«, fuhr Sophie fort. »Dein Volk mag dich nicht.«
Franz-Josef verschränkte die Hände hinter dem Rücken. Diener hatten ihm zwar einen Sessel an den Tisch gebracht, aber da seine Mutter ihn noch nicht gebeten hatte, sich zu setzen, blieb er stehen. Es waren ihre Gemächer und sie war in solchen Dingen sehr eigen.
Eigentlich, dachte er, ist sie in allen Dingen ziemlich eigen.
»Es ist mir egal, ob mein Volk mich mag«, erklärte er, wohl wissend, wie trotzig das klang, »solange es tut, was ich sage.«
»Ach, Franzl.« Er hasste es, wenn sie ihn so nannte. »Könnte ich doch noch einmal so jung und naiv sein wie du.«
Für Franz-Josef sah Sophie aus wie eine junge Frau. Sie hatte langes schwarzes Haar, das sie stets aufgesteckt trug, und ein ebenmäßiges, schmales Gesicht. Er wusste, wie sehr es sie störte, dass sie auf die Menschen alt wirken musste. Dabei war sie es durchaus – nur wie alt genau, das wusste niemand. Selbst Karl und Ferdinand, die seit dem zweiten Kreuzzug mit ihr zusammen waren, hatte sie das nie verraten.
»Ist es naiv«, fragte er nach einem Moment, »anzunehmen, dass die, die zum Dienen geboren wurden, genau das tun sollten?«
»Sehr naiv«, antwortete Karl an Sophies Stelle. Er wirkte etwas älter als sie; ein großer, eleganter Mann mit angegrauten Schläfen und distinguiertem Auftreten. Für die Menschen war Erzherzog Franz Karl bereits seit Jahren tot.
Karl lehnte sich zurück, ohne eine seiner Schachfiguren zu bewegen. Er spielte oft gegen Sophie, hatte aber noch nie gewonnen. Nach dem Anblick, den das Brett bot, würde sich das auch in dieser Nacht nicht ändern.
»Selbst im Mittelalter«, sagte er, »sind wir immer wieder angegriffen worden. Dabei hatten wir die Inquisition auf unserer Seite.«
Das Schmatzen im Hintergrund verstummte. »Und die Pest«, erklärte jemand aufgekratzt.
Sophies Lächeln war so schmal, dass es aussah, als habe man ihr eine Rasierklinge durchs Gesicht gezogen. »Das waren gute Zeiten.« Zum ersten Mal sah sie Franz-Josef an. Ihre Augen waren fast schwarz. »Nächtelang haben wir getrunken.«
»Sie hat London fast allein entvölkert«, meinte Karl. Es klang liebevoll.
»Na, bravo!«, rief die Stimme zwischen den Kissen.
Das Lächeln verschwand aus Sophies Gesicht. »Warum sagt er das nur immerzu?«, fragte sie leise.
Franz-Josef antwortete nicht. Sie alle kannten den Grund, auch wenn sie nie darüber sprachen. Er räusperte sich. »Ich würde mit Ihnen gern noch länger über alte Zeiten plaudern, aber ich habe ein Reich zu regieren und Revolutionen zu verhindern. Also, wenn weiter nichts anliegt …«
Er wollte sich abwenden, aber Sophie hob die Hand. »Sei nicht albern, Franzl. Natürlich liegt noch etwas an. Setz dich.«
»Wie Sie wünschen.« Sophie bestand darauf, dass er sie siezte, eine weitere Eigenart, für die er keine Erklärung hatte.
»Wir haben ja bereits festgestellt, dass dein Volk dir nicht geneigt ist.«
»Es war ein Attentäter, nicht die Französische Revolution.«
Sie ignorierte seinen Einwand. »Die Menschen spüren, dass du anders bist als sie, auch wenn sie nicht wissen, was du dann sein sollst. Früher einmal hätten sie dieses Gefühl für den Funken des Göttlichen gehalten, der unseren Herrschaftsanspruch legitimiert …«
»Jesus, wie ich das Mittelalter vermisse.« Karl seufzte.
»… doch heutzutage weckt es ihr Misstrauen. Sie wollen, dass ihre Herrschenden so sind wie sie«, fügte Sophie hinzu.
»Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit!«, rief die Stimme aus dem Hintergrund. »Na, bravo!«
Noch jemand, der sich ebenfalls zwischen den Vorhängen aufzuhalten schien, stöhnte.
Sophie schloss kurz die Augen, als müsse sie sich sammeln, dann fuhr sie fort: »Diese Illusion müssen wir erschaffen.«
Franz-Josef breitete die Hände aus. »Und wie? Soll ich mit dem Pöbel im Gasthaus Bier trinken und mit dem Schankmädchen ins Heu gehen?«
»Nein«, erwiderte Sophie ruhig. »Du sollst heiraten.«
»Aha.« Franz-Josef dachte nach. »Ich verstehe nicht, wie mich das beim Volk beliebter machen könnte.«
»Du sollst eine Menschenfrau heiraten.«
»Was?« Franz-Josef sprang auf.
»Ein hübsches kleines Ding, nicht zu klug und noch naiver als du. Dein Volk wird denken: ›Wenn sie ihn liebt, dann muss er besser sein, als ich glaube.‹«
»Sind Sie noch ganz …« Er unterbrach sich. »Sind Sie sicher, dass das eine weise Entscheidung wäre? Es gäbe doch sicherlich Situationen, in denen sie … die Frau … meine Frau …«, schon die Worte schmeckten abscheulich auf seiner Zunge, »… trotz größter Sorgfalt meinerseits bemerken würde, dass etwas … anders ist.«
Karl winkte ab. »Leg dich einfach eine Stunde vor den Kamin, bevor du mit ihr ins Bett gehst, dann merkt sie nichts. Habe ich schon hundertmal gemacht.«
Franz-Josef antwortete nicht. Seine Gedanken schwirrten ihm wie aufgescheuchte Hühner durch den Kopf. Ein hübsches kleines Ding, hatte Sophie gesagt. Aber wie lange würde es so hübsch bleiben? Fünf Jahre, zehn? Dann kämen die Falten, die grauen Haare, der körperliche Verfall und schließlich – viel zu spät – der Tod. Jahrzehntelang, bis zu diesem Moment seiner Erlösung, würde er neben einem Ungeheuer aufwachen, jeden Morgen in die alternde Fratze der Sterblichkeit starren.
Entsetzlich, dachte er.
Hinter ihm wurde das Stöhnen lauter, dann raschelte es.
Franz-Josef drehte sich um. Ein alter Mann mit einem mächtigen Backenbart schob die Vorhänge zur Seite. Blutspuren zogen sich über sein helles Hemd. Mit einer Hand stützte er einen zweiten, in bestickte Seidengewänder gehüllten schlitzäugigen Mann.
»Möchte noch jemand etwas von meinem Chinesen?«, fragte er. »Der Geschmack ist wirklich außerordentlich exotisch.«
Sophie erhob sich. »Nein, Ferdinand«, sagte sie erstaunlich sanft. »Im Moment möchte niemand etwas von deinem Chinesen. Vielleicht später als Nachtmahl.«
»Wie ihr wünscht.« Ferdinand beugte sich zu dem benommen wirkenden Mann hinunter und leckte Blutspritzer von seinem Hals. »Wirklich sehr exotisch.«
Für die Welt war Ferdinand Franz-Josefs Onkel, der aus gesundheitlichen Gründen abgedankt und ihm die Kaiserwürde übertragen hatte. Für einen kleinen Kreis von Eingeweihten jedoch war er einer der ältesten noch existierenden Vampire Europas – und ein Problem.
»Ist sein Kopf schon wieder gewachsen?«, flüsterte Karl.
Franz-Josef nickte. Ferdinands Kopf wirkte riesig auf seinem dünnen, geierartigen Hals. Er wuchs bereits seit Monaten.
Wir altern auch nicht gerade würdevoll, dachte Franz-Josef. Er spürte Sophies bohrenden Blick in seinem Rücken und drehte sich um.
»Und wen soll ich heiraten?«, fragte er resigniert.
KAPITEL DREI
Jahrhundertelang wurden die Kinder Echnatons nicht nur von Vampiren, sondern auch von den wenigen Menschen, die von ihrer Existenz erfuhren, belächelt. Cervantes widmete ihnen sogar die Gestalt des Don Quijote und ließ sie gegen Windmühlenflügel kämpfen. Doch seit der Französischen Revolution und der Befreiung Amerikas lächelt niemand mehr. Nicht der Tod regiert heutzutage in den Königshäusern Europas, sondern die Furcht. Und das ist gut so, denn schon bald werden auch sie fallen und dank der Kinder Echnatons wird im Schatten der Guillotinen eine neue Welt entstehen.
– Die geheime Geschichte der Welt von MJB
»Sissi!«
Sie hörte ihren Namen und sah von dem Beet auf, in dem sie Knoblauch geerntet hatte. Ihre Mutter flötete ihn geradezu, als sei er der Beginn eines Liedes, was bedeutete, dass sich entweder Dienerschaft in Hörweite aufhielt oder Besuch gekommen war.
Trotz der strahlenden Frühlingssonne wirkte das Haupthaus düster und seltsam traurig. Sissi hatte das schon als kleines Kind so empfunden, aber niemand schien ihr Gefühl zu teilen. Nach einer Weile hatte sie aufgehört, davon zu sprechen.
Ihre Mutter, Prinzessin Ludovika Wilhelmine, stand auf einem der Balkone im ersten Stock und winkte ihr zu. In dem Salon, der dahinter lag, wurden hauptsächlich unbekannte Besucher empfangen. Es war also tatsächlich jemand da.
»Kommst du einmal her, Kind?«, rief ihre Mutter.
»Ja, ich wasche mir nur die Hände.« Sissi stand auf. Ihre Beinmuskeln schmerzten. Das Training mit Herzog Max und ihren Geschwistern hatte sie wie immer an die Grenzen der Belastbarkeit geführt. Sie lief auf das Haus zu. Prinzessin Ludovika war eine hervorragende Lügnerin, sogar besser als Néné. Ihre Stimme verriet nicht, ob der Besuch Anlass zu Freude oder Sorge gab.
Sissi tauchte ihre Hände kurz in einen Bottich mit Regenwasser und wischte sie an ihrer Schürze trocken. Dann lief sie die Treppe zur offen stehenden Eingangstür hinauf. »Wer Türen schließt, hat in den Augen der Menschen etwas zu verbergen«, sagte ihr Vater stets. Im Schloss ging es eine weitere Treppe empor, dann betrat sie den Salon. Frau Hubers Tochter Agnes stellte gerade ein Tablett mit Tee und Gebäck auf dem kleinen Tisch in der Mitte des Raums ab. Dahinter saß ein uniformierter, schnauzbärtiger Mann mit buschigen Augenbrauen und Halbglatze. Er erhob sich, als er Sissi sah, und verneigte sich nervös.
»Grüß Gott, Prinzessin Elisabeth«, sagte er.
Auch ihre Mutter stand auf. »Sissi, das ist der Leutnant Kraxmayer von der Gendarmerie in Possenhofen.«
Sissi blieb im Türrahmen stehen und verschränkte die Hände vor ihrer Schürze. »Guten Tag«, erwiderte sie betont schüchtern.
Leutnant Kraxmayer trat einen Schritt auf sie zu. »Sie müssen sich keine Sorgen machen, Prinzessin. Ich möchte nichts von Ihnen.« Er errötete. »Also, natürlich möchte ich nichts von Ihnen. Das wäre ja geradezu ungeheuerlich … und wahrscheinlich verboten.« Er stutzte, als würden ihn seine eigenen Worte verwirren. »Was ich möchte, betrifft also nicht Sie, nicht direkt, sondern vielmehr …«
»Leutnant Kraxmayer möchte dir einige Fragen stellen«, unterbrach ihn ihre Mutter. »Es geht um etwas ganz Grausliches.« Sogar ihre Stimme ließ sie bei diesen Worten zittern.
Sissi beneidete sie um ihre Gabe. »Du machst mir Angst, Mutter«, gab sie ohne jedes Zittern zurück. »Was ist denn geschehen?«
Leutnant Kraxmayer hob die Hand. »Sie müssen sich wirklich nicht ängstigen, Prinzessin. Und wenn Ihnen meine Fragen zu viel werden, breche ich selbstverständlich sofort ab. Vielleicht sollten Sie sich aber setzen. Es geht um etwas wirklich …«, er nahm das Wort ihrer Mutter auf, »… Grausliches.«
Sissi setzte sich auf einen der hohen Eichenstühle, die um den Tisch standen.
Der Leutnant zögerte einen Moment, bevor er fortfuhr. »Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie sich des Öfteren in den Wäldern rund um dieses Anwesen aufhalten. Ist das richtig?«
»Ja.« Sissi hauchte die Antwort. Der Gesichtsausdruck ihrer Mutter war nicht zu deuten.
»In diesen Wäldern wurden in letzter Zeit einige grässlich verstümmelte Rehe und Böcke gefunden.«
»Mein Gott, wie schrecklich!« Sissi schlug sich die Hand vor den Mund.
»In der Tat, Prinzessin.« Leutnant Kraxmayer griff in seinen Uniformrock und zog einen Notizblock mit Bleistift hervor. »Nun möchte ich gern wissen, ob Sie diesbezüglich irgendwelche Beobachtungen gemacht haben.«
Ihre Mutter beugte sich vor. »Sag dem Leutnant alles, was du weißt, Sissi.«
»Aber ich weiß doch nichts!« Sissi begann den Stoff ihrer Schürze zu kneten. »Das Papili und ich gehen manchmal im Wald jagen, und wenn er dann schießt, sehe ich auch tote Tiere, aber sonst nie.« Sie schluckte. »Nur das eine Mal, da habe ich einen Rehbock gesehen, hinten an der alten Köhlerhütte über der Quelle.«
Leutnant Kraxmayer klappte den Notizblock auf. Stumm formulierte er jedes Wort, das er hineinschrieb, mit den Lippen.
»Er lag ganz still am Boden. Ich dachte, er würde schlafen, aber dann sah ich … sah ich …« Sie unterbrach sich.
»Was haben Sie gesehen?«, fragte der Leutnant.
»Na, dass er schon ganz alt war. Er hat geschlafen, aber so, wie der Herrgott einen schlafen lässt, wenn er einen zu sich geholt hat.«
Sie fand, dass sie wie Emilie aus dem Dorf klang, die alle nur die »einfache Emilie« nannten, aber das schien man von ihr zu erwarten. Leutnant Kraxmayer strich alles, was er geschrieben hatte, wieder durch und sah auf.
»Haben Sie vielleicht irgendwelche Anarchisten bemerkt?«
Die Frage warf Sissi aus der Bahn. »Wie?«
»Anarchisten.« Kraxmayer klang ernst. »Sie wissen schon … schwarz gekleidete Männer mit missmutigen Gesichtern, die auf den Kaiser schimpfen.« Er schien ihre Verwirrung zu bemerken. »Wir haben menschliche Fußspuren bei den toten Tieren gefunden. Sie können nur von Anarchisten stammen«, erklärte er. »Wer sonst würde es wagen, sich an Gottes Schöpfung und am Besitz Ihres Vaters zu vergreifen?«
»Ja, wer sonst?« Ihre Mutter nickte. »Schreckliche Leute.«
Kraxmayer wartete immer noch auf eine Antwort.
»Ich habe keine Anchristen gesehen«, sagte Sissi.
»Sind Sie sicher?«
»Ziemlich.« Sie bemerkte ihren knappen Tonfall und schraubte die Stimme gleich etwas höher. »Aber wie sollen wir denn jetzt ruhig schlafen, wenn diese Anchristen ums Haus schleichen?«
»Die Gendarmerie wird Ihr Anwesen Tag und Nacht bewachen lassen, bis die Unholde der Gerechtigkeit zugeführt werden können. Bis dahin möchte ich Sie jedoch bitten, die Wälder zu meiden und jede verdächtige Beobachtung sofort zu melden.«
Ihre Mutter runzelte einmal kurz die Stirn.
»Natürlich nur, wenn es keine Umstände bereitet«, fügte Kraxmayer hastig hinzu. Er stand auf. »Es tut mir leid, dass ich Sie mit etwas so Unangenehmen belästigen musste, Prinzessin…nen. Ich werde mich selbst hinausführen. Auf Wiedersehen.«
Seine Stiefel knallten auf dem alten Holzboden. Er schloss die Tür hinter sich.
Sissi wartete, bis seine Schritte auf der Treppe verhallt waren, dann wandte sie sich an ihre Mutter. »Anchristen?«
Prinzessin Ludovika zwinkerte kurz, als wolle sie etwas anderes sagen, dann seufzte sie nur. »Man sieht, was man sehen will.« Dann beugte sie sich vor. »Aber nun zu dir: Hast du heimlich mit den Streitäxten im Wald geübt?«
»Nein! Ich würde nie unschuldige Tiere töten.«
Der Blick ihrer Mutter blieb hart.
»Gut, das eine Mal«, gestand sie. »Aber davon weißt du eh und mir war wirklich nicht klar, dass Wurfsterne so weit fliegen …« Sie dachte an den Anblick des toten Bocks. »… oder einen Schädel spalten können.«
Prinzessin Ludovika stützte das Kinn in die Hand. Sie war eine anmutige, zierliche Frau und weit strenger als Herzog Max. »Wenn du es nicht warst, dann sollten wir dem Vater Bescheid sagen.«
»Wieso? Wer glaubst du denn, bringt die Tiere um?«
»Ein wilder Vampir?« Herzog Max stand am Kopfende des Esstischs und schnitt Scheiben von einem Brotlaib ab. »Von denen haben wir doch schon seit Jahren keinen mehr gesehen.«
»Was nicht heißt, dass es sie nicht mehr gibt.« Seine Frau Ludovika nahm am anderen Ende des Tischs Platz. Zwischen ihnen saßen links Néné und Sissi, rechts die drei Buben. An diesem Abend war es Sissis Aufgabe, auf sie zu achten – was sie aßen, ob sie aßen, was sie miteinander sprachen und was ihre Blicke aussagten. Zwei von ihnen, Ludwig Wilhelm und Maximilian, schwiegen und hielten den Kopf gesenkt. Nur Karl Theodor war lebhaft. Er rutschte auf seinem Stuhl hin und her und hielt Messer und Gabel so verkrampft in den Fäusten, als könne er das Abendessen kaum erwarten.
»Was ist ein wilder Vampir?«, fragte er. Fantasie und Neugier blitzten in seinen Augen.
Sissi mochte Theodor als Einzigen der Buben. Sie hoffte – und manchmal betete sie sogar –, dass sie ihn nie würde befreien müssen.
»Wilde Vampire«, begann Sissis Vater, »sind Kreaturen, die bei Nacht wüten. Sie unterwerfen sich keinem Herrscher und keinem Recht. Man muss sie erschlagen wie räudige Hunde, sonst morden sie weiter bis ans Ende aller Tage.«
Theodor begann mit den Beinen zu schlenkern. Der Stuhl, auf dem er saß, war viel zu hoch für ihn. »Aber wenn man sie erschlägt«, sagte er mit seiner hellen Kinderstimme, »dann stehen sie doch nur wieder auf. Pfählt man sie nicht besser oder schlägt ihnen den Kopf ab?«
Herzog Max lächelte. »Du hast gut aufgepasst.« Kurz glitt sein Blick zu den anderen, teilnahmslos dasitzenden Buben. »Aber ich bin sicher, deine Brüder hätten das auch gewusst, nicht wahr?«
Einen Moment lang herrschte erwartungsvolle Stille am Tisch. Sissi tastete nach dem kleinen Holzpflock, den sie stets in einer Lederschlaufe am Oberschenkel trug.
»Ja, Vater«, antworteten die beiden Buben schließlich.
Sissi legte ihre Hand wieder auf den Tisch. Sie spürte, wie die Spannung, die sich so plötzlich in dem großen Esszimmer aufgebaut hatte, verflog.
Ihr Vater lächelte. »Dann waren die Lehrstunden ja nicht vergebens«, sagte er, bevor er das fertig geschnittene Brot in einen Korb legte und in die Mitte des Tischs stellte. Nacheinander griffen alle zu, die Buben als Letzte. Theodor schaufelte mit einem großen Löffel Fleischsalat auf seinen Teller. Er wollte gerade Butter auf seine Brotscheibe schmieren, als Prinzessin Ludovika ihn aufhielt.
»Hast du nicht etwas vergessen, Theodor?«, fragte sie.
Er hielt inne und nickte. »Verzeih, Mutter. Ich war ungeduldig.«
»Dann hoffe ich, dass dein Gedächtnis ausgeprägter ist als deine Geduld. Du hast heute Abend die Ehre, das Tischgebet zu sprechen.«
Aus den Augenwinkeln sah Sissi die Erleichterung auf Nénés Gesicht, die sie selbst verspürte. Rasch ergriff sie die Hand ihrer Schwester und die ihrer Mutter. Herzog Max und die Buben schlossen den Kreis.
Theodor schluckte, räusperte sich, öffnete den Mund und schloss ihn wieder.
»Du musst keine Angst haben«, sagte Sissi. »Wir alle wissen, wie schwer das ist.«
Er sah sie an, schluckte und setzte erneut an. Zögernd begann er zu sprechen. Es waren seltsame, fremde Laute, die aus seiner Kehle und aus dem Dunkel der Zeit emporstiegen. Sissi schloss die Augen und lauschte ihnen. Sie liebte es, sie zu hören, und hasste es, sie auszusprechen. Das Gebet, wenn es denn eines war, erfüllte sie mit Hoffnung und Zuversicht und schien etwas in ihr zu wecken, was sonst verborgen blieb. Es schenkte ihr Ruhe und die Gewissheit, dass Tausende vor ihr ihm gelauscht hatten – in Hütten und Burgen, in Zelten und Palästen, auf Schlachtfeldern und im Angesicht unvorstellbar grausamer Macht. Doch es existierte immer noch, war weitergereicht worden über Generationen, von Vätern an Söhne, von Müttern an Töchter. Das Böse hatte ihm nichts anhaben können.
Bis vor Kurzem hatte man geglaubt, es stamme aus dem alten Ägypten, doch die Gelehrten unter ihnen, die sich mit dem Gebet beschäftigten, zweifelten mittlerweile daran, hielten es für älter, vielleicht so alt wie die Sprache selbst. Sissi lief ein Schauer über den Rücken, wenn sie daran dachte.
»Fertig.«
Theodor riss sie aus ihren Gedanken. Sie öffnete die Augen und griff nach ihrer Gabel.
»Das hast du gut gemacht«, sagte sie. »Ich habe keinen einzigen Fehler gehört.«
»Was nur daran liegt«, mischte sich ihre Mutter ein, »dass du es auch noch nie fehlerfrei aufgesagt hast. Aber du hast es wirklich gut gemacht, Theodor, wenn auch nicht so gut, wie Sissi glaubt.«
»Danke, Mutter. Darf ich jetzt essen?«
»Soviel du willst.«
Sissi sah, wie Theodor begann, sein Brot zu schmieren. Die Worte ihrer Mutter taten ihr nicht weh, denn sie stimmten. Néné war das einzige Kind am Tisch, das nie einen Fehler machte, wenn es das Gebet aufsagen musste.
Sie griff nach dem Brotkorb und sah ihren Vater an. »Wann werden wir uns um den wilden Vampir kümmern?«, fragte sie.
Er stellte den Bierkrug ab, aus dem er gerade getrunken hatte, und unterdrückte einen Rülpser. »Ich habe noch nicht entschieden, ob wir uns überhaupt um ihn kümmern, wenn es ihn denn gibt.«
»Aber wir können ihn doch nicht weiter die Tiere umbringen lassen.« Néné verdrehte die Augen, aber Sissi beachtete sie nicht. »Es ist unsere Pflicht, etwas gegen ihn zu unternehmen.«
Max stützte das Kinn in seine Handfläche. Mit der Gabel zeichnete er Muster in den Fleischsalat auf seinem Teller. »Du vergisst, dass es auf unserem Land von Gendarmen nur so wimmelt«, sagte er. »Sie könnten uns mit Anarchisten verwechseln.«
»Aber das wäre doch eine gute Übung für uns.« Sissi ließ nicht locker. Sie sah ihm an, dass er nur nach Ausreden suchte, um ihre Mutter zufriedenzustellen. Sie saß am anderen Tischende und hatte die Arme vor der Brust verschränkt. Ungeduldig trommelte sie mit den Fingern auf ihren Oberarm.
»Wir könnten nicht bei Tag auf die Suche gehen«, fuhr ihr Vater fort. »Da gräbt sich der Vampir irgendwo ein und wir würden ihn nie finden. Also müsste es nachts sein, wenn er stark und wach und gefährlich ist.«
»Umso besser.« Sissi stützte ihre Ellbogen auf den Tisch und beugte sich vor. »Alles, was du uns beigebracht hast, wird …«
»Manieren, bitte!«, unterbrach ihre Mutter sie.
Sissi nahm die Ellbogen vom Tisch.
»Sissi hat recht«, sagte Néné unerwartet. »Wie sollen wir uns auf das Große Erwachen vorbereiten, wenn wir keine Gelegenheit bekommen, unsere Fähigkeiten auszuprobieren?«
Ihr Vater antwortete nicht, sondern sah seine Frau an. Sie schienen eine lautlose Unterhaltung zu führen, die mit seinem Nicken endete.
»Also gut«, sagte er. »Heute Nacht.«
Sissi grinste. Néné klatschte aufgeregt in die Hände und sprang auf. »Ich ziehe mich nur eben um, dann …«
Prinzessin Ludovika ließ sie nicht ausreden. »Nicht du, Néné, nur dein Vater und Sissi. Für dich ist das zu gefährlich.« Sie hob die Hand, als Néné widersprechen wollte. »Du bist zu etwas Höherem berufen als wir alle, das weißt du doch. Für dieses Privileg musst du Opfer bringen und dazu zählt auch, dass du nicht jeden x-beliebigen Vampir verfolgst und dein Leben riskierst.«
»Ich will aber nicht länger unter einer Käseglocke leben.« Néné verschränkte die Arme vor der Brust. Sissi hatte noch nie erlebt, dass sie sich gegen ihre Mutter auflehnte. »Ich will frei sein wie Sissi.«
»Das wird nie geschehen.« Prinzessin Ludovikas Stimme klang schneidend, fast schon brutal. »Und nun setz dich wieder und iss weiter.«
Néné zögerte. Erst als Sissi unauffällig an ihrem Rock zupfte, ließ sie sich auf ihren Stuhl fallen, die Arme weiterhin vor der Brust verschränkt. Ihre Lippen zitterten. Tränen standen in ihren Augen.
Ihre Mutter schien die harten Worte bereits zu bereuen, denn sie beugte sich vor und sagte sanfter: »Ihr dürft nie vergessen, dass ich euch beide mehr liebe als alles andere.«
Sissi sah, wie Theodor den Blick senkte. Die beiden anderen Buben spielten lustlos mit ihrem Essen, so als bekämen sie nichts von der Unterhaltung mit.
»Ich liebe euch beide gleichermaßen, aber ihr seid nicht gleich. Sissi kann Dinge, die du, Néné, nicht kannst und umgekehrt. Ihr müsst euch in dieses Schicksal fügen, sonst werdet ihr Unglück über euch und uns bringen. Versteht ihr das?«
»Ja, Mutter«, sagte Sissi.
Néné nickte einen Lidschlag später.
Schweigend aßen sie weiter, doch Sissi schmeckte es nicht. Ihr ganzes Leben hatte Néné gelernt, eine Dame zu sein, der Position gerecht zu werden, die sie eines Tages – wenn auch nur kurz – einnehmen würde. Sie sprach sechs Sprachen fließend, beherrschte das komplizierte Spanische Hofzeremoniell besser als … Sissi dachte einen Moment nach … als die Spanier, nahm sie an. Sie spielte vier Instrumente, konnte singen, tanzen und sticken. Und sie wusste, wie man einen Vampir aus nächster Nähe tötete. Niemand beherrschte den Pflock besser als sie. Néné hatte gelernt, zu gehorchen, zu gefallen und zu töten.
Aber was, wenn es nicht dazu kam?, fragte sich Sissi, als sie das letzte Stück Brot in den Mund schob. Was, wenn der Kaiser eine andere erwählte? Was, wenn der Plan fehlschlug?
Sissi hoffte, dass sie die Antwort auf diese Fragen nie erfahren würde. Sie gönnte Néné den Ruhm, den sie ernten würde, wenn sie der Monarchie den größten Schlag seit der Französischen Revolution zufügte.
Bitte lasst es geschehen, ihr alten Götter, dachte sie. Gewährt Néné diesen Triumph, bevor ihr sie zu euch holt.
KAPITEL VIER
Wer das Privileg genießt, in eine Familie der Kinder Echnatons hineingeboren zu werden, erfährt die Welt so, wie sie wirklich ist. Schon in frühester Kindheit wird die Rolle bestimmt, die er – oder sie – in diesem endlos erscheinenden Krieg spielen wird. Es werden Soldaten gebraucht und Offiziere, Schriftgelehrte und Wissenschaftler, Spione und Bankiers. Und dann wieder gibt es solche, deren Hingabe und Gehorsam so außergewöhnlich sind, dass man ihnen das größte Opfer abverlangen muss. Diese Wenigen werden im Tod zu einer Fackel der Freiheit, deren Licht alle anderen voller Demut folgen.
– Die geheime Geschichte der Welt von MJB
Der Wald war dunkel und kühl, der Himmel schwarz. Es nieselte, aber Sissi ließ die Kapuze ihres Umhangs auf dem Rücken liegen. Sie musste beweglich bleiben und den Überblick behalten, so gut das in der Dunkelheit möglich war. Der Vampir würde sie entdecken, lange bevor sie ihn sahen, wenn es ihn denn gab.
Sie spürte eine kurze Berührung an ihrem Arm und blieb stehen. Ihr Vater zeigte nach vorn. Sissi folgte seinem Blick und entdeckte eine Gestalt, die an einem Baumstamm lehnte. Der Mann hatte sich in seinen Umhang gewickelt und hielt seine Muskete locker in der Armbeuge. Es war einer der Gendarmen, die Leutnant Kraxmayer abgestellt hatte, um nach Anarchisten zu suchen.
Sissi nickte kurz, um ihrem Vater zu zeigen, dass sie die Warnung verstanden hatte, dann wandte sie sich nach links. Der Druck auf ihrem Arm ließ nicht nach. Mit dem Kinn deutete Herzog Max auf den schmalen Weg, der hinter dem Baumstamm tiefer in den Wald hineinführte.
Zeig mir, was du gelernt hast, sagte seine Geste.
Sissi hob die Augenbrauen, zögerte jedoch nicht. Sie fasste die Streitaxt fester und lief geduckt weiter. Die Klinge hatte sie, ebenso wie ihr Gesicht, mit Ruß und Fett eingerieben, sodass sie mit der Dunkelheit verschmolz. Aus dem Augenwinkel sah Sissi, wie ihr Vater zurückblieb. Die Begegnung mit dem Gendarmen war eine Prüfung, die nur sie zu bestehen hatte.
Sissi ging auf den Mann zu. Durch ihre weichen Stiefelsohlen fühlte sie den Waldboden unter sich. Kein Zweig entging ihr und kein Stein. Sie tastete sich voran, ohne den Gendarmen aus den Augen zu lassen. Er wirkte wachsam und angespannt. Immer wieder drehte er den Kopf, mal nach links, mal nach rechts. Es lag ein gewisser Rhythmus in dieser Bewegung, der Sissi an das Pendel einer Uhr erinnerte. Sie passte ihre Schritte an, verharrte jedes Mal, wenn sein Kopf zurückschwang. Schließlich war sie ihm so nahe, dass sie seine Schulter hätte berühren können. Er wandte ihr den Rücken zu, der zum Teil von dem Baumstamm verdeckt wurde, an dem er lehnte.
Sissi warf einen Blick zurück, aber das rußgeschwärzte Gesicht ihres Vaters war in der Dunkelheit nicht zu erkennen. Trotzdem war sie sicher, dass er sie sehen konnte.
Sie blieb hinter dem Soldaten stehen, bückte sich und hob ein Eichenblatt auf. Es war nass, aber nicht zu schwer für ihre Zwecke. Langsam näherte sich ihre Hand dem Kopf des Mannes. Er trug keine Mütze. Der Baum schützte ihn vor dem Regen. Sissi nahm das Blatt zwischen Zeigefinger und Daumen und legte es ihm so vorsichtig auf den Kopf, als könne es bei der kleinsten Unachtsamkeit explodieren. Sie hielt inne, als es seine schütteren Haare berührte, aber er drehte seinen Kopf ungerührt weiter von rechts nach links und wieder zurück. Sie ließ das Blatt los. Es kam auf seinem Kopf zur Ruhe.
Zufrieden trat Sissi einen Schritt zurück, streckte dem Hinterkopf des Gendarmen die Zunge heraus und ging weiter lautlos den Weg entlang. Nicht einmal der Rhythmus seines Atems veränderte sich. Er hatte sie nicht bemerkt.
Erst als der Weg einen kleinen Trampelpfad kreuzte, blieb Sissi stehen, um auf ihren Vater zu warten. Er würde einen Umweg gehen. Beweisen musste er nichts mehr. Trotzdem war sie überrascht, als sie plötzlich seinen Atem im Nacken spürte.
»Das war unnötig und dumm«, sagte er leise.
Sissi drehte sich um. »Es war unnötig und dumm, mich zu ihm zu schicken.«
Sie hätte es nie gewagt, in dieser Weise mit ihrer Mutter zu sprechen, aber zu ihrem Vater hatte sie ein innigeres Verhältnis, in dem sie sich beinah gleichberechtigt vorkam.
Er seufzte. »Deine Fähigkeiten einer Prüfung zu unterziehen, ist weder das eine noch das andere. Damit anzugeben, schon.«
Sie hob die Schultern, die einzige Antwort, die ihr darauf einfiel.
Ihr Vater nahm seinen Lederrucksack von den Schultern, schnürte ihn auf und zog eine unterarmlange quadratische Holzschatulle heraus. Es gab kein Schloss daran, nur eine Reihe ineinandergreifende Holzplättchen, die man über den Deckel der Schatulle schieben musste, bis sie ein kompliziertes Muster bildeten. Ihr Vater beherrschte es längst, ohne hinsehen zu müssen. Sissi dagegen fiel es immer noch so schwer wie das Gebet.
Ein leises Klicken ertönte.
Als Kind hatte Sissi geglaubt, das Ding, das im Innern der Schatulle lag, sei lebendig. Sie hatte ihm sogar einen Unterteller mit Milch hingestellt. Mittlerweile wusste sie, dass es nicht lebte. Nichts, was weder fraß noch trank, konnte lebendig sein. Nur was das Ding war, wusste sie nicht. Niemand wusste es. Aber es war ihnen allen klar, was es tat: Es fand Vampire.
Herzog Max klappte die Schatulle auf. Das Ding schmatzte und seufzte. Es hatte keinen Namen. Man nannte es nur das Ding.
Sissi wandte den Blick ab, als es sich zu entrollen begann. Manchmal glaubte sie, es sei ein Wurm, dann wieder wirkte es wie ein Oktopus mit ineinander verschlungenen grauen Tentakeln. Ihr wurde übel, wenn sie es zu lange ansah.
Auch ihr Vater wandte sich von der Schatulle ab, während er sie mit einer Hand von seinem Körper weghielt und sorgsam darauf achtete, das Ding darin nicht zu berühren.
Sissi glaubte, noch einmal die Ohrfeige zu spüren, die ihr Vater ihr versetzt hatte, als sie vor langer Zeit nach dem Ding gegriffen hatte. »Du fasst das nicht an!«, hatte er geschrien. »Fass es niemals an!« Es war die einzige Ohrfeige ihres Lebens gewesen. Vielleicht brannte sie deshalb immer noch.
Sissi folgte ihrem Vater den schmaler werdenden Pfad hinunter. Sie wusste, dass er ins Tal hinein und dann am Bachlauf entlang bis zur Quelle führte. Jäger benutzten ihn oft, um das Wild beim Trinken zu überraschen. Manchmal gelang es Sissi, ihnen zuvorzukommen und die Rehe und Böcke von der Quelle zu vertreiben. Ihr Vater wusste nichts davon. Es war ihr Geheimnis.
Herzog Max blieb so unerwartet stehen, dass Sissi beinah mit ihm zusammengeprallt wäre.
»Spürst du es?«, fragte er leise.
»Ja.« Es war, als säße man in einem Zimmer, dessen Fenster nicht ganz geschlossen waren. Ein unbestimmbares Ziehen im Nacken, eine leichte Brise, die ihren Blick nach rechts zog, immer wieder, selbst wenn sie versuchte, nicht hinzusehen.
Das Ding war fündig geworden.
»Also gibt es einen Vampir«, flüsterte Sissi. Das Brot vom Abendessen lag ihr plötzlich schwer im Magen wie ein Stein.
»Hier entlang.« Ihr Vater blieb auf dem Pfad, der nach rechts abknickte. Sie überließ ihm die Führung, versuchte nicht, die Zeichen selbst zu deuten. Es war leicht, sie zu spüren, doch sie zu verstehen, bedurfte jahrelanger Erfahrung.
»Wie weit entfernt ist er?«, fragte Sissi.
Ihr Vater antwortete, ohne sich umzudrehen. »Nicht weit.«
Sissi umklammerte den Griff ihrer Streitaxt so fest, dass ihre Knöchel schmerzten. Mit den Fingern der anderen tastete sie nach den drei Pflöcken in ihrem Gürtel. Die Waffen erschienen ihr auf einmal lächerlich, so als würde sie mit einer Armee aus Zinnsoldaten in den Krieg ziehen.
Wie konnte sie es wagen, sich einer jahrhundertealten Kreatur zu stellen, einem Wesen, das Kriege und Verfolgungen, Pestilenz und Hunger überstanden hatte und ihr so überlegen war wie … Vergeblich suchte sie nach einem Vergleich. Er war ein Vampir, sie ein fünfzehnjähriges Mädchen. Sie konnte nichts gegen ihn ausrichten. Es war besser, die Axt fallen zu lassen und zu rennen, so lange zu rennen, bis sie das Anwesen erreichte und sich unter dem Bett verstecken konnte.
Sissi begann zu zittern.
»Er ist in deinem Kopf«, hörte sie ihren Vater durch einen Nebel aus Selbstzweifeln und Angst sagen. »Lass nicht zu, dass er mit dir spielt.«
»Woher weißt du das?«
»Weil er auch in meinem ist.« Die Stimme ihres Vaters klang angestrengt. »Er sagt mir, dass ich mich dafür schämen sollte, meine Tochter in den Tod zu schicken. Er ist recht … überzeugend.«
Sissi kämpfte gegen die Worte in ihrem Kopf. Sie waren so stark, so ehrlich wie ihre eigenen Gedanken.
»Mir kann er nichts anhaben«, sagte sie mit einer Leichtigkeit, die sie nicht spürte. Die Zweifel hämmerten auf sie ein.
»Hörst du?«, schrie sie, ohne es zu wollen. »Du kannst mir nichts anhaben. Deinen Kopf schlag ich dir ab! Du bist ein Nichts, du … du … widerlicher stinkender Anarchist!«
Ihre Worte hallten von den Bergen wider. Irgendwo schrie ein Nachtvogel. Ihr Vater drehte sich zu ihr um. Trotz der Dunkelheit glaubte Sissi zu sehen, wie er eine Augenbraue hob.
Sie zuckte mit den Schultern. »Er weiß doch sowieso, wo wir sind«, sagte sie.
»Jetzt weiß er es in jedem Fall.« Ihr Vater klappte die Schatulle zu.
Und dann hörte Sissi ihn – nicht mehr nur in ihren Gedanken, sondern im dichten Unterholz links von ihr. Äste knackten, Zweige brachen, ein Reh sprang auf den Weg und verschwand mit weiten, beinah schwerelos wirkenden Sätzen in der Dunkelheit.
Hinter ihm trat der Vampir aus den Sträuchern. Sissi stieg die Schamesröte ins Gesicht, als sie sah, dass er nackt war. Dreck und Tannennadeln bedeckten seine bleiche Haut. Sein Haar war lang, schmutzig und verfilzt. Noch nie in ihrem Leben hatte sie einen nackten Mann gesehen, noch nicht einmal die Buben hatte sie als Kleinkinder gebadet. Ihre Mutter hatte es vorgezogen, sie von »solch vulgären Dingen«, wie sie das nannte, fernzuhalten.
Der Vampir stemmte die Hände in die Hüften. Seine Fingernägel waren so lang, dass sie fast bis zu seinen Knien reichten.
»Gefällt dir, was du siehst?«, fragte er. Seine Stimme klang heiser und rau, als benutze er sie nur selten. Aus gelben Raubtieraugen musterte er Sissi. Sein Grinsen enthüllte scharfe, blutverkrustete Eckzähne. Herzog Max beachtete er nach einem kurzen Blick nicht weiter, als sei ihm klar, dass er nur die Tochter töten musste, um auch den Vater zu vernichten.
Sissi zwang sich zur Ruhe. Sie wusste nicht, was sie mehr verstörte, einem Vampir gegenüberzustehen oder einem nackten Mann.
»Haben Sie denn keinen Funken Anstand im Leib?«, fragte sie, so wie es ihre Mutter getan hätte. Das gab ihr Sicherheit. »Wie können Sie es wagen, eine Prinzessin zu duzen?«