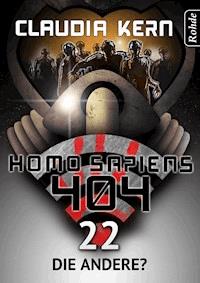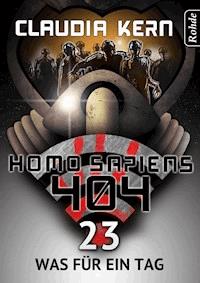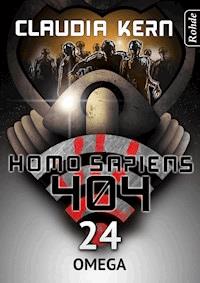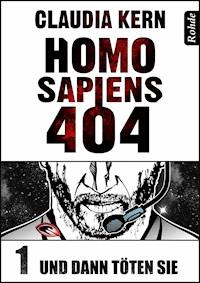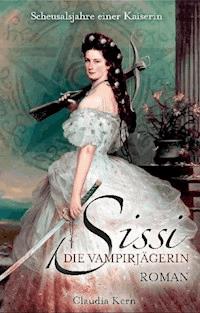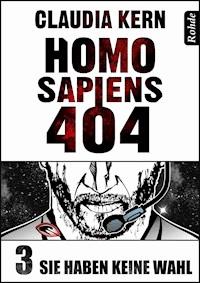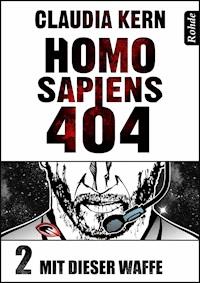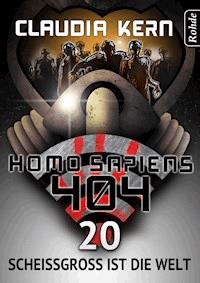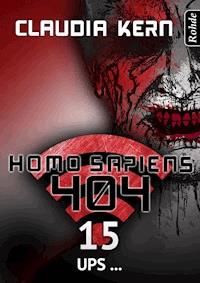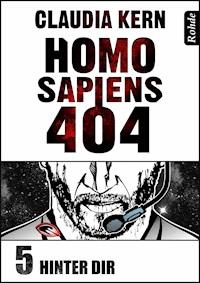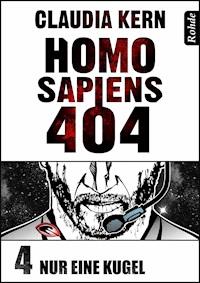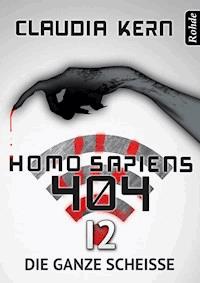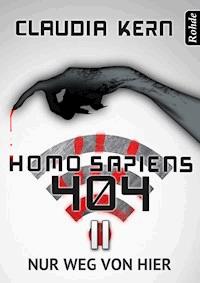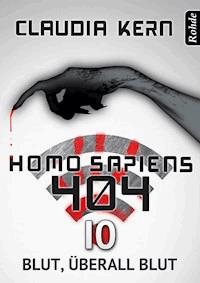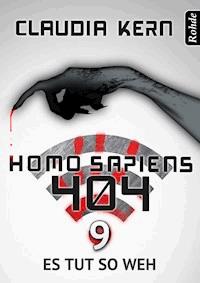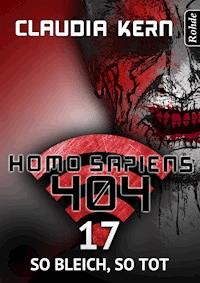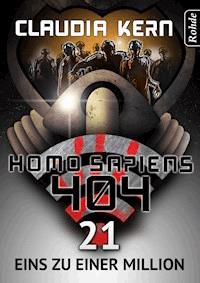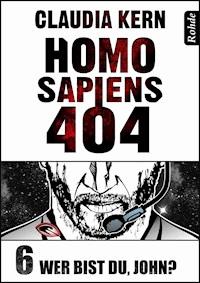
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rohde, Markus
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Homo Sapiens 404
- Sprache: Deutsch
Dies ist die sechste Episode der Romanserie "Homo Sapiens 404". Seit Wochen bereits versucht Kipling, mehr über John herauszufinden. Als ihm unerwartet jemand Informationen anbietet, scheint er seinem Ziel endlich nahe zu sein, doch dann erfährt John davon, und Kipling muss sich fragen, wie weit er gehen wird, um seine Identität geheim zu halten. Über die Serie: Einige Jahrzehnte in der Zukunft: Dank außerirdischer Technologie hat die Menschheit den Sprung zu den Sternen geschafft und das Sonnensystem kolonisiert. Doch die Reise endet in einer Katastrophe. Auf der Erde bricht ein Virus aus, der Menschen in mordgierige Zombies verwandelt. Daraufhin riegeln die Außerirdischen das Sonnensystem ab und überlassen die Menschen dort ihrem Schicksal. Die, die entkommen konnten, werden zu Nomaden in einem ihnen fremden Universum, verachtet und gedemütigt von den Außerirdischen, ohne Ziel, ohne Hoffnung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 99
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Band 6
Wer bist du, John?
Claudia Kern
Digitale Originalausgabe
Homo Sapiens 404 wird herausgegeben vom Rohde Verlag
Rohde Verlag, Auf der Heide 43, 53757 Sankt Augustin
Verleger & Redaktion: Markus Rohde
Autorin: Claudia Kern
Lektorat: Susanne Picard
Covermotiv & –gestaltung: Sebastian Lorenz
Copyright © 2013 by Rohde Verlag
ISBN 978-3-95662-006-5
www.claudia-kern.com
www.helden-in-serie.de
www.rohde-verlag.de
»Es gibt zwei Gründe, aus denen Menschen kämpfen: Weil sie etwas beschützen wollen (Independence Day I und II) oder weil sie nichts mehr zu verlieren haben (Spartacus I und II 3D). Wir haben im Sonnensystem gekämpft, um unsere Familien zu beschützen und unsere Welt zu retten. Das ist gescheitert. Noch lecken wir unsere Wunden wie ein Actionheld nach dem ersten verlorenen Kampf gegen den Bösen, aber schon bald, da bin ich mir sicher, werden wir uns umsehen und erkennen, dass wir nichts mehr zu verlieren haben. Dann werden wir einen Spartacus brauchen, jemanden, der uns aufrichtet und uns die Waffen für diesen neuen Kampf in die Hand gibt. Ich frage mich, woraus sie bestehen werden … aus Stahl, aus Feuer, aus Worten oder aus Bytes?«
– Nerdprediger Dan, ASCII-Zeichen für die Ewigkeit
Prolog
4815162342: ›Und?‹
DetroitKid: ›Sieht gut aus.‹
4815162342: ›Du bist drin?‹
DetroitKid: ›Ich richte schon einen Porn-Server ein.‹
4815162342: ›LOL‹
4815162342: ›Lass das.‹
DetroitKid: ›War’n Witz.‹
4815162342: ›Okay. Sorry.‹
4815162342: ›Meinst du, das Tool kann so raus?‹
DetroitKid: ›Hm. Wenn die Noobs das auch kapieren sollen, brauchst du ne nette GUI.‹
4815162342: ›Benutzeroberflächen sind nicht so mein Ding.‹
DetroitKid: ›Soll ich dir eine bauen?‹
4815162342: ›$$?‹
DetroitKid: ›Nee, 4 free. Du machst da was Geiles. Ist mir eine Ehre, dabei sein zu dürfen. Ich meld mich, wenn ich was hab, ok?‹
4815162342: ›Danke! Sag mal, und du musst nicht antworten, wenn du nicht willst, aber bist du ein Mensch oder ein Jockey?‹
DetroitKid: ›Ich bin ein Nerd.‹
DetroitKid: ›:)‹
Kipling lächelte und loggte sich aus. Tasha lachte ihn von einem Foto in der rechten oberen Ecke seines Displays an. Darunter befand sich ein Ordner mit all dem Code, den er für das Programm geschrieben hatte. Er hatte es ›Tasha’s Tool‹ genannt und schon bald würde die ganze Galaxis diesen Namen kennen.
Niemand wird dich je vergessen, dachte Kipling und löschte das Licht.
1
Ama’Ru löste ihren Blick von der Mündung der Pistole und sah Auckland an. Er war blass. Der Schmerz grub tiefe Linien in sein Gesicht. Die verletzte linke Hand drückte er gegen seine Brust. Dort, wo sich sein Ringfinger befunden hatte, war der Verband bereits durchgeblutet.
»Ich hatte mich gefragt, wann du kommen würdest«, sagte Ama’Ru. Sie spürte die Unruhe der Anderen und strich über ihren Hals.
»Du hast gewusst, dass ich es bin?«, fragte Auckland. Er stand vollkommen still, die Mündung seiner Pistole auf Ama’Rus Kopf gerichtet.
»Ich war mir sicher, dass es jemand auf diesem Schiff sein musste, deshalb habe ich auch–« Sie erschrak. Beinahe hätte sie seinen Namen verraten. Der Anblick der Pistolenmündung machte sie wohl doch nervöse als sie gedacht hatte. »… einen Freund gewarnt.«
»Der den Skorpion schickte.«
»Ja. Ich wollte nicht, dass jemand verletzt wird, ich wollte nur überleben.«
»Wie wir alle.« Schweiß bildete sich auf Aucklands Stirn. Für einen Menschen musste es in der Kabine mit ihren fast fünfzig Grad Celsius unerträglich heiß sein. Sie fragte sich, ob sie das Gespräch so lange dehnen konnte, bis Hitze und Blutverlust Auckland niederzwingen würden. Vielleicht war das ihre einzige Chance.
»Der Skorpion hätte euch umbringen können, John. Das weißt du. Mein Freund muss ihm sehr klare Anweisungen gegeben haben, nur den Richtigen zu töten.«
»Was wird dein Freund tun, wenn er nicht zurückkommt?«
»Ich weiß es nicht.«
Auckland blinzelte sich den Schweiß aus den Augen. »Hat dein Freund auch einen Namen?«
»Ich werde ihn dir nicht sagen, wenn du das meinst.« Sie spürte, dass er das Interesse an der Unterhaltung verlor. Seine Schultern strafften sich, so als wolle er die Entscheidung, die er vor Betreten der Kabine getroffen hatte, nun endlich umsetzen. Die Andere spürte das ebenfalls. Sie spannte ihre Hinterbeine an, aber Ama’Ru zwang sie zur Ruhe.
»Du hast übrigens keinen Namen bei uns«, sagte sie, damit die Stille sich nicht in die Länge zog.
Er schien nicht zu verstehen, was sie meinte, also fügte sie hinzu: »Ihr gebt euren Mördern doch gerne Beinamen, oder? Todesengel? Schlächter? So etwas in der Art? Wir machen so etwas nicht.«
»Ich bin kein Mörder.« Zum ersten Mal hörte sie Emotionen in seiner Stimme. Er war verärgert.
»Du tötest, also bist du ein Mörder. Wie viele sind es schon? Acht?«
»Elf, inklusive Onas’Ramun.«
Elf. Sie versuchte, ihr Entsetzen zu verbergen. »Dann haben wir wohl drei noch nicht gefunden.«
»Das werdet ihr auch nicht.« Er sagte das ohne Stolz. Ein Schweißtropfen lief über sein Gesicht und verschwand im Kragen seiner blutverschmierten Uniformjacke. »Ich verstehe euch nicht. Ihr wisst, dass ich hier draußen bin, aber ihr passt trotzdem nicht auf eure Leute auf.«
»Niemand weiß, wer deine Ziele sind.«
Auckland schüttelte den Kopf. »Deshalb hast du dich auch auf einer Station mitten im Nichts versteckt. Die führende Expertin für menschliche Genetik als Ärztin in einem Slum.«
»Ich wollte den Menschen fort helfen«, sagte sie. Es war nur zum Teil gelogen.
»Du wolltest dir selbst helfen. Du wusstest, dass ich früher oder später nach dir suchen würde.« Sein Blick glitt über ihr Gesicht. »Und nun habe ich dich gefunden.«
Sie hörte die Endgültigkeit in seinen Worten. »Warte. Erkläre mir zuerst, warum–«
»Tue das nicht. Du machst es nur schlimmer für dich und für sie.« Er deutete mit dem Kinn auf die Andere.
Er hatte recht. Die Andere litt. Ama’Ru befürchtete, dass es ihre Angst war, die sie so würdelos um ihre Existenz betteln ließ. Sie streichelte den Kopf des Wesens, das sie ein Leben lang begleitet hatte und traf dann ihre eigene Entscheidung. Kein Betteln mehr, kein Feilschen. Sie war Hhalim. Sie würde den Tod mit der gleichen Akzeptanz begegnen wie dem Leben. »Töte sie zuerst, bitte.«
Auckland nickte. Er richtete die Pistole auf den Kopf der Anderen. Sie wollte ihre Scheren heben, um sich zu schützen, aber Ama’Ru zwang sie, so sanft es ging, ruhig stehen zu bleiben.
»Es wird nicht weh tun«, flüsterte sie.
Auckland atmete langsam aus. Ama’Ru sah Mitleid in seinen Augen, aber keine Zweifel. Er würde schießen, egal, was sie tat, egal, was sie sagte.
Sie schloss die Augen.
Brrr-Brrr.
Sie hörte das Brummen über ihren lauten, pochenden Herzschlag. Es war ein Geräusch, das ihr vertraut war, das Vibrieren eines Pads.
Ama’Ru öffnete die Augen. »Deins oder meins?«
Erst als die Frage heraus war, erkannte Ama’Ru, wie absurd sie klang.
»Meins«, sagte Auckland. Als er sich nicht bewegte, erkannte sie das Dilemma, in dem er sich befand. Mit der verletzten Hand konnte er das Pad nicht aus der Hosentasche ziehen, doch in der anderen hielt er die Pistole. Sie wegzustecken, während sich die Scheren der Anderen keine zwei Meter von ihm entfernt öffneten und schlossen, war unmöglich, aber Ama’Ru glaubte auch nicht, dass er schießen und dann seine Nachricht abrufen würde. So kaltschnäuzig war er nicht.
»Es tut mir leid«, sagte er. »Das hätte nicht passieren dürfen.«
Mit dem linken Ellenbogen drückte er den Türöffner. Rückwärts verließ er die Kabine, die Mündung weiterhin auf die Andere gerichtet. Die Tür schloss sich. Wenige Sekunden später, hörte Ama’Ru ihn »Hallo?« sagen.
Keine Nachricht also, ein Anruf. Das war ungewöhnlich. Wegen der Verschwendung von Bandbreite galt es als unhöflich, jemanden anzurufen.
Die Andere richtete sich auf. »Gut so«, flüsterte Ama’Ru. Sie hatte ihrem Tod mit Fatalismus entgegengeblickt, aber nun sprang die Hoffnung der Anderen auf sie über und erfüllte sie mit prickelndem, wilden Lebenswillen.
»Er will uns töten? Dann soll er kämpfen.«
Sie hörte Aucklands Stimme. Er schien sich von ihr zu entfernen, denn sie wurde leiser. Ama’Ru konnte nicht verstehen, was er sagte.
Die Andere spannte die Hinterläufe an und öffnete beide Zangen. Ama’Ru hielt sich mit den Händen an ihren Schulterblättern fest. Eine Ewigkeit schien zu vergehen, bis sie endlich wieder Aucklands Schritte hörte.
Er öffnete die Tür. »Das–«
Die Andere stieß sich ab. Aucklands Augen weiteten sich, als er den langgstreckten Körper mit den klingenscharfen Zangen auf sich zuschießen sah. Ama’Ru rechnete damit, dass er zurückweichen würde, doch stattdessen warf er sich vor, unter den Zangen und Beinen der Anderen hindurch. Sie hörte das Rascheln, als er inmitten des zerrissenen Papiers landete und dann sein Keuchen.
Die Andere landete federnd. Sie musste sich erst aufrichten, bevor sie sich umdrehen konnte, aber so weit kam es nicht. Ein Bein knickte plötzlich weg, als Auckland es unter ihrem Körper wegtrat, dann stürzte sie auch schon, und auf einmal war er auf dem Rücken der Anderen und presste Ama’Ru die Pistolenmündung in den Nacken.
Wie kann er so schnell sein?, dachte sie, noch während sie erstarrte.
»Das war dein Freund«, stieß er zwischen kurzen, schmerzerfüllten Atemzügen hervor. »Warum hast du nichts gesagt?«
Sie wusste sofort, was er meinte. »Weil du Beweise gefordert hättest und in den Dateien die Namen meiner Kollegen stehen. Ich wollte nicht, dass sie auf deiner Todesliste landen.«
Der Druck der Mündung verschwand. Auckland ließ sich vom Rücken der Anderen gleiten und steckte die Pistole ein. »Zeig mir die Dateien.«
Ama’Ru zögerte.
Auckland seufzte. »Dein namenloser Freund sagte, dass du sie mir zeigen würdest. Außerdem stehen die Namen deiner Kollegen sehr wahrscheinlich längst auf der Liste.«
»Wie viele Namen umfasst diese Liste denn?«
»Zweihundertsechsundzwanzig.«
226 … Sie konnte die Zahl kaum glauben. Hatten sich überhaupt so viele Wissenschaftler mit menschlicher Genetik befasst?
»Ja«, sagte sie, als sie sich wieder gefangen hatte. »Dann ist das sehr wahrscheinlich.«
Sie wollte ihr Pad aus dem Sattel ziehen, aber Auckland ging bereits zur Tür. »Komm mit in meine Kabine«, sagte er, ohne sich umzudrehen. »Du willst bestimmt nicht, dass ich hier umkippe. Nicht mehr jedenfalls.«
Ama’Ru wusste nicht, was sie darauf antworten sollte.
2
Es klopfte.
Trevor Reilly verließ das Bad und knöpfte sein Hemd zu. »Du bist früh dran«, rief er durch die geschlossene Tür. »Sekunde.«
Der Gurt des Banjos hatte dunkelrote Striemen auf seinem Hals hinterlassen. Seine Kehle schmerzte immer noch, doch zum Glück schienen seine Stimmbänder nicht betroffen zu sein. Er band sich ein Tuch um den Hals, das die Striemen verbarg, dann öffnete er die Tür. »Ich dachte, wir–«
Er unterbrach sich, als er sah, dass nicht Arnest vor ihm stand, sondern Lanzo.
Scheiße.
»Kann ich rein kommen?«
»Klar. Sicher. Komm rein.« Trevor machte einen Schritt zurück und ließ ihn eintreten. »Dein Bruder und ich wollen gleich zur Destination Moon und uns die Abstimmung über die Jockeys ansehen. Wir können von denen da drüben vielleicht noch was lernen, was unser eigenes Problem betrifft.«
Lanzo sah sich in der Kabine um. Trevor war ein ordentlicher Mensch. Die Kleidung, die er im Frachtraum gefunden hatte, war im Spind untergebracht, das Bett war gemacht, auf dem Schreibtisch lag nur sein Pad. Das zertrümmerte Banjo hatte er bereits weggeworfen.
»Du magst kein Chaos«, sagte Lanzo, ohne auf seine Worte einzugehen.
Trevor steckte die Hände in die Hosentaschen. »Ich bin jahrelang durch ganz Amerika getingelt. Wenn man in Hotelzimmern keine Ordnung hält, vergisst man die Hälfte. Willst du was trinken?«
Er redete zu viel und zu schnell, eine nervöse Angewohnheit, derer er sich zwar bewusst war, die er aber nicht in den Griff bekam.
»Ich weiß sehr genau, was du hier tust«, sagte Lanzo ansatzlos.
Trevor tat so, als verstünde er nicht, was er damit meinte. Nun, da er den Grund für Lanzos Besuch kannte, brauchte er ein paar Sekunden Zeit, um sich die passenden Antworten zurechtzulegen. »Leben?«
»Du versuchst, uns gegeneinander auszuspielen. Bei Rin bist du abgeblitzt, bei Arnest nicht. Du hetzt ihn gegen die Jockey auf und gegen mich, aber ich verstehe nicht, warum. Was hast du davon?«
»Du kannst mir glauben, dass ich Arnest nicht gegen dich aufhetzen musste. Das hast du ganz allein geschafft.«
Trevor bemerkte die plötzliche Unsicherheit in Lanzos Blick. Das ist sein wunder Punkt