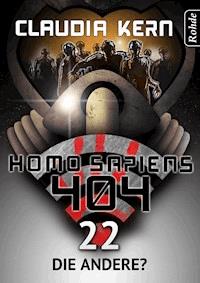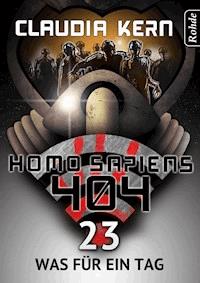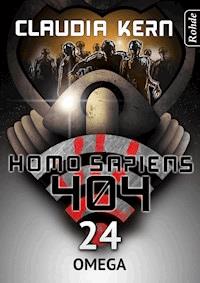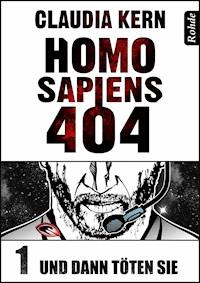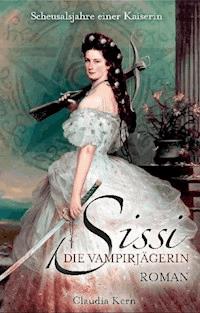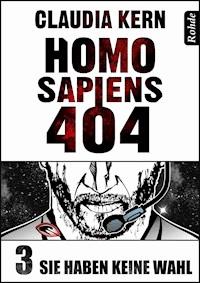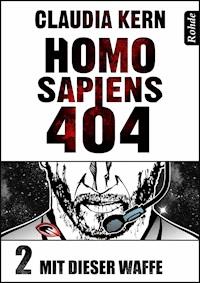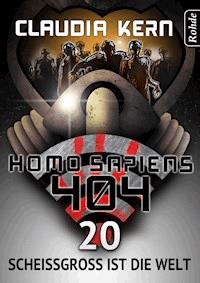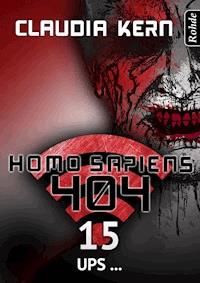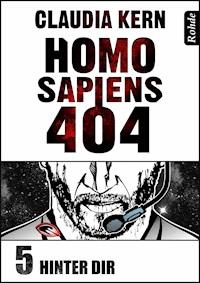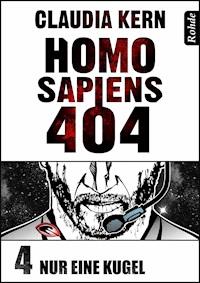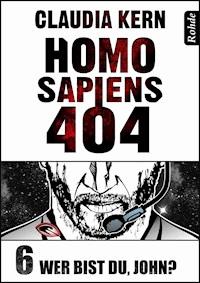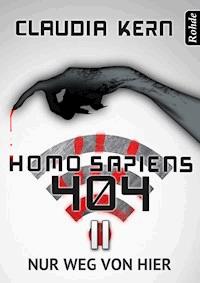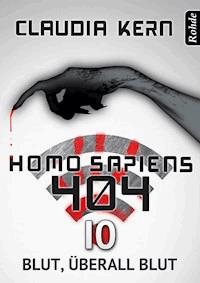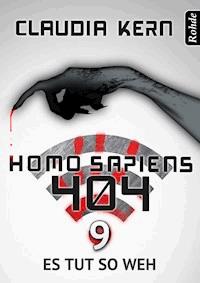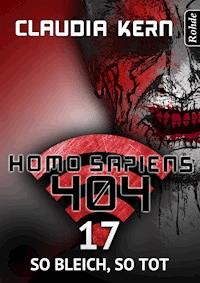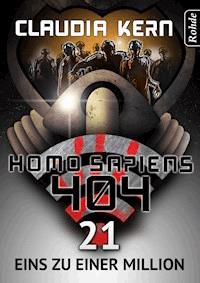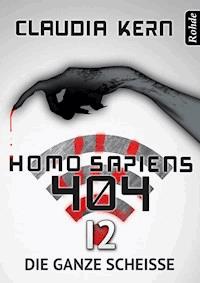
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rohde, Markus
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Homo Sapiens 404
- Sprache: Deutsch
Dies ist die zwölfte Episode der Romanserie "Homo Sapiens 404". Jede Tat hat Konsequenzen. Jede Handlung setzt Mechanismen in Gang, die unvorhersehbar und nicht mehr aufzuhalten sind. Und auf jede, noch so vage, spoilerfreie Inhaltsangabe muss eine Geschichte folgen, in der sich alles klärt. Oder das meiste. Oder ein bisschen was. Irgendwas. In dieser hier wird eines von drei Dingen geschehen: - Niemand stirbt - Jemand stirbt - Jemand Wichtiges stirbt Über die Serie: Einige Jahrzehnte in der Zukunft: Dank außerirdischer Technologie hat die Menschheit den Sprung zu den Sternen geschafft und das Sonnensystem kolonisiert. Doch die Reise endet in einer Katastrophe. Auf der Erde bricht ein Virus aus, der Menschen in mordgierige Zombies verwandelt. Daraufhin riegeln die Außerirdischen das Sonnensystem ab und überlassen die Menschen dort ihrem Schicksal. Die, die entkommen konnten, werden zu Nomaden in einem ihnen fremden Universum, verachtet und gedemütigt von den Außerirdischen, ohne Ziel, ohne Hoffnung. Neue Folgen der zweiten Staffel erscheinen zweiwöchentlich als E-Book. Dies ist die letzte Episode der zweiten Staffel (7-12). Weiter geht es im Juli.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 107
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Episode 12
Die ganze Scheiße
Claudia Kern
Digitale Originalausgabe
Homo Sapiens 404 wird herausgegeben vom Rohde Verlag
Rohde Verlag, Auf der Heide 43, 53757 Sankt Augustin
Verleger & Redaktion: Markus Rohde
Autorin: Claudia Kern
Lektorat: Susanne Picard
Covermotiv & -gestaltung: Sebastian Lorenz
Copyright © 2014 by Rohde Verlag
ISBN 978-3-95662-024-9
www.claudia-kern.com
www.helden-in-serie.de
www.rohde-verlag.de
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Epilog
Die Autorin
Lesetipp des Verlags
»Man sagt, jeder sei zu etwas gut, da er, im schlimmsten Fall, immer noch als schlechtes Beispiel zu gebrauchen sei. Manchmal glaube ich, dass die Jockeys uns nur deshalb am Leben lassen, als Warnung für kommende und heutige Generationen. Wie ein Google Alert, den man vor Monaten gesetzt und längst vergessen hat, tauchen wir auf einmal vor ihnen auf und erinnern sie daran, wohin Arroganz, Dummheit und Gier führen können. Ich hoffe nur, das sie nicht eines Tages genug davon haben und uns einfach wegklicken.«
– Nerdprediger Dan, ASCII-Zeichen für die Ewigkeit
1
Es klickte. Das Licht an der Schleuse der Eliot sprang auf grün. Auckland legte die Hand auf seine Waffe.
»Verriegelung aufgehoben«, sagte eine freundlich klingende Frauenstimme aus den Lautsprechern. »Dies ist das …«
Ein Mann mit gutturalem Akzent fuhr fort: »… siebte …«
»… Mal«, ergänzte die Frauenstimme, »dass Sie Crack & Go verwendet haben. Ihre Trial-Version ist auf zehn Mal beschränkt. Die Vollversion können Sie auf www.crackandgo.tk erwerben. Oder Sie klicken einfach auf den Link am unteren Rand des Fensters. Vielen Dank.«
»Kipling ist wohl nicht mehr dazu gekommen, sich um die Vollversion zu kümmern«, sagte Ama’Ru.
Arnest zog das Magazin aus seiner Pistole, betrachtete es kurz und schob es wieder hinein. »Red nich’ über ihn, so als ob er schon tot wär’.«
»So habe ich das nicht gemeint.«
Arnest knurrte nur. Auckland ahnte, wie nervös er war, auch wenn er sich äußerlich nichts anmerken ließ. Doch er hatte das Magazin schon mindestens vier Mal zuvor überprüft und schien nicht zu wissen, wohin mit seinen Händen. Ab und zu steckte er sie in die Taschen, dann nahm er sie heraus, hakte die Daumen in den Gürtel oder ließ die Hände an den Seiten seines Körpers herabhängen.
Sie hatten Scania unbehelligt erreicht, niemand hatte sie aufgehalten. In der Reichweite der Scanner gab es keine Schiffe und die einzige Sicherheitsvorkehrung der Raumstation schien die Verriegelung der Schleuse zu sein.
»Wäre es möglich, dass sie uns nicht bemerkt haben?«, fragte Ama’Ru. Sie schien den Grund für Aucklands Zögern richtig einzuschätzen.
Er schüttelte den Kopf. »Nein. Sie wissen, dass wir hier sind. Die Eliot übersieht man nicht.«
»Richtig.« Arnest trat neben ihn. »Und je länger wir hier ’rumstehen, desto mehr Zeit haben sie, sich Scheiße für uns zu überlegen.«
Wo er recht hat …, dachte Auckland. Er sah Ama’Ru an. »Wird sie mithalten können?«
Sie warf einen Blick hinunter auf das bandagierte, geschiente Hinterbein der Gottesanbeterin. »Ich würde es vorziehen, sie ausruhen zu lassen, aber …« Sie lächelte auf die typisch gezwungen wirkende Art der Jockeys. »… du wirst uns wohl nicht noch einmal allein an Bord lassen.«
Auckland erwiderte ihr Lächeln nicht. »Sie schon, dich nicht.«
»Ha!« Arnest stieß ein Geräusch aus, das irgendwo zwischen Lachen und Grunzen angesiedelt war. »Und jetzt mach endlich die scheiß Schleuse auf.«
»Nur, wenn klar ist, dass du meine Befehle befolgst, so wie Lanzo es wollte. Ist das klar?«
»Ja, is’ klar.«
»Sag es.«
»Hab ich doch.«
»Vernünftig.« Auckland kam sich vor, als würde er mit einem Fünfjährigen reden. »Als ganzer Satz.«
Einen Moment lang blitzte es in Arnests Augen und Auckland befürchtete, dass er zu weit gegangen war. Arnest fuhr sich mit der Hand über das kurzgeschorene Haar, vor und zurück, vor und zurück, fast ein Dutzend Mal. Er schüttelte sich wie ein Hund und ließ die Hand sinken.
»Ich werde deine Befehle befolgen, so wie Lanzo es wollte«, sagte er. In seiner Stimme lag ein seltsamer Unterton, der Auckland nicht gefiel. »Zufrieden?«
»Ja. Danke, Arnest.« Er öffnete die Schleuse.
Der Gang, der sich rechts von ihnen erstreckte, war hell erleuchtet und leer. Als Auckland vor den anderen beiden hineintrat, roch er Desinfektionsmittel und abgestandene, recycelte Luft. Der Gang endete in einem offenstehenden Schott. Der Bereich dahinter war ebenfalls beleuchtet.
Auf dem Bildschirm der Eliot hatte die Station fast wie ein Güterzug ausgesehen – einige große, durch Gänge verbundene Metallcontainer, die sich aneinanderreihten. In einigen gab es Fenster, durch die Licht ins All drang, andere waren dunkel. Ob es Lebewesen auf der Station gab, wusste Auckland nicht. Die Scanner wurden blockiert und ein Blick auf sein Pad verriet ihm, dass das auch für das Internet galt.
Er steckte das Pad wieder in die Oberschenkeltasche seiner Cargohose. Arnest ging an ihm vorbei, die Mündung der großkalibrigen Pistole auf den Boden gerichtet. Er blieb an der Wand, um kein Ziel für Gegner, die möglicherweise irgendwo auf der anderen Seite des Schotts lauerten, zu bilden. Abgesehen von seinen Schritten und dem leisen, unregelmäßigen Klacken, mit dem sich die Gottesanbeterin über das Metall bewegte, war es still.
Auckland schloss zu Arnest auf und zog seine eigene Waffe. »Bleib zurück«, sagte er. Arnest verdrehte die Augen, blieb aber stehen und ließ Auckland als erstes durch das Schott treten. Der Gang, der dahinter lag, verlief rund zehn Meter geradeaus und knickte dann nach links ab. Große Pfützen aus getrocknetem Blut bedeckten den Boden, schwarze Spritzer die Wände. Es roch nach Eisen.
Menschen sind hier gestorben, dachte Auckland, aber nicht kürzlich.
»Typisch Jockeys«, sagte Arnest. »Erst ’ne riesen Schweinerei veranstalten und dann nich’ aufräumen.«
Aus den Augenwinkeln sah Auckland, wie Ama’Ru im Schott auftauchte. Die Gottesanbeterin musste sich bücken, um nicht mit dem Kopf gegen den Türrahmen zu stoßen.
»Das könnte auch Jockeyblut sein«, sagte Ama’Ru. »Ihr solltet keine Schlussfolgerungen ziehen, ohne die Tatsachen zu kennen.«
»Ich hab so Tatsachen schon hundert Mal gesehen. Die verschissenen Jockeys sterben nie, nur wir.«
»Du weißt sehr gut, dass das nicht stimmt.« Ärger kroch in Ama’Rus Stimme. Das überraschte Auckland. »Diese Station wurde nicht von uns erbaut, sondern von Menschen. Und ihr seid durchaus in der Lage, einander Gewalt zuzufügen. Das habe ich auch schon hundert Mal gesehen.«
Die Gottesanbeterin stakste an Arnest und Auckland vorbei. Das gebrochene Hinterbein hielt sie dabei hoch, aber es schien sie kaum zu behindern. Als sie die Biegung erreichte, drehte Ama’Ru sich in ihrem Sattel um.
»Kommt«, sagte sie. »Oder habt ihr Angst, dass das, was ihr findet, nicht zu euren voreiligen Theorien passen könnte?«
Sie wandte sich ab. Arnest verließ das Schott und folgte ihr kopfschüttelnd. »Hat die ihre Tage oder was ist los?«, fragte er, als er Auckland erreichte. Aber er sprach leise, so als wolle er nicht, dass Ama’Ru ihn hörte. Die Scheren der Gottesanbeterin flößten auch ihm Respekt ein.
Auckland hob nur die Schultern. Er wollte sich weder auf eine Diskussion mit noch über Ama’Ru einlassen. Sie mussten sich auf ihre Umgebung konzentrieren, nicht auf die Probleme, die sie untereinander hatten.
Die aber irgendwann geklärt werden müssen, dachte er.
Ama’Ru war kurz hinter der Biegung stehen geblieben. Auckland sah einen langen, hell erleuchteten Gang, der rund zwanzig Meter entfernt in einem geschlossenen Schott endete. An der linken Wand lehnten einige große, graue Metallplatten. Neben ihnen stand eine Kabelrolle.
Auckland hob seine Waffe und ging langsam auf die Platten zu. Arnest und Ama’Ru blieben hinter ihm. Niemand sagte ein Wort. Als er näherkam, sah er, dass die Platten nicht aus Metall bestanden, sondern aus Sperrholz, das auf einer Seite mit einem grauen Anstrich versehen worden war. Man hatte sie anscheinend aus der Wand entfernt, denn hinter ihnen entdeckte Auckland ein breites Loch, durch das er in einen Tunnel sehen konnte. Kabel und Drähte zogen sich an der Tunnelwand entlang, eine daumennagelgroße, kreisrunde Kamera zeigte in den Gang hinein wie das Stabauge eines Insekts. Ein grünes Licht blinkte unter ihr.
»Was für Vollidioten bauen denn eine Station aus Sperrholz?«, fragte Arnest.
Auckland drehte den Kopf und legte sich den Zeigefinger auf die Lippen. Dann zeigte er in den Tunnel. Arnest beugte sich vor, sah die Kamera und nickte. Dann schlug er mit dem Griff seiner Pistole in seine Handfläche.
Die Frage war eindeutig. Sollen wir sie zerstören?
Auckland dachte einen Moment darüber nach, dann nickte er. Wer auch immer auf der anderen Seite der Kamera saß, wusste zwar mit großer Wahrscheinlichkeit, dass ein Schiff angedockt hatte, aber vielleicht wusste er nicht, wie viele Leute es verlassen hatten und mit welcher Bewaffnung.
Arnest machte einen Schritt an ihm vorbei, streckte der Kamera den ausgestreckten Mittelfinger entgegen und riss sie aus der Wand. Die Plastikschellen, die das Kabel, mit dem sie verbunden war, gehalten hatten, platzten ab. Arnest zog mit beiden Händen an der Kamera und stolperte zurück, als das Kabel plötzlich nachgab und das Licht neben dem Objektiv erlosch. Er ließ die Kamera fallen und zertrat sie mit der Ferse seines Stiefels.
»So«, sagte er.
Auckland warf einen Blick in den Tunnel. Er war schmal und schien parallel zum Gang zu verlaufen. Es schien keine weiteren Kameras oder Mikrofone zu geben. Zumindest nicht in dem Segment, das Auckland überblicken konnte, aber er war sich sicher, dass es noch weitere gab. So eine Mühe machte man sich nicht, um nur einen Gang zu überwachen.
Er legte die Hand auf die Rückwand des Tunnels. Sie war kühl und fühlte sich wie Metall an. Die Sperrholzwände schien es nur auf der gangzugewandten Seite zu geben und auch dort nur an einigen Stellen. Auckland stutzte, als er Markierungen auf dem Boden bemerkte. Sie bestanden aus langen, oft halbkreisförmigen Strichen, die mit Zahlen versehen waren. Er wusste nicht, was sie bedeuten sollten.
Er verließ den Tunnel, bückte sich und strich über die Kabelrolle neben den Sperrholzplatten. Kein Staub. Jemand hatte sie erst vor Kurzem im Gang abgestellt.
Vielleicht haben wir ihn überrascht, dachte Auckland. Er richtete sich auf und sah, dass die Gottesanbeterin die zerstörte Kamera aufgehoben hatte und sie nun Ama’Ru reichte. Die betrachtete den aufgeplatzten Kunststoff und die heraushängenden Drähte.
»Das ist keine Jockey-Technologie«, sagte sie dann. »Solche Kameras stellen wir nicht her.«
»Weil ihr zu blöd dazu seid.« Arnest wartete ihre Antwort nicht ab. »Bleiben wir im Gang oder nehmen wir den Tunnel?«
»Wir bleiben im Gang«, sagte Auckland. »Der Tunnel ist zu schmal. Wenn wir dort angegriffen werden, haben wir keine Chance.«
»Okay.«
Sie gingen weiter auf das Schott zu, Auckland an der Spitze, dann Arnest, zuletzt Ama’Ru. Einige Schritte lang herrschte Stille, dann sagte sie: »Das hat mit Dummheit nichts zu tun. Unsere Technologie hat sich in eine andere Richtung als eure entwickelt, das ist alles.«
Arnest winkte mit der freien Hand ab. Er hatte wohl das Interesse an der Diskussion verloren.
Wieso lässt sie sich von ihm so leicht provozieren?, fragte sich Auckland. Das ist doch sonst nicht ihre Art.
Er schob den Gedanken beiseite, nahm seine Pistole am Lauf und schlug in regelmäßigen Abständen gegen die Wand des Gangs. Bis er das Schott erreicht hatte, hörte er zweimal das dumpfe Geräusch von Holz. Der Rest der Wand bestand aus Metall.
Vor dem Schott blieb er stehen. Das Touchpad, das zum Öffnen und Schließen gedacht war, leuchtete nicht auf, als er die Hand darauf legte, das Schott blieb zu. Es gab keine mechanische Vorrichtung, nichts, das ein manuelles Öffnen ermöglicht hätte.
»Doch den Tunnel?«, fragte Ama’Ru.
»Ungern. Aber wenn–«
Auckland unterbrach sich, als das Touchpad vor ihm aufleuchtete. Er nickte Arnest zu, der seine Waffe in Anschlag brachte und sich in die Lücke zwischen Schott und Wand drückte. Kurz fragte er sich, ob er sich seine Bewegungen von ihrem Gegner diktieren ließ, ob der ihn durch strategisch geöffnete Schotten locken konnte, wohin er wollte. Doch er sah keine Alternative zu diesem Risiko. Dass der Tunnel schmal war, stimmte zwar, aber der wahre Grund, weshalb er ihn nicht nehmen wollte, war ein anderer. Im Tunnel hätte sich Ama’Ru – und damit auch die Scheren der Gottesanbeterin – hinter ihm befunden, ohne dass er hätte ausweichen können. In ihrer gegenwärtigen Stimmung und nach all dem, was geschehen war, schreckte er davor zurück. Er vertraute ihr noch, so wie er auf der Eliot gesagt hatte, er wollte sie nur nicht in seinem Rücken haben.
Das ist kein Vertrauen, das ist Heuchelei. Die innere Stimme, die er hörte, klang wie die von »Doc« Brown, dem Kommandanten, dem er und alle anderen in seiner Einheit von Geburt an unterstanden hatten. Er hörte sie oft, wenn er sich selbst widersprechen musste.
»Heute noch?« Arnest trat ungeduldig von einem Fuß auf den anderen.