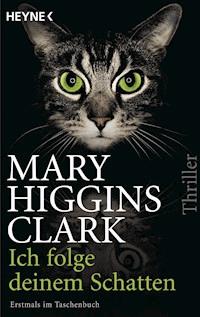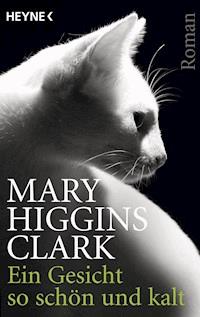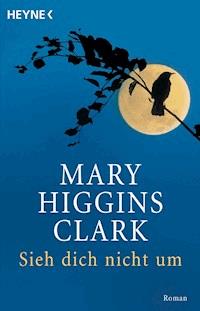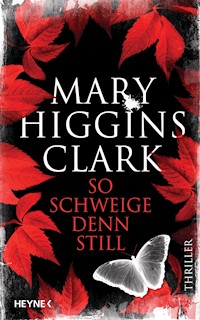
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Reden ist Silber...
Die Investigativjournalistin Gina Kane bekommt eine verstörende Nachricht: Eine Person namens CRyan enthüllt, dass sie in ihrer Firma, einem großen Nachrichtensender, »schreckliche Erfahrungen« gemacht habe. Und sie sei nicht die einzige. Jeder Versuch Ginas, mit CRyan Kontakt aufzunehmen, scheitert jedoch. Nach endlosen Recherchen entdeckt Gina den tragischen Hintergrund: CRyan ist vor Kurzem bei einem Jet-Ski-Unfall ums Leben gekommen. Doch die Hintergründe ihres Todes sind sehr merkwürdig. Also forscht Gina nur mit noch größerem Nachdruck – und stößt auf eine entsetzliche Spur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
DASBUCH
Die junge Investigativjournalistin Gina Kane steht unter Druck: Stetig werden ihrem Hauptauftraggeber Gelder gekürzt, und um sich dem neuen Chefredakteur zu beweisen, braucht sie eine gute Story. Eine richtig gute. Die verspricht sie sich von einer mysteriösen E-Mail, die sie anonym von einer Person erhält, die sich CRyan nennt. Sie arbeite bei einem TV-Nachrichtensender, wo sie »schreckliche Erfahrungen« gemacht habe, berichtet CRyan. Und sie sei nicht die einzige.
Doch als Gina versucht, CRyan zu kontaktieren, scheint diese wie vom Erdboden verschluckt. Ist Gina einem Scherz aufgesessen? Die Sache lässt sie nicht los. Gina recherchiert hartnäckig weiter – und findet heraus, dass CRyan tot ist. Ums Leben gekommen bei einem angeblichen Jet-Ski-Unfall. Nun ist Ginas Spürsinn erst recht geweckt. Etwas sagt ihr, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugeht. Wurde CRyan ermordet, weil sie den Mund aufgemacht hat? Immer mehr Ungereimtheiten kommen ans Tageslicht – und Gina gerät in höchste Gefahr.
DIEAUTORIN
Mary Higgins Clark (1927–2020), geboren in New York, lebte und arbeitete in Saddle River, New Jersey. Sie zählte zu den erfolgreichsten Thrillerautorinnen weltweit. Ihre große Stärke waren ausgefeilte und raffinierte Plots und die stimmige Psychologie ihrer Heldinnen. Mit ihren Büchern führte Mary Higgins Clark regelmäßig die internationalen Bestsellerlisten an und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, u. a. den begehrten »Edgar Award«. Sie starb am 31. Januar 2020 im Kreis ihrer Familie.
MARY
HIGGINS
CLARK
SO
SCHWEIGE
DENN
STILL
THRILLER
Aus dem Amerikanischen von Karl-Heinz Ebnet
Die Originalausgabe KISS THE GIRLS AND MAKE THEM CRY
erschien erstmals 2019 bei Simon & Schuster, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 09/2020
Copyright © 2019 by Nora Durkin Enterprises, Inc.
All rights reserved. Published by arrangement
with the original publisher, Simon & Schuster Inc.
Copyright © 2020 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Claudia Alt
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik.Design, München,
unter Verwendung von iStockphoto Europe GmbH (442656)
Herstellung: Helga Schörnig
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN: 978-3-641-26764-3V001
www.heyne.de
In liebender Erinnerung an
John Conheeney,
meinen außergewöhnlichen Ehemann
PROLOG
12. Oktober
Gina Kane streckte sich auf ihrem Fensterplatz aus. Ihre Gebete waren anscheinend erhört worden. Die Türen des Jumbojets schlossen sich, die Flugbegleiter bereiteten sich auf den Start vor. Der mittlere der drei Sitze auf ihrer Seite war noch frei und würde es während des sechzehnstündigen Direktflugs von Hongkong nach New York City auch bleiben.
Ein zweiter Glücksfall war der Passagier neben dem freien Platz. Sofort nach dem Anschnallen hatte er zwei Schlaftabletten eingeworfen, jetzt hatte er die Augen schon geschlossen, und auch daran würde sich in den nächsten Stunden wohl nichts mehr ändern. Perfekt. Sie wollte nachdenken, sie hatte keine Lust auf Small Talk.
Ihre Eltern hatten die Reise über ein Jahr lang geplant. Wie aufgeregt sie gewesen waren, als sie ihr am Telefon mitgeteilt hatten, dass sie fest dazu entschlossen seien und auch schon die Anzahlung geleistet hätten. Wie so oft hatte ihre Mutter gesagt: »Wir wollen es angehen, bevor wir zu alt dafür sind.«
Die Vorstellung, dass sie altern könnten, hatte sie damals als absurd empfunden. Ihre Eltern hielten sich gern in der Natur auf, sie gingen wandern, unternahmen lange Spaziergänge und Radtouren. Beim jährlichen Medizincheck hatte der Arzt bei ihrer Mutter dann allerdings eine »Abnormalität« entdeckt. Ein Schock: ein inoperabler Krebstumor. Vier Monate später war ihre Mutter, bis dahin ein Ausbund an Gesundheit, tot.
Erst nach der Beerdigung hatte ihr Vater die Reise erneut erwähnt. »Ich werde sie absagen. Wenn ich die anderen Paare aus dem Wanderverein um mich herum habe, deprimiert mich das nur.« Also hatte Gina spontan eine Entscheidung getroffen. »Dad, du wirst die Reise antreten, und du wirst nicht allein sein. Ich komme mit.« So waren sie zehn Tage lang durch die kleinen Dörfer im Hochland von Nepal gewandert. Daraufhin war er mit ihr nach Hongkong geflogen, von wo er den Direktflug nach Miami genommen hatte.
In diesem Fall war es leicht gewesen, das Richtige zu erkennen und es auch zu tun. Ihr Vater hatte die Reise sehr genossen. Genau wie sie. Sie hatte ihre Entscheidung nie infrage gestellt.
Aber wie stand es um ihr Urteilsvermögen in Hinblick auf Ted? Er war ein netter Kerl, kein Zweifel. Sie waren beide zweiunddreißig Jahre alt, und er war überzeugt, dass sie die Frau war, mit der er sein Leben verbringen wollte. Obwohl es ihm nicht gefiel, so lange von ihr getrennt zu sein, hatte er sie dazu ermutigt, ihren Vater zu begleiten. »Die Familie sollte immer an erster Stelle stehen.« Das hatte er oft gesagt bei den Treffen mit seiner weitverzweigten Verwandtschaft.
Sie hatte also viel Zeit zum Nachdenken gehabt, trotzdem wusste sie nach wie vor nicht, was sie Ted sagen sollte. Er hatte ein Recht darauf zu erfahren, wie es mit ihnen beiden weiterging. Wie oft kann ich noch sagen, gib mir noch ein bisschen Zeit?
Wie immer endeten ihre Grübeleien in einer Sackgasse. Zur Ablenkung nahm sie ihr iPad zur Hand und gab das Passwort für die E-Mail ein. Sofort füllte sich der Bildschirm mit neuen Nachrichten, vierundneunzig insgesamt. Nach einigen Klicks ließ sie sich die Mails nach dem Namen der Absender geordnet anzeigen. Keine Antwort von CRyan. Überrascht und enttäuscht verfasste sie eine neue Nachricht, gab CRyans Adresse ein und schrieb:
Hallo, C, ich hoffe, Sie haben die Mail, die ich vor zehn Tagen geschickt habe, erhalten. Ich bin sehr gespannt darauf, mehr von dem »schrecklichen Erlebnis« zu hören. Bitte melden Sie sich baldmöglichst. Mit herzlichen Grüßen, Gina.
Bevor sie auf SENDEN drückte, fügte sie noch ihre Telefonnummer an.
Die einzige andere Mail, die sie öffnete, war von Ted. Ganz sicher würde er ihr vorschlagen, sich mit ihm zum Essen zu treffen. Damit sie reden konnten. Mit einer Mischung aus Erleichterung und Enttäuschung las sie, was er geschrieben hatte.
Hallo, Gina,
ich zähle die Tage, bis ich dich wiedersehe. Leider wird das Zählen noch etwas weitergehen. Ich reise nämlich heute Abend ab, die Bank hat mich mit einem Spezialprojekt betraut. Ich werde mindestens eine Woche in L. A. sein. Ich kann dir nicht sagen, wie enttäuscht ich bin.
Aber ich verspreche dir, wenn ich zurück bin, holen wir alles nach. Ich rufe dich morgen an.
Alles Liebe,
Ted
Über Lautsprecher wurde verkündet, die Maschine sei startklar und alle elektronischen Geräte müssten ausgeschaltet werden. Sie steckte ihr iPad weg, gähnte und schob sich ihr Kissen zwischen Kopf und Kabinenwand.
Die Mail, die sie zehn Tage zuvor erhalten hatte – die, die ihr Leben in Gefahr bringen würde –, ging ihr noch im Kopf herum, während sie langsam eindöste.
ERSTER TEIL
1
Ginas Wohnung lag an der Ecke 82nd Street und West End Avenue. Ihre Eltern hatten sie ihr überlassen, als sie in Rente gegangen und nach Florida gezogen waren. Die Wohnung war geräumig, verfügte über drei Zimmer sowie über eine ganz anständige Küche und rief den Neid ihrer Freunde hervor, von denen sich viele in winzige Einzimmerapartments zwängen mussten.
Sie stellte ihre Taschen im Schlafzimmer ab und sah auf die Uhr. 23.30 Uhr in New York, 20.30 Uhr in Kalifornien. Ein guter Zeitpunkt, um Ted anzurufen. Er meldete sich nach dem ersten Klingeln.
»Na, fremde Frau«, begrüßte er sie mit tiefer, liebevoller Stimme, die Gina mit einem warmen Gefühl erfüllte. »Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr du mir gefehlt hast.«
»Du hast mir auch gefehlt.«
»Es bringt mich noch um, dass ich eine ganze Woche in L. A. festsitze.«
Sie plauderten einige Minuten, bevor er das Gespräch beendete: »Ich weiß, du bist gerade erst nach Hause gekommen, wahrscheinlich bist du erschöpft. Bei mir stehen morgen unzählige Konferenzen an. Ich ruf dich an, wenn es hier etwas ruhiger geworden ist.«
»Gut«, sagte sie.
»Ich liebe dich.«
»Ich dich auch.«
Erst als sie auflegte, wurde ihr so richtig klar, dass Teds unerwartete Reise nach Kalifornien auch ein Segen war. Natürlich hätte sie ihn wirklich gern gesehen, aber sie war auch erleichtert, dass sie nun nicht das Gespräch führen musste, zu dem sie noch nicht bereit war.
Als Gina am nächsten Morgen um halb sechs aus der Dusche trat, war sie überrascht, wie gut sie sich fühlte. Sie hatte fast acht Stunden im Flugzeug geschlafen und weitere vier nach ihrer Ankunft zu Hause. Sie spürte nichts vom gefürchteten Jetlag, unter dem viele nach einer langen Flugreise litten.
Sie konnte es kaum erwarten, wieder zur Arbeit zu kommen. Sofort nach ihrem Journalistik-Abschluss am Boston College hatte sie eine Stelle als Redaktionsassistentin bei einer kleinen Zeitung auf Long Island ergattert. Aufgrund von Etatkürzungen waren viele der langjährigen Mitarbeiter entlassen worden, weshalb sie bereits ein Jahr später große Artikel und Features verfasste.
Ihre Beiträge über Wirtschaft und Finanzen hatten den Herausgeber von Your Money auf sie aufmerksam gemacht. Begeistert war sie daraufhin zu dem unkonventionellen neuen Blatt gewechselt und hatte jede Minute der sieben Jahre genossen, die sie dort gearbeitet hatte. Aber auch hier hatten das nachlassende Interesse an den Printmedien, der Rückgang der Werbeeinnahmen ihre Spuren hinterlassen. Seit drei Jahren war Your Money nun schon eingestellt, und seitdem war sie als freie Journalistin tätig.
Zum einen gefiel ihr die Freiheit, jene Themen verfolgen zu können, die sie interessierten, zum anderen vermisste sie aber auch den regelmäßigen Lohneingang und die Krankenversicherung, in deren Genuss sie als Festangestellte gekommen war. Klar konnte sie sich aussuchen, worüber sie schreiben wollte, letztlich musste ihr jemand die Story aber auch abkaufen.
Der Empire Review hatte sie damals gerettet. Während eines Besuchs bei ihren Eltern in Florida hatten Freunde von ihnen entsetzt erzählt, dass ihr achtzehnjähriger Enkel an seinem College bei einem Initiationsritual der Studentenverbindung mit Brandeisen traktiert worden war. Dabei waren ihm auf der Oberschenkelrückseite griechische Buchstaben eingebrannt worden.
Beschwerden bei der Universitätsverwaltung verhallten ungehört. Wichtige Geldgeber unter den Ehemaligen drohten damit, Spenden zurückzuhalten, sollte gegen die »Greek Life«-Verbindung rigoros durchgegriffen werden.
Der Empire Review hatte sich sofort bereit erklärt, die Geschichte zu veröffentlichen. Man gab ihr einen üppigen Vorschuss und ein großzügiges Reise- und Spesenkonto. Der Artikel, als er im ER erschien, war eine Sensation. Die landesweiten Abendnachrichten griffen das Thema auf, sogar 60 Minutes brachte einen Beitrag darüber.
Der Erfolg der Story machte sie als investigative Journalistin bekannt. Sie wurde überflutet mit »Tipps« von Möchtegern-Whistleblowern und allen möglichen Leuten, die behaupteten, Kenntnisse über einen gewaltigen Skandal zu haben. Manchmal hatte das tatsächlich zu Artikeln geführt, die veröffentlicht wurden. Es kam nur darauf an, zwischen den lohnenswerten Spuren und den Spinnern, den unzufriedenen Ex-Angestellten und Verschwörungstheoretikern zu unterscheiden.
Gina sah auf ihre Uhr. Am nächsten Tag stand ein Treffen mit dem Chefredakteur der Zeitschrift, Charles Maynard, an, der solche Gespräche üblicherweise mit dem Satz begann: »Also, Gina, worüber wollen wir denn als Nächstes schreiben?« Sie hatte also noch gut vierundzwanzig Stunden Zeit, um sich eine gute Antwort zu überlegen.
Sie zog sich schnell an, entschied sich für Jeans und einen warmen Rollkragenpullover. Nach dem Make-up betrachtete sie sich im Ganzkörperspiegel. Sie glich sehr ihrer Mutter, wie sie sie von frühen Aufnahmen kannte, als sie Ballkönigin an der Michigan State University gewesen war. Weit auseinanderstehende Augen, eher grün als haselnussbraun, dazu ein klassisches Profil. Kastanienbraune, schulterlange Haare, die sie noch größer aussehen ließen als ihre ein Meter siebzig.
Kurz darauf steckte sie einen tiefgefrorenen Bagel in den Toaster und machte sich Kaffee. Als alles fertig war, ging sie mit dem Teller und der Tasse zum Tisch am Wohnzimmerfenster, wo die Morgensonne zu sehen war, die sich gerade über den Horizont erhob. Zu keiner anderen Tageszeit war ihr der Tod ihrer Mutter so präsent wie jetzt, zu keiner anderen Tageszeit hatte sie so sehr das Gefühl, dass die Zeit zu schnell dahinraste.
Sie ließ sich am Tisch nieder – ihrem Lieblingsarbeitsplatz – und klappte den Laptop auf. Ungelesene Mails erschienen auf dem Bildschirm.
Ihr erster Blick galt den Nachrichten, die neu eingetroffen waren, seitdem sie sie im Flugzeug gecheckt hatte. Nichts dringendes. Noch wichtiger aber: nichts von CRyan.
Danach überflog sie die Mails der vergangenen Woche, in der sie sich in einer der wenigen noch vorhandenen Weltgegenden aufgehalten hatte, wo es kein WLAN gab.
• Die Mitteilung einer Frau aus Atlanta, die angeblich Beweise hatte, denen zufolge der recycelte Gummi auf Schulspielplätzen die Kinder krank machte.
• Eine Einladung, im nächsten Monat vor der ASJA, der American Society of Journalists and Authors, einen Vortrag zu halten.
• Eine Mail von jemandem, der im Besitz eines nach der Autopsie verloren gegangenen Knochenfragments von Präsident Kennedys Schädel sein wollte.
Obwohl sie sie mittlerweile wahrscheinlich auswendig kannte, ging sie zur Mail zurück, die sie am Tag ihrer Abreise nach Nepal erhalten hatte.
Hallo, Gina, ich glaube nicht, dass wir miteinander zu tun hatten, als wir am Boston College waren. Wir waren einige Jahre auseinander. Gleich nach dem Uni-Abschluss habe ich bei REL News angefangen. Dort hatte ich mit einem der obersten Vorgesetzten ein schreckliches Erlebnis. (Ich war nicht die Einzige.) Jetzt fürchtet man, ich könnte alles ausplaudern. Deshalb hat man mir eine Vertraulichkeitsvereinbarung angeboten. Mehr möchte ich dazu in der Mail nicht schreiben. Können wir uns irgendwo treffen?
Sie hatte sich zu erinnern versucht, warum der Name CRyan ihr bekannt vorkam. Hatte es eine Courtney Ryan an der Uni gegeben?
Gina las die Mail ein weiteres Mal und überlegte, ob sie irgendwas übersehen hatte. Das Medienunternehmen REL News gehörte zu den Lieblingen der Wall Street. Die Zentrale lag an der Ecke 55th Street und Avenue of the Americas, der Sixth Avenue, wie die meisten New Yorker sie immer noch nannten. In einem Zeitraum von zwanzig Jahren hatte es sich von einer kleinen Gruppe von Kabel-TV-Sendern zu einem nationalen Medienkonzern entwickelt. Ihre Einschaltquoten hatten CNN überholt und näherten sich dem Marktführer Fox. Das inoffizielle Motto lautete: »REaL News – nicht die der anderen Sorte.«
Als Erstes war ihr natürlich sexuelle Belästigung in den Sinn gekommen. Moment mal, hatte sie sich gebremst. Du weißt doch gar nicht, ob »CRyan« überhaupt eine Frau ist. Du bist Journalistin. Urteile nicht vorschnell. Halt dich an die Fakten. Es gab nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Sie las sich noch einmal die Antwort durch, die sie verschickt hatte.
Hallo, Mr./Mrs. Ryan, ich bin sehr daran interessiert, mit Ihnen über das »schreckliche Erlebnis« zu reden, wie Sie es genannt haben. Ich werde in nächster Zeit außer Landes sein und auch keinen Mailzugang haben, bin aber ab dem 13. Oktober wieder hier. Wie Sie wahrscheinlich wissen, wohne und arbeite ich in New York City. Wo sind Sie? Es würde mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Mit den besten Grüßen, Gina.
Es fiel ihr schwer, sich zu konzentrieren, während sie durch die Mails scrollte. Sie hatte gehofft, mehr als nur das zu haben, wenn sie in das bevorstehende Treffen bei der Zeitschrift ging.
Vielleicht hatte sie ja eine Nachricht hinterlassen. Die Akkuladung ihres Handys hatte beim Boarding nur noch einen Balken angezeigt, bei der Landung in New York war das Gerät längst tot gewesen. In der Mail an CRyan hatte sie ihre Nummer angegeben.
Gina ging in ihr Schlafzimmer, nahm das Handy vom Ladegerät und kehrte in die Küche zurück. Sie weckte das Gerät auf. Sofort sah sie mehrere Nachrichten, aber nichts von einer unbekannten Nummer.
Die erste stammte von ihrer besten Freundin Lisa. »Hallo, meine Liebe. Ich kann es kaum erwarten, von deiner Reise zu hören. Ich hoffe, unser Essenstermin heute Abend steht noch. Wir müssen unbedingt in einen Laden im Village, ins Bird’s Nest. Ich hab nämlich einen tollen neuen Fall. Ein Ausrutscher, sozusagen. Meine Mandantin ist auf Eiswürfeln ausgerutscht, die der Barkeeper beim Martini-Mixen fallen gelassen hat, dabei hat sich die Ärmste einen dreifachen Beinbruch zugezogen. Ich möchte das Lokal auskundschaften.«
Gina musste schmunzeln. Ein Abendessen mit Lisa war immer ein großer Spaß.
Die anderen Nachrichten waren Werbeanrufe, die sie sofort löschte.
2
Gina fuhr mit der U-Bahn die vier Stationen zur 14th Street, von dort ging sie drei Blocks weit zum Fisk Building, wo die zweite bis einschließlich sechste Etage von der Zeitschrift angemietet waren.
»Guten Morgen«, wurde sie vom Securitymitarbeiter begrüßt, als sie durch den Scanner ging. Vermehrte Drohschreiben hatten dazu geführt, dass die Zeitschrift ihr Sicherheitskonzept überdacht hatte: »Sämtliche Mitarbeiter und Besucher haben sich ausnahmslos einer Sicherheitskontrolle zu unterziehen.«
Gina trat in den Aufzug und drückte auf die 6, die Etage, die der Geschäftsführung und der Redaktion vorbehalten war. Kaum hatte sie den Aufzug verlassen, als sie eine freundliche Stimme hörte. »Hallo, Gina. Na, wieder im Lande?« Jane Patwell, langjährige Assistentin der Geschäftsleitung, streckte ihr die Hand hin. Sie war fünfzig Jahre alt, leicht untersetzt und haderte permanent mit ihrer Konfektionsgröße. »Mr. Maynard empfängt Sie in seinem Büro.« Sie senkte die Stimme zu einem verschwörerischen Flüstern: »Er hat einen gut aussehenden Kerl bei sich. Ich weiß aber nicht, wer das ist.«
Jane konnte es nicht lassen, immer wollte sie Leute miteinander verkuppeln. Trotzdem wunderte sich Gina immer wieder, dass Jane auch für sie jemanden finden wollte. Vielleicht, war sie schon versucht zu sagen, ist es ja ein Serienkiller. Dann aber lächelte sie nur und folgte ihr wortlos zu einem großen Eckbüro, wo Charlie Maynard residierte, der langjährige Chefredakteur und Herausgeber des Blatts.
Charlie war nicht an seinem Schreibtisch, sondern saß – mit einem Handy am Ohr – an seinem Lieblingsplatz, dem Konferenztisch am Fenster. Er war an die eins fünfundsiebzig groß, hatte einen ordentlichen Wanst und ein weiches Gesicht. Die allmählich grau werdenden Haare waren seitlich über den Schädel gekämmt, die Lesebrille war auf die Stirn geschoben. Gina hatte einmal mitbekommen, wie ein Kollege Charlie gefragt hatte, was er mache, um fit zu bleiben. In Anspielung auf ein George-Burns-Zitat hatte er geantwortet: »Ich halte mir zugute, auf die Beerdigung meiner Freunde zu gehen, die gejoggt haben.«
Er winkte Gina zu und bedeutete ihr, sich auf dem Stuhl ihm gegenüber niederzulassen. Neben ihm saß schon der gut aussehende Typ, von dem Jane gesprochen hatte.
Der Neue erhob sich und streckte ihr die Hand entgegen. »Geoffrey Whitehurst«, stellte er sich mit britischem Akzent vor. Er war über eins achtzig groß, hatte ebenmäßige Gesichtszüge, dunkelbraune Augen und ebensolche Haare. Alles an ihm, Miene, durchtrainierte Statur, zeugten von Selbstvertrauen und Autorität.
»Gina Kane«, sagte sie, hatte aber das Gefühl, als würde er ihren Namen bereits kennen. Er dürfte Mitte bis Ende dreißig sein, dachte sie und nahm auf dem Stuhl Platz, den er ihr zurechtschob.
Charlie beendete das Telefonat. »Charlie«, sagte sie, »es tut mir furchtbar leid, dass ich Ihren Geburtstag verpasst habe.«
»Machen Sie sich nichts draus, Gina. Siebzig ist das neue Fünfzig. Wir haben alle unseren Spaß gehabt. Geoffrey haben Sie ja schon kennengelernt. Ich möchte Sie aufklären, warum er hier ist.«
»Gina«, unterbrach Geoffrey, »eins vorweg: Sie sollen wissen, dass ich ein großer Fan Ihrer Arbeit bin.«
»Danke«, antwortete Gina und fragte sich, was als Nächstes kommen würde. Was dann folgte, war ein Schock.
»Nach fünfundvierzig Jahren im Zeitschriftengewerbe habe ich beschlossen, es gut sein zu lassen. Meine Frau will, dass wir mehr Zeit mit den Enkelkindern an der Westküste verbringen, und ich stimme ihr voll und ganz zu. Geoff wird meinen Posten übernehmen und von jetzt an mit Ihnen zusammenarbeiten. Die Übergabe wird offiziell erst nächste Woche bekannt gegeben, ich wäre Ihnen daher dankbar, wenn Sie bis dahin Stillschweigen bewahren.«
Er schwieg kurz, um Gina Zeit zu geben, das alles zu verdauen, dann fuhr er fort. »Wir können von Glück reden, dass wir Geoff von der Time Warner Group loseisen konnten. Bislang hat er meistens in London gearbeitet.«
»Herzlichen Glückwunsch Ihnen beiden, Charlie und Geoffrey«, sagte Gina wie fremdgesteuert. Ihr einziger Trost war, dass Geoffrey ihre Arbeit anscheinend wertzuschätzen wusste.
»Bitte nennen Sie mich Geoff«, sagte er.
»Gina«, fuhr Charlie fort, »Ihre investigativen Recherchen erstrecken sich meistens über einen Zeitraum von mehreren Monaten. Deshalb habe ich Geoff heute dazugeladen, damit er von Anfang an dabei sein kann.« Er räusperte sich. »Also, worüber wollen wir als Nächstes schreiben?«
»Ich hab einige Ideen«, sagte Gina und zog ihr kleines Notizbuch aus der Handtasche. »Ich würde gern Ihre Meinung dazu hören.« Das war an sie beide gerichtet. »Ich habe mehrere Mails mit der ehemaligen Referentin eines New Yorker Senators ausgetauscht. Sowohl die Referentin als auch der Senator sind mittlerweile im Ruhestand. Die Referentin behauptet, Beweise zu haben, wonach gegen Barzahlungen und andere Gefälligkeiten Ausschreibungen und Auftragsvergaben manipuliert wurden. Es gibt nur ein Problem. Die Referentin will vorab fünfundzwanzigtausend Dollar, bevor sie offiziell mit den Fakten herausrückt.«
Geoff hakte als Erster nach. »Meiner Erfahrung nach sind jene, die sich ihr Wissen bezahlen lassen, im Allgemeinen wenig vertrauenswürdig. Sie schmücken ihre Storys aus und übertreiben alles, weil sie auf Geld und öffentliche Aufmerksamkeit aus sind.«
Charlie lachte. »Ich denke, selbst die größten Fans der Korruption in Albany finden das Thema mittlerweile langweilig. Außerdem stimme ich zu – es ist selten empfehlenswert, seine Informanten zu bezahlen.«
Charlie deutete auf Ginas Notizbuch. »Was haben Sie noch?«
»Okay«, sagte Gina und blätterte eine Seite weiter. »Ich bin von jemandem kontaktiert worden, der lange in der Zulassungsstelle von Yale gearbeitet hat. Angeblich sollen sich die Ivy-League-Universitäten abgesprochen haben, wie viel sie ihren einzelnen Bewerbern an Studienbeihilfen gewähren.«
»Warum soll das ein Problem sein?«, fragte Geoff.
»Weil das einer Preisabsprache sehr nahe kommt. Verlierer sind die Studierenden. Man könnte das mit den Absprachen unter den Unternehmen im Silicon Valley vergleichen, die sich darauf einigen, Mitarbeiter der Konkurrenz nicht abzuwerben. Die Unternehmen profitieren davon, weil sie keine höheren Löhne zahlen müssen, um ihre Topleute zu halten. Aber die Angestellten hätten mehr verdient, wenn sie ihre Arbeitskraft gegen Höchstgebot hätten verkaufen können.«
»Es gibt acht Privatuniversitäten, stimmt das?«, fragte Geoff.
»Ja«, antwortete Charlie. »Im Durchschnitt sind bei ihnen zusammen etwa sechstausend Studierende zum Grundstudium eingeschrieben. Es betrifft also achtundvierzigtausend von insgesamt zwanzig Millionen Collegestudierenden des Landes. Ich weiß nicht, ob eine Handvoll Ivy-League-Studierende, die bei ihren Beihilfen betrogen wurde, für unsere Leser von Belang ist. Wenn Sie mich fragen, verschwenden die an diesen überteuerten Unis sowieso ihr Geld.«
Charlie war in Philadelphia aufgewachsen, hatte die Pennsylvania State University besucht und sich in seiner Loyalität gegenüber staatlichen Bildungseinrichtungen nie erschüttern lassen.
Na, wunderbar, dachte sich Gina, du hinterlässt ja einen tollen Eindruck beim neuen Boss. Sie blätterte um und versuchte etwas enthusiastischer zu klingen. »Die nächste Sache steht noch ganz am Anfang.« Sie erzählte von der Mail über das »schreckliche Erlebnis« bei REL News, die bei ihr eingegangen war, und ihrer Antwortmail darauf.
»Es ist also zehn Tage her, dass Sie geantwortet haben, und seitdem kam keine Reaktion darauf?«, fragte Charlie.
»Ja. Elf, wenn man den heutigen Tag mit dazurechnet.«
»Diese CRyan, die Ihnen die Mail geschickt hat – haben Sie irgendwas über sie herausfinden können? Kann man ihr glauben?«, wollte Geoff wissen.
»Ich nehme wie Sie an, dass es sich bei CRyan um eine Frau handelt, aber sicher wissen wir das nicht. Natürlich hab ich mir als Erstes gedacht, es würde sich um eine MeToo-Sache handeln. Aber ich weiß nicht mehr als das, was in der Mail steht. Mein Gefühl sagt mir allerdings, es könnte sich lohnen, die Sache weiter zu verfolgen.«
Geoff sah zu Charlie. »Was meinen Sie?«
»Mich würde sehr interessieren, was CRyan zu sagen hat«, antwortete Charlie. »Es dürfte allerdings einfacher sein, sie dazu zu bringen, ihre Geschichte preiszugeben, bevor sie sich auf diese Vertraulichkeitsvereinbarung einlässt.«
»Okay, Gina, machen Sie sich an die Arbeit«, bestätigte Geoff. »Treffen Sie sich mit ihr – ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es mit einer Frau zu tun haben. Ich möchte hören, welchen Eindruck Sie von ihr haben.«
Auf dem Weg zum Aufzug murmelte Gina leise vor sich hin: »Hoffentlich stellt sich CRyan nicht als eine Verrückte heraus.«
3
Normalerweise hätte sich Gina erst einmal Zeit genommen, um ihre Umgebung wieder in sich aufzunehmen, die Stadt, die sie so sehr liebte, die Menschen, die Geräusche. Als sie in die U-Bahn einstieg, erinnerte sie sich schmunzelnd an Marcie, ihre Zimmergenossin im ersten Studienjahr, die aus einer Kleinstadt in Ohio stammte. Marcie hatte sie gefragt, ob es hart gewesen sei, in New York City aufzuwachsen. Gina war über die Frage mehr als erstaunt gewesen. Mit zwölf Jahren hatte sie sich in der U-Bahn und den Bussen zurechtgefunden und die Freiheit genossen, ganz allein überallhin fahren zu können. Sie hatte im Gegenzug Marcie gefragt, ob es nicht hartgewesen sei, an einem Ort aufzuwachsen, an dem man immer auf die Eltern angewiesen war, wenn man irgendwohin wollte.
Sie stattete dem kleinen Eckladen am Broadway einen Besuch ab und kaufte Milch und einige Sandwich-Zutaten. Überrascht, dass im Starbucks nebenan keine Schlange war, bestellte sie dort ihr Lieblingsgetränk, einen Vanilla Latte. Den eineinhalb Blocks langen Weg zu ihrer Wohnung war sie dann in Gedanken ganz bei der bevorstehenden Aufgabe.
Sie räumte die Lebensmittel ein, ging mit dem Latte zum Küchentisch, schaltete ihren Laptop an und öffnete CRyans E-Mail. Die Nachricht war von einem Google-Konto verschickt worden, was aber zweitrangig war. Nach zahlreichen Gesetzesverstößen standen die Techkonzerne unter großem Druck, die Privatsphäre ihrer Kunden besser zu schützen. Google würde ihr daher keinesfalls behilflich sein, um an CRyan ranzukommen.
Gina las erneut die einzige Passage, die irgendeinen Anhaltspunkt lieferte: Ich glaube nicht, dass wir miteinander zu tun hatten, als wir noch am Boston College waren. Wir waren einige Jahre auseinander.
CRyan weiß anscheinend, in welchem Jahr ich meinen Abschluss gemacht habe, dachte Gina. Anscheinend waren wir einige Jahre zusammen auf dem Campus gewesen. Einige heißt mehr als ein Jahr, allerdings müssen es weniger als vier Jahre sein, sonst hätten wir nicht gleichzeitig am College sein können. Also muss CRyan zwei oder drei Jahre vor oder zwei oder drei Jahre nach mir ihren Abschluss gemacht haben.
Gina lehnte sich auf dem Stuhl zurück und nahm einen Schluck vom Latte. Während der Arbeit an der Brandeisen-Story hatte die Southern University Wind von ihren Recherchen bekommen. Die Uni hatte sich daraufhin quergestellt und sich konsequent geweigert, Kontaktinformationen zu den Mitgliedern der Studentenverbindung und den Fakultätsbeauftragten herauszugeben.
Hier lagen die Dinge aber anders. Das Boston College war nicht Ziel ihrer Recherchen. Es ging nicht um die Uni. Sie wollte nur, dass die Besitzerin der Mailadresse identifiziert würde.
Wenn es nur so einfach wäre, dachte sie. Wenn die Uni keine CRyan-Adresse hatte, würde sie gezwungen sein, zu ganz anderen Mitteln Zuflucht zu nehmen. Datenschutzbestimmungen hin oder her … »Also gut«, sagte sie laut. »Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden.«
4
»Boston College, Studentenverwaltung, was kann ich für Sie tun?« Ihr Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung gab sich knapp und prägnant. Gina schätzte ihn auf etwa Mitte fünfzig.
»Hallo, hier ist Gina Kane. Ich habe am College vor zehn Jahren meinen Abschluss gemacht. Darf ich fragen, mit wem ich spreche?«
»Rob Mannion.«
»Schön, Ihre Bekanntschaft zu machen, Mr. Mannion …«
»Nennen Sie mich doch bitte Rob.«
»Danke, Rob. Ich hoffe, Sie können mir mit einigen Informationen weiterhelfen.«
»Wenn Sie sich über Ehemaligentreffen informieren wollen, finden Sie dazu alles auf unserer Website. Ich kann Ihnen die Adresse geben.«
»Nein, nein, deswegen rufe ich nicht an. Ich möchte mit jemandem Kontakt aufnehmen, der ungefähr zur selben Zeit wie ich am College war.«
»Da kann ich Ihnen durchaus weiterhelfen. Nennen Sie mir den Namen der betreffenden Person und das Jahr ihres Abschlusses.«
»Genau das ist mein Problem. Ich habe den Namen der Person nicht. Ich hab nur eine Mailadresse. Ich hoffe …«
»Na, dann schicken Sie der betreffenden Person doch einfach eine Mail und fragen Sie sie nach ihrem Namen.«
Gina versuchte nicht allzu frustriert zu klingen. »Ich darf Ihnen versichern, der Gedanke ist mir auch schon gekommen.« Sie wusste nicht, wie viel sie ihm gegenüber preisgeben sollte. Manche Gesprächspartner waren immer ganz aufgeregt, wenn sie erfuhren, dass sie mit einer Journalistin sprachen; andere machten dann einfach dicht. »Meine Frage ist nur: Wenn ich Ihnen eine Mailadresse gebe, könnten Sie mir dann sagen, ob Sie weitere Informationen über den Besitzer der Adresse haben?«
»Ich glaube nicht, dass ich befugt bin, Ihnen diese Auskünfte zu erteilen.«
»Das verstehe ich, aber das war nicht meine Frage. Ich will nur wissen, ob Sie über diese Informationen verfügen, auch wenn Sie mir keine Auskunft erteilen können.«
»Das ist sehr ungewöhnlich«, erwiderte Rob, »aber ich sehe mal nach. Einen Moment, ich suche in unserer Datenbank. In welchem Jahr hat die fragliche Person ungefähr ihren Abschluss gemacht?«
»Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, es muss in einem der folgenden sechs Jahre gewesen sein.« Sie nannte ihm die Jahreszahlen.
»Ich muss jedes Jahr einzeln überprüfen.« Rob seufzte. Sein Missmut war nicht zu überhören.
»Ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar«, sagte Gina herzlich.
»Okay, hier kommen die Ergebnisse. Nicht im ersten Jahr, nicht im zweiten, nicht im dritten, nicht im vierten, auch nicht im fünften und sechsten. Tut mir leid. Ich kann Ihnen nicht helfen.«
»Ganz allgemein, haben Sie die aktuellen E-Mail-Adressen Ihrer Studierenden?«
»Wir bemühen uns, die Kontaktinformationen aktuell zu halten. Aber zum größten Teil sind wir dazu auf die Studierenden angewiesen, die uns darüber informieren. Wenn sich diese eine neue Mailadresse zulegen und uns nicht Bescheid geben, lautet die Antwort natürlich Nein. Das gleiche gilt für Wohnadressen und Telefonnummern.«
»Haben Sie noch das letzte Jahr, in dem Sie nachgesehen haben, auf dem Bildschirm?«
»Ja.«
»Können Sie mir sagen, wie viele Studierende mit den Nachnamen Ryan aufgelistet sind?«
»Ms. Kane, ein großer Prozentsatz unserer Studentenschaft ist irischen Ursprungs.«
»Ich weiß. Ich gehöre selbst dazu.«
»Dieser Anruf zieht sich mittlerweile doch sehr in die Länge, Ms. Kane.«
»Bitte nennen Sie mich Gina. Rob, ich weiß Ihre Geduld wirklich zu schätzen. Bevor wir auflegen, möchte ich mit Ihnen aber noch über die Mails reden, die ich wegen der diesjährigen Spendenkampagne erhalten habe.«
»Wie nett von Ihnen«, antwortete Rob mit sichtlich mehr Enthusiasmus.
Eine Viertelstunde später hatte Rob ihr eine Tabelle mit allen Adressen gemailt, deren Nachname in dem Sechsjahreszeitraum »Ryan« lautete. Ihre Mastercard war mit einer Spende über 3000 Dollar belastet worden.
5
Gina ging die Tabellen durch, die Rob ihr geschickt hatte. Rechts neben dem Namen der jeweiligen Studierenden – Nachname, erster und zweiter Vorname – waren weitere Informationen aufgeführt: Geburtsdatum, Wohnadresse, Arbeitsstelle, Telefonnummer, Name des Ehepartners. Schnell stellte sie fest, dass Rob recht gehabt hatte. Bei keinem der gelisteten Namen fand sich die von ihr gesuchte Mailadresse.
Mit Kopieren und Einfügen übertrug sie die Namen auf ein neues Tabellendokument. In den sechs Abschlussjahren fanden sich insgesamt einundsiebzig mit dem Namen Ryan, etwas mehr als die Hälfte waren Frauen.
Daraufhin wählte sie diejenigen Ryans aus, deren Vorname mit C begannen, und schob sie an den Anfang der Liste. Es waren vierzehn: Carl, Carley, Casey, Catherine, Charles, Charlie, Charlotte, Chloe, Christa, Christina, Christopher, Clarissa, Clyde und Curtiss.
Gina druckte die Liste aus und markierte die Frauennamen. Da Casey sowohl ein weiblicher als auch männlicher Vorname sein konnte, überprüfte sie den zweiten Vornamen. Riley. Auch der konnte auf Männer wie Frauen zutreffen. Sicherheitshalber steckte sie Casey in die Liste der Frauen.
Dann hielt sie inne, ihr war ein beunruhigender Gedanke gekommen. Die Mailadresse ihrer Freundin Sharon bestand aus einem S mit dem angehängten Nachnamen. Allerdings war Sharon ihr zweiter Vorname, ihr Rufname lautete Eleanor. Würde sie diese Liste nach einer Sharon durchsuchen, würde sie unter dem falschen Namen nachschlagen. »Bitte, Ms. Ryan, lass deinen Rufnamen mit einem C beginnen«, flüsterte sie.
Gina überlegte, ob Facebook ihr dabei helfen könnte, die Suche einzuschränken. Sie probierte es mit dem ersten Namen auf der Liste: Carley Ryan. Wie nicht anders zu erwarten, fanden sich Dutzende Frauen und einige Männer mit diesem Namen. Sie gab »Carley Ryan, Boston College« ein. Vier Treffer, aber offenbar keiner in dem Alter, nach dem sie suchte. Sie probierte es mit »Carley Ryan, REL News«, fand aber nichts.
Sie wollte diese Prozedur schon mit dem nächsten Namen, Casey, wiederholen, brach aber ab. CRyan hatte nach eigener Aussage »ein schreckliches Erlebnis« bei REL News gehabt. Würde sie in diesem Fall auf ihrem Facebook-Konto REL erwähnen? Wahrscheinlich eher nicht. Wer etwas Fürchterliches erlebt hatte, würde sich doch lieber bedeckt halten. Vielleicht gehörte sie auch zu jenen, die keine Lust auf die sozialen Medien hatten.
Kurz überlegte sie, jeder der Frauen eine Mail zu schicken, verwarf den Gedanken dann aber. CRyan hatte, aus welchem Grund auch immer, beschlossen, nicht auf die Mail zu antworten, die Gina ihr eineinhalb Wochen zuvor geschickt hatte. Warum sollte sie ihr jetzt antworten? Sie griff zu ihrem Telefon und wählte die Nummer von Carley Ryan.
»Hallo.« Die Frau, die sich meldete, klang, als wäre sie in den mittleren Jahren.
»Hallo, ich spreche mit Mrs. Ryan?«
»Ja.«
»Ich bin Gina Kane. Ich habe 2008 meinen Abschluss am Boston College gemacht.«
»Haben Sie meine Tochter gekannt, Carley? Sie war in der Abschlussklasse 2006.«
»Ehrlich gesagt, ich kann mich an eine Carley nicht erinnern. Ich recherchiere für einen Artikel über Absolventen des Boston College, die nach ihrer Ausbildung beruflich in der Medienbranche tätig waren. Hat Carley jemals für einen TV-Sender wie REL News gearbeitet?«
»O nein, Carley doch nicht«, antwortete die Frau und lachte verhalten. »Nach Carleys Meinung ist Fernsehen pure Zeitverschwendung. Sie ist Ausbilderin bei Outward Bound und leitet gerade eine Kanutour in Colorado.«
Gina strich Carley von ihrer Liste und überflog die noch übrigen Namen und Telefonnummern. Unmöglich zu unterscheiden, welche Nummern den Eltern gehörten und welche den jeweiligen Studierenden.
Wieder wählte sie. Casey meldete sich nach dem ersten Klingeln. Sie erklärte, Jura studiert zu haben und anschließend von einer Kanzlei in Chicago angestellt worden zu sein. Die nächste Sackgasse.
Anschließend hinterließ sie Catherine eine Nachricht.
Charlottes Nummer war eine 011 vorangestellt, in der Adressspalte eine Straße in London aufgeführt. Gina sah auf die Uhr. England war fünf Stunden voraus. Es war noch nicht zu spät. Beim zweiten Klingeln meldete sich eine mittelalte Frau mit britischem Akzent. Sie teilte mit, dass ihre Tochter Charlotte nach ihrem Abschluss eine Stelle bei Lloyd’s of London angenommen habe und noch immer dort arbeite.
Chloe hinterließ sie eine Nachricht.
Clarissas Mutter erklärte in weitschweifiger Ausführlichkeit, dass ihre Tochter ihren Highschool-Freund geheiratet und mit ihm vier wunderbare Kinder habe, dass sie lediglich ein Jahr in Pittsburgh beschäftigt gewesen sei, bevor sie sich ganz den Kindern und dem Haushalt gewidmet habe. Sie fügte noch an, dass das bei ihr ganz anders gewesen sei. »Ich hab fast zehn Jahre gearbeitet, bevor ich mich für eine Familie entschieden habe. Clarissa ist ja ganz zufrieden, aber meinen Sie nicht auch, es wäre für Frauen generell besser, wenn sie erst mindestens fünf Jahre arbeiten, sich eine Karriere aufbauen und Selbstbewusstsein entwickeln, bevor sie eine feste Bindung eingehen? Ich habe das Clarissa wer weiß wie oft gesagt, aber glauben Sie, sie hätte auf mich gehört? Natürlich nicht. Ich …«
Chloes Rückruf verschaffte Gina dankenswerterweise eine Entschuldigung, das Gespräch zu beenden. Chloe hatte sofort nach dem College ein Medizinstudium begonnen und jetzt ein Stipendium an der Cleveland Clinic.
Die Nummer von Christa existierte nicht mehr.
Courtney ging ran, während sie gerade Mittagspause hatte. Sie war nach dem Studium Lehrerin geworden.
Gina sah zu den letzten beiden verbliebenen Namen, Catherine und Christina. Da sie nicht wusste, was sie als Nächstes tun sollte, stand sie auf und machte sich erst einmal ein Sandwich.
6
Nachdem sie ihr Sandwich gegessen hatte, betrachtete Gina mit neuem Schwung die Kontaktinformationen zu den ehemaligen Studentinnen. Die aktuellste Adresse für Christina gab Winnetka, Illinois, an, einen exklusiven Vorort etwa fünfundzwanzig Kilometer außerhalb von Chicago. Sie schlug die Telefonvorwahl für Winnetka nach, 224 und 847. Christinas Telefonnummer in der Tabelle begann mit 224.
Ohne sich große Hoffnungen zu machen, wählte sie die Nummer. Eine fröhliche Stimme meldete sich mit einem jovialen Hallo. Routiniert erklärte Gina zum x-tenmal den Grund ihres Anrufs.
Christinas freundlicher Ton schlug augenblicklich in eine Hasstirade um. »Sie rufen mich also an, weil Sie eine Story über dieses angeblich so wundervolle Boston College schreiben wollen? Vergessen Sie Ihre dämliche Story, schreiben Sie lieber über Folgendes: Meine Eltern haben sich auf dem BC kennengelernt, loyalere Studenten hätten Sie nie finden können. Jahr für Jahr haben sie wer weiß wie viel gespendet und freiwillig den Vorsitz mehrerer Komitees übernommen. Bei mir war es genauso, nachdem ich dort meinen Abschluss gemacht habe. Und dann, fünf Jahre später, bewirbt sich mein jüngerer Bruder. Er gehört zu den oberen zehn Prozent seiner Klasse, war Kapitän im Lacrosseteam, hat sich bei allen Aktivitäten engagiert. Alles in allem ein toller Junge, aber sie lehnen ihn ab. ›Wir haben so viele qualifizierte Bewerber aus Ihrer Gegend‹ – das war alles, was sie als Begründung angeben. Nach allem, was meine Eltern und ich geleistet haben! Tun Sie mir einen Gefallen. Vergessen Sie meine Nummer.«
Der Hörer wurde aufgeknallt – das war es mit dem Anruf. Gina musste schmunzeln. Wäre Christina noch einen Moment länger in der Leitung geblieben, hätte sie ihr Rob Mannions Nummer geben können. Die beiden hätten sich hervorragend verstanden.
Gina sah aus dem Fenster. Bislang nichts als Fehlanzeige. Peachtree City, Georgia, lautete die Adresse, die Rob für Catherine Ryan geliefert hatte. Als sie die Onlinedatenbanken der Gegend einsah, fand sie keine Catherine Ryan, die dem Alter der von ihr gesuchten Frau entsprochen hätte.
Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Falls Catherine Ryan tatsächlich die gesuchte CRyan war, könnte sie ihr ja noch etwas Zeit lassen, damit sie doch noch auf die von ihr hinterlassene Nachricht reagierte. Aber irgendwie hatte Gina das Gefühl, dass sie nicht lockerlassen durfte, dass sie eine andere Möglichkeit finden musste, um mit Catherine in Kontakt zu treten.
Rob hatte gesagt, sie würden ihre Informationen ständig aktualisieren, sofern die Ehemaligen neue Adressen und Telefonnummern zur Verfügung stellten. Hieß das, dass sie die alten Adressen dann löschten? Oder gab es vielleicht noch irgendwo am BC die Adresse von Catherines Eltern?
Sie ließ sich mit Rob verbinden, der sich beim ersten Klingeln meldete. Als sie sich vorstellte, reagierte er kurz angebunden. »Ich hab in nicht mal einer Minute einen Konferenzanruf.«
Es musste also schnell gehen. »Laut den Unterlagen, die Sie mir besorgt haben, befindet sich Catherine Ryans neueste Adresse in Georgia. Aber das scheint nicht mehr zu stimmen. Ich würde also gern ihre Eltern ausfindig machen. Haben Sie vielleicht noch deren Adresse, das heißt, die Privatadresse, als Catherine noch am College war?«
»Dazu muss ich den alten Datenbestand prüfen. Mal sehen, vielleicht finde ich sie noch, bevor die Konferenz beginnt.«
Sie hörte, wie er vor sich hin murmelnd Catherine Ryans Namen buchstabierte. Okay, hier ist es ja. 40 Forest Drive, Danbury, Connecticut.«
»Das war’s auch schon. Auf Wiedersehen.«
7
Online fand Gina einen Eintrag über einen Justin und eine Elizabeth Ryan in Danbury. Die Adresse stimmte mit der überein, die Rob ihr gegeben hatte. Sie waren fünfundsechzig und dreiundsechzig Jahre alt. Passte also zu Eltern, deren Tochter Anfang dreißig sein musste, dachte Gina. Ihre Intuition sagte ihr, dass es besser wäre, persönlich nach Danbury zu fahren und sie nicht übers Telefon zu kontaktieren.
Die Fahrt an dem kühlen Herbsttag verlief angenehm und wurde nicht von allzu viel Verkehr beeinträchtigt. Waze sei Dank, dachte sie, als die Navigations-App ihren Mietwagen durch die Stadt zu einer hübschen Vorortgegend im südlichen Connecticut mit exklusiven Häusern auf großen Grundstücken lotste.
Sie klingelte, eine weißhaarige Frau Ende sechzig kam an die Tür. Argwöhnisch beäugte sie zunächst Ginas Visitenkarte, taute aber auf und erläuterte schließlich, dass sie und ihr Mann vor nicht ganz einem Jahr das Haus von den Ryans gekauft hätten und nicht im Besitz von deren neuer Adresse seien.
So viel also zur Richtigkeit von Onlinedatenbanken, dachte Gina. Sie wollte schon gehen, als sie auf dem Nachbargrundstück ein zu-verkaufen-Schild entdeckte. Sie drehte sich noch einmal zur neuen Hausbesitzerin um, die in der Tür stand.
»Eine Frage noch. Haben Sie das Haus über einen Makler erworben?«
»Ja.«
»Erinnern Sie sich noch an dessen Namen?«
»Ja, ich kann Ihnen seine Karte geben.«
Laut dem Navigationssystem war das Maklerbüro eineinhalb Kilometer entfernt. Es war siebzehn Uhr. Gina hoffte, der Makler würde noch im Büro sein, während sie sich auf dem Weg durch die Stadt zusammenreißen musste, damit sie die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit nicht um mehr als zehn Stundenkilometer überschritt.
Das Büro lag an der Main Street, nebenan gab es eine chemische Reinigung, einen Feinkostladen, einen Friseur und ein Sportartikelgeschäft. Bilder von Häusern hingen im Schaufenster. Sie drückte im Stillen die Daumen und stellte erleichtert fest, dass sich die Tür öffnen ließ. Sie trat ein. Ein untersetzter Mann um die sechzig mit angehender Glatze kam ihr von einem hinteren Raum entgegen.
Er war offensichtlich enttäuscht, dass sie nicht auf Haussuche war, aber als sie die Ryans erwähnte, wurde er sehr redselig. »Eine nette Familie«, begann er. »Ich kenne sie schon, seit die Kinder noch ganz klein waren. Leider mussten sie wegziehen, mit Elizabeths Arthritis ist es immer schlimmer geworden. Sie haben was unternehmen müssen und sich umgesehen. Naples und Sarasota waren im Gespräch, schließlich sind sie in Palm Beach gelandet. Gute Entscheidung, wenn Sie mich fragen. Sie haben mir Bilder der Eigentumswohnung gezeigt, die sie kaufen wollten. Ich war nur ein paarmal dort, aber meiner Meinung nach haben sie sie für einen guten Preis bekommen. Alles frisch renoviert, große Räume, ein zweites Badezimmer neben dem Gästezimmer. Was will man mehr? Wirklich schade, dass sie hier weggezogen sind. Gute Leute, wenn Sie wissen, was ich meine.«
Der Makler musste Luft holen, was Gina die Gelegenheit bot, zu Wort zu kommen. »Können Sie sich zufällig noch an die Namen der Kinder erinnern?«
»Na, mal sehen. Ich werde ja langsam alt, früher waren die Namen immer sofort da. Aber mittlerweile dauert alles seine Weile.« Er runzelte die Stirn. »Einen Moment. Ich erinnere mich. Der Junge, das war Andrew. Und das Mädchen hieß Cathy. Zwei hübsche Kinder. Die müssen jetzt Ende zwanzig sein. Mal sehen. Ja, ich hab’s. Der Sohn heißt Andrew, und die Tochter Catherine. Sie haben sie Cathy genannt.«
»Wissen Sie noch, wie der Name buchstabiert wurde? Ich meine, mit einem C oder einem K?«
»Ja, das weiß ich. Mit einem C. C-A-T-H-E-R-I-N-E.«
CRyan, dachte Gina. Zumindest der richtige Buchstabe.
Drei Minuten später hatte sie die Adresse und die Telefonnummer der Ryans in Palm Beach.
Sie kehrte zu ihrem Wagen zurück, ließ den Motor an, wartete dann aber.
Statt sofort anzurufen – und das Risiko einzugehen, dass sie im Verkehrslärm nur schlecht zu verstehen war oder die Verbindung abbrach –, beschloss sie, so lange damit zu warten, bis sie zu Hause war. Die Rückfahrt von Danbury kam ihr länger vor als die Hinfahrt, auch musste sie sich eingestehen, dass sie früh aufgestanden und es für sie doch ein langer Tag gewesen war.
Um Viertel nach sieben war sie wieder in ihrer Wohnung. Dankbar schenkte sie sich ein Glas Wein ein, ließ sich im Essbereich nieder und griff zum Festnetztelefon.
Ein Mann meldete sich, als sie anrief. »Bei Ryans.«
Gina wiederholte, was sie bereits dem Immobilienmakler erzählt hatte – dass sie mit Cathy auf dem Boston College gewesen sei und sie gern sprechen wolle. Es folgte eine lange Pause, bevor Andrew Ryan fragte: »Waren Sie mit meiner Schwester befreundet?«
»Wir waren nicht eng befreundet, aber ich würde gern wieder den Kontakt mit ihr aufnehmen.«
»Dann wissen Sie also nicht, dass Cathy letzte Woche bei ihrem Urlaub auf Aruba durch einen Unfall ums Leben gekommen ist?«
Gina war wie vom Donner gerührt. »Nein, das wusste ich nicht. Das tut mir schrecklich leid.«
»Danke. Wir sind alle entsetzt. Mit so etwas haben wir doch nie gerechnet. Cathy war immer sehr vorsichtig, und sie war eine sehr gute Schwimmerin.«
»Ich würde Ihnen gern darlegen, warum ich anrufe. Vielleicht ist das jetzt kein guter Zeitpunkt dafür. Wenn es Ihnen recht ist, rufe ich später noch einmal …«
»Nein, schon okay. Wie kann ich Ihnen helfen?«
Gina zögerte nur kurz. »Ich bin Journalistin und wollte mit Cathy über eine Story reden, an der ich gerade arbeite. Zuerst eine Frage: Hat sie einmal bei REL News gearbeitet?«
»Ja.«
»Wie lange war sie da?«
»Drei Jahre. Dann hat sie gekündigt und eine feste Stelle bei einem Zeitschriftenverlag in Atlanta bekommen.«
»Wann haben Sie Cathy zum letzten Mal gesehen oder von ihr gehört?«
»Vor etwa zwei Wochen. Am Geburtstag unserer Mutter, da waren wir beide übers Wochenende in Palm Beach, um zu feiern.«
»An welchem Tag genau war das?«
Andrew Ryan antwortete. Gina rechnete kurz nach.
»Ich habe also am Geburtstag Ihrer Mutter eine E-Mail von Cathy bekommen. Ich möchte sie Ihnen vorlesen.«
Andrew hörte ihr zu. Gina erklärte, dass sie während der folgenden Zeit nicht erreichbar gewesen sei, Cathy aber vorgeschlagen habe, sich nach ihrer Rückkehr mit ihr zu treffen.
»Aber sie hat Sie nach Ihrer Mail nicht mehr kontaktiert?«
»Nein. Ich hab einiges unternommen, um sie ausfindig zu machen.«
Wieder folgte ein langes Schweigen. »Am Abend der Geburtstagsfeier hatte ich den Eindruck, dass etwas mit ihr nicht stimmt. Cathy war sehr still. Sie wollte mit mir über etwas reden, hat dann aber nur gesagt: ›Das machen wir, wenn ich aus Aruba zurück bin.‹ Sie wollte dort fünf Tage bleiben.«
»Wissen Sie, ob sie noch Kontakt zu Kollegen bei REL News hatte?«
»Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mit einigen in Verbindung geblieben ist.«
»Sie kennen nicht zufällig deren Namen?«
»Es gibt jemanden aus dem Großraum New York. Ihr Name ist mir aber entfallen. Vielleicht finde ich ihn. Ich bin nach dem Unfall nach Aruba geflogen und habe Cathys Habseligkeiten abgeholt, unter anderem ihr Handy und ihren Laptop. Ich sehe mal nach. Wenn ich den Namen vor mir sehe, erkenne ich ihn wieder.«
»Dafür wäre ich Ihnen sehr dankbar.«
»Geben Sie mir Ihre Nummer. Ich rufe Sie an, sobald ich was finde.«
Sie tauschten ihre Handynummern aus. Dann fragte Andrew: »Haben Sie irgendeine Idee, was meine Schwester mit diesem ›schrecklichen Erlebnis‹ gemeint haben könnte?«
»Noch nicht. Aber ich will es herausfinden.«
8
Nach dem Telefonat mit Andrew Ryan saß Gina lange nur da und ließ das Gespräch in Gedanken noch einmal Revue passieren. Sie hätte ihm gern noch weitere Fragen gestellt. Sie griff sich einen Block und machte sich Notizen.
Cathy hatte unmittelbar nach dem College bei REL News zu arbeiten begonnen. Zu diesem Zeitpunkt musste sie zweiundzwanzig gewesen sein. Laut ihrem Bruder war sie drei Jahre im Unternehmen geblieben. Das »schreckliche Erlebnis« hatte sich also zwischen ihrem zweiundzwanzigsten und fünfundzwanzigsten Lebensjahr zugetragen. Da war sie noch sehr jung und sehr verletzlich gewesen, dachte Gina.
Leider hatte sie vergessen, sich nach den Umständen ihres Unfalls zu erkundigen. Er hatte darauf hingewiesen, dass sie eine gute Schwimmerin gewesen sei – war etwas im Meer vorgefallen? Auf Aruba. War sie mit ihrem Freund dort gewesen? Mit Freundinnen? Allein?
Aruba, hatte da nicht auch Natalee Holloways Familie nur unter großen Schwierigkeiten herausfinden können, was sich ereignet hatte, nachdem ihre Tochter dort bei ihrer Highschool-Abschlussreise spurlos verschwunden war? Der Fall um die junge Frau hatte 2005 weltweit für Schlagzeilen gesorgt.
Hatte es irgendwelche Ermittlungen zu Cathys Tod gegeben? Und falls es kein Unfall gewesen war, wie sollte sie dem nachgehen?
Gina schob den Stuhl zurück und stand auf. In zwanzig Minuten war sie mit Lisa im Bird’s Nest verabredet, wie ihr erst jetzt wieder einfiel.
Sie eilte ins Schlafzimmer, um sich rasch umzuziehen. Sie griff sich eine schwarze Freizeithose, ein schwarzes Tanktop und ihre schwarz-weiß bedruckte Lieblingsjacke und verließ die Wohnung.
Die U-Bahn-Fahrt ins West Village dauerte nur zwanzig Minuten. Als sie ins Restaurant kam, saß Lisa schon an einem kleinen Tisch mit Blick auf die Bar.
Lisa sprang auf. »Du hast mir gefehlt«, begrüßte sie sie. »Falls du dich wunderst, warum ich diesen Tisch genommen habe: Ich möchte den Barkeeper im Auge behalten und sehen, ob wieder Eiswürfel auf dem Boden landen.«
»Und? Sind schon welche runtergefallen?«, fragte Gina.
»Bislang nicht. So, Schluss jetzt mit den Eiswürfeln. Erzähl mit bei einem Glas Wein von Nepal.«
»Da würde eine ganze Flasche nicht reichen. Also, die Reise nach Nepal war fantastisch. Es hat meinem Vater ausgesprochen gutgetan, wieder unter den alten Freunden zu sein. Der Tod meiner Mutter belastet ihn nach wie vor sehr.«
»Verständlich«, sagte Lisa. »Ich hab deine Mutter auch gemocht.«
Gina nahm einen Schluck vom Wein, zögerte, dann sagte sie: »Am Tag der Abreise nach Nepal hab ich eine Mail bekommen, aus der sich vielleicht mein nächster Artikel ergeben könnte.« Sie setzte Lisa ins Bild.
»So ein tödlicher Unfall«, sagte Lisa, »ist, um es mal ganz krass zu sagen, ein ziemlicher Glücksfall für denjenigen, der sich mit ihr außergerichtlich einigen möchte. Vielleicht etwas zu glücklich?«
»Genau das hab ich mir auch gedacht. Natürlich könnte es ein unglücklicher Zufall sein. Andererseits ist es ausgerechnet dann geschehen, als Cathy Ryan mir die Mail geschickt hat.«
»Was hast du als Nächstes vor?«
»Ich brauche noch das Okay von meinem neuen Boss, um nach Aruba zu fliegen und dort selbst zu recherchieren.«
»Kommt die Zeitschrift für deine Ausgaben auf?«
»Das werde ich diese Woche herausfinden.«
Lisa lächelte. »In meinem nächsten Leben will ich deinen Job.«
»So, das reicht jetzt von mir. Wie läuft’s bei dir so?«
»Wie immer, mehr oder minder. Ich versuche aus Unfällen Kapital zu schlagen.« Lisa erzählte von den jüngsten Fällen, die sich seit ihrem letzten Treffen ergeben hatten. Eine Mandantin, die sich auf der Fifth Avenue eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen hatte, nachdem ihr von einem Baugerüst ein Trümmerteil auf den Kopf gefallen war. »Mittlerweile, nach der Aufmerksamkeit, die das Thema durch die Footballspieler bekommen hat, wird für Gehirnerschütterungen mehr gezahlt. Eine einfache Sache also.« Ein weiterer Mandant hatte sich in der Drehtür eines U-Bahn-Ausgangs verletzt. »Die Tür hat auf halbem Weg blockiert. Mein Mandant ist dagegen geknallt und hat sich die Nase gebrochen. Er schwört hoch und heilig, nüchtern gewesen zu sein. Trotzdem frage ich mich natürlich, was er bis drei Uhr morgens so getrieben hat, wenn er nicht getrunken hat.«
Lisa sah zur Theke, als sie hörte, wie ein Drink gemixt wurde. »Bislang keine Eiswürfel auf dem Boden«, bemerkte sie mit einem schiefen Lächeln.
9
Am nächsten Morgen wurde Gina um zehn vor sieben von ihrem klingelnden Handy aus dem Schlaf gerissen. Sie streckte sich und versuchte die Augen offen zu halten. Das Display zeigte den Namen Andrew Ryan an.
»Ich rufe hoffentlich nicht zu früh an«, sagte er. »Ich bin kurz vor dem Boarding zu meinem Flug nach Boston und wollte noch mal auf unser gestriges Gespräch zurückkommen.«
»Kein Problem«, sagte Gina und griff zu ihrem Notizbuch, das sie immer auf dem Nachtkästchen liegen hatte. »Danke, dass Sie sich so schnell gemeldet haben.«
»Meg Williamson gehört zu den Kollegen von REL News, zu denen Cathy noch Kontakt hatte.«
»Meg Williamson«, wiederholte sie und notierte sich den Namen. »Haben Sie irgendwelche Kontaktdaten?«
»Nein, ich konnte sie nicht auf Cathys Computer oder Handy finden. Der Name ist mir gerade auf dem Weg zum Flughafen eingefallen. Wenn ich in Boston bin, rufe ich meine Mutter an, vielleicht weiß sie mehr.«
»Das wäre toll. Ist Ihnen sonst jemand bei REL News eingefallen, zu dem Cathy noch in Verbindung stand?«
»Nein, aber ich werde meine Mutter darauf ansprechen.«
»Nochmals vielen Dank. Wenn Sie noch Zeit haben, würde ich Ihnen gern ein paar Fragen stellen, die mir nach unserem Gespräch in den Sinn gekommen sind.«
»Ich hab noch ungefähr fünf Minuten. Schießen Sie los.«
»Ist Cathy allein oder mit Freunden nach Aruba geflogen?«
»Allein.«
»Wissen Sie vielleicht, ob sie sich dort mit jemandem treffen wollte?«
»Soweit ich weiß nicht. Sie wollte einfach nur ausspannen, allein.«
»Aruba ist ziemlich weit weg für ein paar Tage Urlaub. Irgendeine Vermutung, warum sie die Insel gewählt hat?«
»Nein. Aber sie hat das Wasser geliebt und alles, was man dort machen kann. Tauchen, Schnorcheln, Windsurfen.«
»Sie haben gesagt, Cathy sei bei einem Unfall ums Leben gekommen.«
»Ja, beim Jetski-Fahren.«
»Was ist passiert?«
»Die Polizei auf Aruba hat einen Tag nach dem Unfall meine Eltern angerufen und erzählt, Cathys Jetski wäre im Hafen gegen ein Boot gekracht. Sie wurde dabei abgeworfen.«
»Ist sie ertrunken oder an den Folgen des Zusammenpralls gestorben?«
»Das ist nicht klar geworden.«
»Ich frage nur ungern – aber haben Sie eine Autopsie durchführen lassen?«
»Nein. Wir haben darum gebeten. Aber als wir erfahren haben, dass das zwei bis drei Wochen dauern würde, haben wir uns dagegen entschieden. Ich weiß nur, dass sie massive Kopftraumata erlitten hat. Durch den Zusammenstoß ist sie höchstwahrscheinlich bewusstlos geworden. Cathy hat eine Rettungsweste getragen, aber mehrere Minuten mit dem Gesicht nach unten im Wasser gelegen, bevor sich jemand um sie kümmern konnte.«
»Verzeihen Sie mir die Frage, aber wissen Sie, ob man Alkohol in ihrem Blut festgestellt hat?«
»Laut dem Polizeibericht hat man an der Leiche starken Alkoholgeruch wahrgenommen.«
»Hatte sie Alkoholprobleme?«
»Auf keinen Fall. Sie hat nur in Gesellschaft getrunken. Ein oder zwei Drinks, wenn sie sich mit jemandem getroffen hat. Gelegentlich drei. Ich hab sie nie betrunken erlebt.«
Gina nahm sich vor, eine befreundete Pathologin darauf anzusprechen.
»War sie allein oder in einer Gruppe unterwegs?«
»Es war eine Tour. Drei oder vier andere Jetski plus einem Guide.«
»Wissen Sie, ob die anderen Tourteilnehmer von der Polizei befragt wurden?«
»Angeblich ist das geschehen. Nach dem Polizeibericht hätten alle gestanden, beim Lunch etwas getrunken zu haben.«
Gestanden, dachte sich Gina. Es klang, als hätten sie etwas Ungesetzliches getan.
»Hat die Polizei mit dem Jetski-Verleih gesprochen?«
»Ja. Natürlich hat der Verleiher behauptet, seine Geräte seien in vorbildlichem Zustand gewesen.«
»Haben Sie selbst mit dem Verleiher gesprochen?«
»Nein. Ich war doch wie gelähmt. Es ist schrecklich, wenn man Schubladen öffnen und die persönlichen Gegenstände seiner Schwester in einen Koffer packen muss. Mit dem Verleiher zu reden wäre das Letzte gewesen, was ich gewollt hätte.«
»Das kann ich gut verstehen. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Ihnen diese Fragen stelle.«
»Schon okay. Machen wir weiter.«
»Hat jemand nach dem Unfall den Jetski untersucht?«
»Danach habe ich nicht gefragt. Ich weiß nicht, ob irgendein Gutachter einen Blick darauf geworfen hat.«
»Wird im Polizeibericht irgendwie erklärt, was sich abgespielt haben könnte?«
»Der Unfall wird auf einen Bedienfehler zurückgeführt. Angeblich soll Cathy in Panik geraten sein, nachdem sie den Gashebel unabsichtlich auf volle Leistung gestellt hat. Verschlimmert wurde das wohl noch, weil sie kurz vor dem Unfall in kurzer Zeit eine große Menge Alkohol zu sich genommen haben soll.«
»Haben Sie eine Kopie des Polizeiberichts?«
»Ja, den hab ich.«
»Wären Sie vielleicht bereit, ihn mir zukommen zu lassen?«
»Ja. Ich hab den Bericht eingescannt. Schicken Sie mir Ihre Mailadresse per SMS, und Sie bekommen von mir den Bericht.«
»Hilfreich wäre auch, wenn Sie mir einige aktuelle Fotos von Cathy schicken könnten.«
»Mal sehen, was sich finden lässt. Glauben Sie wirklich, dass Cathys Tod kein Unfall war?«
»Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Ich kann Ihnen nur eines sagen: Ich mag keine Zufälle. Ein großes Unternehmen hat mit ihr verhandelt, um mit ihr eine Einigung zu erzielen, vielleicht wurde sie auch unter Druck gesetzt. Vielleicht hat sie gezögert und abgeblockt. Und plötzlich stirbt sie bei einem Unfall. Meiner Meinung nach ist das zu viel des Zufalls.«
»Mein Gott, wenn ich mir vorstelle, dass jemand meine Schwester umgebracht hat. Mein Abschnitt wird gerade zum Boarding aufgerufen. Wir sprechen uns wieder, ganz bestimmt.«
»Ja. Haben Sie einen guten Flug.«
Das Gespräch war beendet.
10
Nach dem Duschen und Ankleiden ging Gina mit dem Laptop unterm Arm zu Starbucks an der Ecke und bestellte sich einen Vanilla Latte. Wenn sie an ihren Artikeln schrieb, zog sie die Ruhe und Abgeschiedenheit ihrer Wohnung vor. Aber wenn sie Mails beantwortete und recherchierte, genoss sie die Hintergrundgeräusche eines Cafés.