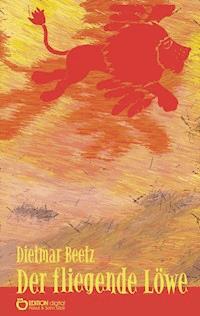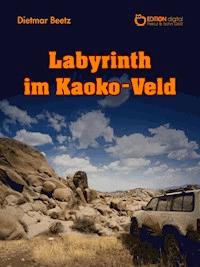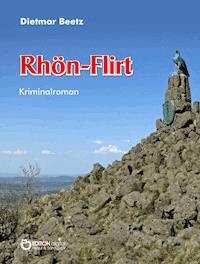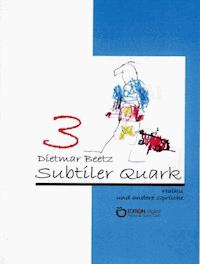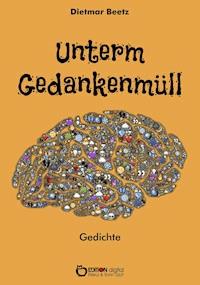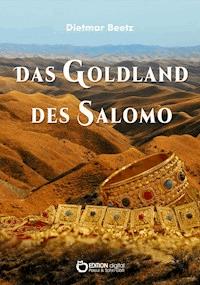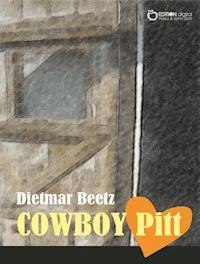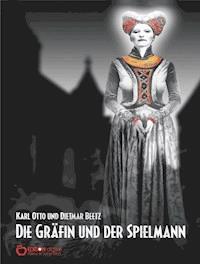8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Als Pieter Koopgaard seine Herde heim nach Rehoboth treibt, ist die Straße menschenleer. Der Hund wittert unruhig. Sollte ein Leopard in der Nähe sein? Im Westen steht eine dunkle Wolkenmauer. Vielleicht hat sie die Leute vertrieben. Dann erfährt Pieter, dass Deutsche im Dorf sind, dass sie den Boten Hendrik Witboois gefangen haben. Pieter fühlt sich schuldig. Er hat dem Boten gesagt: „Die Schnurrbärte? Die sind weit weg.“ Pieter muss versuchen, den Nama zu befreien. Und wenn es nicht gelingt, wird er an seine Stelle treten. Als Späher der Witbooi-Krieger nimmt er am Kampf der Deutschen gegen die Witbooi in Deutsch-Südwestafrika Ende des 19. Jahrhunderts teil, als Bastard von den Deutschen verachtet, als Verräter von den meisten Witbooi bekämpft. INHALT: Der dreifache Bastard Beschützer und Schutzbefohlene Empfang in Hoornkrans Ohne Kriegserklärung Am "letzten Zufluchtsort“ Als Späher in Windhoek In Swakopmund und Walvisbaai Im Engpass von Horebis Pazifizierung Späher oder ...? Krieg in der Noukloof Anfang im Ende
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum
Dietmar Beetz
Späher der Witbooi-Krieger
ISBN 978-3-95655-183-3 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1978 im Verlag Neues Leben Berlin (Band 145 der Reihe „Spannend erzählt“).
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2014 EDITION digital® Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Erster Teil
Der dreifache Bastard
1
Über die Ebene nördlich von Rehoboth, quer durch das frische, kniehohe Gras, kam an diesem Nachmittag Ende März achtzehnhundertdreiundneunzig eilig ein Mann geritten. Sein Pferd, ein Rappe mit einer Blesse, trabte, hinter sich eine Staubfahne, geradewegs auf die Ortschaft zu; doch als der Reiter seitab eine Herde bemerkte, änderte er kurz entschlossen die Richtung.
Währenddessen döste der Hirt, ein siebzehnjähriger Bursche, im Schatten unter einem breitkronigen Dornbaum. Gelangweilt schaute er, die Lider zu einem Spalt verkniffen, in die überhängenden Zweige, schaute vorbei am reglosen Laub zum Himmel, der blau war und flimmernd vor Hitze und kaum mehr bewölkt. Nur links, im Westen über den fernen Bergen, ballte es sich auch heute wieder dunkel, und von Zeit zu Zeit drang dumpfes Grollen herüber. Nah hechelte der Hund, schnauften die Ochsen und Kühe beim Wiederkäuen, sirrten in Schwärmen die Mücken über den gesättigten Leibern der Rinder, und manchmal schlug eins der Tiere klatschend mit der Schwanzquaste zu. Sonst war es still ringsum - eine lastende Stille.
Und genauso bedrückend, so gleichförmig und lähmend fand Pieter Koopgaard, der Hirt, zu dieser Stunde sein gesamtes Dasein. Ihm erschien heute alles wie gestern und vorgestern, alles wie immer am Ende der Regenzeit, und er glaubte, auch künftig werde sich daran nichts ändern. Nichts oder nur wenig. Bis an sein Lebensende müsste er Vieh hüten, die Ochsen von Onkel Willem oder die Kühe von einem anderen Reichen aus Rehoboth. Vielleicht kämen mit der Zeit ein paar eigene Rinder dazu, eine Frau und Kinder. Vielleicht. Und das wäre schon viel, mehr als ein besitzloser Bastard ohne Weiteres erwarten konnte.
Zwiefacher Bastard, ging es Pieter durch den Sinn, und wie immer, wenn ihm seine Herkunft bewusst wurde, verspürte er bitteren Groll auf alle Welt: auf den Vater, den er nicht kannte, auf die Mutter, die wie ihr Sohn unter der Verachtung der Rehobother litt, auf all diese biederen Heuchler.
Riefen ihn „Hottentott!“ und waren doch selber zu einem guten Anteil Nama! Glaubten, weißer zu sein als der Bure, der irgendeiner ihrer entfernten Vorfahren gewesen war. Die stolze Bastardnation! Dabei sah manch einer von ihnen mindestens so hottentottisch aus wie er, Pieter Koopgaard.
Er seufzte und schloss die Augen.
Fortgehn, dachte er, irgendwohin, am besten zu den Witboois ...
Der Hund neben ihm fing zu knurren an, doch Pieter achtete nicht darauf. Zu heftig beschäftigte ihn der Wunsch, seine Herkunft, seine gesamte Existenz abzustreifen wie eine schmutzige Kluft, endlich frei zu sein von allem, was ihn seit der Kindheit beengte; und wie immer, wenn er solchen Fluchtplänen nachhing, tauchte aus dem Unterbewusstsein, kaum eingestanden, die Sehnsucht, dort beim Stamm der Witboois den Vater wiederzufinden. Er ahnte, wie wenig Aussicht diese Hoffnung hatte; soweit er zurückdenken konnte, erklärte die Mutter, sein Vater sei tot. Und doch schien es Pieter, als warte sie gleichfalls, als halte sie manchmal Ausschau wie er.
Auch jetzt sah er hinter den geschlossenen Lidern einen Mann mit verschwimmenden Gesichtszügen und dem weißen Hut der Witboois, und als plötzlich der Hund neben ihm zu kläffen begann und Pieter die Augen aufriss, meinte er im ersten Moment, zu träumen oder eine Fata Morgana zu sehn.
Auf einem Rappen mit einer Blesse, den weißen Hut tief in der Stirn, kam ein Mann, unverkennbar ein Witbooi, geradewegs auf ihn zugeritten. Die Augen im verschwitzten, staubverkrusteten Gesicht des Fremden blickten aufmerksam - abschätzend, wie es Pieter schien. Wenige Schritte vor ihm glitt der Reiter aus dem Sattel und grüßte.
Jetzt erst sprang Pieter auf die Beine, und mit einem kurzen Ruf brachte er den Hund zum Verstummen.
„Der gehorcht ja aufs Wort!“, sagte der Fremde anerkennend, und da Pieter ihn erneut anzustarren begann, fragte er nach einer Weile, während er den Zaum des Pferdes lockerte: „Schwül heute, was?“
„Ja, sehr schwül“, beeilte sich Pieter zu bestätigen. „Aber Wasser ist da.“
„Gute Idee“, sagte der Fremde, und er ging, sein Pferd am Zügel,hinüber zum Zaun aus Dornengestrüpp, der rings um die Quelle errichtet worden war. Am Trog unter der hölzernen Rinne nahm er den Hut ab und wusch sich prustend Gesicht und Nacken, bevor er den Rappen saufen ließ. Dann trank er in langen Zügen aus dem Ledereimer, den Pieter inzwischen hinter der Hecke gefüllt hatte. Die ganze Zeit über fiel kein einziges Wort; nur der Hund knurrte drohend.
„Du kannst mich wohl nicht leiden?“, fragte der Fremde lachend.
„Ach, der ...“, erwiderte Pieter rasch, und er verscheuchte den Hund. Und ging dann, zu seiner eigenen Verwunderung steifbeinig, neben dem Fremden her, zurück in den Schatten.
„Oder meint er den Hut?“, fragte plötzlich der Witbooi. „Als echter Rehobother Hund hat er vielleicht was gegen weiße Hüte?“
„Kann sein“, gab Pieter zu. „Ist halt ein dummer Köter.“
„Und die Rehobother? Euer kluger Kapitän und seine schlauen Ratsherren?“
„Die!“, entfuhr es Pieter. Er hatte den Unterton wohl bemerkt, doch war er jetzt zu aufgeregt, als dass er zurückhaltend bleiben oder besonnen hätte reden können. Wie ein Gewitter entlud sich sein Unbehagen, der seit Jahren angestaute Zorn und Hass.
„Diese Heuchler!“ stieß er hervor. „Dieses biedere, verlogene Pack! Spielt sich auf als Vermittler zwischen den Nama und den Herero und schielt insgeheim zu den Deutschen! Möchte mit den schnurrbärtigen Teufeln paktieren, am liebsten alle übertölpeln! Glaubt, wer weiß wie klug zu sein, und wird am Ende zwischen den Fronten zerrieben.“
Jäh, wie er begonnen hatte, verstummte Pieter. Und starrte, auf der Stirn eine Kerbe, düster vor sich hin.
Der Hund, der mittlerweile schwanzwedelnd zurückgekommen war, hatte sich beim Ausbruch seines Herrn knurrend geduckt, doch weder der Fremde noch Pieter beachteten ihn. Auch das Grollen hinter den Bergen im Westen schienen sie nicht zu bemerken.
„So also sieht das aus“, sagte der Witbooi nach geraumer Zeit wie in Gedanken.
Als habe man ihn geweckt, schreckte Pieter auf. Er schaute den Fremden rasch von der Seite her an, blickte dabei in ein Paar prüfende, lauernde Augen und zuckte, plötzlich hellwach, mit den Schultern.
„Tja“, sagte der Fremde, während er sich erhob, „da werd ich mal weiterreiten. Mal sehn, wie mich deine Obersten empfangen. Falls sie überhaupt noch bereit sind, einem Witbooi die Tür zu öffnen, und nicht zufällig gerade durch andere Gespräche zu sehr beschäftigt ...“ Die letzte Bemerkung, so leichthin sie gesprochen war, klang wie eine Frage; Pieter bemerkte es wohl. Aber er bereute bereits seine Offenheit, und zugleich bedauerte er, bald erneut allein zu sein, die Stunden bis zum Abend nur in Gesellschaft eines hechelnden Hundes und wiederkäuender Rinder.
Indem er gleichfalls aufsprang, sagte er rasch: „Alle Rehobother sind nicht wie Hermanus und seine Leute. Wirklich!“
„Weiß ich ja“, erwiderte der Witbooi. „Schließlich bist doch auch du ein Bastard. - Etwa nicht?“
„Doch, schon“, gab Pieter finster zu, und er verfluchte das Blut, das ihm eben wieder einmal verräterisch ins Gesicht geschossen war, und überlegte atemzuglang, ob er diesen Fremden fragen, ihm sich anvertrauen sollte. Vielleicht kannte er einen Mann namens Josef, Hendriks Kurier vor vielen Jahren, den Gesandten zu einer Zeit, als der Kapitän erst wenig Einfluss besaß und die Stämme noch zerstritten waren; vielleicht ...
Doch Scheu und die Angst vor einem endgültigen Bescheid hielten Pieter zurück. Ohne Übergang sagte er: „Wir, ich und die meisten Rehobother Burschen, auch einige von den Alten, denken anders über Hendrik und den Vertrag, wirklich ganz anders.“
„Und wie?“, fragte, scheinbar gleichmütig, der Witbooi. „Wie denkt denn ihr über unsern Kapitän und seine Verhandlungen?“
„Na, dass sie gut waren, dass sie nützlich sind, ein großartiger Anfang! Nur müsste man jetzt weitergehn, sich zusammentun und die verdammten Schnurrbärte zum Teufel jagen, heim zu ihrem Kaiser! Was haben die in unserm Land zu suchen? Schutzherrschaft! Solche Beschützer brauchen wir nicht!“
Wieder knurrte drohend der Hund, und sogar einige der Ochsen und Kühe erhoben sich und glotzten großäugig herüber.
„Macht noch die Herde rebellisch“, sagte lachend der Witbooi nach einem raschen Blick in die Runde. „Mit solchen Reden …“
„Na, ist doch wahr!“, rief Pieter.
Erneut und diesmal näher grollte es im Westen, und einer der Ochsen begann verstört zu brüllen.
„Hör zu, Hirt! - Wie heißt du eigentlich?“
Mürrisch nannte Pieter seinen Namen.
„Koopgaard? Ach, wohl der Sohn von Willem?“
„Nein, der Neffe. Warum?“
„Hör zu, Pieter! Solche Reden - was soll das? Taten sind erforderlich - zur richtigen Zeit. Dein Geschrei braucht bloß einer aufzuschnappen und Hermanus zu hinterbringen, ihm oder den Deutschen ...“ Er verstummte vielsagend.
Pieter zuckte mit den Schultern. „Hermanus“, sagte er geringschätzig. „Der hat doch Angst vor allen, am meisten vor uns, die wir anderer Meinung sind als er. Und die Schnurrbärte? Die sind zum Glück weit weg in ihrem Windhoek. Noch!“
Der Witbooi nickte, als habe er gerade auf diese Auskunft gewartet.
„Schön“, sagte er und bückte sich nach dem Zügel seines Pferdes, das ihm selbst beim Grasen nicht von der Seite gewichen war.
„Schön?“, fragte Pieter irritiert, doch der Fremde ging darauf nicht ein. Einen Atemzug lang fixierte er einen Punkt am hitzeflimmernden, dunstverschleierten Horizont.
„Hoffen wir“, sagte er dann, „dass die Schnurrbärte in Windhoek bleiben. Und dass bald mal auch dort der Teufel sie holt! Ich dank dir, Pieter Koopgaard.“
Und der Witbooi schwang sich in den Sattel, legte grüßend zwei Finger der rechten Hand an den Hut und drückte seinem Pferd die Hacken in die Flanken. Hinter sich eine Wolke aus gelbbraunem Staub, trabte der Rappe davon, hinüber nach Rehoboth.
2
Stunden später brach auch Pieter auf. Er hatte die Rinder am Trog unter der hölzernen Rinne getränkt, hatte mithilfe des Hundes ein paar frischmelkende Kühe getrennt von der Herde, die wie meist über Nacht in einen Kral gesperrt worden war. Nun trieb er die Kühe heimwärts, trottete, neben sich den Hund, hinter ihnen her, bewegte sich kaum anders als das Vieh auf die Ortschaft zu.
So war er gestern heimgekehrt und vorgestern, so ähnlich nun schon seit mehr als drei Jahren beinah Abend für Abend, und zu dieser Stunde ahnte er noch nicht im entferntesten, dass er heute zum letzten Mal so zurück nach Rehoboth kam.
Wie immer zog es ihn nicht gerade nach Hause, nicht in den Pontok, den er mit der Mutter bewohnte, und schon gar nicht ins übrige Dorf. Da wie dort erwartete er nichts Besonderes, im günstigsten Fall die übliche Langeweile, mochte er nun zum Teich gehn oder auf den Platz vor dem Missionsgehöft, wo er manchmal mit anderen Burschen palaverte, oder gleich daheimbleiben, der Mutter zuliebe.
Die Mutter! Sicher stand sie bereits vor der Tür und hielt besorgt nach ihm Ausschau, bereit, sein Murren und den Spott der Nachbarn zu ertragen, demütig wie meist und schweigend.
Allein diese Vorstellung trieb Pieter das Blut zu Kopf, und er schlug, der plötzlichen Wallung folgend, blindlings mit der Peitsche auf das Hinterteil der nächstbesten Kuh. Sofort schoss der Hund, als habe er bloß darauf gewartet, vor und schnappte kläffend nach den Hufen, die ein paar Schritte sich rascher bewegt und dabei den Staub des zerstampften Weges aufgewirbelt hatten.
Verdammter Dreck! dachte Pieter. Und diese Schwüle! Wenn nur endlich das Gewitter käme!
Doch die Wolken im Westen, eine dunkle Mauer, standen unbewegt. Hinter ihnen war bereits, wie abgeschnitten, ein Teil der Sonne verschwunden, und ihr Rest verbreitete einen blutroten Schein. Der übrige Himmel hatte sich mit Dunst überzogen, und selbst die Luft ringsum erschien Pieter verschleiert.
Wie durch einen Vorhang erblickte er im Halbkreis zwischen den Baum- und Buschgruppen und den Felsbrocken vereinzelt dünne Staubfontänen. Auch dort kamen Hirten von der Weide, und bald hörte Pieter das Kläffen ihrer Köter, in das sein eigener Hund begeistert einfiel.
„Ist ja schon gut“, sagte er. „Gleich kannst du dich rumbalgen.“
Doch der Hund ließ sich nicht beschwichtigen, im Gegenteil, und jetzt wurden sogar die Kühe unruhig, und eine von ihnen begann dumpf und lang gezogen zu brüllen.
Was sie bloß haben? überlegte Pieter. Ob sie was wittern? Einen Leoparden?
Unsinn! sagte er sich gleich. Ein Leopard zu dieser Tageszeit!
Trotzdem schaute er, als sie den lichten Akazienwald durchquerten, aufmerksamer als sonst in die Runde und horchte angestrengt auf jedes Geräusch, und allmählich ergriff auch ihn eine Unruhe, die er sich nicht erklären, die er nur mühsam bezähmen konnte.
So erreichte er den Dorfrand und sah im Schein der untergehenden Sonne, rötlich angestrahlt, die hellen Häuser und die dunkleren Pontoks und dahinter den Wall der nahen Berge. Alles war wie immer gegen Abend, und dennoch fehlte irgendetwas.
Die Menschen! ging es Pieter durch den Sinn. Ganz Rehoboth - wie ausgestorben. Nur dieses grässliche Gekläff ...
Getrieben von wachsender Unruhe, öffnete er den Kral neben dem Hof seines Onkels, einem der ersten am Weg. Dabei warf er einen Blick hinüber zum Gehöft: zum flachen Haus mit den verhangenen Fensterhöhlen beiderseits der Tür und zum Mantjespontok, der Hütte aus Binsenmatten, die gleichfalls verlassen wirkte. Währenddessen drängten die Kühe durch die Lücke im Zaun, und dann standen sie auf der Koppel und glotzten. Hastig schloss Pieter das Tor.
Der Hund war mittlerweile davongerannt, hatte sich wahrscheinlich dem Rudel angeschlossen, das gerade in der Staubwolke auf dem Platz oben vor dem Missionsgehöft verschwand. Dort schien sich das Gekläff zu ballen, und es steigerte sich noch, bis plötzlich aus dieser Richtung, scharf wie ein Peitschenknall, ein Schuss zu hören war.
Unwillkürlich zuckte Pieter zusammen und schaute sich um. Und da erblickte er in der Fensteröffnung links neben der Tür ein neugieriges Gesicht und einen gereckten Hals und erkannte Dirk, seinen Vetter, und vernahm im selben Moment die herrische, befehlende Stimme des Onkels.
„He!“, rief Pieter. „Was ist im Dorf eigentlich los?“
Statt eine Antwort zu geben, ballte der Vetter die Faust, und gleich darauf war sein Gesicht vom Fenster verschwunden, zurückgetaucht ins Dunkel der Stube.
Dann eben nicht, sagte sich Pieter.
Wütend überquerte er den Dorfweg, auf dem wieder das Rudel - eine kläffende Wolke aus Staub und wirbelnden Läufen - erschienen war. Einer der Köter schleppte sich hinkend weit hinter den anderen her.
Armes Tier, dachte Pieter. Auf einen Hund zu schießen ... Möchte bloß wissen, was das alles zu bedeuten hat.
Flüchtig erinnerte er sich an den Witbooi, den Reiter, dem er am Nachmittag auf der Weide begegnet war; aber einen Zusammenhang sah er nicht. Noch im Dezember waren ja Hendrik und seine Leute zu Dutzenden in Rehoboth erschienen, und keiner der Bastards hatte sich vor ihnen verkrochen. Weshalb also wagten sie sich heute nicht aus dem Haus? Woher kam diese Spannung, das Schweigen, das wie ein Gewitter über dem Dorf hing?
Auch der Hirt, der gerade drüben am Teich ein paar Kühe vorbeitrieb, beeilte sich offenbar wie auf der Flucht vor einem Unwetter. Trotzdem war Pieter einen Augenblick lang versucht, hinüberzurennen und ihn zu fragen.
Unsinn, sagte er sich dann. Der weiß bestimmt nicht mehr als ich; der kommt ja genauso von draußen.
Und während er weiterging, in der hereinbrechenden Dämmerung heimwärts, wurde ihm erneut bewusst, wie fremd er in Rehoboth war. Geradezu feindselig erschienen ihm die Gehöfte rechts und links des gewundenen Pfades, kaum einladend auch die Hütten dazwischen und selbst die Pontoks. Keins dieser Gebäude konnte oder mochte er jetzt betreten; in jedem würde man ihn abweisend behandeln, wie einen Eindringling.
Einen Atemzug lang versuchte Pieter, sich diese Empfindung auszureden, sie als Einbildung abzutun. Vergebens. Zu tief saßen in ihm die Eindrücke seiner Kindheit, bittere Erfahrungen, soweit er zurückdenken konnte.
Da war er einmal, vielleicht fünf Jahre alt, der Aufsicht der Mutter entwichen und hinter Dirk und anderen, älteren Jungen hergelaufen. Hier am Teich holte er sie ein, und Jan Matros, der Anführer, entdeckte ihn.
„Wozu bringst du deinen Hottentottenvetter mit?“, fragte er Dirk, und bevor der protestieren konnte, rief Jan: „Los, taufen wir ihn! Machen wir aus dem Söhnchen einen Jungen!“
„Taufen!“, grölte die Meute, „taufen!“, überschrie alle anderen Dirk, und eh sich Pieter versah, hatte Jan ihn gepackt und in das schlammige Wasser gestoßen. Er wehrte sich, strampelte und brüllte. Vergebens. Wieder und wieder tauchte ihn ein Dutzend Hände in die lehmige Brühe, und als er endlich heulend ans Ufer kroch, übergoss der Hohn seiner Peiniger, ihr Gelächter, wie ein Kübel Unrat auch Dirk.
„Hast einen schönen Vetter!“, rief Jan. „Ein hübscher kleiner Koopgaard ... Da wird sich die vornehme Familie aber freun!“ Und Dirk, selber triefend und schmutzig, schrie: „Verschwinde, dreckiger Hottentott! Wenn du mir noch einmal nachläufst, schlag ich dich tot!“
Verwirrt und entsetzt schlich Pieter zurück zum Gehöft des Onkels, wo die Mutter, eine bessere Magd, gerade Kühe molk. Bei ihr wollte er Trost suchen, vielleicht auch eine Erklärung für das Unfassbare, das ihm eben widerfahren war. Als er im Kral erschien, sprang sie auf und stürzte ihm entgegen.
„Was ist passiert? Wo warst du? Tut’s hier weh? Und hier?“
Und erst, nachdem sie sich überzeugt hatte, dass er heil war an Kopf und Leib, an Armen und Beinen, schien sie sein Gestammel zu begreifen, und plötzlich schlug ihre Erleichterung um in Zorn, in blinde Wut.
„Bestien!“, schrie sie. „Heuchler! Schon die Kinder ... Diese Brut! Sich mit denen einzulassen!“
Und dieselben Hände, die Pieter eben noch besorgt und fahrig abgetastet hatten, misshandelten ihn nun wie nie zuvor und wie auch später nicht wieder.
Irgendwann kam der Onkel dazu und riss die Mutter weg.
„Bist du verrückt? Willst du ihn umbringen?“
Da war es, als erwache sie aus einem Rausch, als breche etwas in ihr entzwei. Sie warf sich auf die Erde, mitten in den zerstampften Kot, und ihre Schultern zuckten.
„Steh auf!“, sagte der Onkel. „Wenn dich jemand sieht …“
Doch die Mutter, sonst immer gefasst, peinlich auf Haltung, auf saubere Kleidung bedacht, krümmte sich und wimmerte und schluchzte hemmungslos.
„Verhöhnt haben sie ihn, beinah ertränkt im Teich. Auch dein Dirk ... Kinder ... Bestien sind das, wilde Tiere! Wie die Alten! Was kann denn er dafür? Ist es nicht genug, wenn ich ..., wenn sie mich ...?“
„Steh endlich auf!“, herrschte der Onkel sie an. „Das hättest du früher wissen müssen. Eine Koopgaard ... Ach!“
Und mit einem Blick, den Pieter nie vergessen wird, streifte er ihn, seinen Neffen, bevor er davonstampfte und gebückt im Haus verschwand.
Damals, vor elf Jahren etwa, verstand Pieter weder den Kummer der Mutter noch den Zorn des Onkels. Erst später begriff er, dass er unerwünscht war, dass seine Existenz von der gesamten Familie als Schande, als ständige Demütigung empfunden wurde, und da verschloss er sich und wurde selber abweisend.
Nur zur Mutter fühlte er sich mitunter hingezogen. Er wusste, dass sie litt wie er, und diese Gemeinsamkeit half ihm, die Abneigung der Rehobother zu ertragen, und bestärkte ihn in seinem Trotz gegenüber dem Dorf.
So ging er auch heute vorbei an den Gehöften, ohne anzuklopfen, ging erhobenen Hauptes durch das Schweigen, das ihm feindselig erschien, das nur von fernem Gekläff und vom Brüllen der ungemolkenen Kühe unterbrochen wurde. Währenddessen legte sich die Nacht wie eine Drohung auf den Pfad, und plötzlich wünschte Pieter sehnlich, daheim zu sein, die Mutter zu sehn, ihre Stimme zu hören.
Doch dann erblickte er den dunklen Pontok und die verhangene Türöffnung, vermisste über der Feuerstelle den Rauch, und als er nach seiner Mutter rief, antwortete ihm niemand.
3
Sie kam erst, als der Mond schon aufgegangen war, und an der Art, wie sie den Hügel herauflief, erkannte Pieter, dass sich etwas Ungewöhnliches ereignet hatte. Hastig sprang er auf, aber er beherrschte sich und blieb beim Feuer, das endlich brannte, stehn und wartete gespannt.
„Gott sei Dank!“, rief sie. „Da bist du ja. Hab ich mir Sorgen gemacht!“
„Du?“, fragte Pieter. „Ich war pünktlich daheim.“
„Ist ja schon gut. Ich musste aushelfen beim Herrn Missionar. Diese Aufregung, das Durcheinander!“
„Was ist eigentlich los im Dorf?“
Und dann erfuhr Pieter, was geschehen war, und plötzlich begriff er alles, und sogleich wurde ihm die eigene Schuld bewusst. Er setzte sich auf den kopfgroßen Stein neben der Feuerstelle, und eine Weile starrte er, ohne etwas wahrzunehmen, in die schwelende Glut.
„Fehlt dir was?“, fragte die Mutter. „Du bist so eigenartig.“
„Und ich“, rief Pieter, während er wieder aufsprang, „ich hab ihn auch noch beruhigt, habe ihm gesagt, diese Teufel wären weit weg in ihrem Windhoek! Ins Unglück habe ich ihn geschickt, in den sicheren Tod. Ich ...“
„Bist du verrückt? Wenn dich jemand hört ...“
Und genauso gedämpft erkundigte sie sich, woher er den Witbooi überhaupt kenne.
Stockend, mit wenigen Worten erzählte Pieter von der Begegnung auf der Weide. Und verstummte dann und starrte erneut vor sich hin.
Nach einer Weile berührte ihn die Mutter an der Schulter und sagte eindringlich, beschwörend: „Ist doch Unsinn, Piet. Das redest du dir bloß ein. Woher wolltest du denn wissen, dass sie ausgerechnet heute kommen? Niemand konnte das auch nur ahnen, nicht einmal der Herr Missionar. Glaub mir, Pieter, dich trifft keine Schuld.“
Er zuckte zusammen und schob ihre Hand sanft beiseite.
„Und wo ist er jetzt?“, fragte er unvermittelt. „Noch in der Mission?“
„Wer? Der ..., dieser Bote? Piet, was hast du vor?“
„Nichts, Mutter. Ich bin gleich wieder da.“
Und Pieter rannte den flachen Hügel hinab, lief, als fliehe er, den Pfad entlang, zurück zum Dorfweg. Eine Weile hörte er noch die Mutter, die ihn beim Namen rief, die flehend versuchte, ihn zum Umkehren zu bewegen. Dann war es wieder still ringsum; nur aus der Ferne drang nach wie vor das Kläffen der Hunde.
Sogar diese Köter haben mehr Mumm als die stolzen Rehobother, ging es Pieter durch den Sinn, und plötzlich ergriff ihn ein Gefühl der Überlegenheit, ein berauschender Hochmut. Er, Pieter Koopgaard, der Verachtete, Verhöhnte, er allein verkroch sich nicht daheim, er ging im hellen Mondschein vorbei an den Behausungen all der Feiglinge und Verräter.
Wütend und verächtlich schüttelte er den Kopf über ein Dorf mit tausend Burschen und Männern, die unfähig waren oder nicht gewillt, einer Handvoll Hergelaufener Trotz zu bieten. Hatten einen Boten, den Gesandten eines befreundeten Stammes, diesen Teufeln ausgeliefert, und morgen, wenn nichts geschehen würde, schon morgen früh ...
Pieter stockte in Gedanken und beschleunigte erneut den Schritt.
Sein Schuldgefühl trieb ihn zur Eile. Seitdem er wusste, was dem Witbooi drohte, war ihm klar, dass er etwas unternehmen musste. Wie er ihn befrein, ob er ihm überhaupt helfen könnte, darüber zerbrach er sich im Moment noch nicht den Kopf.
Nur etwas tun, es wenigstens versuchen, nicht einfach sich verkriechen wie alle andern!
So erreichte er den Dorfweg, und plötzlich sah er zu seiner Überraschung vor sich im Licht des Mondes eine stämmige, breitschultrige Gestalt - unverkennbar der Onkel.
Hinter ihm her schlich der Hund, der tagsüber mit Pieter auf der Weide gewesen war; doch Willem Koopgaard schien weder das Tier noch sonst etwas zu bemerken. Zögernd, beinah unsicher tappte er dahin.
Wie ein Betrunkener, dachte Pieter. Er überlegte noch, ob er den Onkel einholen, ihn ansprechen oder sich vor ihm verbergen sollte, da wurde er von dem Hund entdeckt und mit freudigem Gebell begrüßt.
Der Onkel war bei dem Gekläff zusammengezuckt und herumgefahren. Wie er so dastand, geduckt und verwirrt, wirkte er weniger herrisch als sonst, eher ratlos.
„Was sucht denn ihr hier?“, fuhr er den Neffen an, ihn und den Hund in einem, und auch sein Blick traf beide.
„Er und ich“, erwiderte Pieter gepresst, „wir und noch ein paar Köter, wir verkriechen uns eben nicht, wenn in diesem Nest ein Unschuldiger von einem Dutzend Hergelaufener ...“
Weiter kam er nicht. Der Onkel hatte überraschend schnell die Hand gehoben, doch bevor er zuschlagen konnte, sprang der Hund ihn an, und er ließ erst ab, als Pieter eingriff.
„Elender Kläffer“, sagte Willem, während er sich den Staub vom Ärmel klopfte. Er wirkte jetzt gealtert, müde, und Pieter nahm deutlich einen schwachen Dunst von Alkohol wahr.
„Bist auch nicht besser“, fuhr der Onkel fort. „Schreist rum und beleidigst alle. Ach!“
Er winkte ab und ging weiter, stapfte leicht gebeugt auf den Platz zu, der gerade von zwei Männern, älteren Rehobothern, überquert wurde.
„Wo wollt ihr eigentlich hin?“, fragte Pieter.
„Wohin schon? Zu Hermanus. Er hat den Rat einberufen.“
„Und was habt ihr vor?“, erkundigte sich Pieter, während er, den Hund neben sich, in einigem Abstand folgte.
Der Onkel zuckte mit den Schultern und ließ sie dann wieder hängen. Für ihn war das Gespräch offenbar beendet.
„Aber man muss doch was tun!“, rief Pieter. „Man kann doch den Witbooi nicht einfach …“
„Schweig!“, herrschte der Onkel ihn an. Er war erneut zusammengeschreckt und hatte sich hastig umgeschaut.
„Hör zu!“, sagte er drohend, ohne das Knurren des Hundes zu beachten. „Noch bestimmen wir in Rehoboth. Von euch lassen wir uns nicht kommandieren. Wer seid ihr denn? Ein paar Grünschnäbel! - Was sag ich? Keiner außer dir, kein einziger im ganzen Ort ist so hirnverbrannt, heut abend freiwillig einen Fuß vor die Tür zu setzen. Alle sind gescheiter als du. Weiß deine Mutter überhaupt, wo du dich rumtreibst?“
Pieter schluckte und erwiderte nichts. Wortlos wandte er sich ab und ging über den mondscheingefleckten Weg, schweigend bog er ein auf einen Seitenpfad und verschwand im Dunkel unter einem Anabaum.
„Geh heim!“, rief der Onkel gedämpft, in der Stimme Wut und eine Spur Besorgnis. „Sei vernünftig! Wenn ich dir was zu sagen hätt, wenn du mein Junge wärst ...“
Da beschleunigte Pieter den Schritt, lief, gefolgt von seinem Hund, davon. Der Hochmut, das berauschende Gefühl der Überlegenheit, war verflogen, dem Bewusstsein lähmender Ohnmacht gewichen. Wo der Pfad sich teilte, blieb Pieter ratlos stehn.
Er hat ja recht, gestand er sich ein, ich bin tatsächlich allein. An wen aber soll ich mich wenden, wen um Hilfe bitten?
Dirk und seine Freunde, die Söhne von Hermanus und von anderen Reichen, schieden von vornherein aus; zu tief war ihre Abneigung dem Habenichts gegenüber, unüberwindlich sein eigener Hass und, ja, auch sein Neid. Bliebe die Bande von Jan Matros, der seit Wochen verschwunden war - Burschen, die nicht mehr besaßen als er selbst. Doch zu ihnen fühlte sich Pieter gleichfalls nicht hingezogen, im Gegenteil. Soweit er zurückdenken konnte, hatte die Mutter ihm das Spielen mit ihnen verboten, als könnte er sich durch solchen Umgang beschmutzen, und deshalb, vielleicht ausschließlich aus diesem Grund, wurde er auch von ihnen verhöhnt und verachtet.
So wie jetzt hier zwischen den Pontoks und den Gehöften stand Pieter von Geburt an zwischen den Armen und den Reichen des Dorfes - schuldlos und aus eigener Mitschuld ein Außenseiter, ein Bastard in dreifacher Hinsicht, und nun, da er wie nie zuvor auf Unterstützung angewiesen war, hatte er keinen einzigen Verbündeten.
Was hilft’s? dachte er. Heut nacht ändert sich sowieso nichts mehr daran, und morgen, schon morgen früh wär’s für den Witbooi zu spät. Ich muss es allein versuchen.
Und er schlägt den Pfad hoch zum Missionsgebäude ein. Lautlos, mit gesträubtem Fell, folgt der Hund seinem Herrn.
Beschützer und Schutzbefohlene
4
Erst hinterher wurde Pieter bewusst, wie leichtsinnig er gewesen war, wie unbedacht er gehandelt hatte. Und dass weder er noch ein anderer Rehobother, nur auf sich gestellt, dem Witbooi helfen, ihn befreien konnte, auch das begriff er nun voll und ganz, und diese Erkenntnis vertrieb für lange Zeit den Schlaf.
Zudem horchte er weiterhin auf jedes Geräusch, das in den Pontok drang, und selbst nachdem sich draußen endlich alles beruhigt hatte, als sogar das Winseln des Hundes verstummt war und bloß noch fern und vereinzelt ein Köter kläffte, klopfte ihm schneller als sonst das Herz, und die Muskeln seiner Beine zuckten.
Wie nie zuvor war er gerannt, zum ersten Mal um sein Leben gelaufen, und wenn nicht der Hund gewesen wär ...
Pieter versuchte, diesen Gedanken abzuschütteln, die aufdringliche Erinnerung zu unterdrücken. Vergebens. Hinter den geschlossenen Lidern sah er erneut und deutlicher noch als in Wirklichkeit, wie ein Mann mit schwerem Schritt um die Ecke bog, wie der Lauf neben der hochgeschlagenen Krempe im Mondschein blinkte, wie der Deutsche stockte und das Gewehr von der Schulter riss.
„Halt! Stehen bleiben, oder ...“
Im selben Moment musste der Hund ihn angesprungen haben; denn die Kugel flog sirrend über Pieter hinweg. Er stieß sich ab von der Hauswand, überquerte mit ein paar Sätzen den Hof, schwang sich über die Mauer, die das Gehöft umzäunte. Dann hörte er den zweiten Schuss und das Splittern von Holz und ein Peitschen in den Zweigen, unter denen er geduckt davonrannte, hörte auch, bevor alles vom Hämmern des eigenen Pulses überdröhnt wurde, das Jaulen des Hundes und wütendes Gebell und Rufe in der fremden Sprache, erregtes Stimmengewirr.
Keuchend hetzte er weiter, nun taub für die Geräusche ringsum, fast blind vom Schweiß, der in den Augen brannte. Instinktiv verließ er den Pfad, der streckenweise voll im Mondschein lag, und schlug sich durch Gebüsch, durch Dornengestrüpp, zerriss die Hose, lief geduckt an der Rückseite der Behausungen entlang, halb im Unterbewusstsein darauf bedacht, im Dunkeln zu bleiben.
So erreichte er den Pontok, und in der Türöffnung prallte er unversehens mit seiner Mutter zusammen. Sie zog ihn rasch ins Innere und ließ hinter ihm den Vorhang fallen, und erst nach einer Weile bemerkte Pieter, dass sie ihn wie ein Kind an die Schulter drückte, dass sie wie er am gesamten Körper bebte.
Verlegen befreite er sich und sagte abwehrend, besänftigend: „Ist ja schon gut.“
Das aber war offenbar zu viel für sie. Wie ein Gewitterguss entlud sich, was sich den Abend über in ihr angestaut hatte an Angst und Zorn und Ohnmacht.
„Gut?“, stieß sie hervor. „Das nennst du ,gut‘? Und ich? Hast du auch mal an mich gedacht? Wenn sie dich nun erschossen hätten? Oder eingesperrt? Wenn einer dich erkannt hat und verrät?“
Jäh, wie sie begonnen hatte, verstummte sie, und nun erst begriff Pieter, dass er der Gefahr noch lange nicht entronnen war.
Er räusperte sich, aber sie legte ihm die Hand auf den Mund. So lauschte auch er, und da vernahm er, deutlich unterscheidbar vom fernen, schon ruhigeren Kläffen, ein Winseln, ein schwaches Jaulen. Mit ein paar Schritten war Pieter an der Tür.
Den flachen Hügel hoch kam der Hund gekrochen. Wieder und wieder versuchte er, sich zu erheben, doch jedes Mal knickte er mit den Hinterläufen ein, und als Pieter ihn beim Nackenfell gepackt und auf den Arm genommen hatte, spürte er das warme und klebrige Blut.
„Was fehlt ihm?“, fragte die Mutter. „Ist er verletzt?“
„Verwundet“, sagte Pieter.
„Dann schaff ihn beiseite! Er blutet ja! Die Spur!“
„Lass ihn! Wenn er nicht gewesen wär ...“
Und Pieter trug den Hund in den Pontok und bettete ihn auf ein Stück Sackleinwand. Als die Mutter nach einer Weile murrend einen Napf Wasser brachte, hockte er noch immer neben dem Tier und strich ihm über das Fell.
Wenig später ging er hinter den Pontok und wusch sich, bemüht, so leise wie möglich zu sein. Die Luft hatte sich inzwischen abgekühlt, auch ohne das Gewitter, das offenbar nicht über die Berge gekommen war, und Pieter verspürte ein leichtes Frösteln. Trotzdem lauschte er minutenlang und spähte angestrengt in die Runde, bevor er zurück in den Pontok schlich und sich zu seinem Lager tastete.
Beim Ausziehen hatte er bemerkt, dass die Hose zerrissen war. Jetzt breitete er sie über das Fußende des Bettgestells, und dann kroch er aufatmend unter die Felldecke.
So lag er nun schon seit einiger Zeit, und er wusste, dass auch die Mutter nicht schlafen konnte, und noch beim Wegdämmern hörte er, wie sie sich von einer Seite auf die andere wälzte, wie die mit Lederriemen bespannte Kattel knarrte.
Irgendwann vernahm Pieter im Halbschlaf ein Winseln, ein Jaulen und einen dumpfen Schlag und später ein Kratzen und Scharren, und im Traum sah er den Hund, sah, wie er, die Läufe immer wieder einknickend, den Hügel hochkroch, und hinter ihm her, geradewegs auf den Pontok zu, kam ein Soldat geritten, auf dem Rappen des Witbooi ein Deutscher, stämmig, aber die breiten Schultern hängend, und er sprach auch wie Onkel Willem.
Der Klang dieser Stimme holte Pieter zurück in die Wirklichkeit. Er fuhr auf und sah, dass es schon hell war, und erkannte in der Türöffnung die Mutter und hörte, dass sich tatsächlich der Onkel mit ihr unterhielt, anders als sonst, weniger herrisch.
„Was ist? Hab ich verschlafen?“
„Ein Wunder wär‘s nicht“, sagte Willem Koopgaard, und genauso nachsichtig, doch bereits mit einer Spur von Ungeduld, bat er seine Schwester: „Nun mach endlich Platz! Oder möchtest du mich hier draußen abfertigen?“
„Wenn du willst“, erwiderte die Mutter, und sie warf die Hose, an der sie offenbar eben noch gestopft hatte, Pieter zu und sagte zurückhaltend zu ihrem Bruder: „Ich wüsste nicht, wann du je mein Haus betreten hättest.“
Ohne auf den Vorwurf einzugehn, stapfte der Onkel durch die Türöffnung. Er bückte sich dabei, und dann stand er gebeugt im Pontok, und Pieter beobachtete, wie er sich umschaute, und ihm selber wurde erneut und beschämend bewusst, wie dürftig die gesamte Einrichtung war: die beiden Katteln mit den abgenutzten Decken darauf, die Kiste, die als Truhe diente, der klobige Hocker und die Sackleinwand, die stückweise auf dem gefegten Lehmboden lag und neben der Tür und vor dem Fenster hing.
Jetzt raffte die Mutter auch diesen Vorhang zur Seite, und die frische Luft drang voll herein, die Kühle der Nacht und das Tageslicht, das auf die Risse in der Wand und im gewölbten Dach und auf die zerwühlten Lagerstätten fiel.
Flüchtig vermisste Pieter irgendetwas, doch während er noch überlegte, sagte die Mutter, die gerade mit raschen Griffen ihre Bettdecke glatt strich, über die Schulter hinweg, hörbar gereizt: „So setz dich doch! Und du, zieh dich endlich an!“
Wie ertappt fuhr Pieter in die abgewetzten, mehrfach gestopften Beinkleider, und der Onkel zog den Hocker heran und sagte, sich räuspernd: „Er braucht wieder mal eine neue Hose.“
„Ach! Das hast du wohl eben erst bemerkt?“
Auch darauf ging Willem Koopgaard nicht ein, aber seine Hände, die er zur Faust schloss, verrieten, wie mühsam er sich beherrschte. Eine Weile saß er schweigend, das Gesicht zu einem Lächeln verzerrt, auf dem Hocker.
Und dann glaubte Pieter, sich verhört zu haben, und die Mutter schaute gleichfalls überrascht, ja fassungslos den Onkel an, und der tat weiterhin, als sei das alles selbstverständlich, als sei nicht im Geringsten ungewöhnlich, dass er hier saß, schon am frühen Morgen plaudern wollte und wie nebenbei gesagt hatte: „Kannst sie heute beim Kaufmann holen. Auch einen Rock für dich. Er soll’s bei mir anschreiben.“
„Hör mal!“, begann die Mutter, und sie schluckte vor Aufregung. „Erst lässt du dich Jahr und Tag nicht sehn, und nun kommst du und spendierst uns neue Sachen, dem Jungen und mir ...“
„Na und?“, fragte der Onkel.
Die Mutter starrte ihn an und holte tief Luft, doch dann schüttelte sie bloß den Kopf und strich fahrig über die Decke des Lagers, das Pieter inzwischen selber hergerichtet hatte.
„Was stehst du hier rum?“, fuhr sie ihn plötzlich an. „Nimm dir ein paar Ointjes und geh an die Arbeit!“
„Nicht nötig“, sagte der Onkel rasch. „Er braucht nicht mehr auf die Weide, ich hab einen Ersatz für ihn, einen Jungen von Matros.“
„Aber Jan ist doch fort, seit Wochen verschwunden!“
Mehr fiel Pieter im Moment vor Schreck und Überraschung nicht ein, und Willem Koopgaard, als er den Namen hörte, verzog das Gesicht.
„Nicht dieser Jan“, sagte er unwillig, unwirsch. „Einer seiner jüngeren Brüder. Claas oder wie er heißt.“
Jetzt fand auch die Mutter die Sprache wieder.
„Also deshalb die Großzügigkeit! Eine Abfindung sozusagen! Du brauchst ihn nicht mehr, hast dir schon einen Ersatz gesucht.“
„Unsinn!“
Der Onkel war aufgesprungen. Geduckt lief er zur Tür und schaute hinaus, kehrte um und durchquerte einmal, zweimal den engen Raum, stapfte, den Rücken gebeugt, wie ein gefangenes Tier auf dem schmalen Gang zwischen den Katteln, der Truhe und dem Hocker hin und her.
„Und ich Schaf“, sagte währenddessen kopfschüttelnd die Mutter, „ich hab schon geglaubt, ein Wunder wär geschehn nach all den Jahren. Und nun ... Der eigne Bruder!“
Da verlor der Onkel vollends die Beherrschung.
„Hör endlich auf mit dem Gejammer!“, stieß er hervor, und einen Atemzug lang ballten sich erneut seine Hände.
Gequält und wieder ungewöhnlich sanft fuhr er fort, bittend: „So setz dich doch! Auch du, Pieter! Ich muss mit euch reden.“
Folgsam, die Hände im Schoß, nahm die Mutter auf dem Rand der Kattel Platz. Pieter hingegen blieb stehn, abwartend, voller Abwehr.
„Schlimme Zeiten“, begann der Onkel, während er sich ächzend auf dem Hocker niederließ. „Aber wem sag ich das? Du warst ja gestern selber beim Missionar und hast sie gesehn. Und auch du bist ihnen“ - er lächelte matt, dehnte das Wort - „begegnet.“
„Woher weißt du ...?“
„Bleib sitzen und bete, dass niemand außer mir was ahnt! Und dass keiner ihn erkannt hat.“
Die Mutter nickte und senkte den Kopf, demütig nun und ergeben, und Pieter schien es, als habe der Onkel auf diesen Augenblick gewartet, als spiegle sein Gesicht eine Spur Genugtuung, einen flüchtigen Triumph.
„Und selbst wenn sie was rausbekommen“, sagte er und machte eine Pause, „selbst wenn sie ihn überführen, kann er sich noch bewähren, kann ihnen beweisen, dass alles nur ein Irrtum war, Neugier oder Übermut.“
Jetzt hob die Mutter den Kopf, und auch Pieter horchte auf und schaute den Onkel fragend an.
„Ihr wundert euch? - Nun, vielleicht ist es sogar sein Glück, die einmalige Gelegenheit. Nichts gegen Kühehüten, und selbstverständlich beschäftige ich ihn wieder, wenn er entlassen wird, falls er dann noch Lust hat, für mich zu arbeiten, und nicht reich genug ist, sich eine eigene Herde zu kaufen, größer als meine und jede andere im Dorf.“
„Ich versteh überhaupt nichts“, gestand die Mutter, und auch Pieter ahnte nur, worum es ging, begriff bloß, dass der Onkel etwas von ihm wollte.
„Die Deutschen“, sagte Willem Koopgaard so beiläufig wie möglich, „machen mit uns einen Vertrag.“
„Aber ihr habt euch doch mit Hendrik verbündet!“, entfuhr es Pieter.
„Nicht verbündet, verhandelt haben wir, vermittelt zwischen ihm und Maharero. Über Rehoboth verfügen wir selbst, hier sind wir die Herren.“
„Ach! Und der Witbooi, Hendriks Bote, wird wohl geopfert?“
„Was heißt .geopfert“? Er ist ihnen in die Hände gelaufen, und sie haben einen Brief bei ihm gefunden, einen Brief von Hendrik an Hermanus, angeblich einen Aufruf zum Orlog. Was nun geschieht - uns trifft keine Schuld, uns nicht!“
„Ja, und was hat das alles mit Pieter zu tun?“, fragte die Mutter, und jetzt wich der Onkel nicht länger aus.
„Wir müssen Rekruten stellen“, sagte er, „jede Familie einen Mann. Sie bekommen Kost und eine Uniform und Sold, und wenn sie tapfer sind und sparsam ...“
„Ach“, fiel ihm die Mutter ins Wort, und sie erhob sich langsam, „jetzt versteh ich, jetzt wird mir alles klar. Der Mann, wie du sagst, der Rekrut, den die Koopgaards stellen müssen, das soll mein Piet sein?“
„Grete, lass dir erklären!“, sagte der Onkel rasch.
„Grete - auf einmal! Und erklären? Wozu? Hältst du mich für dumm? Schön hast du dir das ausgedacht, ein feiner Bruder bist du. Der große Willem Koopgaard! Und dein eigener Spross? Natürlich, deinen Dirk, den wirfst du diesen Teufeln nicht vor, den möchtest du verstecken!“
„Grete, so beherrsch dich doch!“
„Ich mich beherrschen? Im Gegenteil! Schreien werd ich. Sollen alle hören, was für ein Ratsherr du bist, was für ein Familienoberhaupt und Bruder. Fass mich nicht an!“
Und sie schlug die Hand, die sich ihr auf den Arm legen wollte, weg und stand dann, die Hände gleichfalls geballt, dem Onkel gegenüber, und zum ersten Mal fiel Pieter auf, wie sehr sie einander glichen.
Er hatte bisher geschwiegen, mit wachsendem Staunen die Mutter und mit eigenartiger Genugtuung den Onkel beobachtet. Schon immer war es sein Wunsch gewesen, Willem Koopgaard gedemütigt, als Bittsteller zu sehn, und dass nun er persönlich gebraucht, geradezu umworben wurde, dieses Bewusstsein weckte erneut in ihm jenen berauschenden Hochmut.
„Lass nur!“, sagte er, unfähig, ein Zittern der Stimme zu unterdrücken. „Ich geh, wenn es sein muss. Er kann seinen Dirk verstecken.“
Jetzt fuhr die Mutter herum und starrte ihn an.
„Ist das dein Ernst? Du bist ja verrückt! Willst du dich wirklich an diese Teufel verkaufen? Als Bastard, als Sohn eines Witbooi ...“
Da zuckte Pieter ein Gedanke durch den Kopf, noch unklar und nicht weniger berauschend als sein Triumphgefühl; doch er verschwieg ihn und verschloss sich, blieb stumm.
„Der Junge weiß schon, was er will“, sagte der Onkel erleichtert, und er schickte sich an zu gehn.
„Nein“, erwiderte die Mutter entschieden. „Ein Junge - natürlich, das ist er ja noch: nicht alt genug, erst siebzehn. Und überhaupt: Weder du noch er, keiner kann mich zwingen, ihn herzugeben!“ Ihr Bruder zuckte die Schultern.
„Überleg dir das genau! Mit denen ist nicht zu spaßen. Mit uns übrigens auch nicht. Und er hat ja, denk ich, etwas gutzumachen.“
„Raus!“, sagte die Mutter. „Lass dich hier nie wieder sehn!“
Wortlos, ohne Gruß, verließ Willem Koopgaard den Pontok.
5
Wenig später kam draußen Lärm auf, und Pieter unterbrach die Mutter, die fast pausenlos auf ihn eingeredet, ihn angefleht, ihn beschworen, ihm gedroht hatte.
„Still mal! - Ist das nicht der lahme Dirk?“
„Nein, ich erlaub’s nicht, nie im Leben! Geh nur, wenn du mich unter die Erde bringen willst, geh zu diesen Teufeln! Du wirst schon sehn: Ich häng mich auf, ich bring mich um; dann hast du mich auf dem Gewissen.“
„Aber Mutter!“
Und während sie schluchzend verstummte, wandte sich Pieter ab, betroffen und widerstrebend, und lief zur Tür.
Über den Hügel humpelte tatsächlich der Gemeindediener, ein älterer Mann, der lahmte, seitdem er vor Jahren vom Pferd gestürzt war und ein Bein gebrochen hatte. Wie immer, wenn er Nachrichten bekannt gab, folgte ihm ein Rudel kläffender Hunde, doch heute unterließ er den üblichen, meist scherzhaften Streit mit den Kötern, die ihn beim Ausrufen behinderten; hastiger als sonst verlas er die Botschaft von Hermanus, den Befehl.
„Hast du das gehört?“, fragte Pieter die Mutter, die noch auf dem Rand der Kattel hockte, und plötzlich fuhr er herum. Jetzt war ihm klar, was er, halb unbewusst, seit dem Erwachen um sich vermisste.
„Der Hund! Wo ist mein Hund?“
Mit einem trotzigen Schnaufen erhob sich die Mutter. Statt eine Antwort zu geben, erkundigte sie sich, was der lahme Dirk denn ausgerufen habe, und da Pieter auf einer Auskunft bestand, ging sie selber zur Tür und horchte.
Schon fern, bedrängt vom Gekläff, wiederholte, nur undeutlich vernehmbar, der Gemeindediener: „Alle Rehobother, Männer wie Burschen, Frauen wie Mädchen, haben sich sofort auf dem Dorfplatz einzufinden! Gezeichnet: Hermanus van Wyk, Kapitän der Bastardnation.“
Die Mutter nickte, als habe sie diese Aufforderung erwartet, sie befürchtet.
„Da hast du’s“, sagte sie. „Jetzt müssen wir uns aufstellen, werden einer nach dem andern gemustert und verhört, und wenn dich jemand erkannt hat ...“
„Unsinn!“, fiel Pieter ihr ins Wort, obwohl er sich durchaus nicht sicher war, und er fragte, auch um abzulenken, abermals, wo der Hund sei.
„Hör endlich mit dem Köter auf! Weg ist er, verschwunden, verscharrt. So leichtsinnig, wie du bist, so sentimental - wenn ich da nicht an alles denken, mich nicht um alles kümmern würde ...“
„Du hast ihn ...?“
,,Ja, ich hab ihn ...“ Sie stockte, senkte den Blick. „Und ich hab auch die Blutspur beseitigt, schon heute früh, bevor es hell war. Was schaust du mich so an?“
„Gehn wir!“, sagte Pieter nach einer Weile, und kopfschüttelnd verließ er den Pontok, und beide schwiegen unterwegs, sprachen auf der gesamten Strecke kein Wort und grüßten nur durch flüchtiges Nicken.
Die meisten Rehobother, denen sie begegneten, schienen wie sie in Gedanken zu sein, und alle hatten es eilig, als fürchteten sie, zu spät zu kommen und aufzufallen. Nur ein paar Kinder waren übermütig und ließen sich weder zur Ordnung rufen noch zur Umkehr bewegen.
Gut so, dachte Pieter. Je mehr, desto besser; da verschwindet man in der Menge. Das ganze Dorf verhören, über zweitausend Erwachsene - was für ein Unsinn!
Auch die Mutter hatte sich offensichtlich beruhigt. Gefasst lief sie neben ihrem Sohn her, bemüht, mit ihm Schritt zu halten, und Pieter, der sie von der Seite her ansah, glaubte, in ihrem Gesicht einen neuen Zug zu entdecken, eine Entschlossenheit, ja Härte, die ihm zuvor nie aufgefallen war.
Wie sie dem Onkel gegenübergetreten ist! Und den Hund hat sie einfach ... Nein, leicht ist ihr das bestimmt nicht gefallen, im Gegenteil, und doch hat sie sich überwunden, hat es getan. Ich hätte das nie gekonnt.
Und zum ersten Mal verspürte Pieter Stolz auf seine Mutter, auf diese abgehärmte, früh gealterte Frau, für die er sich bisher insgeheim immer ein wenig geschämt hatte, und zugleich erfasste ihn eine seltsame Erleichterung. Ihm war, als löse sich ein Druck, als falle eine Verantwortung von ihm ab, als werde er hier und gerade jetzt erwachsen und frei für ein eigenes Leben.
Sie wird’s überstehn, dachte er, und sich nichts antun; so nötig braucht sie mich ja gar nicht. Sie hat schon ganz andere Sachen geschafft, allein, all die Jahre über.
„Bleib!“, bat sie gedämpft, als sie den Platz, die noch lockeren Gruppen der Wartenden erreicht hatten.
„Gehn wir rüber zum Store“, sagte Pieter. „Dort sieht man mehr.“
Und er fasste die Mutter am Arm, und sie folgte dem Sohn, der sie einen halben Kopf überragte, ließ sich ohne Widerspruch von ihm bis dicht vor den Kaufladen führen, und unterwegs traten ein paar Männer, ältere Rehobother, als sei das selbstverständlich, beiseite und erwiderten den flüchtigen Gruß.
„Die fühlen sich heut alle nicht gerade wohl in ihrer Haut“, raunte Pieter der Mutter zu.
„Bist du still!“, wies sie ihn flüsternd zurecht, aber ihr Lachen, kurz und voller Genugtuung, war stärker als der Tadel, für Pieter auch beeindruckender als ihr Stoßseufzer: „Hätten wir’s nur schon überstanden!“
Vorerst wuchs noch die Menge, die auf den Platz drängte, und bald standen die Männer und Frauen, die Burschen und Mädchen Schulter an Schulter, und hinter ihnen, zwischen den Pontoks und den Gehöften, tauchten weitere Köpfe auf, und in den Kronen darüber, auf den Ästen der ausladenden Bäume, hockten die Dorfjungen, struppig wie Sperlinge und nicht weniger laut.
Und dann ging ein Raunen durch die Versammelten, lief wie die Welle im Gras nach einem Windstoß bis in die entfernten Ecken des Platzes, und es breitete sich Schweigen aus, eine spannungsgeladene Stille.
Sogar die Jungen in den Bäumen verstummten, und Pieter schien es, als brenne die Sonne plötzlich stärker, als knistere die sich erhitzende Luft.
Aus dem Hof der Mission war ein Trupp Soldaten gekommen. Das Gewehr über der Schulter, marschierten die zwanzig Männer, geführt von einem Unteroffizier, in einer Doppelreihe durch die Gasse, die frei geblieben war. Dabei stampften sie mit kurzen, gleichförmigen Schritten, und alle blickten sie starr geradeaus. Ein Kommando, und die schweren Stiefel standen wie bei einem einzigen Tritt, ein zweiter Befehl, und die Kolonne kehrte sich um wie ein Mann, und erst danach, auf ein weiteres Kommando ihres Führers, rührten sich die Soldaten, nahmen gleichzeitig eine lockere Haltung ein.
Den Riemen am Gewehr hielt nach wie vor jeder von ihnen mit der rechten Hand gespannt, und auch die Uniformen, ja selbst die Gesichter unter den Hüten mit der hochgeschlagenen Krempe, fand Pieter, glichen einander zum Verwechseln.
Unmöglich, den herauszufinden, der auf ihn geschossen hatte. Alle schienen sie dazu fähig zu sein; denn alle blickten sie finster, entschlossen.
Geradezu körperlich spürte Pieter die Drohung, die von ihnen ausging, und zur Furcht, die ihn beschlich, gesellte sich, nur widerstrebend eingestanden, eine Spur Bewunderung. Pieter ahnte, dass diese Wirkung beabsichtigt war, und erkannte, dass nicht er allein ihr erlag. Wie er waren die Mutter und andere Rehobother aus den vorderen Reihen beim Anblick der Truppe einen Schritt zurückgewichen, und nun standen sie wie gebannt und duckten sich vereinzelt und schauten durchweg verängstigt und zugleich beeindruckt.
Und zuckten zusammen und rückten - eine Bewegung, die sich übertrug - unwillkürlich einen Fußbreit vor, als plötzlich der Witbooi, flankiert von zwei weiteren Soldaten, den Hof der Mission verließ.
Diese Bewegung und das Murren, das auf dem Platz unter den Bastards aufkam, genügten, die Einheit der Truppe und den Eindruck von Geschlossenheit, von geordneter Macht zu erschüttern. Nicht jeder der Uniformierten, wohl aber der eine und der andere, ruckte am Riemen seines Gewehrs, und erst ein Befehl ihres Führers rief wieder scheinbaren Gleichmut auf die Gesichter; doch die Bewunderung, die Pieter empfunden hatte, und auch ein Teil der Furcht waren verschwunden.
Sie haben ja selber Angst, dachte er, Angst vor uns. Wenn wir jetzt einig wären, einen entschlossenen Führer hätten, einen wie Hendrik Witbooi ...
Aber Hermanus, der Kapitän der Bastards, der gerade im Tor der Mission erschien, wirkte müde, schlaff und übernächtig. Beim Anblick der Versammelten hob er einen Atemzug lang den Kopf, und sicher hingen jetzt tausend und mehr Augenpaare an seinem breitknochigen Gesicht und an der hohen, leicht gebeugten Gestalt; doch dann wandte er sich, offenbar auf ein Wort des Missionars hin, ab und ließ erneut und tiefer noch als zuvor die Schultern hängen, und wieder lief ein Murren über den Platz, ein Raunen wie vom Wind in den Bäumen, das von nun an nie mehr ganz erstarb.
Mit wachsender Empörung sah Pieter, wie die beiden Uniformierten den Witbooi durch die Gasse führten, vorbei am Spalier der Truppe und an den vorderen Reihen der Rehobother, wie gleichzeitig Hermanus zwischen dem Missionar und einem in Uniform mit Verzierungen, vermutlich dem Offizier der Deutschen, die Stufen zum Kaufladen hochstieg. Und dann stand der Witbooi, rechts und links von ihm ein Posten mit schussbereitem Gewehr, an der Mauer, hinter der sich die Lagerräume befanden, und ähnlich flankiert, die Hände gleichfalls auf dem Rücken, hatte sich Hermanus vor dem Eingang zum Store postiert.
Da ist ja kaum ein Unterschied, ging es Pieter durch den Sinn, doch er korrigierte sich sofort: Der Witbooi war allein vor einer Übermacht, und sicher hat er sich gewehrt und ist geschlagen worden - fleckig und geschwollen, wie er aussieht ...
Und da, als Pieter ihn ansah, forschend, voller Mitleid und Zorn, verzog sich das verunstaltete Gesicht, erschien etwas wie ein Lächeln, und - unverkennbar! - der Witbooi nickte ihm zu.
Oder war er zusammengezuckt wie er, Pieter Koopgaard, weil im selben Moment Hermanus zu reden begann?
Jetzt schaute der Witbooi geradeaus, scheinbar unbeteiligt über die Köpfe der Versammelten hinweg, und Pieter blieb unklar, ob er überhaupt wahrnahm, was Hermanus mit dumpfem Bass, mit seltsam eintöniger Stimme sagte.
Im Namen des Rates von Rehoboth und in seinem eigenen Namen begrüße er, Hermanus van Wyk, Kapitän der Bastardnation, den Herrn Hauptmann von Francois, Kommandeur der deutschen Schutztruppe in Südwestafrika. Der Herr Hauptmann sei mit einigen Reitern seiner Truppe aus Windhoek gekommen, um mit ihm, dem Kapitän, und den Vornehmen der Nation zu verhandeln, und nun möchte der Herr Hauptmann vor dem versammelten Volk der Bastards von Rehoboth eine Ansprache halten. Er übergebe das Wort an den Herrn Hauptmann von Francois.
Mit einer müden Geste trat Hermanus beiseite und überließ seinen Platz dem deutschen Offizier, der die verzierten Schultern reckte und unverzüglich zu sprechen begann, abgehackt, als kommandiere er.
Der Missionar, der die ganze Zeit über flüsternd auf ihn eingeredet hatte, war ihm wie ein Schatten gefolgt. Jetzt übersetzte er laut, was der Hauptmann, auf den Stiefelspitzen wippend, über den Platz rief, und Pieter fiel auf, wie rau auch seine Stimme klang, obwohl er doch, nicht anders als beim Gottesdienst, das Afrikaans, das Holländisch der Buren, benutzte.
„Rehobother! Volk der Bastards! Mich schickt Seine Majestät, der Deutsche Kaiser, der mächtige Herrscher über das gewaltige Deutsche Reich! Ich grüße euch, die Bastards von Rehoboth, im Namen Seiner Majestät!“
Der Hauptmann und der Missionar, beide hielten ein, als erwarteten sie Beifall, und tatsächlich begannen seitab die Ratsherren in die Hände zu klatschen, und zögernd fielen ein paar Umstehende ein. Die Mehrzahl verharrte reglos, abwartend oder abweisend, und der Hauptmann zwirbelte die Enden seines Schnurrbarts und reckte sich erneut, nun sichtlich gereizt.
Einige der Worte, die er hervorstieß, verstand Pieter ohne Übersetzung, und flüchtig wurde ihm bewusst, wie schroff aus diesem Mund die fremde Sprache klang, wie sehr die Rede sich unterschied vom Text der deutschen Kirchenlieder in der Sonntagsschule. Und doch fiel Pieter gerade jetzt ein solches Lied ein, und während er mit wachsender Erbitterung den beiden Stimmen lauschte, der bellenden des Hauptmanns und der gleichfalls erhobenen des Missionars, ging es ihm wieder und wieder durch den Sinn wie ein höhnischer Refrain: „So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich!“
Nicht allen Versammelten sei klar, welch große Stunde sie erlebten. Heute beginne für das Volk der Bastards eine neue, eine ruhmreiche Epoche. Letzte Nacht habe der Rat von Rehoboth beschlossen, die Schutzherrschaft des Deutschen Reiches anzunehmen. Schon nächste Woche reite eine Abordnung der Vornehmen nach Windhuk, um dort feierlich einen Schutz- und Trutzvertrag zu unterzeichnen.
„So nimm denn meine Hände und führe mich ...“
Erneut legten der Hauptmann und der Missionar eine Pause ein, doch diesmal rangen sich selbst die Ratsherren keinen Beifall ab, und auf dem Platz kam wieder das Murren auf, wurde lauter, eindeutiger.