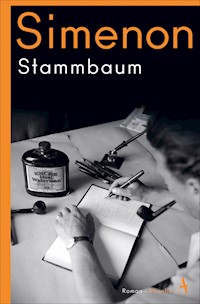
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Stammbaum hat eine besondere Geschichte: Getrieben von einer Fehldiagnose, die ihm seinen baldigen Tod prophezeite, schr ieb Georges Simenon seine Lebensgeschichte nieder. Als sich das Todesurteil als nichtig erw ies , arbeitete er die Autobiographie zu diesem einzigartigen Roman um, der davon erzählt, wofür es sich zu leben – und zu sterben – lohnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 932
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Georges Simenon
Stammbaum
Roman
Aus dem Französischen von Hans-Joachim Hartstein
Atlantik
Die in diesem Werk erwähnten Personen und Ereignisse sind reine Erfindung und haben keinen Bezug zu lebenden oder bereits verstorbenen Personen.
Vorwort
Es ist gar nicht so lange her, dass es für einen Autor noch üblich war, jedes seiner Werke durch eine Vorrede oder eine Einführung vorzustellen, was ihn in gewisser Weise mit dem Leser in direkten Kontakt brachte, sodass die Wendung »Lieber Leser« fast ebenso geläufig war wie das bekannte »Liebe Hörer« im Radio.
Ist die Mode deshalb veraltet, weil uns die Zeitungen heutzutage durch ihre Interviews, Feuilletons und literarischen Analysen über nichts im Ungewissen lassen, weder über die Absichten der Schriftsteller noch über deren Tun und Treiben?
Anlässlich dieser neuen Ausgabe von Stammbaum kann ich der Versuchung nicht widerstehen, aus verschiedenen und sicherlich wenig zwingenden Gründen auf diese Gewohnheit von einst zurückzukommen. Man hat viele Fragen zum Inhalt dieses Buches gestellt und tut es noch; man hat viel, nicht immer sehr genau, darüber geschrieben. Ich weiß auch, dass André Parinaud mir die Ehre einer wichtigen Studie erweist, deren drei Bände unter dem erdrückenden Titel Connaissance de Simenon im Druck sind und die ich noch nicht gelesen habe. Soviel ich weiß, sucht er in Stammbaum die Erklärung, wenn auch nicht meines Werkes, so doch wenigstens einiger seiner Aspekte und bestimmter Tendenzen.
Wird man mich der Überheblichkeit bezichtigen, wenn ich hier einfach einige Einzelheiten aus erster Hand liefere?
Stammbaum wurde weder auf dieselbe Weise noch unter denselben Umständen noch mit denselben Absichten wie meine anderen Romane geschrieben, und zwar wahrscheinlich deshalb, weil er innerhalb meines Schaffens eine Art Insel darstellt.
Als ich 1941 in Fontenay-le-Comte festsaß, teilte mir ein Arzt aufgrund einer fragwürdigen Röntgenaufnahme mit, ich hätte noch höchstens zwei Jahre zu leben, und verurteilte mich zu fast völliger Untätigkeit.
Ich hatte damals einen erst zweijährigen Sohn, und ich überlegte, dass er als Erwachsener fast nichts über seinen Vater oder dessen Familie wissen würde.
Um diese Lücke teilweise auszufüllen, kaufte ich drei in marmoriertem Karton eingebundene Hefte und begann, in Form eines Briefes an den großen Jungen, der mich eines Tages lesen würde, in der ersten Person Geschichten aus meiner Kindheit zu erzählen, wobei ich auf die gewohnte Schreibmaschine verzichtete.
Ich war in ständigem Briefwechsel mit André Gide, dessen Neugier ich entfachte. Ungefähr hundert Seiten waren geschrieben, als er den Wunsch äußerte, sie zu lesen.
Der Brief, den mir Gide daraufhin unverzüglich schrieb, war letztlich der Anlass zu Stammbaum. Sein Rat war, auch wenn ich weiterhin die Absicht haben sollte, mich nur an meinen Sohn zu wenden, mir die Erzählung noch einmal vorzunehmen, und zwar nicht in der ersten Person, sondern in der dritten, um mehr Leben hineinzubringen. Außerdem sollte ich sie, wie meine Romane, mit der Maschine schreiben.
Das sind die ursprünglichen etwa hundert Seiten der Hefte, die im Jahr 1945 von den Presses de la Cité in begrenzter Auflage unter dem vom Verleger in meiner Abwesenheit gewählten Titel Je me souviens veröffentlicht wurden. Allerdings war der Text geändert worden, um all das herauszustreichen, was man für eine Beschreibung lebender Personen hätte halten können.
Der neue Text, der nach dem Brief von Gide geschrieben wurde und sich im ersten Teil an den ursprünglichen anlehnt, muss trotzdem als Roman betrachtet werden. Ich wäre sogar dagegen, ihm das Etikett »biographischer Roman« aufzukleben.
Parinaud hat mich während unseres Radiointerviews von 1955 lange zu diesem Punkt befragt, wobei er mich unbedingt mit der zentralen Figur, Roger Mamelin, identifizieren wollte.
Ich antwortete ihm mit einem Gemeinplatz, der vielleicht nicht von mir ist, den ich jedoch wiederhole: In meinem Roman ist alles wahr, ohne dass irgendetwas genau stimmt.
Ich gestehe übrigens, dass ich, als das Buch beendet war, lange Zeit nach der Entsprechung des wunderbaren Titels Dichtung und Wahrheit gesucht habe, den Goethe seinen Kindheitserinnerungen gegeben hat.
Die Kindheit von Roger Mamelin, sein Milieu, der Rahmen, in dem er sich entwickelt, orientieren sich, ebenso wie die Personen, die er beobachtet, ziemlich genau an der Wirklichkeit.
Die Ereignisse sind zum größten Teil nicht erfunden.
Bei den Personen jedoch habe ich, ausgehend von dem vielseitigen Stoff, von der Freiheit Gebrauch gemacht, Neues zu erschaffen, wobei ich mich mehr an die dichterische als an die einfache, schlichte Wahrheit gehalten habe.
Das ist so wenig verstanden worden, dass sich zahlreiche Leute aufgrund eines charakteristischen Merkmals, einer Schrulle, einer Ähnlichkeit des Namens oder des Berufs wiedererkannt haben wollen und einige mich gerichtlich belangt haben.
Ich bin in diesem Fall leider nicht der Einzige; viele meiner Schriftstellerkollegen haben solche Erfahrungen gemacht. Heutzutage ist es schwierig, einer Romanfigur einen Namen, einen Beruf, eine Adresse oder sogar eine Telefonnummer zu geben, ohne sich gerichtlicher Verfolgung auszusetzen.
Die erste Ausgabe von Stammbaum trug den Vermerk: »Ende des ersten Bandes«, und ich erhalte noch heute Briefe, in denen man mich fragt, wann die folgenden Bände erscheinen werden.
Ich habe Roger Mamelin verlassen, als er sechzehn Jahre alt war. Der zweite Band müsste von seiner Jugend erzählen, der dritte von seiner ersten Zeit in Paris und seiner Lehre in dem Beruf, den ich an anderer Stelle den Beruf, ein Mensch zu sein, genannt habe.
Die beiden Bände habe ich nicht geschrieben und werde es auch nicht tun; denn wie viele neue Verurteilungen zu empfindlich hohen Geldstrafen würde mir das bei den Hunderten Nebenpersonen, die ich auftreten lassen müsste, einbringen? Ich wage nicht, daran zu denken.
In der Auflage von 1952 in einer neuen Aufmachung habe ich vorsichtshalber und vielleicht etwas ironisch die beanstandeten Passagen weggelassen und durch unschuldige Punkte ersetzt. Die Lücken habe ich in einem kurzen Vorwort den Gerichten zur Last gelegt.
In der vorliegenden Ausgabe findet man keine solchen Stellen mehr. Nicht ohne Wehmut habe ich sogar auf die Ironie verzichtet und mein Buch von all dem gereinigt, was verdächtig oder verletzend erscheinen könnte.
Dennoch wiederhole ich, nicht aus Vorsicht, sondern aus Sorge um Genauigkeit, dass Stammbaum ein Roman, also ein Werk ist, in dem die Phantasie und die Wiedererschaffung den größten Teil einnehmen, was mich nicht daran hindert zuzugeben, dass Roger Mamelin viel Ähnlichkeit mit dem Kind aufweist, das ich war.
Georges Simenon Noland, den 16. April 1957
Erster Teil
1
Sie öffnet die Augen. Für einen Moment, mehrere Sekunden, eine lautlose Ewigkeit bemerkt sie keinerlei Veränderung, weder in ihr noch in der Küche um sie herum; zudem nimmt sie keine Küche wahr, sondern nur ein Durcheinander von Schatten und schwachen Lichtreflexen ohne Bestand, ohne Bedeutung. Vielleicht ist sie im Vorhof des Paradieses?
Haben sich die Augenlider der Schläferin zu einem bestimmten Zeitpunkt gehoben? Oder blieben die Pupillen starr ins Leere gerichtet wie das Objektiv eines Fotografen, der vergaß, das schwarze Samttuch wieder herunterzulassen?
Draußen irgendwo – das heißt, in der Rue Léopold – spielt sich ein sonderbares Leben ab, düster, weil die Nacht hereingebrochen ist, lärmend und gehetzt, weil es fünf Uhr nachmittags ist, feucht und träge, weil es seit mehreren Tagen regnet. Die bleichen Kugeln der Bogenlampen leuchten vor den Schaufensterpuppen der Konfektionsgeschäfte, die Straßenbahnen fahren vorüber und sprühen blaue Funken, grell wie Blitze.
Élise hat die Augen geöffnet und ist noch weit entfernt, nirgendwo; von draußen dringen nur diese unwirklichen Lichter durch das Fenster und die weiß geblümten Spitzengardinen und projizieren Arabesken auf die Wände und Gegenstände im Zimmer.
Das vertraute Summen des Ofens mit der kleinen rötlichen Öffnung, durch die hindurch manchmal zu sehen ist, wie kleine Kohlenstücke ins Feuer fallen, wird ihr als Erstes wieder bewusst; das Wasser in dem weißen Emaillekessel mit dem angeschlagenen Schnabel beginnt zu singen; der Wecker auf dem schwarzen Kamin nimmt sein Ticktack wieder auf.
Jetzt erst spürt Élise, wie es dumpf in ihrem Bauch arbeitet, und sie sieht sich selbst unsicher auf einem Stuhl sitzen, sie weiß, dass sie mit dem Geschirrtuch in der Hand vor dem Ofen eingeschlafen ist. Sie weiß auch, wo sie sich befindet: in der zweiten Etage bei den Cessions, mitten in einer geschäftigen Stadt, nicht weit von dem Pont des Arches, der die Stadt von den Vororten trennt; sie hat Angst, sie steht zitternd auf, ihr Atem geht schwer, und dann, um sich durch eine alltägliche Handlung wieder zu beruhigen, schüttet sie Kohlen in den Ofen.
»Mein Gott …«, murmelt sie.
Désiré ist weit weg, am anderen Ende der Stadt, in seinem Büro in der Rue des Guillemins, und vielleicht wird sie ganz allein entbinden, während weiterhin Hunderte, Tausende Passanten mit ihren Regenschirmen auf den glänzenden Gehsteigen aneinanderstoßen.
Ihre Hand macht eine Bewegung, um die Streichhölzer, die neben dem Wecker liegen, zu ergreifen; aber sie hat nicht die Geduld, zuerst den milchigen Lampenschirm, dann das Glas von der Petroleumlampe zu nehmen und den Docht hochzudrehen; sie hat zu große Angst. Es fehlt ihr der Wille, die herumstehenden Teller in den Schrank zu räumen, und ohne in den Spiegel zu blicken, setzt sie ihren schwarzen Hut auf, den sie noch aus der Trauerzeit für ihre Mutter besitzt. Sie zieht ihren schwarzen Cheviotmantel an, der auch zu der Trauerkleidung gehört und sich nicht mehr zuknöpfen lässt, sodass sie ihn über ihrem gewölbten Bauch zusammenhalten muss.
Sie hat Durst. Sie hat Hunger. Irgendetwas fehlt ihr. Sie fühlt sich wie leer, aber sie weiß nicht, was sie tun soll, sie flieht aus dem Zimmer und stopft den Schlüssel in ihr Handtäschchen.
Man schreibt den 12. Februar 1903. Im Treppenhaus zischt und spuckt ein Gasbrenner sein weiß glühendes Gas aus; es gibt nämlich Gas im Haus, allerdings nicht im zweiten Stock.
Im ersten Stockwerk sieht Élise Licht unter einer Tür; sie wagt nicht zu klopfen, der Gedanke kommt ihr gar nicht. Ein Rentnerehepaar lebt dort, die Delobels. Sie spekulieren an der Börse, ein egoistisches Paar, das sich das Leben angenehm macht und jedes Jahr mehrere Monate in Ostende oder Nizza verbringt.
Ein Luftzug streift sie in dem engen Durchgang zwischen zwei Geschäften. In den Schaufenstern von Cession liegen Dutzende von dunklen Hüten, und drinnen stehen verlegene Leute, die sich in den Spiegeln betrachten und nicht zu sagen wagen, ob sie mit ihrem Spiegelbild zufrieden sind, und Madame Cession, die Hauswirtin von Élise, im Schwarzseidenen mit schwarzem Spitzeneinsatz und Gemme, um den Hals eine Uhr an der Kette.
Straßenbahnen fahren alle paar Minuten vorbei, grüne, die nach Trooz, nach Chênée oder Fléron fahren, rote und gelbe, die als Ringlinien ohne Unterbrechung durch die Stadt fahren.
Straßenhändler rufen die Liste der Nummern aus, die bei der letzten Verlosung gewonnen haben, und andere wieder schreien:
»Die Baronesse von Vaughan, zehn Centime! Verlangen Sie das Porträt der Baronesse von Vaughan!«
Das ist die Mätresse von Léopold II. Wie es scheint, verbindet ein unterirdischer Tunnel sein herrschaftliches Privathaus mit dem Schloss von Laeken.
»Verlangen Sie die Baronesse von Vaughan …«
Soweit Élise sich auch zurückerinnert, sie hat immer das gleiche Gefühl, klein zu sein; ja, sie ist ganz klein, zu schwach und schutzlos in einem zu großen Universum, das sich nicht um sie kümmert, und sie kann nur stammeln:
»Mein Gott …«
Sie hat ihren Regenschirm vergessen, und sie hat nicht den Mut, wieder hinaufzugehen, um ihn zu holen. Feine Tröpfchen benetzen ihr rundes Gesicht, das Gesicht eines kleinen Mädchens aus dem Norden, und ihr blondes Haar, das so frisiert ist, wie es in Flandern üblich ist.
Für sie ist jeder beeindruckend, sogar dieser Mann da im Gehrock, steif wie eine Schaufensterpuppe, mit gewichstem Schnurrbart und einem Umlegekragen so hoch wie eine Manschette, der unter der Lampe eines Konfektionsgeschäftes von einem Bein auf das andere tritt. Er stirbt fast vor Kälte an Füßen, Nase und Fingern. Er hat in der Menschenmenge, die auf dem Gehsteig hin und her geht, die Mamans im Auge, die ein Kind hinter sich herziehen. Seine Taschen sind voll von kleinen Farbdrucken und Bilderrätseln: »Suchen Sie den Bulgaren.«
Es ist kalt. Es regnet. Es ist trübe. Ein warmer Schokoladengeruch steigt auf, als sie vor den vergitterten Kellerfenstern von Hosay vorbeigeht. Sie geht schnell. Sie hat keine Schmerzen, und dennoch ist sie sicher, dass die Wehen in ihr beginnen und dass ihre Zeit gekommen ist. Ihr Strumpfhalter ist aufgegangen, und ihr Strumpf rutscht. Kurz vor der Place Saint-Lambert öffnet sich zwischen zwei Geschäften eine schmale Gasse, die immer im Dunkeln liegt. Dort eilt sie hinein und stellt ihren Fuß auf den Bordstein.
Spricht sie zu sich selbst? Ihre Lippen bewegen sich.
»Mein Gott, mach, dass ich genug Zeit habe!«
Und während sie ihre Röcke hochrafft, um an den Strumpfhalter heranzukommen, hält sie plötzlich inne: Dort, im Schatten, in den ein Lichtschein der Rue Léopold dringt, stehen zwei Männer. Zwei Männer, die sie wohl bei der Unterhaltung gestört hat. Verstecken sie sich? Sie könnte es nicht sagen, aber undeutlich spürt sie etwas Verdächtiges in deren Beisammensein. Wahrscheinlich warten sie schweigend darauf, dass diese kopflose Frau, die blindlings bis auf zwei Meter auf sie zugestürzt kam, um ihren Strumpf hochzuziehen, wieder verschwindet.
Sie schaut kaum zu ihnen hin; schon zieht sie sich wieder zurück, als ihr dennoch ein Name auf die Lippen kommt:
»Léopold …«
Sie musste diesen Namen aussprechen, wenn auch nur halblaut. Sie ist sicher, fast sicher, einen ihrer Brüder, Léopold, wiedererkannt zu haben, den sie seit Jahren nicht mehr gesehen hat: ein Rücken, der mit fünfundvierzig Jahren bereits gebeugt ist, ein tiefschwarzer Bart, funkelnde Augen unter dichten Brauen. Sein Begleiter, der an diesem Februarabend im Luftzug der Gasse steht, ist sehr jung, ein Kind, noch bartlos. Er hat keinen Mantel an. Seine Züge sind angespannt wie bei jemandem, der seine Tränen zurückhält …
Élise kehrt zu der Menschenmenge zurück; sie wagt nicht, sich umzublicken. Ihr Strumpfhalter ist immer noch lose, was ihr das Gefühl gibt, schief zu gehen.
»Mein Gott, mach, dass … Und was hat mein Bruder Léopold …?«
Place Saint-Lambert, mit den vielen, noch helleren Lichtern des Grand Bazar, das immer mehr erweitert wird und bereits zwei Häuserblocks verschlungen hat. Die schönen Schaufenster, die Kupfertüren, die sich lautlos öffnen und schließen, und dieser warme, so eigenartige Windhauch, der einen bis zur Mitte des Gehsteigs erreicht.
»Verlangen Sie die Liste der Losnummern, die bei der Brüsseler Verlosung gewonnen haben!«
Schließlich erblickt sie Schaufenster von unauffälligerem Luxus, die Schaufenster des l’Innovation, die voll sind mit Waren aus Seide und Wolle. Sie geht hinein. Es scheint ihr, als müsste sie sich immer mehr beeilen. Sie lächelt, denn sie lächelt immer, wenn sie wieder ins l’Innovation kommt, und wie im Traum begrüßt sie die schwarz gekleideten Verkäuferinnen hinter den Verkaufstischen, die sie kaum erkennen kann.
»Valérie!«
Valérie ist drüben, bei den Handarbeiten. Sie bedient eine alte Kundin und bemüht sich, Stickseidengarn auszuwählen. Als Valérie das erschrockene Gesicht Élises entdeckt, sagen ihre Augen:
»Mein Gott!«
Denn sie sind beide von der gleichen Art, sie gehören zu denen, die vor allem Angst haben und sich immer als zu schwach empfinden. Valérie wagt nicht, ihre Kundin zu drängen. Sie hat verstanden. Im Voraus sucht sie mit den Blicken Monsieur Wilhelms neben der Hauptkasse, den obersten Chef, mit seinen knarrenden Lackschuhen und gepflegten Händen.
Drei, vier Tische weiter, bei der Babywäsche, steht Maria Debeurre, die Élise betrachtet und gern mit ihr sprechen würde, während diese sich in ihrer Trauerkleidung ganz aufrecht hält und mit den Fingern an den Ladentisch klammert. Die feuchte Wärme des Kaufhauses steigt ihr zu Kopf. Der fade Geruch der Stoffe, der Madapolamstoffe, der Sergen, der durchdringende Geruch all dieser Ballen und diese farblosen Seidenlappen, all das widert sie an, genauso wie die lastende Stille, die in den Gängen herrscht.
Es scheint ihr, als würde sie blass um die Nase, als gäben ihre Beine nach, aber ein grämliches Lächeln bleibt auf ihren Lippen hängen, und manchmal nickt sie unauffällig Verkäuferinnen zu, die weit entfernt sind und von denen sie durch einen flirrenden Nebel hindurch nur das schwarze Kleid mit dem Lackgürtel sieht.
Drei Jahre lang lebte sie hinter einem dieser Verkaufstische. Als sie sich vorstellte …
Aber man muss weiter ausholen. Ihr Leben als kleine, ängstliche und immer ein wenig überempfindliche Maus begann, als sie fünf Jahre alt war, als ihr Vater starb und als sie das riesige Haus am Kanalufer in Herstal verließen, wo die Bäume aus dem Norden Holzschuppen gewaltig wie Kirchen füllten.
Sie wusste nichts. Sie verstand nichts. Sie kannte kaum diesen Vater mit dem langen schwarzen Schnurrbart, der Dummheiten gemacht, Gefälligkeitswechsel unterzeichnet hatte und daran gestorben war.
Die Geschwister waren verheiratet oder hatten sich bereits davongemacht, denn Élise war das dreizehnte Kind, mit dessen Geburt man nicht mehr gerechnet hatte.
Zwei kleine Zimmer in einem alten Haus, nahe der Rue Féronstrée. Sie lebte allein mit ihrer Mutter, einer würdevollen, immer gepflegten Frau, die leere Töpfe auf den Herd stellte, wenn jemand kam, um den Anschein zu erwecken, dass es ihnen an nichts fehlte.
Das strubbelige kleine Mädchen schlich sich in einen Laden, deutete auf etwas in der Auslage, öffnete den Mund, fand nicht die richtigen Worte.
»Ein paar … ein paar …«
Ihr Vater war Deutscher, ihre Mutter Holländerin. Élise wusste noch nicht, dass sie nicht dieselbe Sprache wie die anderen sprach, sie wollte unbedingt etwas sagen und brachte vor der belustigten Verkäuferin auf gut Glück hervor:
»Ein paar … Frikadellen.«
Warum Frikadellen? Das Wort kam ihr über die Lippen, weil sie es bei sich zu Hause gehört hatte; hier im Laden jedoch rief es schallendes Gelächter hervor. Es war die erste Demütigung in ihrem Leben. Sie lief schnell nach Hause, ohne etwas mitzubringen. Dort brach sie dann in Tränen aus.
Um dem Leben zu Hause etwas von seiner Ärmlichkeit zu nehmen, hatte sie mit fünfzehn Jahren ihr Haar hochgesteckt, ihr Kleid länger gemacht und sich diesem so gepflegten, höflichen Monsieur Wilhelms vorgestellt.
»Wie alt sind Sie?«
»Neunzehn Jahre.«
Diejenigen, die sie heute hier aufsucht, sind so etwas wie ihre wirkliche Familie: Valérie Smet, Maria Debeurre und die anderen, die sie von weitem beobachten, und sogar die Verkäuferinnen von oben, aus den anderen Abteilungen für Möbel, Linoleum und Spielzeug.
Sie spielt die Tapfere. Sie lächelt, folgt mit den Augen der winzigen Valérie, die von einer enormen dunklen Haarfülle erdrückt wird und deren Figur von dem Lackgürtel in zwei Hälften geteilt wird wie bei einem Diabolo.
»Kasse!«
Die alte Dame hat sich entschieden. Valérie läuft herbei.
»Glaubst du, es ist heute so weit?«
Sie flüstern wie bei der Beichte, blicken ängstlich zur Hauptkasse und zu den Aufsichtspersonen in ihren Jacken.
»Désiré?«
»Er ist im Büro. Ich habe nicht gewagt, ihn benachrichtigen zu lassen.«
»Warte … Ich werde Monsieur Wilhelms fragen.«
Élise erscheint das Ganze wie eine Ewigkeit, und dennoch hat sie keine Schmerzen, sie fühlt nichts anderes als eine unbestimmte Angst im ganzen Körper. Vor zwei Jahren, als sie und Valérie immer Arm in Arm das Geschäft verließen, trafen sie regelmäßig einen großen, schüchternen jungen Mann mit spitzem Kinnbärtchen und schlichter Kleidung.
Valérie legte sich besonders ins Zeug.
»Ich bin sicher, dass er deinetwegen kommt.«
Er war wirklich groß, fast ein Meter neunzig, und die beiden waren, eine wie die andere, gleich klein. Woher hatte Valérie ihre Informationen?
»Er heißt Désiré, Désiré Mamelin. Er ist Versicherungsangestellter bei Monsieur Monnoyeur in der Rue des Guillemins.«
Jetzt bemüht sich Valérie, Monsieur Wilhelms die Situation zu erklären; der wirft einen Blick auf seine ehemalige Verkäuferin und nickt.
»Warte einen Augenblick auf mich. Ich hole eben meinen Mantel und meinen Hut.«
Draußen ein Krach, als würden zwei Straßenbahnen zusammenstoßen.
»Mein Gott«, seufzt Élise.
Dreimal in zwei Monaten hat es einen Straßenbahnunfall unter ihren Fenstern in der Rue Léopold gegeben. Nur einige Kundinnen, die in der Nähe des Eingangs stehen, stürzen hinaus. Die Verkäufer und Verkäuferinnen bleiben an ihren Plätzen. Man hört einige schrille Schreie, dann ein Durcheinander von Stimmen. Monsieur Wilhelms hat sich keinen Ellbogenbreit von der Hauptkasse aus lackierter Eiche wegbewegt. Er streicht seinen silbergrauen Schnurrbart glatt. Vor dem Schaufenster laufen Leute vorbei. Valérie kommt zurück.
»Hast du das gehört?«
»Ein Unfall …«
»Kannst du gehen?«
»Aber ja, meine liebe Valérie. Ich bitte dich um Verzeihung, dass ich dich gestört habe. Was hat er gesagt?«
Er, das ist Monsieur Wilhelms, der Allmächtige.
»Komm. Stütz dich auf meinen Arm.«
»Ich versichere dir, dass ich noch in der Lage bin, allein zu gehen.«
Lautlos öffnen sich die Türen. Sie treten in die feuchte Kälte hinaus, hören ein Getrappel von überallher und sehen Hunderte, vielleicht Tausende von Menschen, die zum nahen Grand Bazar drängen, und schon stehen Straßenbahnen in einer langen Kette bewegungsunfähig hintereinander.
»Komm, Élise. Wir gehen durch die Rue Gérardrie.«
Aber Élise stellt sich hinter der Menge auf die Zehenspitzen.
»Schau …«
»Ja …«
Das Grand Bazar auf der Place Saint-Lambert hat eine riesige Markise, die den gesamten Gehsteig überdacht. Auf einer Länge von mehr als zehn Metern sind die Schaufensterscheiben zertrümmert, die Eisenbeschläge haben sich verbogen, und die Lampen sind erloschen.
»Was ist los, Monsieur?«
Élise fragt bescheiden den Erstbesten.
»Woher soll ich das wissen? Ich weiß nicht mehr als Sie.«
»Komm, Élise …«
Polizisten laufen herbei, versuchen sich durch die Menge zu drängen. Hinter ihnen ist die Sirene eines Feuerwehrautos zu hören, dann die eines Krankenwagens.
»Weitergehen! … Weitergehen, bitte!«
»Das Schaufenster, Valérie …«
Zwei der Schaufenster des Kaufhauses sehen aus wie große dunkle Löcher, nur die Zacken der Scheiben sind wie Stalaktiten übrig geblieben.
»Was ist passiert, Herr Wachtmeister?«
Der Polizist hat es eilig und antwortet nicht. Ein älterer Herr mit Zigarre drängt sich beharrlich nach vorn, antwortet von der Seite:
»Eine Bombe. Wieder die Anarchisten …«
»Élise, ich flehe dich an …«
Élise lässt sich mit fortziehen. Sie hat ihren Schwindelanfall vergessen, er wird plötzlich durch übermäßige Nervosität verdrängt. Sie würde gern weinen, aber sie kann nicht. Valérie öffnet ihren Schirm, drückt sich eng an Élise und führt sie in Richtung Rue Gérardrie.
»Wir gehen jetzt zur Hebamme.«
»Vorausgesetzt, sie ist zu Hause.«
Die umliegenden Straßen sind menschenleer. Jeder ist auf die Place Saint-Lambert geeilt, die Geschäftsleute stehen in der Tür ihres Ladens und fragen die Passanten.
»Im zweiten Stock, ja.«
Eine Visitenkarte, auf der der Name der Hebamme steht, empfiehlt dreimal zu läuten. Sie läuten. Eine Gardine bewegt sich.
»Sie ist zu Hause.«
Im Hausflur wird das Gaslicht angezündet. Eine dicke Frau versucht, die Gesichtszüge der Besucherinnen in der Dunkelheit des Gehsteiges zu erkennen.
»Ah! Sie sind’s … Glauben Sie? … Gut. Gehen Sie nur nach Hause. Ich komme nach. Unterwegs werde ich Doktor van der Donck benachrichtigen, damit er bereit ist für den Fall, dass wir ihn benötigen.«
»Valérie! Sieh mal!«
Berittene Polizisten traben herbei und lenken zur Place Saint-Lambert.
»Denk nicht mehr daran. Komm …«
Und als sie bei Hosay vorbeikommen, schiebt Valérie Élise in das Geschäft.
»Iss etwas, das wird dir guttun. Du zitterst ja wie Espenlaub.«
»Meinst du?«
Valérie sucht Kuchen aus und verlangt, etwas verlegen, ein Glas Portwein. Sie fühlt sich zu einer Erklärung verpflichtet:
»Das ist für meine Freundin, die …«
»Mein Gott, Valérie!«
Um sechs Uhr verlässt der lange Désiré sein Büro in der Rue des Guillemins und geht mit langen, regelmäßigen Schritten nach Hause.
»Er hat einen so schönen Gang!«
Er dreht sich nicht um, bleibt nicht vor den Auslagen stehen. Er raucht seine Zigarette und geht, den Blick geradeaus gerichtet, geht, als würde eine Melodie ihn begleiten. Sein Weg ändert sich nicht. Immer zur gleichen Zeit, bis auf die Minute genau, kommt er vor den Normaluhren an, und genau an derselben Stelle zündet er seine zweite Zigarette an.
Er weiß nichts von dem, was sich auf der Place Saint-Lambert abgespielt hat, und er ist erstaunt, vier Straßenbahnen im Gänsemarsch hintereinanderherfahren zu sehen. Vielleicht ein Unfall?
Mit seinen fünfundzwanzig Jahren hat er nie eine andere Frau als Élise gekannt. Bevor er sie traf, verbrachte er seine Abende bei einem Wohltätigkeitsverein. Er war Souffleur in der Theaterabteilung.
Er geht weiter und kommt durch die Rue de la Cathédrale zur Rue Léopold, betritt den Hausflur, schaut hoch und sieht auf den Stufen der Treppe nasse Spuren, als wären mehrere Personen hinaufgegangen.
Dann stürzt er hoch. Schon in der ersten Etage hört er ein Stimmengemurmel. Die Tür wird geöffnet, bevor er den Knauf berührt. Das kleine, verstörte Gesicht Valéries erscheint, kugelrund, mit Wimpern und Haaren wie bei einer japanischen Puppe und mit zwei roten Flecken auf den Wangen.
»Du bist’s, Désiré … psst … Élise …«
Er will zu ihr. Er geht in die Küche, aber die Hebamme hält ihn auf.
»Vor allem, keine Männer hier drin. Warten Sie draußen. Wir rufen Sie, wenn Sie kommen können.«
Und er hört Élise im Zimmer stöhnen.
»Mein Gott, Madame Béguin, Désiré ist schon da! … Wo wird er essen?«
»Nun! Also, sind Sie immer noch nicht weg? Ich sage Ihnen doch, dass man Sie rufen wird. Hören Sie … Ich werde die Lampe vor dem Fenster bewegen.«
Er bemerkt nicht, dass er seinen Hut auf einer Ecke des unordentlichen Tisches vergisst. Sein langer schwarzer Mantel ist fast bis zum Kragen zugeknöpft und gibt ihm ein feierliches Aussehen. Er trägt einen kleinen braunen Kinnbart wie die Musketiere.
Jetzt ist die Straße leer, kaum belebt durch das Geräusch des feinen Nieselregens. Die Schaufenster sind eins nach dem anderen hinter den Eisenrollläden verschwunden. Die Männer mit den eiskalten Nasen, die an den Türen der Konfektionsgeschäfte bunte Prospekte verteilten, hat die Nacht verschluckt. Die Straßenbahnen fahren jetzt seltener und machen mehr Lärm; das monotone Geräusch in der Luft kommt von den schlammigen Wellen der Maas, die sich an den Brückenpfeilern des Pont des Arches brechen.
In den benachbarten engen Straßen gibt es ziemlich viele kleine Cafés mit Milchglasscheiben und cremefarbenen Vorhängen, aber Désiré setzt seinen Fuß nur am Sonntagvormittag um elf Uhr in ein Café, und er geht immer ins Renaissance.
Er schaut bereits forschend zu den Fenstern hoch. Er denkt nicht ans Essen. Immer wieder zieht er seine Uhr aus der Tasche, und es kommt vor, dass er mit sich selbst spricht.
Um zehn Uhr ist nur noch er auf dem Gehsteig. Als er die Helme von Polizisten auf der Seite der Place Saint-Lambert sieht, zuckt er kaum mit den Wimpern.
Zweimal ist er die Treppe hinaufgestiegen und hat auf die Geräusche gehorcht, zweimal ist er wieder geflüchtet, erschreckt, mit schwerem Herzen.
»Pardon, Herr Wachtmeister …«
Der Polizist an der Straßenecke steht unter einer großen Reklameuhr mit unbeweglichen Zeigern und hat nichts zu tun.
»Können Sie mir wohl die genaue Uhrzeit sagen?«
Dann, mit dem gekünstelten Lächeln eines Mannes, der sich entschuldigt:
»Die Zeit erscheint einem so lang, wenn man wartet … wenn man auf ein so bedeutungsvolles Ereignis wartet … Stellen Sie sich vor, meine Frau …«
Er lächelt, ohne dass es ihm ganz gelingt, seinen Stolz zu verbergen.
»Von einer Minute auf die andere werden wir ein Kind haben …«, erklärt er. Er hat das Bedürfnis, alles zu erklären. Dass sie zum besten Spezialisten, Doktor van der Donck, gegangen sind. Dass er es war, der ihnen die Hebamme empfohlen hat. Dass der Arzt zu ihnen gesagt hat:
»Für meine eigene Frau würde ich sie wählen.«
»Verstehen Sie … Wenn ein Mann wie Monsieur van der Donck …«
Manchmal geht jemand mit hochgeschlagenem Mantelkragen an den Häusern vorbei, und noch lange hallt das Labyrinth der Straßen von seinen Schritten wider. Alle fünfzig Meter, unter jeder Gaslaterne, erfasst ein gelber Lichtkegel einen feuchten Nebelschwaden.
»Was machen die dort?«
Auf der Place Saint-Lambert kann man Leute hin und her gehen sehen, man sieht die Regenmäntel von Polizisten. Eben hört man das Galoppieren einer Reiterstaffel.
»Die Anarchisten …«
»Was haben sie getan?«
Désiré fragt höflich nach, aber hat er es überhaupt verstanden?
»Sie haben eine Bombe in die Schaufenster des Grand Bazar geworfen.«
»Bei dem Nächsten wird man sich daran gewöhnen müssen, nicht wahr? … Aber beim ersten … Vor allen Dingen, weil meine Frau nicht sehr kräftig ist … eher nervös …«
Désiré merkt immer noch nicht, dass er keinen Hut trägt. Runde Zelluloidmanschetten rutschen ihm bei jeder Bewegung auf die Hände. Soeben hat er sein Päckchen Zigaretten zu Ende geraucht, und um sich ein neues zu kaufen, müsste er zu weit von hier weggehen.
»Wenn diese Frau nun vergisst, die Lampe zu bewegen … Sie hat so viel zu tun!«
Um Mitternacht entschuldigt sich der Polizist und entfernt sich. Auf der Straße ist nun keine Menschenseele mehr, keine Straßenbahnen, nichts mehr, nur entfernte Schritte, Türen, die geschlossen, Riegel, die vorgeschoben werden.
»Endlich, die Lampe …«
Es ist genau zehn Minuten nach Mitternacht. Désiré stürzt los wie ein Verrückter. Seine langen Beine bezwingen die Entfernung.
»Élise …«
»Psst! … Nicht so laut …«
Dann weint er. Er weiß weder, was er tut, noch, was er sagt, noch, dass fremde Frauen ihm zusehen. Er wagt nicht, das Kind, das ganz rot ist, zu berühren. Der fade Geruch der Wohnung fällt ihm auf. Valérie geht zum Ausguss in den Zwischenstock, um Wasser auszuschütten.
Élise liegt in der Bettwäsche, die sie extra dafür gestickt hat und die soeben aufgezogen worden ist; sie lächelt schwach.
»Es ist ein Junge«, stammelt sie.
Ohne sich darum zu kümmern, was die anderen denken, sagt er, wobei er immer noch weint:
»Ich werde nie, niemals vergessen, dass du mir soeben die größte Freude gemacht hast, die eine Frau einem Mann machen kann.«
»Désiré … Hör mal … Wie spät ist es?«
Das Kind ist zehn Minuten nach Mitternacht geboren.
Élise flüstert:
»Hör mal, Désiré … Er hat an einem Freitag, den 13., das Licht der Welt erblickt. Wir dürfen es niemandem sagen. Wir müssen diese Frau bitten …«
So lässt Désiré am nächsten Morgen, als er zusammen mit seinem Bruder Arthur als Zeugen zum Rathaus geht, um das Kind anzumelden, mit Unschuldsmiene eintragen:
»Roger Mamelin, geboren in Lüttich, 18 Rue Léopold, am Donnerstag, dem 12. Februar 1903.«
Automatisch fügt er hinzu:
»Über den Cessions.«
2
Und warum sollte es sich nicht wirklich um einen Hausgeist handeln? Warum tritt er immer in demselben Augenblick in Erscheinung, um gewissermaßen »Guten Morgen« zu wünschen? An den anderen Vormittagen läuft Élise auf und ab; heute jedoch liegt sie unbeweglich im warmen Bett, die Schultern auf ihr und Désirés Kopfkissen gestützt. In der Wiege geht leicht pfeifend der Atem des Kindes, das soeben die Brust bekommen hat. Élise macht ihr grämliches Gesicht, nicht traurig, sondern grämlich, sie lächelt verschleiert, ein wenig aus Scham, ein wenig aus Mitleid, weil das, was Désiré sich in diesem Augenblick zu tun zwingt, eigentlich nicht die Aufgabe eines Mannes ist.
Das Feuer im Ofen ist gerade erst angezündet worden. Man fühlt, wie seine Wärme in kleinen Wellen durch die Kälte des Morgens gekrochen kommt; wenn man darauf achtet, kann man sogar einen richtigen Kampf spüren: Die warmen, dann heißen Wellen, die dem Ofen entweichen, stoßen kurz hinter dem Tisch auf die eiskalte Luft, die während der ganzen Nacht an den schwarzen Fensterscheiben vorbeigestrichen ist. Morgens, vor allem sehr früh am Morgen, wenn man zu einer ungewöhnlichen Zeit aufsteht, verbreitet das Feuer nicht dieselbe Stimmung wie sonst während des Tages; es macht nicht dasselbe Geräusch. Die Flammen sind heller, das hat Élise oft beobachtet.
Und das ist der Augenblick, in dem man plötzlich meinen könnte, das lackierte Blech blähe sich auf, ein guter Geist erwache im Innern des Ofens und dehne sich aus, um in einem fröhlichen »Bum!« zu explodieren.
Jeden Morgen! Und jedes Mal entsteht daraufhin dieser feine Regen von rosa Asche, und dann, wenig später, beginnt das Summen des Wassers im Kessel.
Es ist gerade sechs Uhr. Auf der Straße hört man nur die Schritte eines Menschen, und wahrscheinlich hat dieser unbekannte Fußgänger zu den Fenstern hochgeblickt, zu den einzigen, die erleuchtet sind. Durch die Scheiben sieht man nichts, nicht einmal den Schein der Gaslaternen, aber es muss in Strömen regnen, denn ein ständiges Gluckern geht die Dachrinne hinunter. Manchmal ein Windstoß, den man aufgrund eines plötzlichen Luftzuges im Kamin, durch Asche, die in den Aschenkasten fällt, bemerkt.
»Mein Gott, Désiré …«
Sie hat nicht gewagt, »armer Désiré« zu sagen. Sie schämt sich, unbeweglich im Zimmer mit der weit offen stehenden Verbindungstür zu liegen. Sie schämt sich noch mehr wegen der Ungezwungenheit, des inneren Friedens und der Heiterkeit, die der lange Désiré ausstrahlt, während er den Haushalt besorgt. Vor seinen dunklen Anzug hat er sich eine Schürze seiner Frau gebunden, eine kleine Baumwollschürze mit blauen Karos, eine abgetragene Schürze, die mit einem Volant verziert ist; gleichgültig gegenüber der lächerlichen Wirkung, hat er die zu kurzen Träger mit Sicherheitsnadeln an seine Schultern geheftet.
Manchmal geht er, einen Eimer in jeder Hand, hinunter zum Ausguss in den Zwischenstock, so leise, dass man kein Rascheln hört, auch nicht das metallene Geräusch, das der Henkel des Eimers sonst macht, und kaum hört man den leisen Strahl des Wasserhahns.
Er wollte den Fußboden gründlich wischen, denn am Vorabend waren viele Leute da, und weil es regnete, wurde viel Dreck gemacht. Ein Tag, der sich von allen anderen unterschied, dieser Samstag, einer von diesen Tagen, die man nur undeutlich in Erinnerung behält: Valérie nahm einen Tag frei und blieb bei Élise, Maria Debeurre kam in der Mittagspause; dann Désirés Schwestern, sein Bruder Arthur, fröhlich und polternd, immer zu einem Scherz aufgelegt. Er bestand darauf, dem Standesbeamten im Rathaus ein Gläschen anzubieten.
Madame Cession musste wütend sein über dieses Kommen und Gehen im Treppenhaus, und die Leute in der ersten Etage hielten ihre Tür unnahbar geschlossen.
Jetzt ist alles sauber. Das ist komisch: Die Männer wringen den Aufnehmer andersherum aus, von links nach rechts!
Es ist Sonntag. Aus diesem Grund hört man nichts von draußen, während sich die Zeiger des Weckers weiterbewegen, nur die zaghaften Aufrufe der Glocken zur ersten Messe.
»Lass es sein, Désiré. Valérie wird sich darum kümmern.«
Aber nein! Désiré hat Wasser aufgesetzt. Er ist es, der die Windeln wäscht, er, der sie dann zum Trocknen auf die Leine hängt, die quer über den Ofen gespannt ist. Er hat daran gedacht, den alten Kattunstoff mit dem verschossenen Rankenmuster, den sie samstags immer ausbreiten, um nichts schmutzig zu machen, auf den Boden, der noch lange feucht bleibt, zu legen. Désiré denkt an alles. So hat er auch, wie Élise es immer macht, alte Zeitungen zwischen Stoffteppich und Fußboden geschoben, damit dieser trocken bleibt.
Der Tag bricht an, und man weiß nicht, ob es nieselt oder ob es nur Nebel ist, der die Straße erfüllt. Dicke, klare Tropfen fallen von den Fenstersimsen. Die ersten Straßenbahnen, noch beleuchtet, scheinen sich treibenzulassen.
»Wenn ich daran denke, dass ich dir nicht einmal helfen kann!«
An diesem Morgen fühlen sie sich so sehr zu Hause! Ihre Wohnung in der zweiten Etage bei Cession hängt wie losgelöst über der übrigen Welt.
Désiré summt beim Rasieren. Élise zwingt sich dazu, die Unruhe zu vertreiben oder die Traurigkeit, sie weiß nicht, was es ist, ein Gefühl, das sie jedes Mal heimtückisch überkommt, bevor sie sich unglücklich fühlt.
Als sie ganz klein war und sich noch keine Gedanken machte, brach die Katastrophe ohne Warnung über ihre Familie herein. Sie stand zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester Félicie – ihre anderen Geschwister lebten irgendwo verstreut – in tiefer Trauer fast auf der Straße, und seither ist es ihr immer so vorgekommen, als erlitte sie ein besonderes Schicksal, als wäre sie vielleicht nicht so wie die anderen. Sie wird von plötzlichem, unwiderstehlichem Drang zu weinen ergriffen, und sie vergießt oft Tränen, sogar in den ersten Tagen ihrer Ehe.
»Weißt du, ich bin so sehr daran gewöhnt zu weinen!«, versuchte sie Désiré zu erklären. »Es ist stärker als ich.«
Ist der Kleine nicht zu rot? Er bekommt schlecht Luft. Sie ist davon überzeugt, dass er schlecht Luft bekommt, so als beklömme ihn etwas, aber sie wagt es nicht zu sagen. Bald wird ihre Schwiegermutter kommen, und Élise malt sich diesen Besuch aus. Ihre Schwiegermutter mag sie nicht.
»Heirate, wenn du willst, mein Sohn. Das geht nur dich etwas an, aber wenn du mich nach meiner Meinung fragst …«
Ein Mädchen von der anderen Seite des Flusses, ein Mädchen ohne Familie sozusagen, nicht sehr gesund, ein Mädchen, das, wenn es mit ihren Schwestern zusammen ist, eine Sprache spricht, die man nicht versteht.
»Valérie kommt nicht«, seufzt Élise und sieht auf die Uhr. »Du kannst gehen, Désiré. Verspäte dich nicht. Ich kann sehr gut allein warten.«
Er hat die leuchtend blaue Uniform der Bürgerwehr angelegt und seinen Gürtel umgeschnallt. Aus einer weißen Schachtel hat er den sonderbaren hohen Hut mit dem goldbraunen Federbusch genommen und bereits aufgesetzt. Er steigt auf einen Stuhl – auf diesen alten Stuhl, der immer dazu benutzt wird –, um sein Mausergewehr vom Kleiderschrank zu nehmen. Obwohl das Gewehr nicht geladen ist, hat Élise Angst davor.
»Geh! Ich versichere dir, dass ich allein bleiben kann.«
Er steht nah am Fenster, das die blaugrüne, weißliche Farbe der Winterwolken angenommen hat, und wartet. Die Fensterläden der Geschäfte bleiben geschlossen. Von Zeit zu Zeit gleiten schwarze Gestalten an den Fassaden vorüber, sehr wenige, denn die Leute nutzen den Sonntag, um bis in die Puppen zu schlafen.
»Da ist Valérie! Jetzt geh. Du bist spät dran.«
Er küsst sie, und sein Schnurrbart riecht nach Rasierseife. Er wagt nicht, die zarte Haut des Babys mit seinen stachligen Barthaaren zu berühren.
»Hab ich dich warten lassen, Désiré?«
»Sieh mal, Valérie. Er wollte unbedingt den Haushalt machen und die Windeln waschen.«
Kaum ist Désiré im Treppenhaus, lehnt sich Élise halb aus dem Bett und beugt sich über die Wiege.
»Komm mal, Valérie. Fühl mal. Findest du nicht, dass er zu heiß ist?«
»Aber nein, du Dummerchen!«
Alles scheint in Ordnung zu sein in der Wohnung, und dennoch entdeckt Élises Blick eine Kleinigkeit, die nicht stimmt.
»Valérie, kannst du vielleicht den Holzspan an seinen Platz zurücklegen?«
Ein Stück Holz, ein paar Quadratzentimeter groß, das unter einen Fuß des Kleiderschrankes geschoben wird, der wacklig steht und bei jedem Großreinemachen verrückt wird. Ein Mann, und sei es auch Désiré, bemerkt solche Dinge nicht!
Die Straßen können noch so leer sein, und eiskalte, feuchte Windböen können durch sie hindurchfegen, und es kann diese Atmosphäre von Verlassenheit, von der Nutzlosigkeit eines Sonntags im Winter herrschen: Dennoch scheint Désiré auf seinem Weg stets von einer Musik begleitet zu werden, die er als Einziger hört und nach der sich der Rhythmus seiner gleichmäßigen Schritte richtet. Seine genießerischen Lippen unter dem Schnurrbart sind leicht geöffnet, und das angedeutete Lächeln drückt nichts anderes aus als innere Zufriedenheit. Er überquert die Maas, sieht bald die Place Ernest-de-Bavière mit dem Boden aus gebrannten Ziegelsteinen und nähert sich den Gruppen der Bürgerwehr.
»Es ist ein Junge!«, verkündet er, ohne seine Freude zu verbergen.
Er ist glücklich darüber, dass man sich über ihn lustig macht, er ist glücklich über alles, auch über den Händedruck, den sein Hauptmann, der kleine Architekt Snyers mit den Pudelhaaren, ihm vor der Übung ausnahmsweise zukommen lässt.
Der viereckige, nicht sehr schöne Kirchturm, den man hundert Meter weiter sieht, gehört zur Kirche Saint-Nicolas, seiner Gemeinde, wo er geboren ist, wo er immer gelebt hat, und die schmale Straße, die auf den Platz führt, ist »seine« Straße, die Rue Puits-en-Sock, wo seine Verwandten immer noch wohnen.
»Prrrräsentiert das Gewehr!«
Désiré ist zu groß, oder die anderen sind zu klein. Er gibt sich Mühe. Er findet es nicht lächerlich, mit diesen Männern, die er fast alle kennt, Soldat zu spielen, Männer wie er, Familienväter, Angestellte, Handwerker oder Geschäftsleute aus dem Viertel.
»Rühren!«
In der Rue Léopold putzt Valérie das Gemüse.
»Glaubst du, Valérie, dass ich ihn stillen kann?«
»Warum solltest du ihn nicht stillen können?«
»Ich weiß nicht …«
Ist sie selbst nicht das dreizehnte Kind? Hat sie nicht immer gehört … Sie weiß, dass es ein Unglück in der Familie gegeben hat, nicht nur den Konkurs, sondern eine beschämende Sache: Ihr Vater hat, wenigstens zum Schluss, angefangen zu trinken, und er ist an Zungenkrebs gestorben.
Ihre Geschwister haben Élise nie als einen normalen Menschen betrachtet. Ein kleines Kind, das dreizehnte, mit dem man nicht mehr gerechnet hatte, das gekommen ist, um alles noch komplizierter zu machen!
Louisa, die Älteste, ist gestern als Einzige ihrer Familie gekommen, und zwar mit leeren Händen. Désirés Geschwister und sogar die Bekannten haben ein Geschenk mitgebracht, und wenn nur ein paar Weintrauben.
»Ich mache ihm lieber ein schönes Geschenk zu seiner ersten heiligen Kommunion«, hat Louisa, deren Haar vorzeitig ergraut ist, erklärt. »Ich dachte mir, dass es dir wohl an nichts fehlen wird. All diese Sachen …«, sie meint die Lätzchen, die Silberlöffelchen, die Apfelsinen, die Kuchen, »… all das Zeug, man weiß gar nicht, was man damit anfangen soll, und dann verdirbt es.«
»Aber ja, Louisa.«
Dabei ist Louisa eine wohlhabende Geschäftsfrau aus Coronmeuse. Sie blieb eine halbe Stunde sitzen, beobachtete alles, schüttelte den Kopf, und im Grunde hatte sie wohl an allem etwas auszusetzen. Sie kann Désiré nicht leiden.
»Doktor van der Donck hat versprochen, heute vorbeizukommen«, seufzt Élise. »Ich bin froh, wenn er kommt. Ich finde, das Kind ist so heiß!«
»Denk nicht mehr daran, Dummerchen. Hier! Versuch die Zeitung zu lesen, dann kommst du auf andere Gedanken.«
»Wie viel Mühe ich dir mache! Wenn ich dich nicht gehabt hätte … Arme Valérie!«
Valérie, die eilig hin und her geht, schmächtig, mit ihrem dicken Haarknoten, der den Kopf rund erscheinen lässt, und die jedem einen Gefallen tut! Sie wohnt mit Mutter und Schwester oben in der Rue Haute-Sauvenière. Die drei Personen leben in einer Zweizimmerwohnung, überheizt und mit gedämpftem Licht, die nach alter Jungfer riecht. Marie, ihre ältere Schwester, ist Schneiderin und arbeitet tageweise in den reichsten Häusern der Stadt. Valérie ist im l’Innovation beschäftigt. Ihre Mutter, Madame Smet, die außer ihrem Puppenhaushalt nichts zu tun hat, holt sie abends am Ausgang ab, einen komischen schwarzen Altfrauenhut auf dem Kopf, darunter ein Gesicht wie aus Porzellan, rot gefleckte Finger, die aus fingerlosen Handschuhen hervorlugen.
»Vergiss nicht, Zucker an die Möhren zu tun, Valérie. Désiré kann Möhren ohne Zucker nicht essen.«
Élise weiß nicht, wie sie sich verhalten soll. Es ist das erste Mal in ihrem Leben, dass sie bewegungsunfähig im Bett liegt, dazu verdammt, sich unnütz zu fühlen. Sie ist nicht in der Lage, die Zeitung zu lesen, die Valérie ihr gegeben hat; mechanisch wirft sie jedoch einen Blick auf die erste Seite, und plötzlich fühlt sie sich umgeben von einem bedrückenden Schweigen.
Sie sagt nichts. Sie darf nichts sagen, auch nicht zu Valérie, obwohl sie ihr alles anvertraut, sogar Dinge, über die sie nie mit Désiré sprechen würde. Auf der Titelseite der Zeitung ist ein Bild zu sehen, das Bild eines blassen, nervösen jungen Mannes, und Élise ist sicher, ihn wiederzuerkennen. Sie ist sicher, dass dies jenes geheimnisvolle Gesicht ist, mit dem zusammen sie Léopold flüchtig gesehen hat, als sie in dem Gässchen ihren Strumpfhalter wieder festmachen wollte.
Der Anarchist von der Place Saint-Lambert
Sie wusste schon morgens, dass etwas Unheilvolles in der Luft lag. Sie wagt nicht zu weinen vor Valérie, die es nicht verstehen würde. Was hat Léopold nun wieder getan?
… Gestern konnte die Polizei infolge einer gründlichen Nachforschung den Attentäter von der Place Saint-Lambert identifizieren. Es handelt sich um Félix Marette, wohnhaft in der Rue du Laveu, Sohn eines unserer bekanntesten und ehrenwertesten Polizisten. Félix Marette, der flüchtig ist, wird dringend gesucht.
»Die armen Leute«, seufzt Valérie, als sie sieht, dass Élise die Zeitung überfliegt. »Anscheinend wussten sie von nichts. Sie haben sicher große Opfer gebracht, um ihren Sohn auf die höhere Schule zu schicken. Als der Vater von dem Drama unterrichtet wurde, hat er gesagt:
›Lieber würde ich meinen Sohn tot sehen.‹«
Aber Léopold? Was hat Léopold, ein reifer Mann, mit diesem Bengel im Schatten der Gasse besprochen?
Da! Der Ofen macht »Bumm!«, Asche fällt durch den Rost, kleine Zwiebeln werden langsam braun gebraten, und das Kind bewegt sich in seiner Wiege.
»Valérie, meinst du nicht, es ist Zeit, die Windeln zu wechseln?«
Léopold, das älteste Kind der Familie Peters, hat noch die ruhmreiche Zeit der Familie gekannt. Er war auf der Universität und ging mit den jungen Leuten aus den höheren Kreisen, mit Waffenfabrikanten und Adligen, zur Jagd. Dann hatte er plötzlich Lust, Soldat zu werden. Zu jener Zeit wurden nur diejenigen Soldat, die beim Losziehen Pech hatten. Léopold mit seinen zwanzig Jahren hatte Glück. Er konnte jedoch einem Pechvogel seinen Platz abkaufen. Das tat Léopold. Er zog die eng anliegende Uniform der Landser an.
Es gab damals noch Marketenderinnen bei der Truppe, und Eugénie, die bei seinem Regiment war, war eine wunderbare Frau. Sie hatte spanisches Blut in den Adern wie die Kaiserin, deren Namen sie trug.
Léopold heiratete sie, und plötzlich brach er alle Brücken hinter sich ab. Er wurde als Cafékellner in Spa gesehen, wo Eugénie eine Saison lang als Köchin arbeitete.
»Vorsicht mit den Stecknadeln, Valérie! Ich habe solche Angst vor Stecknadeln! Ich denke immer an ein Kind in der Rue Hors-Château, das sich … Da kommt jemand herauf! … Da ist jemand, Valérie … Es klopft!«
Es ist Félicie, und Élises Augen werden feucht, sie weiß nicht, warum. Félicie ist in Eile und verkündet sofort:
»Ich bin entwischt, weil ich es einfach küssen musste.«
Félicie legt einige Päckchen auf den Tisch: eine Flasche Rotwein, die sie aus den Regalen stibitzt hat, ein Frühstücksgedeck aus Porzellan mit Blümchenmuster, ein Portemonnaie voller Geldstücke.
»Nein, Félicie, kein Geld! Du weißt doch, dass Désiré …«
Und schon spricht sie wieder Flämisch, instinktiv, so wie jedes Mal, wenn sie zusammen sein können. Félicie ist nur wenige Jahre älter als Élise. Sie war Verkäuferin in einem Kaufhaus wie ihre Schwester. Dann heiratete sie Coustou, der das Café du Marché in der Nähe des Pont des Arches hat; er ist dermaßen eifersüchtig, dass er sie nicht fortgehen lässt und ihr verbietet, von ihrer Familie Besuch zu bekommen. Sie treffen sich nur heimlich.
Valérie geht hin und her, ohne etwas von den Gefühlsausbrüchen der beiden Schwestern zu verstehen. Élise kann endlich nach Herzenslust weinen.
»Bist du nicht glücklich?«
»Aber doch, meine liebe Félicie.«
Félicie riecht nach Portwein. Vor ihrer Hochzeit trank sie nicht. Während einer Anämie empfahl ihr der Arzt, Starkbier zu trinken, und sie gewöhnte sich daran. In ihrem Café am Quai de la Goffe gibt es zu viele Gelegenheiten, von morgens bis abends stehen Flaschen in ihrer Reichweite.
Élise weint, aus keinem Grund, wegen allem, weil der Kleine warm ist, weil sie Angst hat, ihn nicht stillen zu können, weil der Himmel bewölkt und trübe ist.
»Hast du Léopold wiedergesehen?«
»Nein. Und du?«
Élise lügt. Sie sagt nein.
»Ich muss machen, dass ich wegkomme. Wenn Coustou gemerkt hat, dass ich fort bin …«
Obwohl Désiré wegen der Wohnung, die sie in der Stadt gefunden haben, auf die andere Seite des Flusses gezogen ist, versäumt er sonntags dennoch nie die Messe in Saint-Nicolas. Sogar an den Sonntagen, an denen sich die Bürgerwehr trifft, verlässt er seine Kameraden in dem Augenblick, wenn diese sich nach der Übung in ein kleines Café begeben. Er lässt sein Gewehr bei dem Küster, der einen Kerzen- und Bonbonladen hat, stehen und kommt gerade rechtzeitig zur Elf-Uhr-Messe. Den Leuten, die er kennt – und er kennt jeden –, unauffällig zunickend, geht er mit seinem regelmäßigen, elastischen Gang zu seiner Bank und nimmt dort Platz. Es ist die Bank der Mamelins, die letzte in der Reihe, die beste Bank und die einzige mit einer hohen Holzlehne, die den unvermeidlichen Luftzug abhält, wenn die gepolsterte Tür geöffnet wird.
Die Musik in seinem Innern vermischt sich mit den Orgeltönen. Désiré bleibt stehen, ganz aufrecht, weil er zu groß ist, um sich auf so engem Raum hinzuknien. Schweigend drückt er die Hände seiner Nachbarn, und während der ganzen Messe wird er zum Hochaltar blicken, vor dem sich die Chorknaben bewegen.
Die Bank der Mamelins ist die Bank der Confrérie de Saint-Roch, dessen Statue mit dem grünen Mantel mit Goldlitze, dem blutenden Knie und dem treuen Hund auf der ersten Säule zu sehen ist.
»Für’n … ut’n … ’aint …och … bi… schön.«
Für den guten Saint-Roch, bitte schön! In den frühen Messen ist es Chrétien Mamelin mit seinem langen weißen Schnurrbart und den kaum gebeugten Schultern, der an den Reihen entlanggeht und die Kupferschale, die an einem langen Stiel befestigt ist, schüttelt, wobei das Kleingeld klimpert; und jedes Mal, wenn ein Geldstück hineinfällt, hört man das gedämpfte:
» … ’gelt’s … Gott …«
Vergelt’s Gott!
Zurück in seiner Bank, schüttet Vater Mamelin die Geldstücke nacheinander in den eigens dafür angebrachten Schlitz.
Die Wandlung … Die Kommunion … Désirés Lippen bewegen sich unter dem Schnurrbart, und sein Blick richtet sich immer noch geradeaus zum Tabernakel.
Ite missa est …
Die Orgel … Das Trippeln der Menge auf den großen blauen Fliesen und der Regen, der einem an diesem trüben Tag beim Verlassen der Kirche wieder entgegenkommt, der Wind, der von der Place de Bavière herüberweht …
Durch ein armseliges Gässchen, ein Gässchen aus der Gaunerzeit, wo die Kinder fast nackt herumlaufen, wo die schmutzigen Abwässer einem zwischen den Füßen hindurchrinnen, durch eine solche Gasse gelangt Désiré zur Rue Puits-en-Sock, der Geschäftsstraße, in der alle Häuser Ladenschilder haben, die riesige Schere des Eisenwarenhändlers, die bleifarbene Uhr, das gewaltige Bündel Schnittlauch und schließlich, über dem Hutgeschäft der Mamelins, der leuchtend rote Zylinder.
Désiré, der sein Gewehr wieder abgeholt hat, geht durch den schmalen und immer feuchten Flur seines Elternhauses und überquert den Hof. Die Küche liegt hinten. Eine Seitenwand besteht ganz aus buntem Glas wie ein Kirchenfenster, sodass man nicht hindurchsehen kann. Désiré weiß, dass eine kleine Ecke im Glas freigekratzt ist, dass seine Mutter durch dieses Loch späht und verkündet:
»Da ist Désiré.«
Es ist seine Zeit. Er kennt den Geruch des Rinderbratens und den des Wachstuches auf dem langen Tisch, an den sich dreizehn Kinder gesetzt haben.
»Guten Tag, Mutter.«
»Guten Tag, mein Sohn.«
»Guten Tag, Lucien. Guten Tag, Marcel.«
Kochdunst. Die Mutter mit grauer Gesichtsfarbe und eisengrauen Haaren sitzt niemals, ist immer schiefergrau gekleidet.
Man setzt sich. Man lässt sich von der Wärme und den Gerüchen durchdringen und empfindet kaum das Bedürfnis zu sprechen.
»Geht es Élise gut?«
»Es geht ihr gut.«
»Und dem Kind?«
»Auch.«
»Sag deiner Frau, dass ich sie bald besuchen werde.«
So kommen alle Mamelins sonntagmorgens zu ihren Eltern, um sich in der Küche der Rue Puits-en-Sock einen Augenblick hinzusetzen. Hinten in einem Sessel sitzt unbeweglich Großpapa, Mutters Vater. Im Halbschatten erkennt man kaum seinen ungeheuer großen Körper, so riesig wie ein Bär, dessen Arme scheinbar die Welt umfassen können, ein bartloses Gesicht, steingrau mit leeren Augen und übermäßig großen Ohren.
Er erkennt jeden am Gang. Sie streifen mit den Lippen seine raue Wange, die sich wie Sandpapier anfühlt. Er spricht nicht. Wenn es Zeit für die Messe ist, sagt er leise sein Gebet. Seine Haut, die Haut eines ehemaligen Bergmanns, ist mit blauen Punkten wie mit Sternen übersät, so als hätte sich Kohlenstaub dort festgesetzt.
Zweikilobrote, am Vortag gebacken, warten auf die ganze Familie, auf alle verheirateten Kinder. Jeden Sonntag holt sich jeder seinen Teil ab.
»Geht es Juliette gut?«
»Sie ist soeben hier gewesen.«
»Und Françoise?«
Der Regen, der auf das Flachdach aus Zink über der Küche fällt, macht ein Geräusch, das irgendwie zu der Familie Mamelin gehört. Die Gerüche unterscheiden sich von denen anderswo. Auf den mit Ölfarbe gestrichenen Wänden bildet der Küchendunst trübe Tröpfchen. Um zehn vor zwölf erhebt sich Désiré, nimmt sein Brot und sein Gewehr und geht fort.
»Bis bald!«
Es stört ihn nicht, dass er in Uniform ist, das Gewehr umgehängt hat und dabei ein Brot nach Hause trägt. Ebenso wenig wie sich eine Schürze mit kleinen Karos über seinen Anzug zu binden, um den Haushalt zu erledigen. Wie im Rausch geht er die schmalen Gehsteige der Rue Puits-en-Sock entlang, an denen die Straßenbahnen gefährlich nahe vorbeifahren. Aus jedem Laden weht ihm ein anderer Dunst entgegen, von der Pommes-frites-Verkäuferin, aus dem Tabakgeschäft, der Konditorei, dem Milchgeschäft … Halt! Fast hätte er es vergessen! Es ist Sonntag, und er betritt den Laden von Bonmersonne, um zwei Stück Kuchen zu kaufen, ein Stück Apfelkuchen – Élise mag nur Obstkuchen – und ein Stück Reiskuchen für sich selbst, denn er liebt Süßigkeiten.
Er geht über den Pont des Arches. Die Rue Léopold ist wie ausgestorben. Nur in der Woche ist sie belebt, so wie alle Straßen im Zentrum der Stadt, aber man kennt hier niemanden; die Leute kommen von weit her, von überall, und sie gehen nur vorüber, während die Rue Puits-en-Sock zum Beispiel die Lebensader eines Viertels ist.
Er geht vorsichtig an der Wohnungstür in der ersten Etage vorbei. Die Delobels beschweren sich immer über den Lärm und rennen bei der kleinsten Gelegenheit zu den Cessions.
»Zu Tisch, Kinder!«
Désiré schnuppert, lächelt und steigt auf den schlechten Stuhl, um sein Gewehr wieder an seinen Platz zurückzulegen.
»Na, Valérie?«
Er wendet sich Élise zu.
»Hast du geweint?«
Sie schüttelt den Kopf.
»Hat sie geweint, Valérie?«
»Aber nein, Désiré, reg dich nicht auf. Du weißt doch, dass es die Nerven sind.«
Er weiß es, aber er versteht es nicht. Deshalb hat Élise kurz vorher zu Valérie gesagt:
»Weißt du, Désiré ist der beste Mann der Welt, aber er fühlt nicht wie wir.«
Was fühlt er nicht? Er lebt. Er isst. Er schläft. Er hat eine gute Stellung. Sehr jung ins Geschäft von Monsieur Monnoyeur eingetreten, ist er dessen Vertrauensmann geworden, und es ist Désiré, der den Schlüssel des Geldschrankes in Verwahrung hat und die Kombination kennt.
Was macht’s, dass er nur einhundertfünfzig Franc im Monat verdient! Haben sie jemals gehungert? Also!
»Iss, Désiré.«
Er erinnert sich, dass er soeben bei Kreutz, dem Puppenhändler neben seinem Haus – »sein Haus«, damit meint er immer das Haus seiner Eltern –, dass er bei ihm ein ganzes Schaufenster voller Masken, falscher Nasen und Knarren gesehen hat.
»Heute ist der erste Karnevalssonntag«, verkündet er.
Élise versteht nicht, warum er davon anfängt. Der erste Sonntag, das ist der Kinderkarneval. Désiré erinnert sich einfach an die Karnevalstage seiner Kindheit.
»Sind die Möhren süß genug?«
»Sie sind gut. Hast du sie angerichtet, Valérie?«
»Arme Valérie! Wenn du wüsstest, Désiré, wie viel Mühe sie sich gibt! Ich frage mich, was wir ohne sie gemacht hätten!«
»Aber wir haben sie doch!«
Nicht wahr? Valérie ist doch da, warum sich also Sorgen machen? Er hat kein Gespür dafür.
»Félicie war hier.«
»War sie angesäuselt?«
Ein Wort, mit dem sie ausdrücken: nicht richtig besoffen, aber auch nicht ganz nüchtern …
»Désiré!«
Sie deutet auf Valérie.
»Na und? Weiß Valérie nicht, dass deine Schwester … Noch ein Stück Fleisch, Valérie? Aber ja, man muss zu Kräften kommen.«
Bis drei Uhr bleiben die Straßen leer oder fast leer; dann sieht man einige dunkel gekleidete Eltern, die ihre verkleideten Kinder lustlos an der Hand halten. Ein winziger Torero zittert unter seinem Flauschmantel, dreht eine Knarre und lässt sich weiterziehen.
»Deine Mutter, Désiré?«
»Sie wird uns besuchen. Du weißt, dass es für sie ein Abenteuer ist, über die Brücken zu gehen.«
»Valérie, meinst du nicht, dass der Kleine erstickt?«
Er atmet schwer, das steht fest. Das Atmen eines Babys dürfte nicht so zu hören sein. Was wird Madame Mamelin sagen, sie, die immer so gern erwähnt, dass Élise nicht gesund ist?
»Hast du im Flurschrank nachgesehen, Valérie? Liegt nichts herum?«
Ihre Schwiegermutter ist nämlich imstande, den Wandschrank im Flur zu öffnen, um zu beweisen, dass Élise eine schlechte Hausfrau ist! Élise hat ihr ihren langen Désiré weggenommen, und das wird sie ihr nie verzeihen.
»Bist du sicher, dass wir nichts anbieten sollen? Einen kleinen Likör? Kuchen?«
»Ich versichere dir, dass man bei einer Wöchnerin nichts anbietet. Im Gegenteil! Die Besucher sind es, die etwas mitbringen.«
Désiré findet es selbstverständlich, dass man etwas mitbringt! Élise dagegen würde gern etwas zurückgeben, mehr als sie bekommt, sie möchte nie etwas schuldig bleiben. Sie ist eine Peters.
»Ich höre ein Geräusch.«
Er öffnet die Tür und ruft fröhlich:
»Bist du’s, Mutter?«
Die Leute aus der ersten Etage sind fortgegangen, und so brauchen sie sich nicht mehr in Acht zu nehmen.
»Warte, ich mach dir Licht. Das Treppenhaus ist so dunkel.«
Er ist zufrieden, einfach zufrieden.
»Kommt herein … Komm rein, Cécile.«
Das ist seine jüngste Schwester Cécile, die bald heiraten wird. Sie begleitet ihre Mutter. Madame Mamelin ist in ihrem grauen Kleid mit dem Medaillon, mit ihren grauen Handschuhen und ihrem breitrandigen Hut über die Brücken gekommen, um das Kind dieser Fremden zu sehen, das Kind dieses zerzausten Mädchens, das weder vermögend noch gesund ist, das nicht aus Outremeuse ist, noch nicht einmal aus Lüttich, und das mit seiner Schwester eine Sprache spricht, die man nicht versteht. Désiré bemerkt als Einziger nicht, dass seine Mutter, als sie die Wohnung betritt, wie Zugluft wirkt.
»Guten Tag, meine Liebe.«
Sie beugt sich nicht hinunter, um ihre Schwiegertochter zu küssen.
»Wo ist euer Gör?«
Sie gebraucht wohl absichtlich Wörter aus dem Dialekt, um zu unterstreichen, dass sie sehr wohl eine Frau aus Outremeuse ist.
Élise zittert unter ihrer Bettdecke, und Valérie bleibt in ihrer Nähe, als wollte sie sie beschützen.
»Nun, meine Liebe, es ist grün, euer Gör!«
Das ist nicht wahr! Das ist boshaft! Das Kind ist nicht grün. Nachdem es den ganzen Morgen über zu rot gewesen ist, scheint es wohl das letzte Stillen schlecht verdaut zu haben. Es ist blass, na gut! Élise ist selbst erstaunt darüber, dass es so blass ist, und ihre Hände krallen sich in das Bettzeug unter der Decke, während ihre Schwiegermutter den Kopf schüttelt und ein für alle Mal beschließt:
»Was für’n hässliches Kind!«
Das ist alles. Sie setzt sich. Sie geruht in diesem Haus, das sie mit ihrem eiskalten Blick inspiziert, Platz zu nehmen. Sicherlich hat sie alles gesehen, die beiden feuchten Flecken an der Decke – die nun einmal da sind, denn die Cessions haben es abgelehnt, sie zu übertünchen – und den Lappen, den Valérie auf einem Stuhl vergessen hat.
Auch die Schwiegermutter hat nichts mitgebracht. Sie ist hier, weil sie hier sein muss, aber um nichts in der Welt würde sie ihren Hut absetzen.
Élise bringt mit Mühe hervor:
»Eine Tasse Kaffee, Maman?«
»Nein danke, meine Liebe.«
Als wäre der Kaffee ihrer Schwiegertochter nicht gut genug!
Élise schämt sich wegen der Möbel, weil es die Frau ist, die die Möbel mit in die Ehe zu bringen hat. Nach dem Tod ihres Vaters standen schöne alte Möbel bei ihr zu Hause. Einer ihrer Brüder, Louis – Louis de Tongres, wie man ihn nennt, weil er in Tongres wohnt und dort reich geworden ist –, kam später in die Rue Léopold und holte die Möbel nacheinander ab, unter dem Vorwand, dass sie den Peters gehörten und zu den Peters zurückkehren müssten. Er ersetzte sie durch weiße Möbel …
»Nun, meine Kinder …«
Die Mindestzeit für einen Besuch ist um.
»Ich frage mich nur, ob deine Frau ihn stillen kann.«
Mitleidig wendet sie sich an Désiré. »Du hast es so gewollt! Ich habe dich gewarnt!« All diese Sätze werden durch ihre Stimme, die Betonung und ihren Blick ausgedrückt.
»Nun, ich hoffe für euch, dass es gelingen wird!«
Sie geht. Cécile folgt ihr. Désiré begleitet sie nach unten, und als er wieder zurückkommt, findet er Élise in Valéries Armen, in Tränen aufgelöst.
»Sie war boshaft … Absichtlich! Sie ist absichtlich boshaft.«
»Aber nein … Ich versichere dir, du täuschst dich.«
Er hätte so gern, dass alle in gutem Einvernehmen miteinander leben, dass sich alle mögen, dass alle, so wie er, jeden Augenblick in innerem Frieden und in Heiterkeit erleben! Er blickt auf die Uhr.
»Es ist Zeit, die Brust zu geben.«
O weh! Das Kind erbricht eine dunkle, grünlich schimmernde Flüssigkeit. Das ist keine Milch mehr.
»Valérie! Er ist krank … Mein Gott!«
Plötzlich ist der durchdringende Lärm von Flöten und Knarren zu hören, und vom Fenster aus sieht man Familien, die eine Regenpause ausnutzen, um mit ihren verkleideten Kindern durch das Stadtzentrum zu ziehen.
»Vielleicht sollten wir ihm gezuckertes Wasser geben?«
»Da, jetzt ist er wieder ganz rot, man könnte meinen, dass ausgerechnet, weil deine Mutter da war …«
Arme Valérie! Nicht für einen Moment verliert sie die Ruhe. Sie geht hin und her, wie eine eifrige Ameise, eine kleine huschende Maus.
»Reg dich nicht auf, Élise. Ich versichere dir, es ist nichts.«
»Warum erbricht er? Wegen meiner Milch, da bin ich sicher. Seine Mutter hat immer behauptet, dass ich ihn nicht stillen könne …«
Désiré trommelt mit den Fingern gegen die Scheibe, was durch die Spitzengardinen gedämpft klingt. Er ist ganz glücklich, als er melden kann:
»Da kommt Doktor van der Donck.«
Der braucht unendlich lange, bis er gemessenen Schrittes die Stufen heraufgestiegen ist. Er klopft und tritt ein.
»Nun, Madame Mamelin?«
Schon hat Élise weniger Angst. Sie schämt sich ihrer Überängstlichkeit und zwingt sich zu lächeln. Der Doktor ist in seiner Sonntagsruhe gestört worden, man muss ihm dankbar sein.
»Ich weiß nicht, Doktor … Es scheint so … Er hat gerade seine Milch wieder von sich gegeben, und seit heute Morgen habe ich den Eindruck, dass er sich so heiß anfühlt … Valérie!«





























