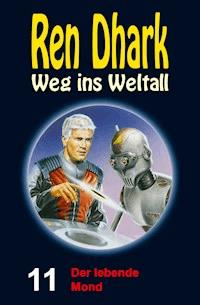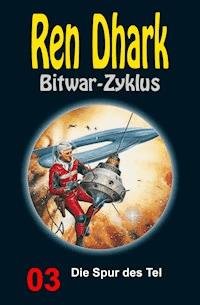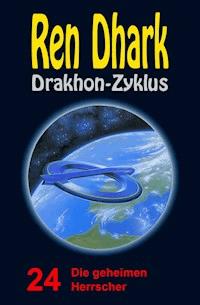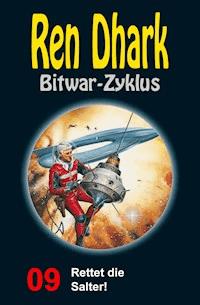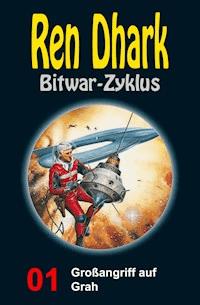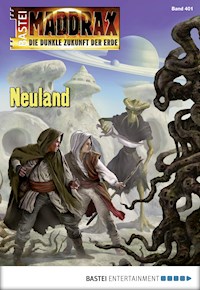4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die Menschheit im 55.Jahrhundert nach Christus: Die Milchstraße ist besiedelt und es herrschen eiserne Gesetze. Doch Widerstand regt sich.
Den Rebellen der Galaxis bleibt nur die FLUCHT INS ALL.
Dies ist der Auftakt zu JO ZYBELLs spektakulärem Science Fiction-Zyklus, mit dem er sich einen eigenen, vielschichtigen Serienkosmos erschuf. Eine Vision der Zukunft des Menschen im All, die den Vergleich mit großen Vorbildern nicht zu scheuen braucht!
JO ZYBELL prägte die Serien MADDRAX und RHEN DHARK über Jahre hinweg durch eine Vielzahl von Romanen mit. Seine epischen Fantasy-Romane brachten ihm die Anerkennung der Kritik. Doch mit Terra 5500 hat er gezeigt, was wirklich in ihm steckt.
Cover: STEVE MAYER
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Terra 5500 - Doppelband 1
Flucht ins All/ Jäger der Milchstraße: Cassiopeiapress Science Fiction Abenteuer
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenDoppelband Terra 5500: Rebellen der Galaxis (1 und 2)
von Jo Zybell
Ein CassiopeiaPress E-Book
© by Author
© 2014 der Digitalausgabe by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
www.AlfredBekker.de
Dieses Ebook enthält folgende zwei Bände und Glossar und zwei Zeittafeln :
Band 1 Flucht ins All
Band 2 Galaktische Jäger
Glossar
Zeittafel I
Zeittafel II
Der Umfang dieses Ebook entspricht 292 Taschenbuchseiten.
Band 1: Flucht ins All
Manchmal, wenn sie lange genug ins Eis starrte, geschah es, dass eine Grotte sich in der Eiswand öffnete. In solchen Momenten sah sie eine andere Welt, eine Welt jenseits des Eises: blauer Ozean, weiße Strände, Regenwälder und Flussmündungen an flachen Küsten. Wenn sie ihrem Vater davon erzählte – und das tat sie häufig – lächelte er, nahm sie in die Arme und sagte: „Die Bilder, die ich in deinen Kopf gepflanzt habe, bringen das verfluchte Eis zum Schmelzen.“ Er sprach dann immer mit heiserer Stimme.
Auch an jenem Morgen, dem ersten des Plans und ihrem letzten auf Genna, geschah es wieder: Im grauen Eis, hundertzwanzig Meter entfernt auf der gegenüberliegenden Schachtwand, strahlte eine gelbe Sonne über blauem Meer; eine Sonne, die sie nie gesehen hatte, über einem Meer, das sie nur aus den Beschreibungen ihrer Eltern kannte.
Ich komme. Stumm bewegte sie die Lippen. Ich komme zu dir...
„Code vierundzwanzig eins vierundfünfzig alpha“, sagte ihr Vater, während das Tor sich hinter ihnen senkte, und die letzten Scheinwerfer an den Querstreben über ihnen aufflammten. Er trug eine silberfarbene ISKK unter seinem Helm, vielleicht seine wichtigste Waffe an diesem Tag. Venus musste daran denken, dass er fünf Jahre an der ISK-Kappe gearbeitet hatte. An dem Plan hatte er gearbeitet, seitdem sie lesen konnte.
„Achtzehn Omega-Frachter auf den Landeplätzen.“ Der kugelförmige Kommunikator gab die entschlüsselte Form des Codes wieder. „Je drei neben jedem Schacht. Wir bringen die Container wie üblich an Bord der Omega-Frachter.“
„Richtig.“ Ihr Vater nickte. Der hochgewachsene Mann trug einen unförmigen Ganzkörperanzug aus schwarzem Kunstleder, der ihn noch breiter und grobknochiger aussehen ließ, als er sowieso schon war. An seiner Schulter hing ein Laserkaskadengewehr, auf seinem Rücken eine altertümliche Kompressionspatrone mit Standardatemgasgemisch, auf seiner Brust baumelte die Atemmaske. „Code vierzwanzig eins vierundfünfzig beta“, forderte er. Wie einer jener Barbaren, denen die Republik die Raumfahrt untersagt hatte, sah Uran Tigern aus, und nicht wie ein Mann, der einst in Para-Astrophysik promoviert und im Rang eines Primoberst einen Flottenverband kommandiert hatte.
„Begutachtung des Rohstoffs durch den Kommandanten und die Frachterkapitäne“, sagte der Kugler. „Verhandlungen über Volumen und Tauschware.“ Das Kunsthirn sprach mit einer sanften, einschmeichelnden Stimme.
„Richtig. Und wie gehst du vor? Code vierundzwanzig eins vierundfünfzig gamma und delta...“ Während ihr Vater ein letztes Mal mit dem Primkugler den Plan durchging, beobachtete sie die Gesichter der anderen. Unter den Alten die beiden Brüder ihres Vaters, Plutejo Senior und Sarturis, und ihre Getreuen; dann die Patriarchen der Vegas- und der Insulasippe samt ihren Eidmännern und -frauen; dahinter die Mütter und Väter der namenlosen Sippen, und schließlich die Männer und Frauen, die keiner Sippe angehörten, nicht einmal einer Familie, die um keine Kinder und Kindeskinder bangen mussten und um keine Zukunft. Lauter bläuliche Gesichter, lauter ausgemergelte und von den Mühen der Arbeit gebeugte Gestalten, viele schon Greise, und alle auf irgend eine Weise bewaffnet.
Unter den Jungen standen ihre drei Schwestern Lune, Alya und Pluteja; ihre drei Brüder Alvan, Nepuk und, wie meist Seite an Seite mit der zierlichen Mutter, Plutejo junior. Er war der jüngste und zugleich größte – größer und breiter noch als sein Vater, kräftiger als seine älteren Brüder. Sein von der Droge aufgedunsenes Gesicht hatte schon eine Blaustich, wie das eines Alten. In seinen Zügen duckten sich Hass und Leidenschaft zum Sprung.
Auch viele ihrer Altersgenossen hatten sich heute aus dem Labyrinth gewagt, manche zum ersten Mal. Einige waren längst selbst Väter und Mütter. Diese hatten darauf bestanden ihren Nachwuchs mitzunehmen, wenn es soweit war. Uran Tigern gestattete es, war sogar froh, dass sie diesen naheliegenden und von ihm und dem Freiheitsrat durchaus einkalkulierten Schritt aus eigenem Antrieb gehen wollten. Und war es nicht wirklich gnädiger, die Kleinen rasch in den Feuerkaskaden der Republikaner sterben zu lassen, als Jahrzehnte lang in den Bergwerken unter dem Eis?
Und schließlich gab es da noch diejenigen, die Venus Tigern einst gepflegt und gehütet hatte, als sie noch Säuglinge waren: Halbwüchsige Jungen und Mädchen, die einen erst dreizehn, andere sechzehn oder siebzehn Terrajahre alt. Sie sahen scheu um sich, sie blickten ängstlich über sich, dorthin, wo man den jungen Genna-Tag am Ende des Schachts wegen der Scheinwerfer und wegen der Eisschachthöhe nicht erkennen konnte, und sie hielten sich mit Blicken immer aufs Neue am General der Freiheitsarmee fest wie am Geländer einer Brücke über einer Eisspalte. In solchen Momenten platzte Venus schier vor Stolz auf ihren Vater.
In den Mienen der Jungen spiegelten sich Trotz, Angst und Ungeduld, in denen der Alten eine eigenartige Mischung aus Erschöpfung und Entschlossenheit.
„Code fünfundzwanzig eins vierundfünfzig alpha“, verlangte Venus’ Vater, und der Roboter bestätigte seine Bereitschaft mit dem dechiffrierten Text: „Neutralisierung des ersten Omega-Frachters, zeitgleich ein Langwellensignal an unsere Verbündeten auf Orkus, danach euer Ultimatum.“ Die geschlechtslose Stimme klang sanft und heiter, als wollte sie ein quengelndes Kind beruhigen.
„Richtig...“ Und dann hörte sie ihren Vater Code 26-1-54 abfragen, der Dreischritt des Planes, um den die Angstträume aller kreisten, seit der Freiheitsrat ihn bekannt gegeben hatten. Venus legte den Kopf in den Nacken und verengte ihre Augen zu Schlitzen. Vierhundert oder fünfhundert Meter über ihr zwischen den Querstreben verschwammen die Controgravspiralen um die beiden Liftschächte zu einer einzigen Säule. Nur an besonders klaren Tagen konnte man die Schachtöffnung dort oben in dreizehnhundert Metern Höhe erkennen. Das Scheinwerferlicht tat ihren Augen weh. Venus schloss sie und lauschte der Stimme ihres Vaters und dem seelenlosen Gesäusel des Kuglers – 26-1-54-alpha und Auffahrt, 26-1-54-beta und Angriff, 26-1-54-gamma und Sturm auf die Frachter, erst die Alten, dann die Jungen. Danach musste jeder selbst sehen, wo er blieb, und wie er sich nach Orkus durchschlug, dem großen Eismond des Nachbarplaneten...
Die Nähe des Todes war eine Eisblase. Die Eisblase füllte ihr Hirn. Selten klare Gedanken dachte sie plötzlich: dass es keinen Weg zurück mehr gab, dass sie keinen Weg zurück mehr wollte, dass es sich lohnte, und dass sie bis zum letzten Atemzug kämpfen würde. Sie wusste, dass jetzt, in diesen Minuten, auch am Grund der anderen fünf Schächte mutige und ängstliche und ungeduldige Menschen lauschten, dass auch dort letzte Worte mit den Primkommunikatoren gewechselt wurden, und dass auch dort Männern und Frauen die Prognose des gekaperten Rechners durch die Köpfe ging: Höchstens zwölf Prozent würden überleben.
„Wir rechnen mit euch“, schloss Uran Tigern.
„Das ist vernünftig“, sagte der Kugler. Auch er war gekapert. Auf Tefloncarbonatketten wendete er und rollte zum Frachtlift. Zwei weitere Kommunikatoren und zwei humanoide Koordinationsroboter warteten dort bereits, Einheiten aus geraubten und lange versteckten Beständen. An ihren Schädeln und Gliedern nagte bereits der Rost.
Die Tore der Lagerhallen öffneten sich, vielarmige Arbeitsroboter mit kegelförmigem Torso rangierten die ersten drei Schwebecontainerplomben in Richtung Frachtlift. Schwarzblaues von gelblicher Maserung durchzogenes Geröll häufte sich unter ihren Bleikristalldeckeln: Glaucauris. Kein Rohstoff der Galaxis war begehrter.
Ihr Vater wandte sich um und blickte auf den Ringchronometer an seinem Mittelfinger. „Noch neunundsechzig Stunden bis zum Einbruch der Dunkelheit. Gehen wir ein letztes Mal ins Labyrinth.“ Er sah in die Runde. Selten hatte Venus ein derart schönes und mildes Lächeln auf seinem verbrauchten Gesicht gesehen. „Ein jeder suche die Höhlenburg seiner Sippe auf, ein jeder versöhne sich mit denen, die er hasst, und ein jeder verabschiede sich von denen, die er liebt.“ Das Tor hob sich, das Dämmerlicht dahinter nahm eine schweigende Menge auf.
Sechs Stunden später meldete der Prim-Kommunikator das Ende der Begutachtung und den Beginn der Verhandlungen, vierzehn Stunden später das wie immer magere Ergebnis, und zweiunddreißig Stunden später die Verladung der ersten drei Container. Danach schwebte Container um Container den Eisschacht hinauf, der Arbeitsertrag eines ganzen Jahres.
Sechzehn Stunden vor Anbruch der Genna-Nacht funkte der Kugler Tigern senior über eine geheime Langwellenfrequenz an, für die es auf den Schiffen der Flotte schon seit Jahrhunderten keine Empfangsgeräte mehr gab. „Erstes Langwellensignal an Orkus gefunkt“, sagte er. „Autoeliminierungsmodus aktiviert, Countdown läuft. Noch sechzehn Stunden...“
1
Der Navigator lehnte sich entspannt zurück. Zum Greifen nahe leuchtete Die Sonne Doxa bereits im Visuquantenfeld. Ihr vierter Planet stand als grüner Punkt im Zentrum des runden Navigationsmonitors. Meyer-Rulands Job war erledigt. Für Bremsmanöver und Landung war das Bordhirn zuständig; und der Kommandant.
Er grinste in dessen Richtung. „Guter Kahn“, sagte er, nur um etwas zu sagen. „Ehrlich. Selten so ein feines Gerät geflogen.“ Meyer-Ruland war neu; sein erster Flug für Tellim TransKonzept.
„Ist ja auch noch nicht lange im Stall, die Jerusalem“, antwortete der Pilot anstelle des Kommandanten, ein Endvierziger namens Norge Holm. „Haben wir erst vor zwei Jahren gekauft, stimmt’s Yaku?“ Der Kommandant nickte, sagte aber noch immer nichts. Er starrte die Sonne im Viquafeld unter der Panoramakuppel an, als hätte er sie nie zuvor gesehen. Auf der Sessellehne, über seinem weißhaarigen Schädel, hockte ein Kolkrabe.
„’Jerusalem’ – was für ein Name. Muss man erst mal drauf kommen.“ Wieder wandte Meyer-Ruland sich an den Mann im Kommandantensessel. „Was bedeutet das eigentlich, Mr. Tellim?“ Wieder reagierte der Kommandant nicht.
„Irgend’ne Insel auf Terra Prima, glaub ich“, sagte Holm. Und dann an die Adresse des Kommandanten: „Was ist los, Chef? Warum so schweigsam auf einmal?“
„Wie?“ Der Kommandant blickte erst nach links zum Navigator, dann nach rechts zum Piloten. Ganz wie einer, der gerade aus einem Nickerchen aufgeschreckt war, kam er den Männern vor. Meyer-Ruland jedoch hätte schwören können, dass er seine Augen die ganze Zeit nicht geschlossen hatte. „Ist mir was Wesentliches entgangen, Männer? Ich war gerade in den Anblick unserer Heimatsonne vertieft. Ein hübscher Stern, findet ihr nicht?“
Holm runzelte die Stirn. „Klar doch, Chef.“ Er räusperte sich. „Romus wollte wissen, warum das Schiff Jerusalem heißt.“
„Gefiel mir einfach.“ Moses breitete die Schwingen aus. Ein Krächzen wie Holztürknarren, tief und trocken, drang aus seiner schwarz gefiederten Kehle.
Meyer-Ruland lauerte erst misstrauisch nach dem Vogel und räusperte sich dann ebenfalls. „Und aus welcher galaktischen Kultur stammt der Begriff, Sir?“ Er gab weiterhin den Interessierten.
„Keine Ahnung.“ Der Kommandant streckte sich und faltete die Hände im Nacken. Moses flatterte auf die rechte Armlehne des Kommandantensessels. „Keine Ahnung, wo ich das aufgeschnappt hab.“ Der Kommandant streckte die langen Beine von sich. Seine Kniegelenke knackten. „Fand’s einfach schön.“
„Aha“, murmelte Romus Meyer-Ruland. „Verstehe...“
Der Pilot beobachtete seinen Chef von der Seite. Natürlich log er. Holm flog lange genug für den Reeder und lange genug mit ihm vor allem – Yakubar Tellims Tonfall und Mimik mochten für einen Außenstehenden verschlossen wirken, er aber konnte darin lesen. Außerdem wusste er, was seinem Chef morgen für ein Tag ins Haus stand. „Geht’s noch, Yaku, oder wie?“ Chrjaku, krächzte Moses, chrjaku, chrjaku...
Der hochgewachsene, knochige Mann mit dem weißen Haarzopf zog die weißen Brauen hoch und musterte seinen Piloten. Zahllose Falten zerfurchten sein braunes Gesicht; wie altes, zerknautschtes Leder sah es aus. Seine linke Augenhöhle war mit einer Prothese gefüllt. Die war von einem solch matten Schwarz, dass man den Eindruck gewann, sie würde jeden Lichtstrahl aufsaugen. „Ich mag’s halt, ins Doxa-System hineinzufliegen.“ Er zuckte mit den Schultern. „Freu mich nach Hause kommen, mehr nicht.“
Holm hörte die Worte, und Holm verstand den Blick. Lass mich in Ruhe, forderte der, und unterhalte den Quatschkopf im Navigationstand ein wenig, damit auch er mich in Ruhe lässt.
„Was du wieder redest, Yaku!“ Holm winkte ab. „Ist doch ein furchtbar langweiliges Sonnensystem! Es gibt Dutzende von Planeten, die Doxa IV jederzeit in den Schatten stellen!“ Der Pilot war nicht besonders groß, ein wenig rundlich zudem. Er trug eine Tätowierung auf dem kahlen Schädel: eine geballte Faust, die im Nacken in die Büste einer barbusigen Frau überging. „Waren Sie zum Beispiel schon mal auf Gizeh, Romus?“ Er wandte sich an den Navigator. „Da gibt es Schmetterlinge, so groß wie ein Beiboot! Oder kennen Sie Hawaii-Novum? Da können Sie in dreißig Meter tiefem Wasser noch die nackten Perlentaucherinnen auf dem Grund sehen! Und die Fische fangen Sie mit bloßen Händen, so zahm sind die...“
„Ach ja? Ich hab schon gehört von Hawaii-Novum, die Hauptinsel sei so märchenhaft...“
„Märchenhaft ist gar kein Ausdruck...!“ Norge Holm verwickelte den Neuen in einen Small Talk über Planeten, die sie gesehen oder angeblich gesehen, oder von denen sie gehört hatten, über Raumhafen-Städte die sie angeflogen, über Landschaften und Gebirge, in denen sie Urlaub gemacht hatten.
Danke, altes Haus, dachte Yakubar Tellim, dabei war der Pilot dreiundzwanzig Jahre jünger als er. Aber was sind dreiundzwanzig Jahre, wenn man auf ein ganzes Leben zurückblickte? Himmel über Doxa IV – was für ein kurzes Tänzchen! Er nahm die Arme aus dem Nacken, beugte sich vor und stützte sich auf der Instrumentenkonsole auf. Was für ein kurzes Tänzchen, weiß Gott!
Moses flatterte auf, drehte eine Runde durch die Kommandozentrale, und landete auf der linken Schulter des Kommandanten. Mit dem Schnabel pickte er nach dem großen Elfenbeinring in seinem Ohrläppchen, einmal, zweimal – bis der Weißhaarige ihn anzischte.
Wieder versank Tellim in den Anblick der Sonne Doxa. Sicher gab es schönere Sonnen; und schönere Planeten sowieso. Wer wüsste das besser als er? Sein Heimatplanet Tell zum Beispiel: Jede Klimazone, die man sich vorstellen kann, Gebirge, Meere, einsame Wälder. Oder Woodstock mit seinen Vulkaneisbergen und Geysiren an den Polen, seinen Dschungeln auf der Nordhalbkugel und seinen Savannen im Süden. Oder eben Hawaii-Novum mit seinem unendlichen Warmozean; selbst Berlin, der heiße Wüstenplanet mit seinen Rennpisten, seinen traumhaften Oasen und seinen gespenstischen Canyons war interessanter. Yakubar hatte sie alle gesehen.
Fast achtzig der hundertzwölf Lebensplaneten, die zum Territorium der Galaktischen Republik Terra gehörten, hatte er gesehen, und etwa die Hälfte der Planeten, auf denen terranische Kolonien unter Biosphären siedelten. Dazu noch eine ganze Reihe der knapp fünfhundert, zum Teil lebensfeindlichen Welten, auf denen die Republik Bodenschätze abbaute. Von den außerterritorialen Welten gar nicht zu reden. O ja, Yakubar Tellim war weit herumgekommen, sehr weit.
In diesen Minuten jedoch, seit sie die Umlaufbahn von Doxa XIII gekreuzt hatten, erschienen sie ihm unverwechselbar – dieses zentrumsnahe Sonnensystem, in dem er sich vor dreißig Jahren niedergelassen, und dieser Planet, auf dem er seine Firma gegründet hatte. Unverwechselbar und einmalig erschienen sie ihm, weil ihm nämlich von jetzt auf nun diese verfluchte Frage im Hirn brannte, die Frage, wie es sich wohl anfühlen mochte, wenn man zum letzten Mal nach Hause kommt; zum wirklich allerletzten Mal.
Der Kolk beäugte ihn von links, Holm von rechts, und im Viquafeld unter der Frontkuppel entdeckte der Reeder einen kleinen grünlich schimmernden Punkt: Doxa IV. Während er die dreidimensionale Darstellung vergrößerte, musste er schlucken. Die ganze Reise über hatte er versucht, das Gefühl der Letztmaligkeit gar nicht erst aufkommen zu lassen. Nun aber hatte es ihn doch erwischt. „Sentimentaler, alter Knochen“, flüsterte er. Moses knarzte sein Chrjaku. Es war zärtlich gemeint. Yakubar lächelte wehmütig – er wusste die Zwischentöne des Gekrächzes herauszuhören.
Über Bordfunk meldete sich die untere Ebene der Kommandozentrale. Dort arbeiteten Kommunikator und Aufklärung. Über eine Galerie und Treppen waren beide Ebenen miteinander verbunden. Norge Holm nahm das Gespräch an. Der Kommunikator hatte Kontakt mit Doxa IV. „Wie ist es, Yaku?“, fragte Holm Sekunden später. „Die Raumfahrtbehörde hat uns die Einflugkoordinaten und den Landeplatz zugeteilt. Bringst du das Hufeisen runter, oder mach ich das?“
Wortlos und mit einer Kopfbewegung deutete der Kommandant auf die ISK-Kappe neben Holms Instrumentenkonsole. „In Ordnung, Sir!“ Zum Spaß nahm Holm militärische Haltung an und mimte den beflissenen Untergebenen. „Ist mir eine Ehre, Ihren Befehl ausführen zu dürfen, Exzellenz!“ Mit spitzen Fingern langte er nach der blauen Kappe und setzte sie so feierlich auf seinen kahlen Schädel, als wäre sie eine Krone. „So sei sie denn mir nichtswürdigem Individuum geliehen, die individuelle Steuerungskompetenz über das schönste Schiff des Universums im Umkreis von anderthalb Metern...“
Meyer-Ruland machte erst ein verblüfftes Gesicht, dann lachte er gekünstelt; er war die komödiantischen Einlagen des Piloten noch nicht gewohnt. Der Kolk krähte, und Yakubar lächelte mehr aus Höflichkeit. Unfair, einen seinen besten Freunde vor den Kopf zu stoßen, nur weil seine Stimmung sich im freien Fall befand. Er nahm sich vor, diese Einsicht in den nächsten vier Tagen zum Maßstab seines Verhaltens zu erheben. Seine Gedanken allerdings kreisten längst um das geheime Wandfach hinter seinem Bücherregal, zuhause, in seinem Apartment. Zwei Flaschen mit verbotenem Inhalt lagerten darin: Whisky von Terra Sekunda. Möglicherweise hatte der die längste Zeit dort auf ihn gewartet.
Seine Gestalt straffte sich, Yaku Tellim riss sich zusammen. Der Kolk wechselte von der Schulter zurück auf die Kante der Sessellehne. Im VQ-Feld unter der Panoramakuppel schwebte nun gut sichtbar Doxa IV, eine türkisfarbene Welt, deren Pole wie silberne Kristalle funkelten. „Seht euch diesen Planeten an“, unterbrach Yaku das Geplauder der anderen beiden. „Sieht er nicht aus, wie ein Smaragd mit Elfenbeineinsprengseln?“ Er vergrößerte die Darstellung, bis der Planet fast das gesamte vordere Drittel der Zentrale einnahm. „Überall gibt es Schönes zu sehen. Man muss nur Augen im Kopf haben...“
Da war es wieder, das Gefühl der Letztmaligkeit. Tellim erschauerte. Himmel, wie schön so ein Planet einem vorkommen konnte! Und wie schrecklich zugleich vor dem Hintergrund des kalten Glitzerns all der Sterne. Alles was Yakubar im Lauf seines langen Lebens gesehen hatte, alles, was die Natur hervorgebracht hatte, schien ihm in diesem Augenblick von maßlosem Schrecken und maßloser Schönheit gleichermaßen zu sein. Er wünschte, noch tausend Jahre leben zu können, um wenigstens einen Bruchteil dieser Schönheit und dieses Schreckens ausloten zu können.
„Nun ja, Chef...“ Norge Holm machte ein gelangweiltes Gesicht. „... sieht aus wie immer, oder?“
Später, nach der Landung – Moses saß auf seiner rechten Schulter – verabschiedete Tellim sich von jedem der sechsundzwanzig Besatzungsmitglieder per Handschlag. Das war noch nie vorgekommen. Danach flog er mit seinem Privatgleiter zur Geschäftsstelle seiner Reederei.
„Nervt Sie das Federvieh nicht?“, wollte Meyer-Ruland wissen, nachdem er und Holm die Routendokumentation an die Raumhafenbehörde gefunkt hatten.
„Moses? Iwo!“
„Wieso nimmt der Chef ihn sogar auf Frachtflüge mit? Ich meine – ist doch irgendwie ungewöhnlich, oder?“ Sie verließen die Kommandozentrale.
Holm zuckte mit den Schultern. „Vielleicht wegen seiner Frau.“
„Erträgt sie den Vogel nicht zu Hause, oder was?“
„Sehr gut sogar. Es ist eigentlich ihr Kolk. Aber Yakus Frau ist vor sechs Jahren gestorben. Sie hat Moses geliebt. Wahrscheinlich kann er sich deswegen nicht von ihm trennen.“ Die Männer erreichten den Haupttunnel. „Moses ist übrigens eine Sie.“ Über fünf Ebenen schwebten sie zur Schiffsbasis hinab.
„Ein bisschen introvertiert, der Chef.“ Meyer-Ruland sondierte noch immer die Eindrücke seines ersten Fluges für die Tellim Transkonzept. „Fast melancholisch, möchte ich sagen. Überrascht mich eigentlich.“ Gemeinsam verließen sie die Jerusalem über den ausgefahrenen Liftschacht.
„Sonst ist er anders.“ Holm wirkte selbst ein wenig bekümmert. „Ganz anders. Aber er hat morgen Geburtstag.“ Meyer-Ruland runzelte die Stirn. „Jahrgang vierundachtzig,“ erklärte der Pilot.
Der neue Navigator schnitt zunächst eine begriffsstutzige Miene. Doch dann begriff er. „Er wird siebzig...? Ach du Scheiße...!“ Belegt klang seine Stimme plötzlich, und seine Gesichtshaut nahm die Farbe einer unreifen Aprikose an. „Ich..., ich ahnte ja nicht..., wie schade, verdammt noch mal...!“ Sie verließen den Lift. Meyer-Ruland gewann seine Fassung zurück. „Und wer..., ich meine..., wer übernimmt dann den Laden?“
Sie gingen zu einem der wartenden Robotschweber. Norge Holm zuckte mit den Schultern. „Keine Ahnung. Vielleicht seine Tochter.“
„Habt ihr denn nicht darüber gesprochen?“ Sie stiegen ein, der Navigator tippte den Zielcode in die Bordtastatur. „Ich meine..., auf so was..., auf den Fall der Fälle muss man sich doch irgendwie vorbereiten! Da hängt doch die Existenz einer Menge Leute dran, oder? Und eine Menge Kapital dazu, schätz ich mal...“
„Das Thema ist tabu.“ Holm schnallte sich an. „Der Chef tut, als würde er ewig leben. Ich glaube, er verdrängt den Tag einfach. Oder er hofft auf ein Wunder; was weiß denn ich...“ Der Pilot lächelte wehmütig. „Aber mal unter uns, Romus: Sie und ich – würden wir uns anders verhalten in seiner Situation?“
2
„Noch eine Stunde und fünfzehn Minuten“, säuselte die emotionslose Stimme aus Plutejos selbstgebautem Empfänger. Aus dem Audiomodul des alten Monitors hörten sie Arbeitsgeräusche und menschliche Stimmen. Die Bildübertragung funktionierte nicht, schade. Was sie hören konnten jedoch, verriet ihnen genug: Die Verladung der Containerplomben war abgeschlossen, die Auslieferung der Tauschware hatte begonnen. Die Frachterkapitäne bezahlten mit Medikamenten, Konserven, Textilien und elektrischem Gerät; und natürlich mit der Droge. Bis zur zehnten Stunde vor Sonnenuntergang hatte der Primkommunikator nur jede volle Stunde des Countdowns angesagt; seitdem tönte seine einschmeichelnde Stimme jede Viertelstunde aus dem Empfänger.
Die meisten hockten in der Höhlenmitte unter dem Heizstrahler um den improvisierten Empfänger und den antiken Kugelmonitor herum: Uran, seine Frau, seine Söhne und Töchter, seine Brüder und Schwestern und deren Männer, Frauen, Söhne und Töchter. Einige lagen auch in der Schlafhöhle bei den Halbwüchsigen und Kleinen. Gedämpfte Stimmen erfüllten die Haupthöhle, manchmal schluchzte jemand, manchmal fluchte jemand, manchmal umarmte jemand seinen Nachbarn und hielt ihn fest. Der Empfänger rauschte meistens, der Monitor blieb leider weiterhin dunkel.
Venus hatte sich in ihre Höhlennische zurückgezogen. Dort lag sie in Decken gewickelt auf weichem Verpackungs- und Isoliermaterial. Als Kopfkissen benutzte sie ihren prallvollen Rucksack. Alle hatten sie schon das Nötigste zusammengepackt; alle, die den Ausbruch wagen sollten.
In Gedanken fuhr die junge Frau zum hundertsten Mal mit dem Schachtlift zur Eisoberfläche hinauf. Zum hundertsten Mal stürmte sie über das Eis bis zum Frachter, schwebte den Teleskoplift hinauf, drang ins Innere des Schiffes ein und lief vom Hauptinnenschott hinauf zur fünften Ebene, und von dort bis zu Ebene I der Kommandozentrale.
Niemals hatte sie einen Omega-Raumer betreten, dennoch sah ihr inneres Auge vertraute Formen und Farben, vertraute Gänge und Abzweigungen, vertraute Luken und Sensorenschlösser. Und als sie in Gedanken im Pilotensessel saß, in Gedanken die Steuerungskonsole betrachtete, und in Gedanken die ISK-Kappe überstreifte, konnte sie jeden einzelnen Schalter, jeden Monitor, jede Kontrolleuchte benennen und einer Funktion zuordnen.
Von Kindesbeinen an hatte ihr Vater sie und ihre Geschwister in seinen Geschichten durch sein ehemaliges Flaggschiff geführt, tausend Mal und öfter Luken geöffnet, Controgravlifte betreten, auf dem Kommandantensessel Platz genommen und den Start eingeleitet. Ob Frachter, Aufklärer oder schwerer Kreuzer – die Omega-Raumer der Republik waren alle nach dem gleichen Muster konstruiert. Trotzdem fürchtete Venus sich manchmal vor dem Augenblick, wenn die Bilder in ihrem Kopf mit der Wirklichkeit draußen, oberhalb des Eises zusammenstießen.
Über solchen Gedanken und Ängsten schlief sie von Zeit zu Zeit ein. In wilden Träumen hetzte sie durch Schneeverwehungen, über Kunststoffböden und an Kunststoffwänden entlang. In farbenprächtigen, euphorischen Träumen stand sie an Stränden, schwamm in warmem Wasser oder ließ ihren nackten Leib von warmem Sonnenlicht bescheinen.
„Dreißig Minuten.“ Die Stimme des Primkommunikators riss sie aus dem Schlaf. Sie blinzelte in das schroffe Gesteinsrelief der Höhlendecke über sich. Noch dreißig Minuten...! Sie fuhr hoch. Alle drängten sich um den alten Kugelmonitor. Der übertrug jetzt Bilder! Bilder von der Eisoberfläche!
Venus band sich eine Decke um die Schultern, packte ihren Rucksack und kroch in die Höhlenmitte zu den anderen. „Funktioniert er endlich?“ Ihre Mutter nickte. Einige Kinder hatten sich inzwischen unter die Erwachsenen gemischt. Die feuchten Münder weit offen und mit glänzenden Augen starrten sie in das Geflimmer des Monitors. Säuglinge glucksten an Brüsten, Knaben nagten an ihren Unterlippen, Venus’ Vater, seine Brüder und die Sippenältesten saßen stocksteif. Einige der Jüngeren, die den Ausbruch versuchen sollten, hatten ihre Bestecke ausgepackt – Halbwüchsige, junge Männer, junge Frauen. Auch Venus’ Bruder: Plutejo band sich den Arm ab und setzte die Spritze an.
Kurz schoss ihr die Frage durch den Kopf, wo er wohl den Stoff herbekommen würde, falls er überlebte. Sie verscheuchte den Gedanken. Später. Immer eines nach dem anderen. Jetzt konzentrierte sie sich auf den Kugelmonitor. Das Herz schlug ihr im Hals, sie biss sich auf die Unterlippe, ihr Atem flog. Zum ersten Mal in ihrem Leben sah sie, was ihr Vater ihr unzählige Male beschrieben hatte: Omega-Raumer.
Totenstille herrschte in der Haupthöhle. Nicht einmal die Kleinen quengelten mehr. Man durfte das Labyrinth ja nicht verlassen, wenn alljährlich im Januar die legendären Frachter landeten. Die gesamte zweite und dritte Generation der Tigern-Sippe sah die schwarzen Giganten zum ersten Mal.
Es waren drei. Der Kugler, dessen optisches Sensorium Venus’ Onkel Sarturis mit dem gekaperten Rechner und dem alten Kugelmonitor verbunden hatte, schien in der Nähe der Schachtöffnung zu stehen. Er drehte sich langsam, so dass die Schiffe eines nach dem anderen über den Bildschirm glitten. Tiefschwarz hoben sie sich von dem erschreckend grellen Weiß des Eises und der Schneeböen ab, die der Wind dort oben vor sich hertrieb.
Venus sah den Teleskoplift zwischen Kommandokuppel und Boden, sah die größeren Lastenlifte aus den beiden Schiffsschenkeln im Schneegestöber über dem Eis verschwinden, und sie sah auch die viel dünneren Teleskopstützen. Die zu zählen, ließen die verschiedenen Bildperspektiven kaum zu, doch von ihrem Vater wusste sie, dass es sechs Paar sein mussten.
Hinter dem Schleier aus Schneeflocken ahnte man die Container mit der Tauschware mehr, als dass man sie sehen konnte; das galt erst recht für die Arbeitsroboter, die sie von den Frachtliften aus zum Eisschacht steuerten. Graue Flecken und Punkte bewegten sich da unter dem Schiffsrumpf, winzige Flecken und Punkte, verglichen mit den gewaltigen Omega-Frachtern. Zweihundertvierzig Meter maß so ein Gigant von Schenkelinnenseite zu Schenkelinnenseite, von Außenseite zu Außenseite gar zweihundertneunzig Meter.
Der Rumpf hatte in etwa den Grundriss des letzten Buchstabens einer uralten Sprache, die vor drei oder vier Jahrhunderten eine Renaissance erlebt hatte, aber heute nur noch von Liebhabern, wie Venus’ Mutter Elvetia gelesen werden konnte. Venus kannte den Namen des Buchstaben – Omega – und konnte ihn schreiben. Den Namen der Sprache hatte sie sich nicht gemerkt. Wozu auch?
Es gab Leute, die verglichen die Omega-Raumer einem Hufeisen mit Querstrebe. Venus allerdings war auf Genna geboren worden und hatte nie ein Hufeisen zu sehen bekommen. Sie wusste nur, dass man auf gewissen Planeten gewissen Tieren solche Eisen an die Hufe nagelte. Wenn sie sich aber einen Huf oder gar das entsprechende Tier vorstellen sollte, musste sie schon wieder passen.
Als sie noch ein kleines Mädchen war, und die Raumschiffe, von denen die Eltern erzählten, ihr wie Fabelwesen vorgekommen waren, hatte ihr Vater sie mal aufgefordert, ihren Daumennagel zu betrachten. „So ungefähr sieht ein Omega-Schiff aus, wenn du es von oben oder unten anschaust“, hatte er damals gesagt. „Nur musst du dir die Ränder doppelt, den Innenraum leer und das Weiße am Nagelbett gerade vorstellen.“ Venus hatte es damals tagelang probiert, bis ihr die Vorstellung endlich gelang.
Die Form der Rümpfe war auf dem Kugelmonitor nur ungefähr auszumachen. Sie hätten den Querschnitt eines Tropfens, hatte sie gelernt; eines großen, spitz zulaufenden Tropfens vorn in der Mitte und eines flachen, stumpfen Tropfens an den Schenkelenden, wenn man die beiden dort hinten aufgesetzten Triebwerkswülste nicht mit in Betracht zog.
„Fünfzehn Minuten“, plärrte es aus dem Empfänger. So lieblich die Stimme auch klang – fast alle zuckten zusammen. Ehepaare blickten sich ängstlich oder traurig an, Frauen schlossen die Augen, Männer zogen die Schultern hoch.
Venus’ Vater erhob sich. „Sobald ich das Ultimatum abgesetzt habe, werden sie herauskommen.“ Sein Blick suchte die Gesichter der zur Flucht ausgewählten jungen Männer und Frauen. „Wir werden sie und ihre Kampfmaschinen angreifen und euch den Weg freischießen. Wer immer von euch eine Kommandozentrale erreichen wird, starte, steuere Orkus an, lande dort zwischen und nehme an Bord, wen die Verbündeten für die Flucht ausgewählt haben. Danach tut euch zusammen und nehmt Kurs auf den verbotenen Planeten. Es wird schwer für euch in das Heimatsystem der menschlichen Gattung einzudringen...“
3
Der Planet im Viqua-Feld erinnerte ihn an einen durchgeschnittenen Tischtennisball. Man hielt schier den Atem an, weil man jeden Moment das Auseinanderdriften der beiden weißen Hälften erwartete. Veron fand ihn von Anfang an abstoßend. Möglicherweise lag das aber auch an der bescheuerten Musik. Gleichförmig wie immer perlte sie durch die Kommandozentrale. Heute allerdings produzierten nicht Violinen und Blechbläser die einschläfernde Geräuschkulisse, sondern ein Instrument, dass der Subgeneral Orgel nannte. Calibo Veron wusste nicht, was genau er sich unter einer Orgel vorzustellen hatte. Zu Hause auf Kaamos überließ man die Musikproduktion weitgehend den dafür konzipierten Kunsthirnen.
„Nicht katalogisiert, mein Subgeneral“, meldete er. „Weder der Stern noch sein Planet. Wir sind die Ersten, mein Subgenereal.“
„Sehr schön.“ Der Angesprochene streckte die Rechte nach einem Menschen aus, der neben seinem in Liegeposition eingestellten Sessel stand. Dieser Mensch sah aus, wie eine Mischung aus durchsichtigem Gespenst und blauem Crashdummy. „Setzen Sie sich mit der Newton in Verbindung.“ Der gespenstisch Blaue richtete den Rückenteil des Sessels ein wenige auf. „Ich will die Daten endlich auf meinem Schirm sehen!“ Der Blaue reichte seinem Herrn ein Glas Wasser.
„Sofort, mein Subgeneral.“ Newton hieß das Forschungsschiff des Pionier-Kampf-Verbandes. Kein PK-Verband war wirklich vollständig ohne so ein fliegendes Labor. Veron gab den Befehl per Bordfunk und mit einem Dringlichkeitsvermerk dritten Grades an den Ersten Kommunikator unten auf Ebene II weiter. Die Bestätigung ließ nicht lange auf sich warten.
Die sogenannte Orgel schraubte jetzt ein Geflecht von Tönen bis an die Decke der zwölf Meter hohen Ebene I der Kommandozentrale – und bis an Verons Schmerzgrenze. Er blickte verstohlen um sich – niemand verzog eine Miene. Sollte er der einzige sein, der die sogenannte Musik an diesem Bordabend unerträglich fand? Der schwarze Suboberst fragte sich, wie verrückt man sein musste, um Musik zu hören, die mindestens dreitausend Jahre alt war. Er selbst nannte sie übrigens Bronzezeitmusik. Nun, damit lag er ziemlich weit daneben. Auf seinem Monitor erschien das Symbol der Newton und gleich darauf eine Zahlenliste. „Die Daten, mein Subgeneral.“
Sicher, auch zu Hause auf Kaamos gab es Folklore-Fanatiker, die gern alte Musik hörten oder zum Besten gaben. Aber diese Leute benutzten elektronisch verzerrte Pauken, Holzblasinstrumente und diverse elektronische Zupfinstrumente, und alt hieß bei denen höchstens tausend Jahre alt. Veron fing ein Lächeln der Navigatorin auf. Pazifya schien seine Gedanken zu erraten. Er lächelte zurück. Aus den Augenwinkeln bemerkte er gleichzeitig die glühenden Augen des bläulichen Kunstmenschen. Täuschte er sich, oder beobachtete ihn der Diener des Kommandeurs?
Eigentlich wusste man ja, worauf man sich einließ, wenn man sich zum Dienst auf der Johann Sebastian Bach meldete – der war freiwillig, niemand wurde verpflichtet. Musikgeschmack und Schrulligkeiten des Subgenerals und sein blaukristallener Diener galten bereits in der ganzen Republik als sprichwörtlich. Vor allem Erste und Zweite Offiziere mussten mit einem Höchstmaß an Belastung rechnen, denn Subgeneral Bergen zog die ISK-Kappe nur in Notfällen persönlich über. Wenn die Umstände seine Geistesgegenwart nicht unbedingt erforderten, lag er im Kommandosessel und las eines seiner uralten Bücher; oder komponierte. Andererseits verbrachte er zwanzig von vierundzwanzig Stunden am Stück in der Zentrale und brauchte selten mehr als vier Stunden Schlaf.
„Die Daten vom Labor sind auf Ihrem Sichtfeld, mein Subgeneral“, wiederholte Veron.
Der rothaarige Mann im Kommandostand öffnete die Augen und gab seinem Diener das Wasserglas zurück. Er betrachtete das zentrale Sichtfeld auf seiner Arbeitskonsole. „Die Musik ein wenig leiser bitte, Heinrich.“ Die Orgelakkorde traten in den Hintergrund. „Interessant“, sagte der Subgeneral, und jeder Mann und jede Frau in der Kommandozentrale konnte seine hohe, klare Stimme vernehmen. „Die Eispole bedecken achtzig Prozent des Planeten. Der eisfreie Gürtel rund um den Äquator ist nur dreitausendsechshundert Kilometer breit; vorwiegend Wasser, ziemlich heißes Wasser. Die Strahlung ist zweifelsfrei?“
„Zweifelsfrei, mein Subgeneral. Eindeutig Glaucauris.“
„Was sind wir doch für Glückskinder!“ Bergen schlug sich auf die Schenkel. „Was meinen Sie, meine Damen und Herren?“ Beifall brandete auf, auch Veron klatschte höflich in die Hände. Der Diener stellte das Glas ab und tippte mit seinen durchscheinend blauen Fingerbeeren auf seine durchscheinend blaue Handinnenfläche. „Wer hat den Stern zuerst auf dem Schirm gehabt?“, wollte sein Herr wissen.
„Der Kommandant der Brüssel, mein Subgeneral“, antwortete die Navigatorin. Die Brüssel war einer von sechs Aufklärern des Zwölften PK-Verbandes. Ihr Kommandant hieß Ralbur Robinson.
„Dann in den Katalog mit ihr! ‚Robinson’ soll sie heißen. Und wer hat den Planeten zuerst angepeilt?“
„Ich, mein Subgeneral.“ Die Erste Navigatorin lächelte ihr hinreißendstes Lächeln.
„Vor- oder Sippenname?“ fragte Bergen.
„Familienname“, lächelte die schlitzäugige Pazifya.
„Kommandant an Golf!“
„Wir hören.“ Die Golf war das Kommunikator-Schiff des Verbandes. Über diese kleinen, mit Kommunikationstechnik vollgestopften Schiffstypen wickelte man im Allgemeinen die Fernkommunikation eines Verbandes ab.
„Meldung an Terra Prima, Terra Sekunda und Terra Tertia“, sagte Bergen. „Neuer Katalogeintrag: Sonne Robinson, Kategorie D, mit dem Planeten Corales. Corales ist der einzige Planet des Systems, mondlos, von zweihundertfünfzig Meter bis acht Kilometer dickem Eis überzogen, und unter dem Eis mindestens siebzehn Glaucauris-Stöcke...“ Er zog die Brauen hoch, spitzte die Lippen und musterte die Erste Navigatorin. „Passt irgendwie zu Ihnen, Primhauptmann Corales, was meinen Sie?“ Die schlitzäugige Schöne versuchte ihr Lächeln aufrecht zu erhalten. Es gelang ihr nur ansatzweise.
Bergen gab die vollständigen Planetendaten, die Koordinaten des Systems und die Positionen der angepeilten Metalladern durch. Anschließend brachte er seinen Sessel aus der Horizontalen in die Sitzstellung und stand auf. „Ich bin zufrieden.“ Er schlug dem blauen Kristallmenschen auf die blaue Kristallschulter. „Ich bin außerordentlich zufrieden.“
Wie die meisten an Bord trug der Kommandeur einen cremefarbenen Allzweckbody mit zahlreichen Taschen und dem Emblem der GRT auf der Brusttasche: Einer goldenen Spirale aus 793 Sternen auf blauem Grund; ein Stern für jeden Planeten der Republik. Über der Tasche, in metallicblauen Buchstaben auf rotem Grund, sein Name: Merican Bergen. Metallicblau war die Schriftfarbe des obersten Subranges, Rot die Untergrundfarbe eines Generals.
Bergen war klein und drahtig, sein Haar schulterlang und kupferrot. Eine schmale Hakennase dominierte sein scharfgeschnittenes Gesicht. „Und jetzt wollen wir den Planeten Corales für unsere geliebte Republik in Besitz nehmen. Was meinen Sie, meine Damen und Herren?“
Wieder brandete Beifall auf, diesmal mischten sich Hochrufe in den Applaus. „Lang lebe die Republik!“ Veron vergaß die Musik und stimmte in die Rufe mit ein. „Lang lebe die Republik!“ Endlich mal wieder einer jener seltenen Augenblicke, in denen er sich beglückwünschte freiwillig auf die Johann Sebastian Bach gegangen zu sein.
4
Er blieb länger in der Reederei als sonst. Erst nach Einbruch der Dunkelheit fuhr er durch die Schluchten Doxa Citys zu den Wohntürmen an der Küste. Moses hockte auf der Lehnenkante des Beifahrersessels. Millionen von Scheinwerferpaaren überholten ihn, kamen ihm entgegen, sausten unter ihm vorbei, glitten über ihn hinweg. Doxa City hatte dreiundzwanzig Millionen Einwohner. Manchmal kam es ihm vor, als würde jeder von ihnen zwei Gleiter besitzen und beide gleichzeitig durch die Stadtschluchten steuern.
Alles erlebte er intensiver als sonst an diesem Abend – den Heimflug, das müde Krächzen des Kolks, das gleichmäßige Summen aus dem Heck seines Gleiters, die unendlichen Perlenketten der Scheinwerferpaare in den Außenspiegeln und jenseits der Frontkuppel, das warme Leuchten der Armaturen, die in den Wolken verschwindenden Wohntürme, das Ankommen auf dem Terrassenparkplatz. Er stieg aus und trat ans Geländer. Als erfolgreicher Unternehmer und ehemaliger Oberst der Flotte konnte er sich ein Apartment im dreihundertzwölften Stock leisten. Moses flatterte hinter ihm her und ließ sich auf dem Geländer nieder.
Zweihundert Meter unter ihm, wie dunkler, von innen glühender Nebel, eine Wolkenbank; rechts und links und jenseits der Fassadenschlucht erleuchtete Fensterfronten und ihre Reflexe in den Karosserien der Gleiter auf den Parkbucht-Terrassen; und über ihm das Gefunkel der Sterne. Doxa IV hatte keinen Mond, dafür standen die Sterne besonders dicht in diesem relativ zentrumsnahen Teil der Milchstraße. Leider sah man das Meer an diesem Abend nicht.
In einem der Gleiter auf der Parkplatzterrasse der Wohnebene jenseits der Fassadenschlucht brannte Licht; ein weißer Gleiter mit einem runden Fleck auf dem Bug vor der Frontkuppel. Ein Paar saß auf der vorderen Bank. Yakubar sog die kühle Abendluft tief in seine Lungen. Dann wandte er sich um und ging zum Lift.
Im Apartment flatterte Moses sofort durch den Salon hindurch ins Schlafzimmer, wo seine Echtholz-Voliere auf ihn wartete. Yaku selbst stand zunächst eine Weile im Salon und ließ seinen Blick über die Pflanzen auf der Fensterbank wandern, über die Porträts und die Visuquantenleiste an der Wand, über die Sessel, das Ledersofa, den Tisch und das Bücherregal. Das füllte die lange Innenwand aus. Yaku sammelte Bücher.
Den Rücken zur Fensterfront gewandt holte er die erste der beiden Whiskyflaschen aus dem Geheimfach im Regal. Er barg sie unter seiner Silberzwirnweste und trug sie in die kleine Küche. Dort füllte er den Whisky in eine Teekanne – immer darauf bedacht, den Rücken der gläsernen Straßenfront zuzuwenden. Die leere Flasche trug er unter der Weste zurück zum Bücherregal und versenkte sie im Geheimfach zwischen Band 17 und Band 19 eines vierhundertzehn Jahre alten Lexikons. Der Buchblock von Band 18 lag zwischen einem Stapel anderer umschlaglosen Bücher hinter der Ledercouch.
„Wüste“, sagteYaku, als er sich mit einer Tasse Whisky auf der Couch niederließ und die Beine auf den Tisch legte. Das Licht wurde matter, die Fensterfront und die Schmalseite mit der VQ-Leiste entfärbten sich. Einen Atemzug später schien die Sonne von einem wolkenlosen Himmel auf endlose Sanddünen herab. Heiß rann ihm der Whisky durch die Kehle und hinter dem Brustbein entlang in sein Körperzentrum. Das tat gut.
Sein Blick fiel auf den Kalender am Türrahmen. So ein antikes Ding aus Papier, an dem man jeden Tag ein Blatt abreißen musste und dann irgendein Motto zu lesen bekam, wie zum Beispiel Gestern ist Geschichte, Morgen ist ein Rätsel, Heute ist ein Geschenk oder Erkenne dich selbst, oder Vegetarier leben nicht länger, sie sehen nur älter aus und so weiter. Man fand solche Kalender nur noch in bestimmten Souvenirläden bestimmter Planeten. Der hier stammte von Terra Sekunda, wo Yaku Tellim öfter zu tun und gute Freunde hatte. Der Spruch des heutigen Tages lautete Realität ist die Illusion, die man hat, wenn man nüchtern ist. Das Datum darüber lautete: 25. Januar 2554. Yakubar nahm einen Schluck aus der Tasse.
Er rülpste und lehnte sich zurück. Eine Kolonne von Reitern in weißen Gewändern ritt über den Kamm einer Sanddüne. Sie saßen auf großen schwarz-braunen Tieren mit langen, mähnigen Hälsen und zwei seltsamen Höckern auf dem Rücken. Yaku hatte gehört, dass man solche Kolonnen früher Karawanen genannt hatte. Auch den Namen der witzigen Reittiere hatte er schon gehört. Er fiel ihm aber im Augenblick nicht ein.
Sein Blick wanderte über die Wand mit den Porträts: Seine Enkel Jannis, Kobald und Corall, seine Tochter Mirjam, sein dritter Sohn Hosea, sein zweiter Sohn Jesaja, sein erster Sohn Amoz und schließlich Elsa, seine Frau, im schwarzen Rahmen des größten Bildes.
Zwischen den Porträts der letzten beiden flog sein Blick hin und her. „Kann sein, wir sehen uns bald“, flüsterte er. Er spülte den schlechten Geschmack auf der Zunge mit einem besonders großen Schluck hinunter. Elsa war vor sechs Tagen gestorben. Eine Infektion auf Woodstock; unbekannter Erreger. Dem entsprechenden Eintrag in der Familienchronik zufolge war sie schon vor sechs Jahren gestorben. Aber das konnte er nicht glauben, wenn er, wie jetzt, ihr Bild betrachtete. Amos, sein Ältester, war von einer Expedition in den Pferdekopfnebel nicht mehr nach Hause gekommen. Angeblich auch schon siebzehn Jahre her; und auch das kam ihm wie gestern vor. Er leerte die Tasse und schenkte sich nach. Die Jahre rückten irgendwie enger zusammen, wenn man älter wurde; fast wie im Rückblick die Tage einer Woche.