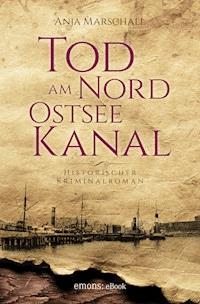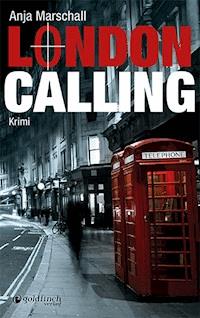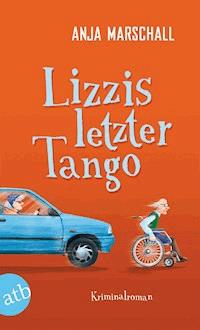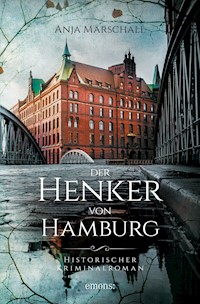9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Duft von frisch gemahlenem Kaffee und der Traum von Freiheit Drei starke Frauen in bewegten Zeiten: Band 1 der großen Familiensaga rund um den Aufstieg einer Hamburger Kaffeedynastie vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte zwischen 1889 und 1989. Hamburg 1889: Als die junge Brasilianerin Maria den Kaffeehändler Johann Behmer heiratet, fühlt sie sich fremd in Hamburg und einsam in Johanns zerstrittener Familie. Doch Maria ist eine Kämpferin, und als Tochter eines Kaffeeplantagenbesitzers liegt ihr das »schwarze Gold« im Blut. Begierig lernt sie in der neu eröffneten Speicherstadt alles, was man über den Handel mit dem Luxusgut wissen muss. Schon bald erweist sie sich als kluge Geschäftsfrau. Aber dann beginnt der Erste Weltkrieg, der Kaffeehandel kommt fast zum Erliegen, und Maria merkt, dass jemand in der Familie ihren Mann aus der Firma drängen möchte ... Die Hamburger Speicherstadt: weltweit größter historischer Lagerhauskomplex, Architektur-Juwel, UNESCO-Welterbe, Touristen-Magnet – und Herz des Hamburger Kaffeehandels Mit dem »schwarzen Gold« wird an der Waterkant schon lange gehandelt. 1887 eröffnete in der Speicherstadt die Hamburger Kaffeebörse und wurde zum wichtigen Handelsplatz für das begehrte und lukrative Genussmittel. 24 Millionen Jutesäcke Kaffee aus Brasilien und Zentralamerika sollen dort in den ersten eineinhalb Jahren gehandelt worden sein. Bis zum Ersten Weltkrieg blieb Hamburg führend für diesen besonderen Markt, und noch heute ist die Hansestadt für den Kaffeehandel von großer Bedeutung. Für LeserInnen der neuen historischen Sagas von Fenja Lüders und Anne Jacobs.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Töchter der Speicherstadt – Der Duft von Kaffeeblüten«an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Redaktion: Birgit Förster
Covergestaltung: Teresa Mutzenbach
Covermotiv: Miguel Sobreira / Trevillion Images
und Shutterstock.com
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Prolog
1889–1897
Die Wilde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1904–1914
Der falsche Bruder
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1914–1918
Der große Kampf
29
30
31
32
33
34
35
Nachwort
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Prolog
Hamburg, 1842
Sie drohten im Schlund der Hölle zu krepieren! Aus den Fensteröffnungen der brennenden Häuser zu beiden Seiten schlugen heiß züngelnde Flammen heraus. Ihm war, als griffen sie gierig nach ihm, wollten ihn fassen, ihn zu sich ziehen und verschlingen. Ein Fauchen über seinem Kopf! Kurz blickte er hoch, als auch schon ein glühender Funkenregen auf ihn niederging. Schützend hob er den Arm. Der Westwind trieb schwere Rauchwolken Richtung Alster. Sie waren in phosphoreszierendes Orange gehüllt, als würden sie aus sich selbst heraus leuchten. Überall zischte es wie aus tausend Schlangenmäulern, die die Stadt an der Elbe überfielen. Das Feuer um sie herum brüllte ohrenbetäubend. In dieser Nacht stillt der Teufel seinen infernalischen Hunger an Hamburg, dachte Hermann und rannte mit den anderen weiter, als ein tiefes Grollen in der Ferne zu hören war. Kurz blieben die Männer stehen, sahen sich an. Man hatte also tatsächlich das Rathaus gesprengt! Doch das Unglück war nicht mehr aufzuhalten. Einzig Gott konnte noch helfen.
In diesem Moment barsten Fenster in Hermann Behmers Nähe. Splitter regneten wie Pfeile auf ihn nieder. Eilig schoben er und die anderen die Feuerspritze weiter, um wenigstens St. Petri zu retten. St. Nikolai war bereits verloren.
Hitze brannte sich in Hermanns Haut. Jeder Atemzug schmerzte die Lunge. Er duckte sich unter der Lederkapuze, die schwer auf Kopf und Schultern wog. Der geölte Mantel zog ihn immer weiter gen Boden. Er spürte, wie seine Kräfte nachließen.
Zwei Tage und Nächte kämpften die Menschen nun schon gegen dieses Inferno, ohne Hoffnung, auch nur ein Gebäude retten zu können. Die Nachwelt würde sagen, der Teufel habe Hamburg am Himmelfahrtstag 1842 mit sich in den Hades gerissen. Niemals würde sich Hamburg von diesem Schicksal erholen können. Niemals!
Hermann spürte, wie wütende Tränen seine Wangen hinunterliefen, während er sich gegen die Spritze stemmte. Die tauben Beine trugen ihn kaum noch. Brüllende Flammen verschluckten das Poltern der Räder auf dem Kopfsteinpflaster.
Als sie auf den Jungfernstieg kamen, sah er, dass der Feuersturm die Ufer der Alster bereits erreicht hatte. Der Alsterpavillon vor ihnen war nur noch ein verkohltes Gerippe, dessen rußige Beine aus dem flachen Wasser ragten. Auch das Zuchthaus brannte. Wenn doch nur der Wind endlich nachlassen würde! Der Mann neben ihm sank erschöpft auf die Knie und begann jammernd zu beten.
Hermann starrte auf das onyxschwarze Wasser der Alster, in dem sich die Flammen über der Stadt in den Wellen spiegelten. Das Bild seiner Frau trat vor seine brennenden Augen. Als er Amalie verlassen musste, hatten gerade die Wehen eingesetzt. Er wusste nicht, ob er Vater eines Jungen geworden war oder bereits Witwer. Konnte all das wirklich Gottes Plan sein? Er zog den wimmernd betenden Mann auf die Beine. »Weiter, Hans!«
Immer mehr Spritzenleute stolperten aus den Seitenstraßen, schleppten sich zum Zuchthaus hinüber, in der verzweifelten Hoffnung, wenigstens den Westteil der Stadt retten zu können. Hunderte kleiner Ruderboote, vollgepackt mit Hausrat und ängstlichen Menschen, dümpelten mitten auf der Alster, dem einzigen Ort, der ihnen Sicherheit versprach.
Da hörte Hermann jemanden um Hilfe rufen. Er blieb stehen, horchte, während seine erschöpften Kameraden keuchend weitereilten. Da! Noch einmal drang der schwache Ruf zu ihm, es klang fast wie ein Jammern. Es war eine Frau! Sie musste in dem Haus neben der Apotheke sein. Warum war sie nicht geflüchtet wie all die anderen? Er fuhr herum und sah, dass der Dachstuhl des Eckhauses bereits Feuer gefangen hatte. Hermann wollte schon loslaufen, um der Frau zu helfen, als er innehielt.
Vielleicht war das Rufen nur eine Täuschung. Eine Sirene könnte seine Sinne verwirrt haben, damit er in die Flammenhölle lief und unter ihrem Siegesgeschrei verbrannte. Er hielt seinen müden Kopf mit beiden Händen, um sich zu konzentrieren. Da hörte er den Hilferuf erneut!
Hermann spürte die Gier des Feuers auf seiner Haut, als er durch die offen stehende Tür des Fachwerkhauses rannte. Überall lagen umgekippte Möbel, Hausrat und Kleidung in der Diele.
»Wo sind Sie?«, brüllte er und hustete. Da hörte er die Stimme ein weiteres Mal. Er stieß eine Tür auf. Vor dem Kohleherd sah er eine gekrümmte Gestalt liegen. »Sind Sie verletzt?«
Statt einer Antwort hielt sie ihren dicken Bauch mit beiden Händen. Das Gesicht vor Schmerzen verzerrt. »Das Kind kommt!«, schrie sie und griff nach seinem Mantel. »Helfen Sie mir!« Dann wurde sie ohnmächtig. In diesem Moment stürzten Hermanns Kameraden in die Küche.
»Bist du wirr im Kopf! Komm hier raus. Der Dachstuhl geht gleich nieder!« Da sahen sie die Frau, packten an und brachten sie hinaus.
»Sie muss ins Lazarett«, rief Hermann draußen, und sein Blick hetzte die Straße auf und ab, in der Hoffnung, Leute mit einem Handkarren oder gar ein Fuhrwerk zu finden. Ratlos blickten die Männer zu der Frau herunter, die auf dem Kopfsteinpflaster lag. Über ihnen flogen Funkenwolken auf der Suche nach noch mehr Futter. Hermann dachte an seine Frau und ihr ungeborenes Kind. Dann nahm er die Ohnmächtige auf, obwohl jegliche Kraft seinen müden Körper bereits verlassen hatte. »Ich trage sie zu den Nonnen am Pferdemarkt«, rief er den anderen zu. Er wusste, er musste die Frau in Sicherheit bringen.
Als Hermann Behmer seine Augen öffnete, lag er auf einer Trage. Durch ein Fenster sah er das orangefarbene Leuchten eines neuen Morgens. Für einen kurzen Moment hoffte er, das Licht möge dem Sonnenaufgang geschuldet sein. Da hörte er in der Ferne ein Knacken und Donnern, ein Zischen und Stöhnen. Noch immer kämpfte seine Stadt ums Überleben. Vage erinnerte er sich, dass er es noch bis zum Pferdemarkt geschafft hatte. Jemand hatte ihm die Frau aus den Armen genommen. Dann war er zusammengebrochen. Eine Nonne trat an seine Liege.
»Ist es vorbei?«, fragte er.
Müde schüttelte sie den Kopf. »Sie hat nach Ihnen gefragt.«
Vorsichtig setzte er sich auf. Alles drehte sich. Es dauerte einen Moment, bis ihm seine Beine gehorchten.
Die Schwester geleitete Hermann zu einem Raum, an dessen Längsseiten Bett an Bett stand, getrennt nur von Laken, die man auf grobe Holzgestelle genagelt hatte. Es war eigentümlich still hier, und er begriff, dass hier gestorben wurde. Das Bett jener Fremden, die er gerettet hatte, stand etwas abseits. Sie hielt das schlafende Neugeborene in ihrem Arm und lächelte matt, als sie Hermann erkannte.
»Es ist ein Junge«, sagte die Schwester.
Hermann ging zu der Frau im Bett. Ihre Lippen bewegten sich, aber er konnte sie kaum verstehen. Also kam er näher. »Der Herr holt mich zu sich«, flüsterte sie. Er nahm ihre Hand, während er der Schwester einen fragenden Blick zuwarf. Diese nickte stumm und ging.
»Wie heißen Sie?«, wollte die junge Mutter wissen. Sie war kaum älter als zwanzig. Er nannte ihr seinen Namen. »Sie sind ein guter Mensch, Herr Behmer«, flüsterte sie. »Ich flehe Sie an, nehmen Sie meinen Sohn mit.«
»Aber der Vater … Ihre Familie …«
»Der Junge hat niemanden mehr. Nur Sie.« Mit letzter Kraft gab sie dem Kind einen Namen. Dann fiel ihr Kopf zur Seite. Ihre Hand rutschte aus seiner. Hermann erschrak, wollte nach jemandem rufen, aber er war allein mit ihr und dem Kind. Und dem Tod. Er traute sich kaum zu atmen, schaute auf ihr schweißnasses, strähniges blondes Haar, das halb über ihrem Gesicht lag. Sie sah aus, als würde sie tief schlafen. So, wie ihr Kind. Wieder dachte Hermann an Amalie und hoffte, sie möge die Geburt ihres ersten Kindes überlebt haben. Ob es ein Junge geworden war oder nur ein Mädchen? Angst überfiel ihn, doch er widerstand dem Wunsch, aufzuspringen und fortzulaufen. Stattdessen betete er leise ein Vaterunser.
Niemand hielt Hermann Behmer auf, als er bald darauf mit dem Kleinen im Arm das Hospital verließ.
1889–1897
Die Wilde
1
Brasilien, Fazenda Santo Antônio, 1889
Sie beugte sich über den Hals ihres Pferdes. Mit der Gerte in der Hand trieb Maria das Tier hart an. Sie galoppierten die kaum befestigte Straße zum Fluss hinunter, vorbei an mannshohen Kaffeesträuchern, deren rote Beeren in der heißen Sonne leuchteten. Erstaunt schauten die Sklaven der Tochter des Coronel nach, als sie an ihnen vorbeipreschte. Mit einer Hand wischte Maria die Tränen aus ihrem Gesicht. Ihr Atem ging schnell. Schweiß trat auf ihren Rücken, als sie auch schon das Glitzern des Rio Paraíba do Sul zwischen den Bäumen sah.
Wie hatte Vater das nur tun können? Sie trieb das Pferd zu einer Furt, stürmte in den Fluss und folgte seinem Lauf. Das Wasser spritzte, als sie dahinjagte.
Sie spürte, dass das Pferd erschöpft war. Marias Herz aber raste weiter, pumpte das Blut wie Trommeln durch ihren Körper. Nur ungern ließ sie den Rappen in den Schritt fallen.
Die Fazenda war ihr Zuhause! Wie konnte Vater die Plantage nur verkaufen! Maria sog die schwüle Luft so tief in ihre Lungen, als könne sie damit die wilden Teufel in ihrem Inneren beruhigen. Wütend sprang sie ab und setzte sich ans Ufer. Ihr Pferd kühlte sich ganz in ihrer Nähe im Wasser des Flusses ab. Maria zwang sich zur Ruhe, während einige Papageien über den hohen Bäumen schreiend ihre Kreise zogen. Das Keifen von Affen drang aus dem nahen Wald zu ihr, und ein Tapir schob sich aus dem Dickicht, um im Flusswasser zu trinken.
Maria war sicher, dass ihre Mutter den Verkauf verhindert hätte, wenn sie noch leben würde. Die Plantage, das Haus, die Stallungen … all das war schon lange im Besitz der Familie, und jetzt sollte es ein Ausländer bekommen?
Maria Pereira da Silva erhob sich. Stolz warf sie den Kopf zurück, trat ins Wasser zu ihrem Pferd, griff nach den Zügeln und stieg wieder auf. Es war dumm gewesen, ohne Waffen und Begleitung in den Wald zu reiten. Aber noch dümmer war es, sich den Problemen nicht zu stellen, sondern wie ein Kind fortzulaufen. Sie würde tun, was getan werden musste, um die Fazenda vor dem Fremden zu schützen. Sie musste es nur klug genug anstellen.
*
Die bodentiefen Fenster des Salons standen offen. Der kühle Wind von den Hügeln ließ die Gardinen vor und zurück schweben. Von draußen wisperten die Geräusche eines endenden Tages zu den beiden Männern, die sich gegenüber saßen. Der eine, leicht gebeugt in einem hohen Lehnstuhl sitzend, schaute schweigend in die kleine Tasse in seiner Hand, die er auf einem feinen Unterteller aus Porzellan balancierte. Coronel Arturo Pereira da Silva war nur zehn Jahre älter als sein Besucher, und doch wirkte er wie ein greiser Mann. »Wir sollten den Vertrag unterschreiben.«
Johann Behmer schmeckte dem Aroma des Brasils nach, der seine Kehle hinunterlief. Nussig, mit einem leichten Hauch von Honig im Gaumen. Er nickte. »Wenn Sie es wünschen, Coronel, dann werden wir es genau so machen. Ich möchte mich zuvor nur noch auf Ihrem Anwesen umsehen.«
»Warum? Sie haben doch bereits alle Unterlagen. Ihr Agent hat sie schon vor Wochen nach Hamburg geschickt.« Der Hausherr unterdrückte ein Husten. »Die Erträge der Fazenda steigen von Jahr zu Jahr. Der Preis ist gut. Warum warten?«
Johann Behmer stellte die Tasse zurück auf den Tisch. Vor Monaten hatte er von da Silvas Leiden gehört. Pinheiro, der Agent der hiesigen Hamburger Exportfirma Wille, die alle Lieferungen für Behmer & Söhne abwickelte, hielt ihn über da Silvas Zustand auf dem Laufenden. Der Coronel war seit einigen Jahren Witwer. Pinheiro meinte, nach dem Tod seiner Gattin hätte auch der Coronel aufgehört zu leben. Doch Johann sah die Dinge weniger romantisch. Da Silva musste verkaufen, weil er schwer krank war und keinen Sohn hatte. Zudem hatte sich für die zwanzigjährige Tochter Maria kein geeigneter Ehemann finden lassen, der die Plantage hätte weiterhin leiten können. All das drückte den Preis für die Fazenda Santo Antônio. Johann wusste, dass die Zeit drängte, denn der Preis für die Plantage war zu günstig, als dass nicht auch einer der anderen Hamburger Kaffeehändler interessiert sein würde, sollte er von da Silvas Absichten erfahren. Bisher aber liefen die Verhandlungen mit da Silva so diskret, dass nicht einmal Johanns Zwillingsbruder Alfons in seinem Kontor in Hamburg Genaueres wusste.
In diesem Moment wurden die Salontüren geöffnet, und eine junge Frau in einem weißen Seidenkleid trat ein. Ihr dunkles Haar hatte sie kunstvoll hochgesteckt und mit Orchideen geschmückt. Sie lächelte, als sie auf Johann zuschritt und ihm die Hand reichte. Er sprang auf und deutete den geforderten Handkuss mit einem charmanten Lächeln an. In einem makellosen Deutsch hieß Maria da Silva, die Tochter des Hauses, ihn willkommen und entschuldigte sich, dass sie bei seiner Ankunft nicht auf der Fazenda gewesen sei. »Sie bleiben doch sicherlich für ein paar Tage, lieber Herr Behmer«, säuselte sie.
»Es ist mir eine Ehre, Senhorita«, sagte Johann und meinte es so. Er war jetzt fast achtundvierzig Jahre alt, und viele schöne Frauen hatten seinen Weg gekreuzt. Von keiner hatte er sich bezirzen lassen. Sein Leben gehörte der Firma. Sollten sein Bruder Alfons und Schwägerin Gertrud sich um die kommende Generation kümmern. Er würde niemals eine Frau heiraten, die so war wie alle anderen: hübsch, leidlich gebildet, eine Zierde ihres Geschlechts, ausstaffiert mit Rüschen und Volants, langweilig und fordernd. Dass Alfons bereits Andeutungen hinsichtlich Johanns Desinteresse an Frauen gemacht hatte, war wenig schmeichelhaft gewesen, kümmerte Johann aber nicht. Jetzt jedoch stand Johann Behmer mitten im brasilianischen Urwald einer Schönheit gegenüber, die ihn sprachlos machte.
Man hatte Johann ein Zimmer im Seitenflügel des Gebäudes zugewiesen, welches ebenso luxuriös eingerichtet war wie der Rest des Hauses. Kristallvasen, edles Mobiliar im Stile Louis Philippes, silberne Obstschalen und chinesisches Porzellan. Johann aber sah all das nicht. Unruhig hoffte er auf den Moment, an dem er die Tochter des Hauses beim Diner wiedersehen würde.
Schlag acht Uhr ging er hinunter.
Im Salon hatte sich bereits eine kleine Gesellschaft eingefunden. Agent Pinheiro ließ Johann ein Glas Champagner bringen und stellte ihm gerade einige Herren aus Vassouras vor, als Maria in den Salon trat. Sie trug ein Chiffonkleid, dessen Stoff mit Perlen bestickt war. Sofort fiel Johann auf, dass sie ansonsten auf jeglichen Schmuck und Zierrat verzichtet hatte. Sie trug nicht einmal einen Ring am Finger. Maria begrüßte die Gäste. Dann schwebte sie auf Johann zu. Für einen kurzen Moment trafen sich ihre Blicke.
»Ich denke, Herr Behmer, Sie und ich sollten die Tafel eröffnen.« Lächelnd reichte sie ihm ihren Arm. Johann beschränkte sich auf ein Nicken, denn ihm fehlten die Worte. »Sie scheinen überrascht zu sein, dass ich Deutsch spreche.« Wieder nickte er. »Die Familie meiner Mutter kommt aus Bremen. Ein Onkel besaß dort eine Handelsfirma. Mutter reiste mit ihren Eltern nach Joinville, eine von Deutschen südlich von São Paulo gegründete Stadt. Sie lernte meinen Vater auf einem Ball kennen. Ich selbst wuchs mit zwei Sprachen und zwei Kulturen auf. Das Land meiner Mutter kenne ich bedauerlicherweise nur von einem Sommer, den ich vor einigen Jahren in einer Höheren Mädchenschule verbrachte. Als meine Mutter starb, musste ich zurückkehren.«
Johann wusste nicht, was er darauf entgegnen sollte. Ihre Offenheit überraschte ihn. Und so beschränkte er sich auf ein Lächeln.
Gemeinsam schritten sie in den Festsaal, wo eine üppig gedeckte Tafel stand. Sklaven in goldbetresster Livree warteten, um das Essen zu servieren. »Mein Vater lässt sich entschuldigen. Er ist unpässlich.« Ein besorgter Blick huschte über ihr Gesicht.
»Nun, das bringt mich in den Genuss Ihrer Gesellschaft für den ganzen Abend, wie ich hoffe.« Johann war froh, seine Stimme wiedergefunden zu haben.
Das Menü im Hause da Silva war köstlich und hätte ebenso in einem der besten Pariser Restaurants serviert werden können. Kalbsfilet mit Spargelspitzen, vielerlei Pasteten, Truthahn mit Trüffeln, Schinken und Filets, Gemüse und Obst, Kuchen und Sorbets, begleitet von Champagner sowie Weine der fernen Güter Château d’Yquem, Laffite und Margaux.
Pinheiro beugte sich zu Johann. »Sie fragen sich bestimmt, wie all das hierherkommt? Nun, nachdem der Rohkaffee mit den Schiffen nach Hamburg gebracht wurde, fahren die Segler vollgestopft mit all dem europäischen Luxus wieder zurück.« Er legte seine Damastserviette zur Seite und griff nach dem Glas Rotwein vor sich. »Südamerika und Hamburg sind sich in ihren Herzen viel näher, als so mancher glauben mag.« Der Agent sah zu Maria da Silva und prostete ihr zu. »Und? Wie war Ihr Gespräch mit dem Coronel, lieber Herr Behmer?«
»Morgen lasse ich mir die Plantage von Dona Maria zeigen. Dann sehen wir weiter.«
Am nächsten Morgen ritten Johann und Maria in aller Frühe los. Er hatte Schwierigkeiten, mit ihrem scharfen Ritt mitzuhalten. Auf einem Hügel hielt sie ihr Pferd an und wartete, bis er sie erreicht hatte. »Von dort drüben, wo der Rio Paraíba eine weite Biegung macht …« Ihr Arm fuhr über den Horizont, »bis zu den hohen Palmen auf der rechten Seite und dem Berg im Westen gehört das Land seit Jahrzehnten meiner Familie.« Sie sagte dies mit hörbarem Stolz. »Wissen Sie, warum aus dem Wald ab und zu besonders hohe Palmen ragen?« Johann schüttelte den Kopf. »Es sind Kaiserpalmen. Sie begrenzen unser Anwesen gegen die Mata Atlântica, den Regenwald.«
»Kaiserpalmen?«
»Nun, eigentlich handelt es sich um Dattelpalmen mit sieben Seitentrieben. Unser Kaiser erlaubt nur seinen edelsten Vasallen, sie anzupflanzen. Es ist eine Auszeichnung.« Sie sprang aus dem Sattel, band das Pferd an einen Strauch und führte Johann zwischen endlosen Reihen von Kaffeesträuchern entlang, wo Männer mit schweißglänzenden Oberkörpern und Frauen mit breitkrempigen Hüten die roten Beeren von den Zweigen pflückten, die unreifen grünen und die weißen duftenden Blüten aber hängen ließen.
Johann hatte Probleme, ihrem schnellen Schritt zu folgen. »Könnte man die Ernte nicht effizienter gestalten?«, wollte er wissen. »Bei uns werden Bäume geschüttelt, damit die Früchte herabfallen. Das geht schneller und ist …«
Maria schnaufte verächtlich. »Die Sträucher brechen leicht. Zudem würden die unreifen grünen und gelben Früchte ebenfalls zu Boden gehen. Diese müssten dann wieder aussortiert werden. Es sei denn, man legt keinen Wert auf einen guten Kaffee.«
Johann überhörte ihre schnippische Bemerkung. »Sie verstehen viel vom Kaffeeanbau, Dona Maria.«
»Ich bin mit Kaffee aufgewachsen. Der Anbau von Kaffee ist eine Kunst, die nicht jeder beherrscht. Guter Kaffee verlangt Respekt vor der Natur. Wussten Sie, dass ein junger Strauch seine ersten Früchte nach drei Jahren trägt, aber erst im fünften Jahr geerntet werden kann?«
Natürlich wusste er das. Johann blieb ein wenig atemlos stehen. Die Arbeit im Kontor hatte ihn offenbar verweichlicht. »Darf ich Sie etwas fragen, Dona Maria?« Fragend sah sie ihn an. »Ich habe den Eindruck, Sie möchten nicht, dass Behmer & Söhne die Fazenda kauft.«
Kurz zögerte Maria. »Seit meiner Kindheit dreht sich mein ganzes Leben um den Kaffee. Wenn Stürme unsere Ernte ruinieren oder die Sträucher in den heißen Monaten nicht mehr genügend Wasser haben, sind wir arm. Wenn Gott es aber gut mit uns meint, leben wir wie im Paradies. Es geht uns immer nur so gut, wie es den Sträuchern geht, die wir hegen. Diese Kaffeekirschen sind unser Leben, Herr Behmer. Und so, wie wir unser Leben nicht verkaufen würden, dürfen wir auch unsere Sträucher nicht irgendeinem Fremden überlassen, der nur an Profit denkt.« Johann begriff, dass die junge Frau vor ihm um ihr Erbe kämpfen würde.
Als sie zur Fazenda zurückkehrten, stand die Sonne hoch am Himmel. Sie gingen über den Platz vor dem Haupthaus, wo ein Meer frisch geernteter tiefroter Kaffeekirschen in der heißen Sonne trocknete, bis ihr Fleisch hart geworden war und sie aussahen wie kleine braune Nüsse. Sobald die Fruchtschale dann nach dem Waschen fortgespült und die knisternde Pergamenthaut des Kerns entfernt wurde, kamen die unscheinbaren Bohnen zum Vorschein. Sie und der stetig wachsende Durst der Welt auf würzigen Kaffee hatten Marias Familie reich gemacht. Frauen mit hölzernen Harken in den Händen verteilten gerade die Früchte gleichmäßig am Boden, als Maria an ihnen vorbeischritt. Johann folgte ihr zum Haupthaus. Durch eine offene Tür hörte er jemanden singen. Der Geruch köstlichen Kaffees zog Johann um die Nase.
»Das ist Ana. Sie röstet gerade einige Kaffeebohnen«, erklärte Maria und trat ein. Die Köchin mit dem Namen Ana, eine breite Sklavin mit wirren schwarzen Locken, die sie unter einem Tuch zu bändigen versuchte, stand am Herd und rührte mit einem Holzlöffel in einem Topf. Mit einer Hand streute sie ein wenig Zucker auf die Kerne, während sie ohne Pause den Löffel kreisen ließ und dabei sang. Maria gab der Frau einen Kuss auf die Wange. »Ana ist mein altes Mütterchen«, meinte Maria und lächelte zärtlich.
»Altes Mütterchen! Wehe dir!« Die Köchin drohte Maria mit dem Kochlöffel, und die Tochter des Hauses lachte.
Johann schnupperte. »Wie lange röstest du die Bohnen?«, wollte er von Ana wissen.
»Bis sie so dunkel sind wie meine Haut, Senhor.«
»Gehen wir in den Salon«, schlug Maria Johann vor.
Doch ihm gefiel es hier. Suppe brodelte in einem großen Topf, und im Ofen schmorte ein Braten. »Ich würde lieber hier meinen Kaffee einnehmen, Senhorita.«
Argwöhnisch betrachtete Maria den Mann, als er mit Ana wieder über das Rösten sprach. Wollte der Deutsche sich auf diese Weise in einem guten Licht darstellen? Kritisch beobachtete sie Johann Behmer, wie er Ana über die Schulter schaute. Er war groß, größer als ihr Vater. Und er konnte sehr viel besser reiten, als sie es ihm zugetraut hatte. Er hatte nicht gelacht oder eine abfällige Bemerkung gemacht, als sie ihm vorhin ihre Ideen offenbart hatte, wie die Bewässerung der Sträucher verbessert werden könnte oder welche Maschinen für das Reinigen der Kirschen angeschafft werden sollten. Er war so anders als all die Männer, die sonst im Salon ihres Vaters verkehrten. Sie alle waren bereit, für die Fazenda auch die störrische Tochter in Kauf zu nehmen, und behandelten sie wie ein dummes Mädchen. Dieser Kaufmann aus Hamburg hingegen fragte nach ihrer Meinung und schien über ihre Ideen nachzudenken. Sie musste zugeben, dass er schnell lernte.
Plötzlich drehte sich der Gast zu ihr um, als hätte er ihren Blick in seinem Rücken gespürt. Sie wollte sich fortdrehen, aber ihr Körper gehorchte nicht. Wieder sahen sie einander an.
Endlich riss sich Maria von seinen Augen los. Nein! Sie wollte ihn nicht leiden können. Da bemerkte sie Anas verschmitzten Blick, was Maria noch mehr ärgerte. »Trinkt man im Reich des deutschen Kaisers noch immer Kaffee mit Sahne?«, wollte sie ein wenig schnippisch von dem Gast wissen.
»Ja, er ist dann bekömmlicher.«
Missbilligend schüttelte Maria den Kopf. »Nun, dann trinken Ihre Landsleute abscheulichen Kaffee, gemacht aus einer schlechten Bohne oder verbrannt bei der Röstung.«
»Ich selbst füge eine Prise Zucker in die Röstpfanne«, mischte Ana sich ein. »Sie nimmt dem Kaffee die Bitterkeit. So, wie die Liebe das Leben versüßt.« Schmunzelnd drehte sie den beiden ihren breiten Rücken zu.
Maria nahm einen Schluck aus ihrer Tasse, wobei sie die Augen schloss. »Es ist ein ungünstiger Zeitpunkt, eine Fazenda zu kaufen, Herr Behmer«, meinte sie leise.
»Warum denken Sie das, Senhorita?«
»Nun, noch sind unsere Sklaven trotz des Goldenen Gesetzes bei uns. Sie lieben meinen Vater, denn er behandelt sie gut. Obwohl sie frei sein könnten, bleiben sie. Ein neuer Besitzer aber … Wer weiß? Ohne unsere Leute werden Sie nicht ernten können, Herr Behmer. Die eingereisten Italiener auf den Fazendas sind teuer, und sie sind bei Weitem nicht so versiert im Umgang mit den Sträuchern. Außerdem steigt der Preis für brasilianischen Rohkaffee stetig. Die Kaffeehändler in Hamburg, Amsterdam und New York werden darum wohl auf Kaffee aus Guatemala ausweichen.« Sie sah ihn an.
»Sie möchten mir die Fazenda tatsächlich ausreden, Maria?«
Er schien es zu bedauern. Das verwirrte Maria. Sie schluckte. »Sie sollten nicht in etwas investieren, das heute vielversprechend aussieht, aber schon morgen Verluste einbringen wird. Außerdem ist unser Vorarbeiter Felipe ein unfähiger Dummkopf.« Bisher hatte Maria stets verhindern können, dass der Kaufmann mit dem Vorarbeiter redete. Sie gedachte, die Zügel in der Hand zu behalten. Mit einem Lächeln erhob sie sich von der Bank. »Ohne die Anweisungen meines Vaters könnte er niemals die Fazenda leiten. Jemand muss ihm sagen, was er zu tun hat, sonst setzt er sich in den Schatten eines Baumes und verschläft den Tag. Einem Kaufmann aus Hamburg wird Felipe auf der Nase herumtanzen. Es wird wirklich Zeit, dass mein Vater wieder gesund wird. Bis dahin behalte ich unsere Plantage und Felipe im Auge.«
Als sie dicht an Johann vorbeiging, um die Küche zu verlassen, ergriff er ihre Hand und sah zu ihr hoch. Maria zuckte unter seiner Berührung zusammen. »Hat Ihr Vater es Ihnen denn nicht gesagt?«, wollte er leise wissen.
»Was soll er mir gesagt haben?« Sie hörte die Angst in ihrer eigenen Stimme. Eine Ahnung, die seit Monaten wie eine Schlange um sie herumkroch, war wieder da und legte sich um ihren Hals.
»Ihr Vater ist todkrank. Darum muss er verkaufen.«
Die Worte hingen im Raum wie der schwüle Nebel über dem Wald, wenn sich der Monsun ankündigt. Maria starrte den Mann vor sich an, wollte widersprechen, wollte ihn anschreien, ihm sagen, dass er lügt. Dann aber sah sie zu Ana, die traurig nickte. Alle schienen es gewusst zu haben, nur sie, die Tochter, nicht! Maria riss ihre Hand fort. »Nein!«, rief sie und rannte aus der Küche. »Er wird mich nicht verlassen!«
*
Die Tage vergingen, und Johann Behmer unterzog das Anwesen und die Bücher einer strengen Prüfung. Tief über die Kontobücher gebeugt, saß er am letzten Abend seines Besuches am offenen Fenster. Die Karaffe mit dem Portwein war bereits halb leer. Es stand nicht so gut um den Besitz der da Silvas, wie Marias Vater glaubte. Die Plantage war eine der kleineren in der Gegend, umgeben von anderen Fazendas, sodass die Anbauflächen wohl nicht wesentlich erweitert werden konnten. Die Maschinen waren alt und die Wirtschaftsgebäude zu klein. Hinzu kam ein gewisser Schlendrian, den der Vorarbeiter zu verantworten hatte. Gerade bei diesem Felipe teilte Johann Marias Einschätzung. Der Kerl gab sich allzu eifrig, wenn Johann in der Nähe war. Ein wahrer Kratzfuß. Kein Mann, dem man vertrauen konnte. Er würde ihn auswechseln müssen.
Sicherlich tat Maria ihr Bestes, um den Vater zu vertreten, den Kaffee rechtzeitig ernten und trocknen zu lassen, um ihn auf dem Markt in Vassouras zu den Händlern zu bringen, aber es reichte nicht. Wenn Behmer & Söhne all das kaufen sollte, müsste erst einmal investiert werden. Johann seufzte.
Zum hundertsten Mal schob sich Marias Gestalt in seine Gedanken. Er hatte sie seit dem Vorfall in der Küche nicht mehr gesehen. Das Gefühl, sie ginge ihm aus dem Weg, schmerzte ihn. Er hoffte sehr, Maria vor seiner Abreise noch einmal zu begegnen. Sie war eine bemerkenswerte junge Frau. Ganz anders als jene in den Salons zu Hause. Er legte den Schreiber zur Seite, streckte seinen schmerzenden Rücken und blickte aus dem offenen Fenster zu einem samtschwarzen Himmel hinauf.
Millionen Sterne funkelten dort oben. Der volle Mond warf scharfe Schatten auf den Platz vor dem Haus. Johann beschloss, für heute Aktiva und Passiva in Ruhe zu lassen. Mit dem Glas in der Hand ging er auf die Veranda hinaus. Morgen würde er zurück nach Vassouras reiten und mit Pinheiro sprechen. Der Kauf der Fazenda war ein Risiko. Und er musste allein entscheiden, ob der mögliche Gewinn größer als die Kehrseite der Medaille war. Immerhin wäre das Traditionshaus Behmer & Söhne dann nicht nur Kaffeehändler, sondern auch Produzent. Alle Kosten für den Zwischenhandel würden entfallen. Johann nippte am Portwein. Ohne Risiko kein Gewinn.
Er lauschte in die Nacht hinein. Eigentümliche Laute kamen vom Urwald herüber. Grillen zirpten nahe dem Haus. Irgendwo kreischte ein Vogel. Die Kaiserpalmen hoben sich als Schatten gegen das strahlende Mondlicht ab. Dieser Ort schien Johann so friedvoll. Er überlegte, ob er noch bleiben könnte. Doch er wusste, er hatte seine Abreise schon jetzt unnötig verschoben.
Da hörte er einen Schrei. Johann wusste sofort, dass es Maria war. Das Glas in seiner Hand fiel zu Boden. Er rannte, ohne Schuhe an den Füßen, in die Richtung, aus der der Schrei gekommen war.
Als er die Ställe erreicht hatte, hörte er Marias wütende Stimme durch das unruhige Wiehern der Pferde. »Nimm deine dreckigen Hände von mir!«
Johann riss die Tür auf. Im Licht einer Petroleumlampe sah er Maria, die sich einen Kerl mit der Gerte vom Leib zu halten versuchte. Felipe hatte sie in eine Ecke gedrängt. Johann stürzte sich auf ihn, riss ihn herum, schlug mit der Faust in das überraschte Gesicht des Vorarbeiters. Er hatte leichtes Spiel, denn der Mann war schwer betrunken. In der einen Hand hielt der Kerl noch eine fast leere Flasche Cachaça. Fluchend versuchte Felipe, sich gegen die mächtigen Tritte zu wehren, mit denen Johann ihn hinausbeförderte.
Auf dem Platz vor dem Haupthaus fiel der Vorarbeiter schwankend zu Boden. Wütend riss Johann ihn am Hemd wieder auf die Füße. »Verschwinde von hier! Lass dich bloß nie mehr blicken!«, zischte er dem Kerl ins Gesicht. »Sollte ich deine Visage noch einmal sehen, erschieße ich dich!«
Felipe lachte nur. Dann torkelte er davon.
Johann spürte, wie er am ganzen Leib zitterte. Er knetete seine Hände. Noch nie hatte er sich so gehen lassen. Niemals hatte er einen Menschen geschlagen. Nicht einmal einen Hund. Was war nur in ihn gefahren?
Als er sich zum Haus drehte, sah er Ana auf der Veranda stehen. »Er wird wiederkommen«, rief sie ihm düster zu. Harte Züge lagen um ihren Mund. »Sobald Sie fort sind, Senhor, wird er zurückkommen. Und er wird sich Maria nehmen, bevor die Fazenda verkauft worden ist. Dann wird er sie heiraten und Herr auf der Santo Antônio sein.«
»Heiraten?« Johann sah sie fragend an.
»Ja, so machen das manche Männer hier. Sie entehren die Mädchen, damit diese für alle …«, sie suchte ein Wort, »hässlich geworden sind. Dann nehmen sie die armen gebrochenen Dinger zur Frau, weil die Mädchen wissen, dass nur so ihre Ehre wiederhergestellt werden kann. Ist es nicht überall so?«
Entsetzt sah Johann zu Maria hinüber, die in diesem Moment aus dem Stall kam. Sie hatte ihr Haar gerichtet und versuchte, so würdevoll wie möglich zum Haupthaus zu gelangen. Johann eilte ihr entgegen. Er legte seine Hand auf ihren Arm. »Heiraten Sie mich, Maria.«
Erschrocken wich sie zurück, als hätte er sie geschlagen. »Warum sollte ich das tun?« Sie drückte den Rücken durch, hob das Kinn, doch er sah die Angst in ihren Augen lodern. »Ich sage Ihnen, warum Sie mich heiraten wollen, Herr Behmer: Sie wollen die Fazenda als Mitgift. So wie alle anderen.« Ihr Ton hatte etwas Schneidendes. »Das wäre ein sehr gutes Geschäft für Behmer & Söhne.«
Johann zuckte zusammen. »So ein Unsinn!«, rief er.
»Es geht doch stets nur um Geld.«
In seinem Kopf geriet alles durcheinander. Er wollte ihr widersprechen, sagen, dass er nur hatte helfen wollen. Doch er musste zugeben, dass sein überstürzter Antrag mehr war als das. Etwas anderes hatte ihn zu diesem ungewohnten Ausbruch von Gefühlen getrieben. Und anders, als Maria vermutete, war der Grund nicht Geld gewesen.
»Ich werde meine Heimat niemals verlassen, Herr Behmer. Niemals.« Maria eilte an ihm vorbei, zurück ins Haupthaus, wo Ana auf der Veranda die Szenerie aufmerksam beobachtet hatte.
Hilflos blickte Johann Maria nach. Wie hatte er ihr in dieser Situation nur einen Heiratsantrag machen können? Sie musste ihn für einen plumpen Bauerntölpel halten. Er hätte sich ohrfeigen können.
Maria rannte in den dunklen Salon und warf die Tür hinter sich zu. Bebend lief sie auf und ab, viel zu erregt, um einen klaren Gedanken fassen zu können. Der Mond schien durch die Fenster, tauchte alles in ein kaltes Licht. Sie nahm ein Streichholz, um die Kerzen auf dem Tisch anzuzünden, doch ihre Hand zitterte. Nach dem dritten vergeblichen Versuch stampfte sie mit dem Fuß auf und warf das Holz zu Boden. Da klopfte es leise an der Tür. Erschrocken fuhr Maria herum, befürchtete sie doch für einen Moment, Felipe könnte zurückgekommen sein. Oder der Gast.
»Maria?« Es war Anas dunkle, warme Stimme, die leise zu ihr drang. Erleichtert riss Maria die Tür auf und zog die Köchin schnell zu sich herein. Dort fiel sie der Vertrauten weinend um den Hals. »Ich hatte entsetzliche Angst«, wimmerte sie immer wieder, während Ana beruhigend ihren Rücken streichelte.
»Ist ja gut, Kleines. Es wird vergehen.« Geduldig wartete die Köchin, bis Marias Tränen trockneten.
»Was soll ich nur tun? Ich kann nicht bleiben, wenn Vater mich auch noch verlässt, so wie meine Mutter damals.« Maria konnte nicht weitersprechen. »Ich will nicht irgendeinen Mann heiraten, nur weil er die Fazenda haben will oder weil er sich meiner erbarmt.« Marias Zittern begann von Neuem. Schnell nahm die Köchin sie wieder in den Arm.
»Ich weiß, dass der Herrgott viel von dir verlangt, Kleines. Aber er hat dich mit Klugheit gesegnet. Nutze sie.«
Maria sah die Köchin lange an und versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen. »Ich könnte in ein Kloster gehen, oder?«
Ana lachte auf. Und Maria lachte mit, denn hinter Klostermauern sah sie sich wahrlich nicht, obwohl sie dort vor aufdringlichen Männern sicher wäre. »Ich könnte einen der Söhne von …«
»Nein, Maria, du hast alle abgelehnt, als sie dich heiraten wollten. Die Alten wie die Jungen. Keiner von ihnen wird dich mehr haben wollen. Sie sind zu stolz. Jetzt warten sie wie die Geier darauf, dass die Plantage für eine Handvoll Milreis zu haben sein wird. Keiner muss dich mehr heiraten.«
Wieder begann Maria, im Salon auf und ab zu gehen. Sie knetete ihre kalten Hände. »Und wenn ich die Plantage leite?«
»Mädchen, wie lange, denkst du, könntest du gegen die anderen Plantagenbesitzer bestehen? Für sie bist du nicht mehr als ein verletztes Tapirjunges. Sie werden dich zerfleischen und die Santo Antônio unter sich aufteilen.«
Maria ging schneller. »Ich weiß, ich weiß …« Im Vorbeigehen ergriff sie ein Buch und warf es schmetternd zu Boden. »Verdammt! …«
»Du sollst nicht fluchen!«, rief Ana sie scharf zur Ordnung.
»Aber ich kann diesen Deutschen unmöglich heiraten. Er liebt mich nicht! Er will nur die Fazenda.« Maria nahm ihren Weg wieder auf, doch dieses Mal war es nicht die Wut, die sie antrieb, sondern der Kampf mit einer Entscheidung, die es zu treffen galt. »Wenn ich seinen Antrag annehme, muss ich fortgehen. Ich muss mein Zuhause verlassen, um in ein kaltes Land zu ziehen.« Sie ging zu Ana. »Ich müsste dich verlassen, Ana.«
»Meine Kleine«, sagte die Köchin und nahm sie in den Arm. »Die Dinge ändern sich. Noch hast du die Möglichkeit zu entscheiden, welche Richtung deine Zukunft nehmen soll. Ich hatte diese Möglichkeit nicht, als sie damals in mein Dorf kamen.«
Maria sah sie überrascht an. »Was redest du da?«
»Anders als du durfte ich mir mein Leben nicht aussuchen. Niemand fragte mich, ob ich in euer Land wollte. Sie nahmen mich einfach mit. Ich war noch ein halbes Kind. In dieser Nacht verlor ich meine Familie und mein Leben.«
Maria stolperte zurück. »Aber wir sind deine Familie!«
»Unser Dorf lag nahe einem Fluss mit dem Namen Oyo«, fuhr Ana unbeirrt fort. »Wären die Dinge anders gewesen, hätte ich bestimmt eigene Kinder gehabt, einen Herd, ein paar Hühner, eine Kuh, einen Ehemann … Sie nahmen mir sogar meinen Namen.«
»Was meinst du damit? Du heißt Ana Yoruba!«
»Nein, Kleines. Den Namen Ana gaben mir die Sklavenhändler. Und Yoruba ist der Name meines Volkes. Seit ich in dieses Land gebracht wurde, bin ich ohne Namen.«
Entsetzt hörte Maria die Worte, die ganz ohne Vorwurf gesprochen worden waren und dennoch ihr Herz schmerzten. In ihrem Kopf war ein schreckliches Durcheinander.
»Sagst du mir deinen Namen, Ana?«, fragte sie leise.
Die Köchin lächelte traurig. »Es ist zu lange her. Ich habe ihn vergessen.«
Jetzt war es an Maria, die alte Frau in ihre Arme zu schließen. »Es tut mir leid. Ich habe nie darüber nachgedacht, woher du gekommen bist. Seit ich geboren wurde, warst du einfach nur da.« Sie schluckte. »Ich bin ein schrecklich dummes und verwöhntes Ding.«
»Nein, meine Kleine, du bist jung.«
Die beiden Frauen sahen sich lange an, und Maria wusste, dass sich etwas verändert hatte. »Wirst du gehen, wenn Vater tot ist, Ana?«
»Ja. Ich werde mich auf die Suche nach den anderen aus meinem Dorf machen. Und vielleicht finde ich ja auch meinen Namen wieder.«
2
Atlantik-Hamburg, 1889
Die Corrientes legte an einem schwülwarmen Oktobertag von Rio de Janeiro ab. Bei sonnigem Wetter und mäßigem Wind erreichte der Dampfer schon bald Recife. Man nahm genügend Kohlen auf, um den Atlantik auf Höhe des Äquators zu queren. Da es sich bei der Corrientes um ein Frachtschiff handelte, waren außer Johann Behmer und seiner jungen Frau Maria kaum Passagiere an Bord, wohl aber tonnenweise Kaffee für Hamburg.
Nach dem höchst peinlichen Vorfall, als Johann sich zu dem unüberlegten Heiratsantrag hatte hinreißen lassen, war er gleich am nächsten Morgen abgereist. Es war ihm unmöglich gewesen, noch einmal unter Marias Augen zu treten, zumal er nicht gewusst hätte, welche Worte die richtigen gewesen wären.
Sieben schreckliche Tage und schlaflose Nächte hatte er in einem Hotelzimmer in Vassouras verbracht, ohne zu wissen, was er tun sollte. Vergeblich hatte Pinheiro versucht, ihm wegen des Kaufs der Plantage eine vernünftige Entscheidung abzuringen, doch Johann hatte sich zu nichts durchringen können. Die Plantage war ihm gänzlich unwichtig geworden. Stattdessen hatte er jede wache Minute an Maria gedacht.
Mehrmals griff er zu Papier und Stift, um ihr einen Brief zu schreiben. Doch dann saß er da, stundenlang, ohne auch nur eine Zeile zu verfassen. Dabei wollte er ihr all die Gründe nennen, warum sein Antrag in der einen Nacht zwar unerwartet gekommen war, aber dennoch folgerichtig. Im ersten Moment war es nur der Wunsch gewesen, sie vor Kerlen wie Felipe zu schützen. Dann aber begriff er, dass es noch andere Gründe gab, die weitaus wichtiger waren. Da war der sehnliche Wunsch, sie immer an seiner Seite zu wissen, ihr Haar berühren und küssen zu dürfen. Er wollte mit ihr für den Rest seines Lebens über Kaffee reden, tagein und tagaus, wollte alles mit ihr teilen, was seins war, denn erst mit ihr würde er wirklich reich sein. Er war so überzeugt wie noch nie in seinem Leben, dass sie seine Frau werden müsse, dass Marias klare Worte der Ablehnung ihn schmerzten. Das immer wieder aufflammende Bild jener Nacht, als sie ihn zurückwies, hatte Johann mal schamesrot, mal wütend werden lassen.
In ungebührlicher Weise hatte er in den Schenken von Vassouras dem Schnaps zugesprochen, was ihm gar nicht gut bekommen war. Pinheiro hatte sich Sorgen gemacht und gedroht, ein Telegramm nach Hamburg zu senden, wenn Johann nicht endlich zu Vernunft käme.
Dann, eines Morgens, war Johann zur Fazenda zurückgekehrt, wo er Maria ganz offiziell um ihre Hand bat. Ein letzter, hoffentlich würdevollerer Antrag, den die junge Dame sicherlich ein weiteres Mal ablehnen würde. Dennoch hatte Johann es wenigstens versuchen wollen.
Zu seiner Überraschung aber hatte Maria Ja gesagt. Er war glücklich! Und er hoffte, ihr Jawort möge aus dem Herzen gekommen und weniger dem Bedürfnis entsprungen sein, mit einer Heirat die Fazenda nicht zu verlieren.
Die Hochzeit hatte verhältnismäßig bescheiden in der Kapelle auf der Santo Antônio mit nur wenigen Gästen stattgefunden, denn der gesundheitliche Zustand des Brautvaters ließ eine große Feier nicht zu. Dennoch hatte der Coronel es sich nicht nehmen lassen, der jungen Braut am Abend vor der Trauung ein besonderes Geschenk zu machen. Es war ein Collier aus vierzig Perlen, von denen jede Einzelne in ein fein ziseliertes Silberblatt gebettet war, geschmückt mit einem Meer zarter Diamanten, die wie Sterne in der kleinen Familienkapelle geleuchtet hatten. Dieses Collier hätte dereinst Kaiser Dom Pedro II. dem Coronel zur Hochzeit mit Marias Mutter geschenkt, sagte da Silva. Und nun solle es in die nächste und übernächste Generation gehen.
Die Trauung, die Abreise, die Geschäfte, alles war so schnell an ihm und Maria vorbeigeflogen, dass beide sich erst an Bord der Corrientes kennenlernen konnten.
Johann erzählte Maria viel von Hamburg und ihrer neuen Familie. »Die Villa Behmer liegt ein wenig außerhalb der Stadt, in einem wunderschönen Park«, erklärte er an Deck, wo sie an einem runden Tischchen einen Mokka im Windschatten der Passagierkabinen zu sich nahmen. »Mein Vater ließ das Anwesen von Martin Haller fertigstellen. Dieser Haller ist ein famoser Architekt. Wenn du möchtest, lassen wir uns auch ein Haus von ihm bauen. Nicht so pompös wie die Villa Behmer, aber …«
»Lebt er noch?«
»Haller? Aber natürlich. Warum sollte er nicht …?«
»Ich meinte deinen Vater. Du sprichst so selten von ihm.« Johann nahm Marias Hand, an deren Ringfinger ein schlichter Goldring steckte. »Er starb vor einigen Jahren an einem Herzanfall.« Der Verlust eines geliebten Menschen mochte sich wie der eigene Tod anfühlen, doch im großen Weltengefüge war er, bei allem Schmerz, nichts Besonderes, das wusste Johann. »Meine Mutter lebt mit meinem Zwillingsbruder Alfons, dessen Frau und mir in der Villa. Alfons’ Gattin Gertrud ist eine echte Gräfin von Schmettau, ein schlesisches Adelsgeschlecht. Sie trauert dem verlorenen Grafentitel seit Jahren nach, denn mit ihrer Hochzeit verlor die Familie den Adelsstand endgültig. Es gab keinen lebenden männlichen Erben. Alfons und Gertrud haben eine kleine Tochter mit dem Namen Emma.«
»Was für ein Mensch ist dein Bruder?«, wollte Maria wissen. Johann grinste. Dann imitierte er Alfons, wie dieser brettsteif bei Tisch Platz nahm oder, wenn ein Witz erzählt wurde, ratlos bis verächtlich in die Runde der Lachenden zu schauen pflegte. »Aber ich kenne niemanden, der so virtuos mit Zahlen umgehen kann wie er«, fügte Johann ernst hinzu. »Ohne ihn wäre Behmer & Söhne nicht, was es heute ist. Er genießt den Respekt der Angestellten, ist ein guter Vater und treuer Ehemann. Und er ist mein Bruder. Wir sind zu gleichen Teilen an der Firma beteiligt.«
In Südwestafrika nahm die Corrientes erneut Kohle auf und folgte nun der Küstenlinie Richtung Norden bis nach Marokko. Die Zeit an Bord wurde für Maria, trotz eines heftigen Sturms vor Mauretanien, von Tag zu Tag angenehmer, ja, fast schon war sie geneigt zu sagen, dass sie glücklich war. Jeden Morgen wachte sie neben ihrem Ehemann auf und betrachtete ihn, während er noch schlief. Johann behandelte sie mit Respekt. Er schien sie sogar zu lieben. Besonders in den letzten Wochen auf der Fazenda hatte sich gezeigt, dass er gewillt war, sein Versprechen ihr gegenüber zu halten. Bei der Wahl eines Verwalters und eines neuen Vorarbeiters hatte er auf ihren Rat gehört. Sie war bei allen wichtigen Gesprächen in Vassouras dabei gewesen, wo die neuen Besitzverhältnisse von Notaren eingetragen und Preisverhandlungen geführt werden mussten. An den lauen Abenden hatten sie bei einem Glas Portwein auf der Veranda das Tagesgeschäft besprochen, und Johann hatte sie in die hanseatische Kunst von Aktiva und Passiva eingeweiht, die sich von der Buchhaltung einer brasilianischen Fazenda deutlich unterschied.
Ihrem Vater schien mit der Heirat seiner einzigen Tochter eine schwere Last von der Seele genommen zu sein, denn sein Gesundheitszustand besserte sich ein wenig. Als dann der Tag nahte, an dem das junge Paar die Fazenda Richtung Hamburg verließ, war Maria unendlich schwer ums Herz. Voller Tränen hatte sie sich von Ana und dem Coronel verabschiedet.
In den Armen ihres Vaters hatte Maria vergeblich versucht, nicht zu weinen. »Versprich mir, mein Kind«, hatte er gesagt, »dass du deine Heimat niemals vergessen wirst.«
»Bestimmt nicht«, hatte sie geschluchzt und versprochen, zurückzukommen.
Dann folgten die Tage an Bord. Es waren glückliche, und mit jedem neuen Sonnenaufgang war Maria sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Des Nachts aber, wenn ihr Mann bereits schlief, weinte sie sich vor Kummer um die verlorene Heimat leise in den Schlaf.
*
Tief in ihren Pelzmantel gehüllt, stand seine Ehefrau an der Reling und blickte auf das graue Elbwasser. »Ob deine Familie mich mögen wird?«, fragte Maria besorgt, als der Dampfer an diesem nebligen Morgen im November mit der Flut Richtung Hamburg einlief. Es roch nach Regen.
Johann hatte sich diese Frage in den letzten Tagen ebenfalls gestellt. Mit einem äußerst knappen Glückwunschtelegramm hatte Alfons auf die Hochzeit reagiert und sogleich nach der diesjährigen Ernte auf der Fazenda gefragt. Seine Mutter hingegen hatte ihnen einen warmherzigen Brief mit den besten Wünschen für die Zukunft geschrieben. Ihre Worte klangen eigentümlich endgültig, zumal Johann die kleinen Buchstaben, die unstete Linienführung und die fast schon abgehackt wirkenden Sätze auffielen.
Schweigend blickte er zum Elbufer hinüber, wo sich Fischerhütten in den steilen Hang schmiegten. Hier und da blitzten zwischen hohen Bäumen weiße Villen hervor. Kinder suchten am Ufer der Elbe Treibgut, das sie auf einen Handkarren luden und fortschafften.
Bald darauf zog das Schiff langsam an den Hafenanlagen vorbei. Hunderte Segelschiffe lagen an den Kaianlagen vor Anker. Ihre kahlen Masten stachen in den regengrauen Himmel. Das geschäftige Treiben, mit all den kleinen Dampfschiffen, die die Menschen von der einen Seite des breiten Flusses auf die andere brachten, verwirrte Maria. Kähne, die unter der Last der gestapelten Waren an Bord zu kentern drohten, wurden in Fleete gestakt, die wie Straßen zwischen hohen Backsteingebäuden entlangführten. Erst dachte Maria, diese roten Häuser seien Teil der Stadt, ähnlich wie in Venedig. Doch es schienen keine Behausungen für Menschen zu sein, sondern waren einzig dazu gedacht, Waren zu beherbergen. Maria konnte sehen, wie Männer ein Bündel Säcke an einem Seil an der Außenwand eines der roten Gebäude nach ganz oben hievten, wo andere Männer die Ware durch eine Luke hereinzogen.
»Das ist unsere neue Speicherstadt«, erklärte Johann. »Mein Vater war einer jener Kaufleute, die dafür kämpften, dass Hamburg einen Freihafen bekam.« Stolz schwang in seiner Stimme.
»Freihafen? Was ist das?«
»Dort lagern Waren von überall aus der Welt, werden bearbeitet und weiterverkauft, ohne dass dafür Zoll erhoben werden darf. Erst wenn die Gewürze, Felle, Tees und natürlich der Kaffee die Hafengrenze in die Stadt oder ins Kaiserreich passieren, wird Zoll für den Kaiser fällig.«
Maria sah Männer in grünen Uniformen, die am Kai zwischen Stapeln von Säcken umhergingen, Papiere prüften und streng dreinblickten. Das mussten die Männer vom Zoll sein.
»Und der dort?« Sie wies auf einen Mann mit einer schweren Lederschürze vor dem Bauch und einem Zylinder auf dem Kopf, der an einer offenen Luke stand und auf die nächste Hieve Säcke wartete.
»Das sind die Quartiersleute. Sie lagern die Waren im Auftrag der Kaufleute in den Speichern. Mit ihnen sollte es sich ein Kaufmann niemals verscherzen. Sie wissen alles und kennen jeden. Sie sind die ungekrönten Könige der Speicherstadt.«
»Ich dachte, ihr Hamburger beugt euer Knie nicht vor Königen und Kaisern.«
Johann lachte. »Bei den Quartiersleuten müssen wir ab und an eine Ausnahme machen, befürchte ich.«
Fasziniert betrachtete Maria das Treiben am Kai, während die Corrientes zum Anlegeplatz manövrierte. Sie hatte sich als Kind niemals Gedanken darüber gemacht, was mit all den Kaffeebohnen geschah, die die Arbeiter auf der Fazenda in Säcke schütteten und auf Eseln nach Vassouras brachten. Irgendwie hatte sie immer geglaubt, der Kaffee der Santo Antônio sei der Einzige auf der Welt. Wie sehr sie sich doch geirrt hatte. Am Kai lagen weitere Schiffe, aus deren Ladebäuchen säckeweise Partien mit Rohkaffee aus anderen Ländern gehievt wurden.
»Wie viele Säcke Kaffee liegen in den Speichern?«
Johann zuckte mit den Schultern. »Ich weiß es nicht. Sicherlich Tausende. Und es könnten noch mehr werden, denn die Speicherstadt ist noch nicht fertig gebaut.«
»Wo lagert der Kaffee von Behmer & Söhne?«
»Die meisten Händler lassen in Block O lagern. Wir aber haben einen Privatspeicher am St. Annenufer, nur einige Meter vom Sandtorkai entfernt. Wir sind die einzige Firma, die einen eigenen Speicher hat. Mein Vater ließ sich das vor Jahren vom Hamburger Senat zusichern, als Gegenleistung für mehrere Grundstücke auf der Kehrwieder-Insel, auf der die Speicherstadt gebaut wurde.«
»Ein weitsichtiger Mann. Ich hätte ihn gerne kennengelernt.«
Gemeinsam beobachteten sie das Anlegemanöver und lauschten auf die Geräusche des Hafens, das Schlagen und Hämmern der Werften auf der anderen Seite des Flusses, die unverständlichen Wortfetzen der Kaiarbeiter, das Schreien der Möwen.
»Dies ist mein Zuhause«, sagte Johann, ohne Maria anzusehen, als gerade ein Matrose vom Heck des Frachters einen dicken Tampen über Bord warf, den zwei Arbeiter am Kai auffingen, um das Schiff festzumachen. »Und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass es eines Tages auch deine Heimat sein wird.«
Kurz darauf verabschiedeten der brasilianische Kapitän und seine Mannschaft die Gäste an Deck. Maria wurde klar, dass sie gerade für lange Zeit das letzte Mal ihre Heimatsprache gehört hatte. Wieder überfiel sie Wehmut, wie so oft in den letzten Tagen. Doch dieses Mal ließ sie das Gefühl nicht gewähren.
»Johann«, sagte sie, als ihre Füße zum ersten Mal Hamburger Boden betraten, »bitte zeige mir, wo Behmer & Söhne meinen Kaffee lagert.« Suchend glitt ihr Blick an der Fassade der Speicher entlang. Da die Kutsche, die sie abholen sollte, noch nicht am Kai war, willigte Johann ein. Er führte sie durch die Menge der Kaiarbeiter, entlang der Backsteinfront der Speicher, vor denen Pferdekarren standen. Aus Luken wurden Säcke abgesenkt und verladen. Männer schleppten Kisten, und Quartiersleute mit Bleistift hinter dem Ohr mahnten zur Eile, während Herren in Gehrock und Zylinder vorbeiliefen, um Proben von einem Kontor ins nächste zu bringen. Jeder von ihnen warf der Frau an Johanns Seite verstohlen einen neugierigen Blick zu.
Da entdeckte Maria ein mit Giebeln und bunten Ornamenten aus glasiertem Stein verziertes Gebäude. Es war das Einzige, auf dessen Fassade goldfarbene Buchstaben prangten: »Behmer & Söhne von 1839«. Energisch bahnte sie sich einen Weg zu dem kleinen Eingang, wo gerade eine Partie Kaffeesäcke an einem eisernen Haken bis in die oberste Etage gehievt wurde.
In diesem Moment fuhr eine schwarz lackierte Kutsche um die Ecke. Neben dem Kutscher saß ein Mann im dunklen Wollmantel und mit einer Melone auf dem Kopf. Er kletterte eilig herunter, nahm den Hut ab und verbeugte sich. »Herr Behmer, willkommen zurück.«
»Jennings!«, rief Johann freudig. »Wie schön, Sie zu sehen.« Er stellte Maria den Mann als den treuen Butler der Familie vor. Formvollendet verbeugte sich Jennings vor Maria. Dann wandte er sich wieder Johann zu.
»Ihr Herr Bruder lässt Sie bitten, umgehend in die Villa zu kommen.« Seine Stimme hatte etwas Dringliches.
Sofort wich Johanns Wiedersehensfreude einem besorgten Gesichtsausdruck. »Was ist passiert, Jennings?«
»Ihre Mutter, Herr Behmer«, sagte der Butler kaum hörbar.
So schnell wie möglich bahnte sich die Kutsche einen Weg aus der Speicherstadt, hinaus in die Stadt. Sie passierten die alten Wallanlagen der Stadt, die einem hübschen Park glichen. Ab hier konnte der Kutscher die Pferde antreiben, und die Fahrt ging schneller voran.
Je weiter sie fuhren, umso verstreuter lagen die Häuser. Maria entdeckte elegante Bürgerhäuser hinter hohen Staketenzäunen und Rhododendronbüschen. Ab und an passierten sie windschiefe Katen und Bauerngehöfte. Sie durchfuhren ein kleines Dorf, wo eine Herde Schweine ihre Reise abrupt behinderte. Während der Kutscher dem Hirten ein paar gepfefferte Worte entgegenwarf, deren Sinn Maria nur erahnen konnte, befragte Johann den Butler über die Dinge, die in seiner Abwesenheit geschehen waren. Stirnrunzelnd blickte Maria aus dem Fenster und wunderte sich, warum Johann nicht seinen Bruder fragen wollte, den er doch sicherlich gleich sehen würde.
Bald darauf verließ die Kutsche die Straße und rollte durch ein hohes Tor, hinter dem eine Allee mit kahlen Ahornbäumen begann. Am Ende der Allee erhob sich stolz die Villa Behmer. Überrascht von der Größe und Pracht, beugte sich Maria aus dem Fenster. »Das ist ja ein Schloss.«
Johann lächelte. »Du hast recht, es ist ein wenig übertrieben.« Er seufzte. »Ich verspreche aber, es ist das einzige Mal gewesen, dass mein Vater seinen Erfolg zur Schau stellte. Eigentlich war er durch und durch Hanseat. Und ein Hanseat prahlt nicht mit seinem Reichtum. Dennoch, so sagte er mir einmal, ist es manchmal wichtig, dass die Geschäftspartner wissen, mit wem sie es zu tun haben.«
Der weiße Bau verfügte über ein Haupthaus mit kupfernem Mansardendach, auf dessen Spitze eine lebensgroße Frauenfigur Richtung Elbe wies. Ein zweistöckiger Erker mit Säulen schaute über eine weite Rasenfläche, die sich bis zu dem Wald erstreckte, aus dem sie soeben fuhren. Links und rechts des Hauses ging je ein Flügel mit hohen Fenstern ab, an dessen einem Ende ein Wintergarten lag. Auf einem trutzigen Turm, der mit einer kleinen Balustrade gekrönt war, flatterte eine Fahne.
Noch immer berauscht von dem Anblick, ließ Maria sich von Johann aus der Kutsche helfen. Ein gläsernes Dach über dem Windfang sorgte dafür, dass man jederzeit trockenen Fußes ins Haus gelangte. Maria bemerkte noch das Wappen der Familie über der aufwendig geschnitzten Eichentür: ein Kaffeezweig, ein Löwe und ein Schiff.
Sie traten in die Eingangshalle, die mit ihrer hohen Decke und den sechs griechisch anmutenden Säulen dem Palast eines Fürsten in nichts nachstand. Zwischen den Säulen hatte man Büsten irgendwelcher alter Männer auf Marmorpfeiler gestellt, die ebenso wie die Dienerschaft neugierig die Ankömmlinge betrachteten.
Man nahm Maria und Johann die Reisemäntel ab. Dann stellte Jennings das Personal, von der Köchin, dem ersten und zweiten Dienstmädchen bis hin zum Gärtner und den Stallburschen, vor. Bei einer hageren Frau blieb er stehen. »Das ist Franzi. Ihre Zofe.«
Die Frau im einfachen schwarzen Kleid mit hochgeschlossenem Kragen knickste vor Maria. Verwirrt blickte Maria zu ihrem Mann. Sie hatte nicht mit einer eigenen Bediensteten gerechnet und wusste auch nicht, was sie mit einer Zofe anfangen sollte. Sie hatte immer gedacht, dass Zofen das Privileg der Königshäuser und des Hochadels seien. Schon wollte Maria widersprechen, sagen, dass beim Ankleiden doch sicherlich auch eines der Dienstmädchen helfen könnte, doch sie schwieg. Stattdessen lächelte sie die ernste Person unbestimmt an.
Johann indes eilte einem Herrn im schwarzen Anzug entgegen, der gerade aus dem Salon in die Halle trat. »Alfons!«
»Gut, dass du endlich da bist, Johann.«
Die Brüder umarmten sich. Auch Alfons hatte erste graue Strähnen in seinem Haar, das jedoch weitaus schütterer war als jenes von Johann. Um den Bauch herum war er runder als sein Bruder. Den üppigen Vollbart trug er in kaiserlicher Manier. Der Binder saß fest um seinen Hals. Die gestreifte Hose hatte eine exakte Bügelfalte.
Nun wandte sich Alfons Behmer Maria zu. »Schwägerin.« Mit etwas eckiger Geste deutete er einen Handkuss an. »Ich begrüße dich in deiner neuen Familie und deinem neuen Heim. Es wird Zeit, dass wir uns kennenlernen.« Er drehte sich zu einer eleganten Dame, die nach ihm aus dem Salon getreten war. Sie trug ein mitternachtsblaues Seidenkleid mit einer feinen Brüsseler Spitze als Kragen. Die linke Hand ruhte auf ihrem gewölbten Bauch.
»Gertrud!«, rief Johann aus und eilte auf sie zu. »Ich wusste ja gar nicht, dass du … Mein Gott, war ich wirklich so lange fort? Herzlichen Glückwunsch! Dann bekommt meine kleine Nichte Emma also ein Geschwisterchen. Wunderbar!« Johann wandte sich an Maria. »Das ist meine Schwägerin Gertrud, eine echte Gräfin von Schmettau.«
Nur knapp konnte Maria einen Knicks unterdrücken, als die Frau trotz ihres Bauches in königlicher Anmut auf sie zuschwebte.
Gertrud Behmer musterte Maria, wie man eine Zuchtstute begutachtete oder ein neues Möbelstück. Dann hauchte sie ihr einen Kuss auf die Wange. »Meine Liebe. Wie schön, dass Johann dich uns endlich vorstellt. Eure Rückkehr könnte kaum unter einem unglücklicheren Stern stehen.«
Maria wusste nicht, was sie sagen sollte, schließlich war es nicht ihre Schuld, dass Johanns Mutter krank geworden war. Gertrud Behmer nahm Marias Hand in ihre. Die Finger der Schwägerin waren warm und weich wie Samt. Sie lächelte Maria lange an, als müsse sie überlegen. »Franzi«, sagte sie plötzlich. Marias Zofe trat vor und machte einen Knicks.
»Jawohl, Frau Gräfin.«
»Richten Sie für meine Schwägerin ein Bad. Sie wird sich nach der langen Reise frisch machen wollen.«
Maria wollte dankend ablehnen, aber Gertrud schob sie zur Marmortreppe hinüber, deren Stufen mit einem blauen Teppich ausgelegt waren. »Glaube mir, meine Liebe, es ist besser so.«
Gertruds eisiger Blick traf Maria unvorbereitet. Im selben Moment aber begriff sie, was Gertrud Behmer vor aller Ohren unmissverständlich andeutete: Die Wilde aus dem Urwald solle erst einmal gesäubert werden, bevor man sie empfangen könne.
Maria drehte sich um, in der Hoffnung, ihr Mann würde ein Wort dazu sagen, doch Johann verschwand soeben mit seinem Bruder im Salon. Weder hatte er den Affront noch das selbstgefällige Lächeln der Schwägerin bemerkt. Wütend sah Maria der Frau nach, wie sie den Männern in den Salon folgte. Mittlerweile hatte auch die Dienerschaft lautlos die Halle verlassen, um zur Arbeit zurückzukehren. Einzig Franzi stand mit gefalteten Händen da und wartete.
»Wenn ich Ihnen Ihre Räume zeigen dürfte, Frau Behmer …« Sie nahm die Stufen in die erste Etage hinauf, und Maria folgte ihr. Nie zuvor hatte sie sich so elend gefühlt.
*
Die Brüder standen am Fenster des Salons und blickten hinaus in den Park. Es hatte zu regnen begonnen. »Du warst sehr lange fort, Johann«, begann Alfons in einem leicht vorwurfsvollen Ton. »Mutter hat oft nach dir gefragt.« Dicke Regentropfen schlugen an die Fensterscheibe. »Der Arzt meinte, es könne sich nur noch um wenige Tage handeln«, fuhr Alfons fort. »Er ist gerade bei ihr.«
Die Standuhr in der Ecke tickte laut. Sekunde um Sekunde kam der Tod näher zum Haus. Johann meinte, die Gestalt des Schnitters unter den Bäumen bereits entdeckt zu haben, der kam, um sich seinen Zoll zu holen.
»Ich habe Heise angewiesen, die Korrespondenz vom Kontor hierherzubringen«, fuhr Alfons leise fort. »Nicht, dass es von Bedeutung wäre, aber es hilft mir, wenn ich mich ablenken kann.«
Johann nickte halb abwesend. »Ihr habt den neuen Speicher bezogen, wie ich sehen konnte. Die goldenen Buchstaben machen was her.«
»Ja, Vater wäre stolz gewesen. Ich musste sieben Leute allein für den Speicher neu einstellen. Auf der anderen Seite vom Zollkanal habe ich im Dovenhof ein neues Kontor angemietet. Es sind nur zehn Minuten Fußweg bis zum Sandtorkai.«
»Im Dovenhof? Der Ohlendorff nimmt doch bestimmt gepfefferte Mieten.« Es gefiel Johann nicht, dass sein Bruder all das ohne ihn entschieden hatte. »Wir hätten das besprechen sollen.«
»Warum sollte ich? Du bist Monate in Brasilien geblieben, ohne mir mitzuteilen, was du planst. Und dann heiratest du, wen du willst, ohne es mit der Familie zu bereden. Irgendjemand musste sich ja um die Firma kümmern.«
Im Hintergrund saß Gertrud auf dem Chintzsofa beim Kamin und blätterte abwesend in der Gartenlaube auf ihrem Schoß. Leise gab sie dem Butler Anweisung, ein paar Gurkensandwiches in der Küche bereiten zu lassen. »Ich denke, keiner von uns hat heute Appetit auf eine Mahlzeit«, raunte sie ihm zu. Geräuschlos verließ Jennings den Raum.
Alfons legte die Hände auf den Rücken. »Ich weiß nicht, wen du in unser Haus gebracht hast, Johann, aber es wäre das Mindeste gewesen, diesen Schritt mit mir abzusprechen. Du weißt, wie sehr Mutter gehofft hat, du könntest dich endlich für eine standesgemäße Partie …«
»Nicht, dass es für mich wichtig wäre, aber meine Heirat mit Maria wird uns nützlicher sein als eine Ehe mit irgendeiner übrig gebliebenen Hamburger Kaufmannstochter«, entgegnete Johann scharf. »Ich werde jetzt zu Mutter hinaufgehen.«
Gertrud sah von ihrer Illustrierten auf. »Aber der Arzt ist bei ihr!«, rief sie ihm nach, als er auch schon in die Halle hinauseilte, um zu den Gemächern von Amalie Behmer im ersten Stock zu gelangen.
»Nun, was hältst du von ihr?«, wollte Gertrud von ihrem Mann wissen, nachdem die Salontür zugefallen war und Johann außer Hörweite. Sie legte Die Gartenlaube auf den kleinen Beistelltisch neben dem Sofa. Dann strichen ihre Hände über den Stoff ihres Kleides. »Sie ist recht hübsch, findest du nicht?«
Alfons trat zur Anrichte und goss sich ein Glas Cognac aus einer Karaffe ein. »Er hat uns die Plantage eingebracht. Und zudem ist er endlich verheiratet. Das Geschwätz im Club über seine Ehelosigkeit ging mir schon lange auf die Nerven.«