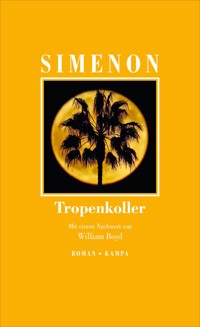
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Georges Simenon
- Sprache: Deutsch
Der 23-jährige Joseph Timar soll für eine französische Handelsgesellschaft in Gabun arbeiten. Kaum in Libreville angekommen, erfährt er, dass es dort keine Arbeit für ihn gibt. Die Hitze, die aus dem Boden, aus den Mauern, aus allen Dingen zu dringen scheint, die gleißende Sonne, die keine Jalousie aussperren kann, die Moskitos, die niemals schlafen ...Und es gibt nichts zu tun, als zu trinken und Billard zu spielen - und eine Affäre zu beginnen, mit Adèle, der verheirateten Wirtin des Hotels Central, die in ihrem schwarzen Seidenkleid auf Joseph gewartet zu haben scheint wie eine Spinne auf ihre Beute. Dann wird der Hotelboy ermordet, und bald darauf stirbt auch Adèles Mann. Joseph hat einen schrecklichen Verdacht. Aber er kommt nicht los von Adèle: Es ist wie das Fieber, das ihn immer wieder überkommt. Als sich für Joseph eine vielversprechende Verdienstmöglichkeit im Landesinneren auftut, verkauft Adèle kurzerhand ihr Hotel und begleitet ihn. Beginnt für die beiden nun ein neues Leben? Vor allem aber: Kann Joseph seiner Geliebten wirklich trauen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Band 4
Georges Simenon
Tropenkoller
Roman
Mit einem Nachwort von William Boyd
Aus dem Französischen von Hansjürgen Wille, Barbara Klau und Ulrike Ostermeyer
Kampa
1
Bestand denn irgendein Grund zur Beunruhigung? Nein. Nichts Ungewöhnliches war geschehen. Er musste sich nicht bedroht fühlen. Es wäre lachhaft, jetzt die Ruhe zu verlieren, das war ihm selbst klar, weshalb er schon jetzt, während der Feier, dagegen anzugehen versuchte.
Im Übrigen war es keine Unruhe im eigentlichen Sinn. Er hätte auch gar nicht sagen können, wann genau ihn die Beklommenheit gepackt hatte, dieses Unbehagen, das durch ein kaum merkliches Ungleichgewicht hervorgerufen wurde.
Jedenfalls nicht in dem Augenblick, da er Europa verließ. Im Gegenteil, Joseph Timar war beherzt und glühend vor Begeisterung aufgebrochen.
Bei der Landung in Libreville, seiner ersten Berührung mit Gabun? Das Schiff hatte auf der Reede geankert, so weit draußen, dass vom Festland nur eine weiße Linie zu sehen war, der Strand, über dem sich der Wald als ein dunkler Streifen hinzog. Große graue Wellen hoben das kleine Boot und ließen es immer wieder gegen den Rumpf des Dampfers stoßen. Timar stand allein unten am Fallreep, das Wasser zu seinen Füßen, und lauerte auf das Boot, das für eine Sekunde nah herankam, ehe es wieder forttrieb.
Ein nackter Arm, der Arm eines Schwarzen, hatte ihn ergriffen, und dann waren er und der Schwarze über die Wellenkämme davongesprungen. Später, vielleicht eine Viertelstunde oder mehr, als vom Dampfer schon die Signale ertönten, legten sie an einer Mole aus übereinandergeworfenen Betonwürfeln an.
Dort war niemand, nicht einmal ein Schwarzer. Niemand erwartete jemanden. Einzig Timar stand dort, inmitten seiner Koffer!
Aber auch in diesem Augenblick hatte ihn die Unruhe nicht gepackt. Er hatte sich zu helfen gewusst. Er hatte einem vorüberfahrenden Lastwagen gewinkt, und der hatte ihn ins Central, das einzige Hotel von Libreville, gebracht.
Und wie schön war das gewesen! So pittoresk. Und typisch afrikanisch! In dem Lokal, dessen Wände mit afrikanischen Masken geschmückt waren, setzte er ein Grammophon mit Schalltrichter in Gang, während der Boy ihm einen Whisky einschenkte, und kam sich vor wie ein Kolonist.
Was den Zwischenfall anging, so war der mehr komisch als dramatisch gewesen. Und so typisch für die Kolonien! Timar war begeistert von allem, was eine koloniale Prägung hatte.
Einem seiner Onkel war es zu verdanken, dass man ihn bei der Sacova engagiert hatte. Der Vertreter der Gesellschaft in Frankreich hatte ihm angekündigt, er würde mitten im Wald leben, irgendwo in der Nähe von Libreville, Holz fällen und den Einheimischen allerlei Krimskrams verkaufen.
Kaum an Land, war Timar in eine kümmerliche Faktorei gestürzt, über der das Wort Sacova prangte. Mit ausgestreckter Hand war er auf einen Mann mit melancholischer oder angewiderter Miene zugegangen, der diese Hand angesehen, aber nicht ergriffen hatte.
»Sind Sie der Direktor? … Sehr erfreut. Ich bin der neue Angestellte.«
»Angestellt von wem, wofür? Was wollen Sie hier tun? Ich brauche keinen Angestellten!«
Timar war nicht zurückgezuckt. Das hatte den Direktor erstaunt. Mit seinen durch die Brillengläser riesig wirkenden Augen hatte er ihn forschend angeblickt und war fast höflich, ja, im Ton sogar geradezu vertraulich geworden.
»Immer wieder die alte Geschichte! Die Büros in Frankreich, die sich in die Leitung der kolonialen Angelegenheiten einmischen!« Man hatte Timar den Posten versprochen? Nun, dorthin dauerte es zehn Tage mit der Pinasse, ganz den Fluss hinauf. Aber erstens war die Pinasse leck und würde erst in einem Monat wieder fahrbereit sein. Zweitens besetzte ein verrückter Alter den Posten und wollte jeden erschießen, der käme, um ihn abzulösen.
»Sehen Sie zu, wie Sie zurechtkommen. Ich habe damit nichts zu tun.«
Vier Tage waren seitdem vergangen, vier Tage war Joseph Timar jetzt in Afrika. Er kannte Libreville schon besser als La Rochelle, wo er geboren war: ein langer, von Kokospalmen gesäumter Quai aus rotem Schotter, der an dem unter freiem Himmel liegenden Markt der Einheimischen entlangführte, alle hundert Meter gab es eine Faktorei, und abseits davon standen einige Villen, im Grün versteckt.
Er hatte sich die beschädigte Pinasse angesehen. Niemand arbeitete daran. Niemand hatte jemanden dazu beauftragt. Er wagte es nicht, selbst den Auftrag zu erteilen, er, Timar, der Neuankömmling, der in gewisser Weise überzählig war.
Er war dreiundzwanzig Jahre alt. Über seine Wohlerzogenheit und guten Manieren lachten selbst die Boys, die ihn bei Tisch bedienten.
Kein Grund zur Beunruhigung? O doch! Er kannte den Grund, und wenn er in Gedanken all die falschen Gründe aufzählte, dann nur, um den Augenblick hinauszuzögern, da er bei dem wahren Grund anlangte.
Der Grund war da, diffus verstreut um ihn herum und im Hotel. Er war das Hotel selbst. Er war …
Er war hingerissen gewesen vom äußeren Anblick des Central. Ein gelbes Gebäude, etwa fünfzig Meter hinter den Kokospalmen landeinwärts, inmitten eines Gewirrs merkwürdiger Pflanzen.
Der große Raum, zugleich Café und Restaurant, hatte sehr helle Wände, deren Pastellfarben an die Provence erinnerten, und eine Bar aus lackiertem Mahagoni mit Messingbeschlägen und hohen Hockern davor, die den Eindruck von Behaglichkeit vermittelten.
Hier nahmen die Junggesellen von Libreville ihre Mahlzeiten ein. Jeder hatte seinen Tisch und seinen Serviettenring.
Die Zimmer im oberen Stockwerk waren nie belegt. Kahle und leere Zimmer, ebenfalls mit pastellfarbenen Wänden. Betten, über denen Moskitonetze hingen, und hier und dort ein alter Krug, eine angestoßene Waschschüssel, ein leerer Überseekoffer.
Überall, oben wie unten, wurden einfallende Sonnenstrahlen von den Jalousien vor den Fenstern zerschnitten, sodass sich durch das ganze Haus Gittermuster aus Licht und Schatten zogen.
Timars Gepäck war das eines jungen Mannes aus guter Familie, und es wirkte komisch, wie es da in seinem Zimmer auf dem Boden stand. Er war es nicht gewohnt, sich in einer kleinen Schüssel zu waschen, und schon gar nicht, sich für gewisse Verrichtungen ins Gebüsch zu schlagen.
Auch all die herumschwirrenden Insekten, unbekannten Fliegen, fliegenden Skorpione, pelzigen Spinnen kannte er nicht.
Und dann wurde er zum ersten Mal von dem heimtückischen Unbehagen befallen, das ihn hartnäckig wie ein Schwarm Insekten verfolgen sollte. Als er am ersten Abend seine Kerze gelöscht hatte, erkannte er trotz der Dunkelheit noch den bleichen Käfig des Moskitonetzes. Über dem Tüll spürte er eine gewaltige Leere, in der es kaum wahrnehmbar knisterte, und winzige Lebewesen – Skorpion? Mücke? Spinne? –, die sich manchmal auf das durchsichtige Gewebe setzten.
Und in diesem weichen Käfig lag er und versuchte, den leisen Geräuschen zu folgen, dem Erzittern der Luft und den unvermutet eintretenden Momenten völliger Stille.
Abrupt hatte er sich auf die Ellbogen gestützt. Es war schon am Morgen. Die Sonnenstrahlen sickerten herein, und die Tür hatte sich soeben geöffnet. Die Wirtin des Hotels sah ihn an, ruhig lächelnd.
Timar war nackt. Das wurde ihm jäh bewusst. Seine Schultern und sein Oberkörper tauchten blass und feucht aus den zerwühlten Laken auf. Warum war er nackt? Angestrengt versuchte er, sich zu erinnern.
Ihm war heiß gewesen. Er hatte stark geschwitzt. Vergeblich hatte er nach Streichhölzern gesucht, denn ihm schien, dass nicht fassbare Tierchen über seine Haut krabbelten.
Und da, vermutlich mitten in der Nacht, hatte er seinen Pyjama ausgezogen. Sodass nun die Wirtin seine blasse Haut und die hervorspringenden Rippen sehen konnte. Sie schloss die Tür mit verblüffender Ruhe und fragte:
»Haben Sie gut geschlafen?«
Seine Hose lag auf dem Boden. Sie hob sie auf, schüttelte den Staub heraus und hängte sie über den Stuhl.
Timar wagte nicht, sich zu erheben. Sein Bett roch nach Schweiß. In der Schüssel stand noch schmutziges Wasser, seinem Kamm fehlten mehrere Zinken.
Und doch wollte er nicht, dass diese Frau im schwarzen Seidenkleid, die ihm sanft und zugleich ironisch zulächelte, fortging.
»Ich bin hier, um Sie zu fragen, was Sie möchten. Kaffee? Tee? Schokolade? Hat Ihre Mutter Sie geweckt, in Europa?«
Sie hatte das Moskitonetz gelüftet und bespöttelte ihn. Sie neckte ihn, mit spitzen Zähnen, als hätte sie Lust, ihn anzubeißen.
Ihn anzubeißen, weil er anders war als die Kolonisten, weil er nach Bett und gepflegter Jugendlichkeit duftete.
Sie war nicht aufreizend. Sie war auch nicht mütterlich. Und doch hatte sie von beidem etwas. Aber vor allem strahlte diese füllige fünfunddreißigjährige Frau von Kopf bis Fuß eine dumpfe Sinnlichkeit aus.
War sie nicht nackt unter ihrem schwarzen Seidenkleid? Trotz seiner Verlegenheit stellte sich Timar die Frage.
Dabei ergriff ihn ein heftiges Verlangen, verstärkt durch Dinge, die gar nichts damit zu tun hatten. Die Muster von Licht und Schatten, die animalische Feuchtigkeit des Bettes, sein unruhiger Schlaf in der zurückliegenden Nacht, unterbrochen von unwillkürlichem Aufschrecken und blindem Herumtasten im Dunkel.
»Ach je, Sie sind ja gestochen worden.«
Auf dem Bettrand sitzend, legte sie einen Finger auf seine nackte Brust, ein wenig oberhalb der Warze, berührte einen kleinen roten Fleck und blickte Timar in die Augen.
Das also war passiert, das Folgende ging dann sehr schnell, sehr wirr und unbeholfen. Sie war darüber ebenso erstaunt gewesen wie er, gewiss irritiert, und während sie vor dem Spiegel ihr Haar in Ordnung brachte, hatte sie gesagt:
»Thomas wird Ihnen Ihren Kaffee bringen.«
Thomas war der Boy. Für Timar bloß ein Schwarzer, denn er war noch nicht lang genug in Afrika, um die Schwarzen voneinander unterscheiden zu können.
Als er eine Stunde später hinuntergegangen war, hatte die Wirtin mit einer Häkelarbeit aus grellrosa Seide hinter der Bar gesessen. Von dem wilden, leidenschaftlichen Rausch zuvor war ihr nichts mehr anzumerken. Gelassen und heiter lächelte sie wie sonst.
»Wann wollen Sie zu Mittag essen?«
Nicht einmal ihren Namen kannte er! Seine Sinne waren überreizt. Er spürte noch ihre Wärme, die zarte Haut, den nicht sehr festen, aber köstlichen Körper.
Eine kleine Schwarze brachte Fische, die Wirtin wählte wortlos die schönsten aus und warf einige Geldstücke in den Korb.
Aus dem Keller tauchte der Ehemann auf, zunächst der Oberkörper, dann der starke, aber müde Rest. Er war ein Koloss mit trägen Bewegungen, mürrisch verzogenem Mund und galligem Blick.
»Sie waren hier?«
Und Timar errötete wie ein dummer Junge. So ging das nun schon seit drei Tagen. Nur stieg sie morgens nicht mehr hinauf in sein Zimmer. Von seinem Bett aus hörte er, wie sie unten im Lokal hin und her ging, Thomas Anweisungen gab und den Schwarzen Waren abkaufte.
Von früh bis spät trug sie dasselbe schwarzseidene Kleid, unter dem sie, wie er jetzt wusste, nackt war. Das verwirrte ihn so sehr, dass er oft den Blick abwenden musste.
Draußen gab es für ihn nichts zu tun. Er verbrachte fast den ganzen Tag im Hotel, trank irgendetwas, blätterte durch drei Wochen alte Zeitungen oder spielte für sich allein Billard.
Sie häkelte und bediente Leute, die sich für einen Moment an die Theke stellten und die Ellbogen aufstützten. Der Mann kümmerte sich um sein Bier und seine Flaschen, rückte die Tische zurecht, und hin und wieder forderte er Timar auf, sich in eine andere Ecke zu setzen. Er schien ihn wie einen störenden Gegenstand zu betrachten.
Das Ganze hatte etwas Gereiztes, Verbissenes und trotz der Sonne Düsteres, besonders in den drückend heißen Stunden, wo einem der Schweiß schon ausbrach, wenn man nur den Arm hob.
Mittags und abends kamen die Stammgäste zum Essen und zum Billardspiel. Timar kannte sie nicht. Sie musterten ihn neugierig, ohne Wohlwollen oder Abneigung. Und er wagte nicht, sie anzusprechen.
Schließlich hatte das Fest stattgefunden. Es war auf seinem Höhepunkt. In einer Stunde würden alle betrunken sein, selbst Timar, der ganz allein seinen Champagner trank.
Der Künstler hieß Manuelo. Er musste angekommen sein, als Timar noch schlief oder ausgegangen war. Gegen elf Uhr am Vormittag jedenfalls war Timar im Hotel auf ihn gestoßen. Lächelnd, mit allem vertraut, schon ganz zu Hause, klebte der Künstler Plakate an die Säulen des Lokals. Sie kündigten Manuelo an, die größte spanische Tänzerin.
Ein geschmeidiger und charmanter kleiner Mann. Er verstand sich bereits sehr gut mit der Wirtin. Nicht so, wie sich ein Mann und eine Frau, sondern wie sich Frauen untereinander verstehen.
Schon am Mittag waren die Tische umgestellt worden, damit mehr Platz für Manuelos Tänze entstand. Man hatte bunte Papiergirlanden gespannt und das Grammophon ausprobiert.
Stundenlang hatte der Spanier im Zimmer seine Nummern geübt, so heftig auf den Boden stampfend, dass die Decke wackelte.
War Joseph Timar deshalb verstimmt, weil der Rhythmus, an den er sich gewöhnt hatte, gestört worden war? Trotz der Sonne war er ausgegangen und hatte gespürt, wie sein Schädel unter dem Tropenhelm heiß wurde. Schwarze Frauen hatten ihn lachend angesehen.
Ebenfalls wegen des Festes war den Stammgästen ihr Essen in aller Eile serviert worden. Dann waren Leute von draußen gekommen, Weiße, die Timar noch nie gesehen hatte, weiße Männer und Frauen, Frauen im Abendkleid und zwei Engländer im Smoking.
An allen Tischen wurde Champagner getrunken. Draußen im Dunkel, hinter den Türen und Fenstern, standen plötzlich Hunderte schweigsame Schwarze.
Manuelo tanzte wie eine Frau, so sehr, dass es umso zweideutiger wirkte. Die Wirtin war an der Bar. Timar kannte jetzt ihren Namen: Adèle. Alle nannten sie so. Die meisten der Gäste duzten sie. Er schien der Einzige zu sein, der sie mit Madame anredete. Wie immer in Schwarz und wie immer nackt unter der Seide, war sie auf ihn zugekommen.
»Champagner? Es stört Sie doch nicht, einen Piper zu nehmen? Ich habe nur noch wenige Flaschen Mumm, und die Engländer trinken nichts anderes.«
Das hatte ihn gefreut, ihm sogar gutgetan. Aber warum verzerrte sich Minuten später sein Gesicht?
Manuelo hatte ein paar Tänze vorgeführt. Der Wirt – auch ihn duzten alle und nannten ihn Eugène – hatte sich in eine Ecke neben das Grammophon gesetzt und wirkte mürrischer denn je. Trotzdem beobachtete er alles, hörte alles, rief die Boys herbei.
»Siehst du nicht, Idiot, dass die Leute dort was zu trinken haben wollen?«
Mit unvermuteter Sanftheit wechselte er dann die Grammophonnadel. Auch Timar spitzte die Ohren, fing Satzfetzen auf und versuchte zu verstehen. Aber das war fast unmöglich. Den großen, ziemlich gewöhnlichen jungen Mann am Nebentisch, der aussah wie ein Student im dritten Semester und schon bei seinem zehnten Whisky war, zum Beispiel, nannte man Herr Staatsanwalt. Holzfäller erzählten:
»… solange es keine Spuren gibt, ist es ungefährlich. Aber die lassen sich leicht vermeiden: Du tust ihm ein nasses Handtuch auf den Rücken. Dann kannst du loslegen. Die Nilpferdpeitsche hinterlässt keine Striemen.«
Auf dem Rücken des Schwarzen natürlich!
Hatte Timar schon eine ganze Flasche getrunken? Man brachte ihm eine neue und füllte sein Glas. Er sah einen Teil der Küche, und genau in diesem Augenblick schlug die Wirtin Thomas mit der Faust ins Gesicht. Was bedeutete das? Der Schwarze zuckte nicht mit der Wimper, nahm die Schläge bewegungslos, mit starrem Blick hin.
Dieselben Platten wurden zehnmal gespielt. Einige Paare tanzten. Die meisten der männlichen Gäste hatten sich ihrer Jacketts entledigt.
Draußen stand noch immer dieses Spalier aus stummen Schwarzen, die zusahen, wie sich die Weißen amüsierten.
Der Wirt saß neben dem Grammophon und sah so grimmig und streng drein, dass sein Ausdruck etwas Tragisches bekam.
Was ging hier vor? Nichts natürlich! Timar hatte dummerweise zu viel Champagner getrunken, und mit einem Schlag stiegen all seine kleinen Ängste, all die beklommenen Gefühle der letzten Tage wieder an die Oberfläche.
Er hätte gern etwas zu Adèle gesagt, irgendetwas, nur um den Kontakt aufzunehmen. Er sah zu ihr hin, aber es gelang ihm nicht, ihren Blick einzufangen. Als sie dann an einen Tisch gerufen wurde, kam sie dicht an ihm vorüber, und er war so kühn, sie mit zwei Fingern an ihrem Kleid zu fassen.
Ein kurzes Innehalten. Ein flüchtiger Blick. Ein Satz:
»Warum hast du die Frau deines Chefs nicht längst zum Tanz aufgefordert?«
Er sah in die Richtung, in die ihr Kinn deutete, und erblickte eine dicke Frau im rosafarbenen Kleid neben dem Direktor der Sacova. Warum hatte Adèle das gefragt? Und warum so nervös? War sie etwa eifersüchtig? Er wagte es nicht zu hoffen. Im Übrigen hatte er keine andere Frau angesehen.
Mit dem üblichen Lächeln sprach sie mit den Gästen. Aber sie kehrte nicht an die Kasse zurück, sondern ging zu der Tür hinten im Lokal, die auf den Hof führte. Niemand bemerkte es außer Timar, der ohne Bewusstsein ein weiteres Glas leerte.
›Ich bin vielleicht ein Dummkopf! Wie konnte ich hoffen, der Einzige zu sein!‹
Was hätte er darum gegeben, sie jetzt in den Armen zu halten, ihren erhitzten, hingegossenen Körper, der unvorstellbar biegsam war.
Wie viele Minuten verstrichen? Fünf? Zehn? Der Wirt, immer noch mit tragischem Ausdruck, drehte das Grammophon auf. Timar bemerkte eine Flasche Mineralwasser neben ihm.
Adèle kam nicht wieder herein. Eugène, dem ihre Abwesenheit vielleicht bewusst geworden war, sah sich suchend um.
Timar erhob sich zögerlich, erstaunt über sein schwammiges Gefühl, und durchquerte wankend den Raum. Er erreichte die kleine Tür, den Hof, eine weitere Tür, die ins Freie führte. Im Dunkeln kam jemand angelaufen und stieß ihn an. Es war Adèle.
»Endlich …«, stammelte er.
»Lass mich vorbei, du Dummkopf!«
Es war stockfinster. Musik war zu hören. Das schwarze Kleid verschwand, und er stand da, ratlos, gekränkt und traurig.
Auf der Wanduhr war es drei. Manuelo hatte seinen Auftritt längst beendet und das Geld eingesammelt. Wieder zum Mann geworden, trank er an einem Tisch Pfefferminzlikör und erzählte von seinen Erfolgen in Casablanca, in Dakar und Belgisch-Kongo.
Adèle füllte an der Theke Gläser, mit konzentriert gerunzelter Stirn.
Der Staatsanwalt, der zwischen den beiden Engländern an der Bar saß, war betrunken und sarkastisch.
Viele Leute waren schon gegangen. Die Holzfäller, die an zwei Tischen saßen, aßen Sandwiches und tranken Bier.
»Schluss mit der Musik!«, brüllte einer von ihnen. »Stell das Ding ab, Eugène, komm und trink mit uns.«
Der Wirt erhob sich. Sein Mund war seltsam verzerrt. Er blickte in den schmutzigen Raum, auf die herumliegenden Luftschlangen, die leeren Gläser, die befleckten Tischtücher, und seine Augen glänzten wie im Fieber. Als wäre ihm schwindelig, schwankte er zur Tür und stammelte:
»Ich komme gleich.«
Adèle zählte und bündelte Geldscheine und streifte ein Gummiband über jedes Bündel.
Timar, hundemüde, ausgehöhlt und angeekelt, trank mechanisch seinen Champagner aus, und niemand hätte später sagen können, wie lange der Wirt fortgeblieben war.
Als er wieder hereinkam, wirkte er noch größer und schwerer, aber so kraftlos, dass es fast komisch war.
Er blieb im Türrahmen stehen und rief:
»Adèle!«
Seine Frau sah ihn an, zählte aber weiter ihre Geldscheine.
»Ist der Doktor schon gegangen? Lass ihn schnell holen.«
Ein tiefes Schweigen, dann sagte er:
»Wo ist Thomas? Ich sehe Thomas nicht.«
Timar und alle anderen hielten Ausschau nach ihm. Aber es waren nur die beiden für den Abend engagierten jungen Boys zu sehen.
»Du bist wohl nicht recht auf dem Damm?«, fragte einer der Holzfäller.
Der Wirt starrte ihn an, als wollte er ihn erdrosseln.
»Macht den Laden dicht«, sagte er in scharfem Ton. »Verstanden? Der Doktor soll kommen, wenn er nicht zu besoffen ist. Egal, ich bin erledigt. Blut im Urin, Schwarzwasserfieber …«
Timar verstand nicht. Aber die Gäste schienen zu begreifen, denn sie standen hastig auf.
»Eugène! Du …«
Eugènes Stimme klang erschöpft.
»Lasst mich in Frieden. Macht den Laden dicht!«
Und er verschwand im Flur. Eine Tür schlug zu, und man hörte, wie er gegen einen Stuhl trat.
Adèle war leichenblass geworden. Sie hatte den Kopf gehoben. Sie hörte etwas. Ein Geräusch, das näher kam und deutlicher wurde. Eine Gruppe von vier oder fünf Schwarzen blieb an der Tür stehen.
Timar konnte die wenigen Worte, die ihnen mühsam, Silbe für Silbe, entlockt werden mussten, noch nicht verstehen.
Er verstand nur, was einer der Holzfäller, ein Einäugiger, übersetzte.
»Gerade eben wurde Thomas tot aufgefunden, zweihundert Meter von hier. Er ist mit einem Revolverschuss niedergestreckt worden.«
Oben klopfte ein Stock auf den Boden. Es war Eugène, der ungeduldig wurde, schließlich aufstand, die Tür seines Zimmers aufriss und ins Treppenhaus rief:
»Adèle! Herrgott, willst du mich hier einfach krepieren lassen?«
2
Als Timar erwachte, hatte er sich in dem heruntergerissenen Moskitonetz verheddert. Das Zimmer war sonnendurchflutet. Aber hier schien die Sonne alle Tage, es war kein freudiger Sonnenschein.
Auf seinem Bett sitzend, lauschte er den Geräuschen im Haus. Vier- oder fünfmal hatte er nachts in seinem unruhigen Schlaf ein Kommen und Gehen gehört, Flüstern und Wasser, das plätschernd in einen Steinkrug gegossen wurde.
Als der Arzt gekommen war, hatte die Wirtin Timar in sein Zimmer hinaufgeschickt und alle anderen aus dem Lokal gejagt.
»Wenn Sie mich brauchen …«, hatte er mit lächerlicher Inbrunst gestammelt.
»Ja. Gut. Aber jetzt legen Sie sich schlafen.«
War der Mann gestorben, wie er es angekündigt hatte? Jedenfalls wurde das Lokal ausgefegt. Als Timar seine Tür einen Spaltbreit öffnete, hörte er Adèles Stimme sagen:
»Gibt es keinen Käse mehr? In der Faktorei auch nicht? Dann mach eine Büchse grüne Bohnen auf. Warte! Zum Nachtisch gibt es Bananen und Aprikosen, von denen in der Reihe rechts. Hast du verstanden, du Hohlkopf?«
Sie hob die Stimme nicht. Sie hatte keine schlechte Laune. So sprach sie einfach mit den Schwarzen.
Als Timar einige Minuten später unrasiert hinunterkam, fand er sie an der Kasse, wo sie Bons ordnete, und das Lokal war schon sauber und aufgeräumt. Adèle sah proper und frisch aus. Ihr schwarzes Kleid war nicht zerknittert und ihre Frisur tadellos.
»Wie spät ist es?«, murmelte er verlegen.
»Kurz nach neun.«
Und um vier Uhr morgens war das mit dem Wirt passiert! Als er den Anfall bekommen hatte, war das Lokal dreckig und unaufgeräumt gewesen. Adèle war nicht schlafen gegangen, und nun hatte sie schon das Mittagessen bestimmt und sich Gedanken über Obst und Käse gemacht.
Und doch war sie blasser als sonst. Vor allem die dunklen Ringe unter den Augen veränderten ihr Aussehen. Gleichzeitig ahnte er, dass ihre Brüste unter dem Kleid auch jetzt wieder nackt waren, und er errötete.
»Geht es Ihrem Mann besser?«
Sie sah ihn erstaunt an, schien sich plötzlich zu erinnern, dass er erst seit vier Tagen in der Kolonie war.
»Er wird den Tag nicht überleben.«
»Wo ist er?«
Sie deutete zur Decke. Er wagte nicht zu fragen, ob der Sterbende allein war, aber sie erriet seinen Gedanken.
»Er redet schon wirres Zeug. Er merkt nichts mehr. Übrigens, hier ist ein Brief für Sie.«
Sie reichte ihm einen Umschlag über die Theke: ein kleines amtliches Schreiben, in dem Timar aufgefordert wurde, sich schnellstens auf dem Polizeikommissariat zu melden.
Eine Schwarze kam mit einem Korb Eier herein. Die Wirtin schüttelte den Kopf.
»Es wäre besser, Sie gingen hin, bevor es zu heiß wird.«
»Was, glauben Sie, wollen die …«
»Sie werden es ja sehen!«
Sie war nicht nervös. Auch das Lokal wirkte genauso wie an den anderen Vormittagen.
»Hinter der Mole, kurz vor dem Schiffsbüro, biegen Sie rechts ein … Vergessen Sie den Tropenhelm nicht!«
Er bildete es sich vielleicht nur ein, doch er hätte schwören mögen, dass sich die Schwarzen an diesem Morgen anders verhielten als sonst. Sicher, auf dem Markt ging es so laut und lebhaft zu wie immer, und die bunten Schurze schillerten in der Sonne. Aber plötzlich sah jemand in der Menge den Weißen mit einem düsteren Blick an, oder drei, vier Einheimische verstummten und wandten die Köpfe ab.
Joseph Timar beschleunigte den Schritt, obwohl ihm der Schweiß herunterrann. Er verlief sich und landete vor der Villa des Gouverneurs, musste umkehren und sah schließlich am Ende eines schlechten Weges eine Baracke, an der ein Schild hing:
Polizeikommissariat
Die Schrift war mit weißer Farbe ungeschickt aufgemalt, die beiden »s« von Kommissariat standen verkehrt herum. Schwarze in Polizeiuniform saßen mit nackten Füßen auf den Stufen der Veranda. Irgendwo in dem dämmrigen Haus klapperte eine Schreibmaschine.
»Ich möchte zum Kommissar.«
»Dein Papier …«
Timar zog seine Vorladung heraus, wartete, auf der Veranda stehend, und wurde dann in ein Büro gerufen. Die Jalousien waren heruntergelassen.
»Setzen Sie sich. Sie sind Joseph Timar?«
Im Halbdunkel konnte er einen Mann mit rotem Gesicht, hervorquellenden Augen und starken Tränensäcken ausmachen.
»Wann sind Sie in Libreville angekommen? Setzen Sie sich.«
»Mit dem Schiff am Mittwoch.«
»Sie sind nicht zufällig mit dem Departementsrat Timar verwandt?«
»Das ist mein Onkel.«
Mit einem Ruck erhob sich der Kommissar, schob seinen Stuhl zurück, streckte ihm eine schlaffe Hand hin und wiederholte in einem ganz anderen Ton:
»Setzen Sie sich doch. Wohnt er immer noch in Cognac? Ich bin fünf Jahre lang Inspektor in dieser Stadt gewesen.«
Timar war erleichtert. Denn zunächst hatte er in diesem dunklen, kümmerlich ausgestatteten Zimmer eine Anwandlung von Zorn oder Entmutigung empfunden. Es gab insgesamt fünfhundert Weiße in Libreville. Leute, die ein hartes, manchmal gefährliches Leben auf sich nahmen, nur damit man in Frankreich begeistert von der Erschließung der Kolonien sprechen konnte.
Und kaum war er gelandet, wurde er von einem Polizeikommissar vorgeladen und rüde wie ein unerwünschtes Element behandelt!
»Ein bedeutender Mann, Ihr Onkel! Er könnte jeden Tag Senator werden. Aber was wollen Sie denn hier?«
Nun war es am Kommissar, verwundert zu sein, so ehrlich verwundert, dass es Timar wiederum beunruhigte.
»Ich habe einen Vertrag mit der Sacova unterschrieben.«
»Geht denn der Direktor fort?«





























