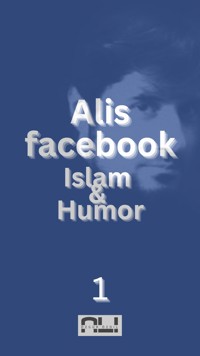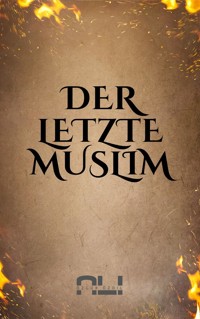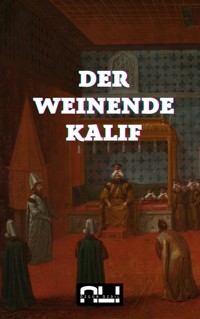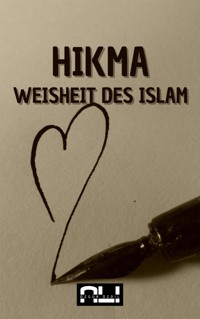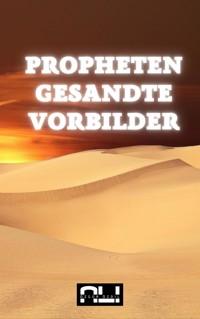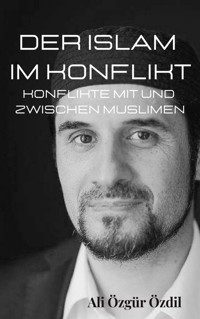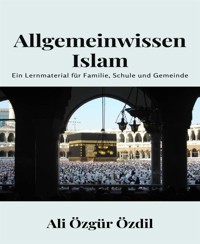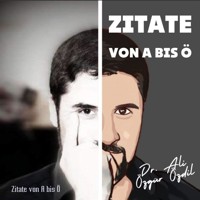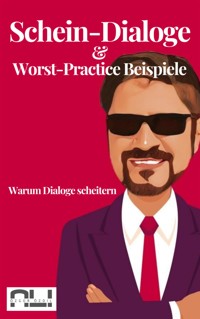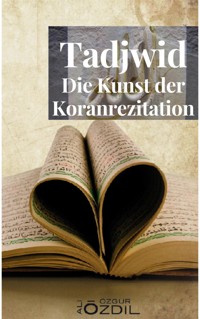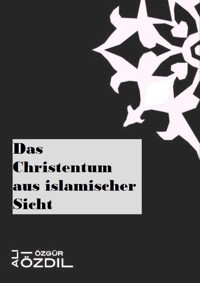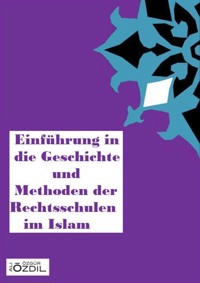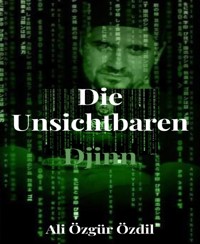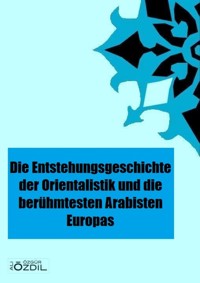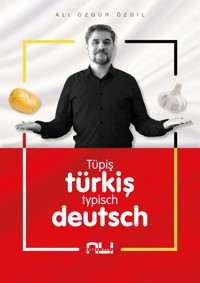
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Der Autor erzählt auf autobiograpische Weise, teilweise sehr humorvoll, von seiner Kindheit, Schulzeit, Familie, Studienzeit, Arbeitswelt und Alltag als Türke in Deutschland. Es ist ein Buch voller, teilweise bitterer, Erfahrungen als Migrant und Minderheit, mit der sich sicher viele Menschen mit Migrationshintergrund identifizieren können.
Er möchte Menschen mit ähnlichen Erfahrungen motivieren, ihre Erlebnisse niederzuschreiben und/oder zu erzählen, damit auch ihre Stimme gehört wird.
Zum Beispiel erzählt er von Diskriminierungserfahrungen im Bildungssystem, die - obwohl sie 40 Jahre zurück liegen - heute immer noch aktuell sind.
In Lesungen aus dem Buch haben viele ZuhörerInnen mit Migrationshintergrund mitgeteilt, dass sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben und das Buch ihnen aus der Seele spricht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Tüpiş türkiş, typisch deutsch
Lach- und Sachgeschichten mit einem Türken und ganz vielen Deutschen
Dieses Buch widme ich meinem Brazer Ömer.BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenINHALT
Geleitwort
Vorwort: Über den humorvollen Umgang mit Diskriminierungen
I. KINDHEITSERINNERUNGEN
1. Wenn du die Deutschen schlägst, rufen sie die Polizei
2. Ist Allah jetzt in der Türkei geblieben?
3. Meine Mutter war viel schöner
4. Mensch, du bist hier in der Türkei. Hier musst du „imdat!“ schreien
5. Brötchenball
6. Komm, das ist ein Türke!
7. Zwei vorbei und einer drinnen
8. Der Hund war gesund
9. Gut, den letzten Schlag hatte er
10. Klingelstreich
II. FAMILIENGESCHICHTEN
1. Ich wollte doch nur mehr Zucker
2. Vier Hosen übereinander
3. Ich habe nur gegen den Sandsack geboxt
4. Wenn nach dem Schnellkochtopf die Schwester explodiert
5. Ich platze gleich
6. Als Börek Dans nach Italien kam
III. DIE SCHULZEIT
1. Wer kann Lo-ko-mo-ti-ve sagen?
2. Kusskriegen
3. Als der, den ich nicht mochte, ertrank…
4. Du scheiß Türke!
5. Ich bin es gewesen
6. Ich habe gar nichts gestohlen
7. Auf der Polizeiwache
8. Bist du vielleicht schwul?
9. Miss K., Django, Tavuk und James Bond
10. Auf dem linken Auge blind
11. Wenn der Sportlehrer schlechter ist als seine Schüler
12. Aber ich kann einer Türkin doch keine bessere Note geben als einer Deutschen
13. Respekt
IV. EIN TÜRKE AUF REISEN
1. Bello Ragazzo
2. Fahrt weiter! Nein, bleibt stehen!
3. Komm mit zum Geheimdienst! Nein, Du kommst mit zum Geheimdienst!
4. Keine Aufenthaltsgenehmigung, keine Ausreisegenehmigung
5. Erzähle uns einen typischen Witz über die Deutschen
6. Als erster am Ticketschalter und als letzter im Flugzeug
7. Bin ich Promi, oder was gucken die Leute immer so?
V. ALLTAGSLEBEN
1. Sie sprechen aber gut deutsch
2. Sie wollen doch bestimmt nicht zurück in ihre Heimat
3. Es war mir nie aufgefallen, dass wir stanken
4. Mir aber blieb die Spucke weg
5. Eisenbahn Altona – Türkspor 2:1
6. Wissen Sie, wo die Max-Brauer-Allee ist?
7. Lass Kanacki mal vorbei
8. Wenn der Fahrkartenautomat defekt ist
9. Tu das, was du nicht lassen kannst
10. Der Nazi vom Bahnhof
1 1. Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein
12. Der Lüstling auf der Brücke
13. Mein Nachbar seine Frau
14. Gott sei Dank ist bei uns kein Ausländer in der Klasse
VI. BERUF
1. Die Türken durften die Werkstatt fegen
2. Nach 20 Minuten habe ich gekündigt
3. Muttu Blei geben
4. Du hast im Lehrerzimmer nichts zu suchen
5. Junger Mann, kann es sein, dass Sie uns missionieren wollen?
6. Sagen Sie Mal, wollen Sie uns verarschen?
7. Der Türkei-Experte
VII. TYPISCH TÜRKISCH, TYPISCH DEUTSCH
1. Grillen auf dem Spielplatz
2. Wenn die Ehefrau Tee serviert
3. Hammelschlachten im Badezimmer
4. Paranabokye Paranabokye
5. Hammelschlachten im Kleingarten?
6. Kennt ihr in der Türkei keine Straßenschilder?
7. Tüpiş türkiş
8. Und was, bitteschön, ist typisch deutsch?
9. Fazit
10. Es ist aber nicht alles Türkisch, was türkisch aussieht
11. Machen wir es auf die deutsche oder türkische Art?
12. Auch Türken haben Vorurteile
VIII. Hilfe, meine Kinder werden zwangstürkisiert!
IX. Schlusswort
X. Anhang
1. Der Erste-Hilfe-Antidiskriminierungskurs
2. Weshalb flog die Türkentaube nach Europa?
Geleitwort
Ali-Özgür Özdil hat mit seinen Erinnerungen an Kindheit und Jugend in der fremdbestimmten Diaspora dem Leser ein Schatzkästlein geöffnet: Wie beiläufig gibt er den Blick frei auf die Wahrnehmung eines Kindes, dessen Familie so nach und nach in die Fremde geht und dort, besser gesagt, hier in Hamburg, vereint, den Widrigkeiten trotzt. Alles erscheint anders, selbst das Licht und die Gerüche erinnern ihn daran, dass er hier lange brauchen wird, um zu Hause zu sein. Wie so oft in Diasporagesellschaften erweist sich die Familie als Halt und Brückenpfeiler zwischen dem Zurückgelassenen und den Notwendigkeiten der Gegenwart. Doch auch die Familie verändert sich unter den Eindrücken Deutschlands. Generationskonflikte klingen an, sehr leise, Solidarität zwischen den Geschwistern, unterschiedliche Erziehungsstile zwischen Vater und Mutter, lassen diese Familie grundnormal erscheinen – was sie auch schließlich ist. Die Özdils haben allerdings, wie im Übrigen alle Migranten, vieles im Auge zu behalten, was für sie und ihre Identitätsfindung überaus wichtig ist. Kulturgeschichte und Gegenwart des Mutterlandes, politische und gesellschaftliche Prozesse dort und hier und nicht zuletzt die eigene Position in den beiden, sich stets verändernden Gesellschaften. Diese Herausforderungen und Kunstfertigkeiten in Wahrnehmung, Analyse und Handeln wird hierzulande zu wenig gewürdigt. Obwohl auch die Bundesrepublik viele grundlegende Erschütterungen seit den Sechzigern erfahren hat, ist doch Eines geblieben: Es gibt immer noch einen kleinherzigen und selbst in der „Demographie-Debatte“ unerschütterlichen politischen Konsens darüber, was originär Deutsch ist und dass Herkunft und Bekenntnis den Zugang zu Bildung und Arbeitsmarkt bestimmen. Ali Özgür Özdil hat gute, wie schlechte Erfahrungen gemacht. Er ist seinen Weg gegangen, vom Jugendlichen, der seinen Kräften vertraute, bis zum nachdenklichen Gesprächspartner im interreligiösen Dialog. Er konnte sich auf sich verlassen, auf wen sonst? Die Institutionen, die er erfolgreich durchlief, schienen, von der Auffangklasse einmal abgesehen, nicht vorbereitet. Sie sind es heute noch nicht.
Und auch deshalb gebührt Ali-Özgür Özdil Dank, dass er dem kleinen Jungen in sich, dem Jugendlichen, dem Vater und dem Wissenschaftler beim Austarieren der Lebenswirklichkeiten Türkei und Bundesrepublik Deutschland, das Wort erteilt hat.
Dr. Andrea Zielinski
Social Anthropologist/Cultural Anthropologist/
Intercultural Management
VORWORT
Über den humorvollen Umgang mit Diskriminierungen
Kümmeltürke, Kanake, Knoblauchfresser, Itaker, Spaghettifresser, Schlitzauge, Reisfresser waren Wörter, mit denen ich als Schüler aufwuchs. In der Generation meiner Kinder sind neue Begriffe wie Kartoffelfresser, Schweinefresser oder Ungläubige hinzugekommen. Können sich Türken, Italiener, Asiaten oder Deutsche, auf die die genannten diskriminierenden Reduzierungen bezogen werden, ernsthaft mit diesen identifizieren? Ich meine, sind Türken tatsächlich eher typische Knoblauchfresser und Deutsche typische Kartoffelfresser?
Mir wurde doch tatsächlich mehrmals gesagt, ich sei kein typischer Türke, was vermutlich immer als Lob gemeint war. "Ist das jetzt ein Lob oder eine Beleidigung (aller anderen („typischen“) Türken)“ habe ich immer zurückgefragt. Wie soll denn ein typischer Türke sein und wie ein untypischer Türke (wie z.B. ich)? So begab ich mich auf die Reise in die Vergangenheit und wollte jene Abzweigung finden, wo ich den Weg eines "typischen" Türken verlassen haben soll. Der Mann im Spiegel ist aber auch ein kein „typischer“ Deutscher, dachte ich mir. Nein, ich bin kein Deutscher, auch kein Deutsch-Türke, wie sich inzwischen viele, wie sagt man, „Deutsche mit türkischem Migrationshintergrund“ bezeichnen. Ich bin ein Türke, der in der zweiten Generation in Deutschland lebt. Noch besser: ein Hamburger Türke, der den Hamburger Regen liebt, welcher seine Pollenallergie dämpft und der den kalten Winter liebt, wenn der Schnee im Sonnenlicht glänzt. Vor allem liebe ich den Herbst, wenn die vielen bunten Blätter im Wind tanzen. Während viele "Deutsche" sich nach Sonnenstrahlen sehnen und – wie ich schon einige Male beobachtet habe – während sie an der Ampel stehen, mit geschlossenen Augen Sonnenlicht tanken, bleibe ich im Herbst unheimlich gerne auf dem Gehweg stehen, schließe meine Augen und genieße den Wind auf meinem Gesicht, das Rauschen der Blätter und den Duft von Erde, wenn es regnet.
Wenn ich durch die Straßen Hamburgs gehe, werden gelegentlich auch Emotionen aus meiner Vergangenheit wach. Irgendwo habe ich sie gespeichert, all die Bilder, Düfte, Gefühle, Gesichter und Stimmen meines Lebens.
Ich bin seit 1977 ein Hamburger. Wie aber kam es dazu? Ich war doch in Iskenderun, einer Kleinstadt am Mittelmeer geboren. Dort, wo fast an 300 Tagen im Jahr die Sonne scheint. Jeder Morgen begann mit einem Blick aufs Meer im Westen oder auf das leicht von Schnee bedeckte Licht-Gebirge (Nur Dağı) im Osten. Die Straßen waren geschmückt mit Palmen und gefüllt mit türkisch- und arabischsprachigen Menschen. Wo ist unser Güzel Çay Mahallesi (unser Stadtteil) mit ihrem Mohnfeld, ihren ständig bellenden Hunden, dem Freesien-Duft im Garten meiner Großmutter und dem Teergeruch, den wir von den Schienen vernahmen, die zum Hafen von Iskenderun führten?
Hamburg dagegen ist immer unter mir, umgibt mich und füllt mich. Wie konnte das kleine türkische Kind aus Iskenderun - „Ali al-Iskenderuni“ -, ein Hamburger – „Ali al-Hamburgi“ - werden?
Begleiten Sie mich auf dieser soziokulturellen Transformation? Ich verspreche Ihnen, wenn Sie sich erst einmal durch dieses erste, etwas mühselige Kapitel durchgekämpft haben, werden Sie verstehen, was ich damit meine.
„Aua oder ach?“
Wenn ich mir manchmal wehtue, sage ich „aua““ oder „autsch““. Sie meinen, das sei nichts Ungewöhnliches? Oh doch, denn ein Türke würde „ach!“ sagen. Während man z.B. in Deutschland „buuh“ sagt, wenn man jemanden ausbuht, sagt man in der Türkei „yuuch!“
Diese Kleinigkeiten haben mir deutlich gemacht, dass ich kein Türkei-Türke mehr bin, sondern ein Deutschland-Türke. Ich habe mich aber in einem langen und oft unbewussten Prozess so entwickelt. Der Satz „Du bist ja gar kein typischer Türke“, gab den Ausschlag für dieses Buch. Scheinbar passe ich nicht so ganz in die Türken-Schublade. Oft erwische ich mich sogar dabei, wie ich im Radio bei deutscher Volksmusik oder klassischer Musik hängenbleibe. Es dauert einige Minuten, bis ich mich selbst frage, warum ich dort hängengeblieben bin.
Da bin ich nun und ich gehe hier so leicht auch nicht mehr weg, wie einst meine Eltern 1973 ihre Heimat verlassen hatten, um hier anzukommen. Sie kamen als Fremde in die Fremde, die sie körperlich wie seelisch – wenn ich es so deutlich ausdrücken darf – kaputt gemacht hat. Meine Medizin gegen die Krankheiten der Fremde sind aber all jene Geschichten, die ich in diesem Buch erzähle, sowie die süßen und bitteren Lehren, die ich aus ihnen gezogen habe. Denn sich in der Fremde zurechtzufinden, ist immer mit Schwierigkeiten verbunden. Man ist unsicher, macht Fehler und hat Probleme, auch ohne die Einwirkung anderer. Wenn einem aber zusätzlich von anderen Schwierigkeiten gemacht werden, ist das auf die Dauer für die Psyche nicht gesund.
Humor ist in solchen Lebenssituationen eine sehr wichtige Hilfe, ja sogar ein Heilmittel. Die sogenannten Deutschland-Türken haben z.B. ein ganz anderes Wörterrepertoire als Deutsche (ohne bekannten Migrationshintergrund), so dass wir – vor allem, weil wir untereinander eine Mischsprache sprechen (das nennt man „Code-Switching“) – manchmal über uns selbst lachen. „Gel“ (sprich „gell“) heißt auf Türkisch „komm“, und dann kann ein Satz schon einmal: „Gels Du mal bitte her?“ lauten. Am meisten jedoch lachen wir über die Älteren oder z.B. über jene türkischen Gemüsehändler, die ihre Waren mit türkischen Buchstaben beschriften. Im Türkischen schreibt man nämlich alles so, wie man es ausspricht. Da kam vielen Türken die neue Rechtsschreibreform sicherlich gelegen. Meine Schwiegereltern zum Beispiel wohnen in Blumenthal, meine Schwiegermutter würde „Bulumental“ sagen. Daher ist es auch kein Wunder, wenn sie in ihrem Gemüseladen Bulumenkol oder Knabilau verkauft. Gut, die meisten Kunden sind Russen, da wird vielleicht der eine oder andere Fehler nicht auffallen, so mein Schwiegervater. Es ist auch halb so schlimm, wenn man die Artikel durcheinanderbringt, da es im Türkischen keine Artikel gibt und Deutsche dabei auch gelegentlich Fehler machen. Richtig lustig wird es, wenn Türken, die keine deutsche Schule besucht haben, Deutsch schreiben. Da liest man dann im Kaufvertrag für ein Auto: „Gekavf vi gezen“.
Wenn wir über unsere Eltern lachen, dann lachen sie mit, denn unser Lachen ist anders als das Lachen jener, von denen sie ausgelacht werden. Übrigens, lachen und weinen tun wir gleich! Da gibt es kein deutsches oder türkisches Lachen. Und selbst wenn meine Schwiegermutter zu Cornflakes „Kenklocks“ sagt, ändert das noch lange nicht den Geschmack. Es bleibt, was es ist. Das ist eine wichtige Erkenntnis, um die Menschheit – trotz ihrer Vielfalt – auch in ihrer Einheit zu erkennen.
Der amerikanische Schwarzenführer Malcolm X (ehemaliges Mitglied der selbsternannten „Nation of Islam“, gest.1965) zum Beispiel, hat durch eine simple Erkenntnis während der Pilgerfahrt in Mekka seinen Hass gegen die Weißen abgelegt. Er erlebte, als er in einem der großen Pilgerzelte in der Ortschaft Mina aufwachte, das alle, egal ob Weiße oder Schwarze, Reiche oder Arme, in derselben Sprache schnarchten („…All snored in the same language.“). Da erkannte er, dass alle vor Gott gleich sind. Er war auch beeindruckt, als er erstmals mit so vielen Menschen aus verschiedenen Nationen aus demselben Teller aß (man isst dort nämlich ohne Besteck). Das war für ihn ein Akt der Brüderlichkeit.
Hier nun ein Einblick in die lustige und krasse Welt eines Türken und seiner deutschen Mitmenschen. Natürlich werde ich versuchen, mich konkret korrekt auszudrücken und ich hoffe, dass es mir gelingen wird, da ich beide „Kültürräume“ einigermaßen kenne. Schließlich habe ich nicht nur Islamwissenschaften und Religionswissenschaften, sondern auch Ethnologie „gestudiert.“
Hinweis: Um die Authentizität zu wahren, wurde alle Rechtschreibfehler in diesem Buch absichtlich begangen!
- Warum aber persönliche Erlebnisse an die Öffentlichkeit weitergeben, wo unsere türkisch-islamische Kultur doch bekannt dafür ist, dass die Privatsphäre so geschützt ist?
Darauf hätte ich viele Antworten. Geld und Ruhm werde ich wohl kaum ernten, zumal auch meine früheren Werke, die allesamt Sachbücher sind, nur einen kleinen Kreis angesprochen haben. Mit diesem Buch trete ich aber unserer Gesellschaft teilweise auf die Füße. Dabei gebe ich Einblicke in das Leben türkischer Familien (allen voran in meine eigene Familie) und in die deutsche Gesellschaft. Natürlich ist mein Blickwinkel ein anderer als der eines Deutschen (was immer man auch darunter verstehen möchte). Es ist nun einmal immer etwas Besonderes „fremd“ oder „anders“ zu sein bzw. aus einer Minderheit zu stammen. Man wird mit Fragen konfrontiert, die man als Mitglied der sogenannten „Mehrheit“ niemals hören würde.
Ich möchte Ihnen, liebe Leser*innen, nicht vorenthalten, dass das Buch auch politische Botschaften enthält. Es wird also nicht nur lustig. Wäre es zu direkt, wenn ich sagen würde, dass in Deutschland Ausländer- und Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und vor allem Islamfeindlichkeit weiterhin salonfähig sind und sich durch alle Gesellschaftsschichten hindurch ziehen?
Wenn ich, der seit 1977 durchgehend in Deutschland lebt, seit 1994 deutscher Staatsbürger ist, hier 12 Jahre zur Schule gegangen ist und sechs Jahre studiert hat, schon so viel Diskriminierungen erlebt habe, wie muss es dann bei jenen sein, die nicht so gut Deutsch können oder die eine dunkle Hautfarbe haben oder ein Kopftuch tragen?
Wenn jeder Migrant (früher hießen diese „Ausländer“) genauso wie ich, in 45 Jahren mehr als zweidutzend fremdenfeindliche Erlebnisse vorweisen könnte, kämen wir bei knapp 10 Mio. Migranten auf über 200 Millionen fremdenfeindliche Geschichten innerhalb einer Generation; viele davon sicherlich ohne Happy-End. Mein Happy-End ist meine jeweilige Erfahrung aus jedem Erlebnis, das ich für meine Selbst- und Fremdwahrnehmung brauche. Oft folgte der süße Geschmack jedoch nach einer gewissen Phase des Nachdenkens und Selbstreflexion. Nachdenken ist die geistige Art der Verdauung von Erlebnissen. Denn nicht jede Diskriminierung ist leicht verdaulich.
Natürlich spielt die persönliche (subjektive) Wahrnehmung dabei eine wichtige Rolle, wann man ein Erlebnis als Diskriminierung empfindet und wann nicht. Es wäre meines Erachtens auch falsch, wenn ich meine persönlichen Erlebnisse zum Maßstab für die Beurteilung von „Deutschen“ nehmen würde.
Ich lache heute zwar über vieles, aber nicht über alles. So möchte ich – anders als dies in vielen Romanen ist – in die Realität einladen und zeigen, dass es überall, in der Schule, auf der Straße oder auf der Arbeit, Ungerechtigkeiten gibt und die Würde des Menschen tagtäglich angetastet wird (das war ein Hinweis auf Art. 1 Grundgesetz). Die Gründe für diese Ungerechtigkeiten sind jedoch häufig so lächerlich, dass man über diese nur lachen kann. Aber wieso alleine lachen, wenn zusammen lachen doch viel schöner ist?
Ich möchte auch all jenen, die wie ich, die Erfahrung von Diskriminierungen, Ausgrenzungen oder die Verletzung ihrer Würde hinnehmen mussten und weiterhin müssen, meinen Respekt aussprechen. Sie sollen nicht denken, dass ich durch meine, gelegentlich humorvolle Art, all diese Verletzungen auf die leichte Schulter nehme. Sie alle haben – ungeachtet ihrer Nationalität, ihrer Religion, ihres Geschlechtes oder ihrer Hautfarbe – meine Solidarität.
Ich möchte mich auch nicht immer nur in der Opferrolle sehen und verlange auch kein Mitleid, da mich alle Erlebnisse eher gestärkt haben als geschwächt. Nach jedem Tief kam ein Hoch und mit ein wenig Selbsterziehung sogar ein Höher. Der Weg der Erfahrung ist nach dem Weg der Nachahmung und des Nachdenkens der dritte Lernweg (hat einmal Konfuzius gesagt). Während der erste Weg der leichteste und der zweite der Edelste ist, ist der Weg der Erfahrung der Bitterste, und ich mag wie meine 2009 verstorbene Mutter Zartbitter.
Nun lade ich die Leser*innen ein zur Selbstreflexion und zum Perspektivwechsel. In welcher Geschichte mögen Sie sich wohl wiederfinden? Waren Sie auch einmal Opfer oder vielleicht Täter oder stiller Beobachter?
Ich beginne mit meinen Kindheitserinnerungen, erzähle über meine Familie, meine Schulzeit, von Reiseerlebnissen, aus dem Alltags- und Berufsleben und auch etwas über meine Kinder. Ich hoffe auch, dass sie von den Diskriminierungen, denen ich ausgesetzt war und bin, verschont bleiben. Schließlich sind sie, im Gegensatz zu meinen Eltern und mir, hier in Deutschland geboren, beherrschen die deutsche Sprache besser als die türkische und sind seit ihrer Geburt deutsche Staatsbürger. Es hat sich also einiges verändert, aber eben nicht alles.
Als Malik (28) einmal mit fünf Jahren von einem türkischen Dönerverkäufer gefragt wurde: „Bist du kein Türke?“ (da Malik auf seine Fragen in Türkisch nicht geantwortet hatte), sagte Malik: „Ja, manchmal.“ Also nur Deutscher ist er nicht, sondern mehr als dies.
Ich möchte noch erläutern, weshalb ich die Erzählform der Kurzgeschichten gewählt habe. Ich dachte mir, dass es besser ist, sich kurz zu fassen, da ich viel zu erzählen habe.
Was jedoch erhoffe ich mir noch durch die Erzählung persönlicher Erlebnisse? Ich respektiere das Privatleben anderer und möchte natürlich auch, dass mein Privatleben geschützt bleibt. Ich glaube aber, dass sich viele dieser Erzählungen immer noch irgendwo da draußen in ähnlicher Weise abspielen. Vermutlich werden sich viele Türken (oder auch andere) in einigen dieser Geschichten wiederfinden. Es ist aber auch wahrscheinlich, dass sich mancher Deutscher darin wiederfindet. Vielleicht, da habe ich eine kleine Hoffnung, wird das Buch auch dazu verhelfen, in „den Türken“, „den Muslimen“, „den Minderheiten“, „den Migranten“, aber auch „den Deutschen“ einen ganz normalen Mitmenschen zu sehen, mit dem man – neben Unterschieden – auch viele Gemeinsamkeiten entdecken kann. Mensch, so schwer kann das doch gar nicht sein!
Meiner Frage, warum ich all dies niedergeschrieben habe, möchte ich eine weitere Frage hinzufügen: „Für wen schreibt man eigentlich?“ Dies fragt z.B. auch Jean-Paul Sartre in seinem Werk: „Was ist Literatur?“.
Ich habe darin einige sehr interessante Hinweise über den Dichter, den Schriftsteller und den Prosa-Schriftsteller gefunden. Grundsätzlich schreibt man für alle Menschen. Aber wenn ich überlege, habe ich bei fast jeder Kurzgeschichte bestimmte Gesichter vor Augen gehabt und es war so, als wollte ich zurück in die Vergangenheit und mit diesen Menschen noch einmal sprechen und sie fragen: „Warum habt ihr das eigentlich getan?“
Mit einigen Geschichten wollte ich zeigen, wie unsinnig Hass, Rassismus, Radikalismus, Nationalismus, Intoleranz und Hochmut sind und da habe ich gemerkt, ich schreibe nicht nur für alle Menschen, sondern auch gegen einige Menschen. Ich schreibe aber auch im Speziellen für jene, die ähnliches oder schlimmeres erlebt haben und zeige ihnen Wege, ihre Vergangenheit zu bewältigen und ihre Gegenwart zu meistern.
Ich schreibe auch für jene, die in der Täterrolle waren und gebe ihnen die Möglichkeit, Menschen aus einer anderen Perspektive zu sehen, indem ich ihnen erzähle, was ihre bösen Blicke, dummen Sprüche oder schädlichen Handlungen auslösen können.
Und ich schreibe gegen jene, die unverbesserlich sind, die weiterhin rücksichtslos bleiben werden, aber ohne die es leider auch nicht geht. Ja, es geht nicht ohne sie, denn wir nehmen das Gute und das Richtige nur durch ihre Gegensätze wahr. Das lehrte mich der große Mystiker Rumi in seinem Werk „Das Mesnevi“. Aber auch von Goethe habe ich gelernt, dass „Toleranz“ alleine nicht genügt. Sie ist in der Bedeutung von „Duldung“ sogar eine Beleidigung. Vielmehr sollten uns unser Wissen und unsere Erfahrungen zur Akzeptanz führen. Nein, ich gehe damit nicht zu weit, sondern gerade so weit, wie es nötig ist, damit ein menschliches und friedvolles Zusammenleben möglich ist.
Ich schreibe aber auch für und gegen mich selbst. Schließlich arbeite ich meine eigenen Erlebnisse auf und therapiere mich sozusagen selbst. Sollten Sie also an der einen oder anderen Stelle einen Fehler entdecken, so werden Sie dies hoffentlich als eine menschliche Schwäche und Unvollkommenheit bewerten.
Ich möchte jedoch auch ausführen, gegen wen ich nicht schreibe. Ich lebe – wie bereits gesagt – seit 1977 durchgehend in Deutschland und habe unzählige (deutsche) Menschen „kennen gelernt“: (Im folgenden Satz schließt mein Plural auch das weibliche Geschlecht mit ein) Klassenkameraden, Lehrer, Nachbarn, Sportskameraden, Arbeitskollegen, Dialogpartner und viele andere mehr.
Einer meiner besten Freunde in der Grundschule war Wilfried. Von der 5. bis zur 13. Klasse waren meine besten Freunde Michael und Francis, aber auch Erdoğan und Nural. O.K., Francis hat eine englische Mutter und die letzten beiden sind Türken, aber ich hatte mehr deutsche Freunde als türkische und hatte in all den Jahren natürlich mehr positive Erlebnisse als negative, so dass ich nicht pauschalisieren und alle Deutsche in einen Topf werfen möchte. Würde ich pauschalisieren, wäre ich nicht anders als jene, die abfällig von „den Türken“ oder „den Ausländern“ reden. All die guten, vernünftigen und freundlichen Deutschen schließe ich sozusagen von meiner Kritik aus, meine aber, dass auch sie hier einiges dazu lernen können. Gehören Sie, liebe Leserin, lieber Leser, also zu den Guten, lesen Sie bitte trotzdem weiter.
Bei den Kurzgeschichten habe ich mich bemüht, eine gewisse Chronologie zu berücksichtigen. Ich hoffe, die LeserInnen können meinen Humor leiden, auch wenn mir einige Male vorgeworfen wurde, nur ich würde über meine eigenen Witze lachen. Da sage ich: „Hahaha, wenigstens einer, der sie versteht.“
Die Türkei hat mein Herz geformt, Deutschland meinen Verstand. Ich kann weder ohne das eine noch ohne das andere Leben. Das macht mir möglich, mit einer besonderen Kunst umzugehen; nämlich der Kunst, die Dinge aus zwei Innenperspektiven zu sehen.
I. KINDHEITSERINNERUNGEN
EIN VATER KANN SEINEM KIND KEIN BESSERES ERBE
HINTERLASSEN ALS EINE GUTE ERZIEHUNG
(Prophet Muhammad)
1. „Wenn du die Deutschen schlägst, dann rufen sie die Polizei“
Früher gab es unter Türken die Vorstellung, dass Deutsche immer gleich die Polizei anrufen würden, wenn ihnen etwas zustößt, so wie man oft hörte, dass Türken immer gleich ihre großen Brüder holen würden. Also, ich habe nie meinen großen Bruder gerufen. Damals, als mir diese Sache mit Melanie passierte, musste ich mir selbst helfen. Ich war so um die vier oder fünf Jahre alt. Melanies Eltern hatten sich bei meinen Eltern beschwert, weil ich Melanie geschlagen haben soll. Mein Vater soll mir dann gesagt haben: „Warum hast du das getan? Was, wenn sie jetzt die Polizei rufen?“
„Wieso?“, soll ich ihm entgegnet haben: „Wenn sie uns schlagen, kommt die Polizei doch auch nicht.“
Als Grund soll ich genannt haben, dass Melanie sich auf mich gesetzt und versucht haben soll, mich zu küssen. Dabei soll sie mir auch Sand in den Mund gefüllt haben.
Später soll ich meiner Mutter gesagt haben: „Wenn ich groß bin, werde ich Jetpilot und bombardiere Melanies Haus.“
Von wegen, schlagt nicht die Deutschen. Später hatte mein Vater auch einmal unseren deutschen Nachbarn geschlagen. Dieser kam gerade von der Arbeit als ich im Sandkasten spielte. Da der Mann betrunken war, hatte ich Angst vor ihm und weinte. Beim Weglaufen hatte ich dem armen Mann auch noch Sand in die Augen geworfen. In diesem Moment kam mein Vater von der Arbeit und hat ihn einmal geboxt. Der Mann ging dann weinend und sagte währenddessen: „Ich wollte doch nur mit ihm spielen.“ Der Arme hatte es gar nicht böse gemeint und ich schmeiße ihm Sand in die Augen und mein Vater verpasst ihm eine. Bis heute erfüllt es mich mit Trauer, wenn ich mich an dieses Erlebnis erinnere.
2. „Ist Allah jetzt in der Türkei geblieben?“
Sehr oft erzählte mir meine Mutter eine interessante Geschichte aus meiner Kindheit. Zum Beispiel wenn ich ihr erzählte, was meine Kinder wieder über Gott gefragt haben, sagte sie: „Als ihr damals (1973) nach Deutschland kamt, hast du mich gefragt »Mama, ist Allah jetzt in der Türkei geblieben?« Als ich dir erklärte, dass Allah auch hier sei, hast du gesagt: »Dann gibt es zwei Allah?« Als ich dann erwiderte: »Nein, es gibt nur einen Allah«, hast du gefragt: »Spricht er denn auch deutsch?« Da antwortete ich: »Ja«. Dann bist du in dein Zimmer gegangen. Als du wieder herauskamst, hast du zu mir gesagt: »Du hast mich angelogen. Ich habe mit Allah gesprochen und Er hat mir nicht geantwortet. Also ist er doch in der Türkei geblieben.«“
3. „Meine Mutter war viel schöner“
Eine der traurigsten Erlebnisse meiner Mutter war das Wiedersehen mit uns, nachdem sie als erste in unserer Familie und völlig alleine nach Deutschland gekommen war. Eigentlich hat sie sich sehr nach uns Kindern gesehnt. Einige Monate später war auch mein Vater nachgereist, doch meine ältere Schwester, mein älterer Bruder und ich waren bei meiner Oma in der Türkei geblieben. Als auch wir einige Monate später nach Deutschland kamen, soll ich meiner Mutter, als sie mich umarmen wollte, eine Ohrfeige gegeben haben. „Wer ist diese Frau?“ wollte ich von meinem Vater wissen. Als er sagte: „Deine Mutter“, soll ich gesagt haben: „Nein, meine Mutter war viel schöner.“ Sie meinte dann, dass die Trennung von uns sie wohl so sehr mitgenommen hatte, dass ich sie nicht gleich wiedererkannt habe.
Als Ende 1973 meine jüngere Schwester geboren wurde, war es für meine Eltern besonders schwierig geworden, sich als voll arbeitende Menschen um vier Kinder zu kümmern, von denen zwei keinen Kindergartenplatz hatten. So mussten wir Kinder 1975 wieder zurück in die Türkei und kamen dann endgültig 1977 nach Hamburg. Meine Eltern hatten in diesen zwei Trennungsjahren viele Nächte Arm in Arm weinend auf dem Sofa verbracht. Nur wer Kinder hat und von diesen selbst nur für sehr kurze Zeit getrennt ist, weiß wie schwierig das ist.