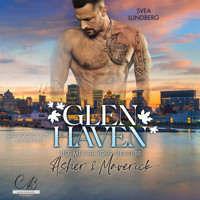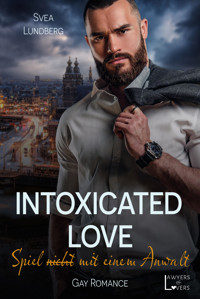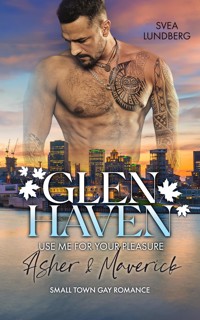4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Traumtänzer-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Pine Ridge Reservation, August 2018 Armut, Drogen, Gewalt, Suizide – Mit dem grausamen Alltag im Indianerreservat will sich Chayton Callahan nicht abfinden. Weniger noch, als er seine Cousine Janice eines Abends auf einem abgelegenen Schrottplatz findet – missbraucht und halb totgeprügelt. Aus bitterer Erfahrung weiß Chayton, dass die hiesige Stammespolizei nichts gegen Janice’ Peiniger wird ausrichten können, sollte es sich wie befürchtet um einen Weißen handeln. Chayton sieht nur eine Chance: Er muss einen Agenten des FBI überzeugen, sich des Falles anzunehmen. Doch Special Agent Logan Harris ist nicht freiwillig bei der Indian Country Crimes Unit gelandet. Schuld waren seine große Klappe und seine direkte Art, Missstände offen anzusprechen. Als sich die beiden Männer zum ersten Mal begegnen, ist schnell klar, dass Welten aufeinanderprallen. Hätten Chayton und Logan nicht ein gemeinsames Ziel, würden sie einander aus dem Weg gehen – oder miteinander ins Bett. Eine Zusammenarbeit scheint unmöglich, doch die wenigen Indizien legen nahe, dass der Täter bald sein nächstes Opfer finden wird. Und so versuchen Chayton und Logan gegenseitige Anziehung und Abneigung gleichermaßen beiseitezuschieben, um in der Trostlosigkeit des Reservats eine weitere Tragödie zu verhindern …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Prolog
1. Kapitel – Logan
2. Kapitel – Chayton
3. Kapitel – Logan
4. Kapitel – Chayton
5. Kapitel – Logan
6. Kapitel – Chayton
7. Kapitel – Logan
8. Kapitel – Chayton
9. Kapitel – Logan
10. Kapitel – Chayton
11. Kapitel – Logan
12. Kapitel – Chayton
13. Kapitel – Logan
14. Kapitel – Chayton
15. Kapitel – Logan
16. Kapitel – Chayton
17. Kapitel – Logan
18. Kapitel – Chayton
19. Kapitel – Logan
20. Kapitel – Chayton
21. Kapitel – Logan
22. Kapitel – Chayton
23. Kapitel – Logan
24. Kapitel – Chayton
25. Kapitel – Logan
26. Kapitel – Chayton
27. Kapitel – Logan
28. Kapitel – Chayton
29. Kapitel – Logan
30. Kapitel – Chayton
31. Kapitel – Logan
32. Kapitel – Chayton
33. Kapitel – Logan
Epilog
Danksagung
Aus dem Verlagsprogramm
TEL
Unter weiten Adlerschwingen
Ein Roman von
Màili Cavanagh und Svea Lundberg
Die Handlung ist frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären zufällig und nicht beabsichtigt.
Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert, eine gewisse künstlerische Freiheit bei einigen Dingen sei uns jedoch zugestanden.
Impressum
Copyright © 2019 Traumtänzer-Verlag
Lysander Schretzlmeier
Ostenweg 5
93358 Train
www.traumtaenzer-verlag.de
© 2019 Svea Lundberg
© 2019 Màili Cavanagh
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte sind vorbehalten.
Alle in diesem Buch geschilderten Handlungen und
Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden
oder verstorbenen Personen sind zufällig und nicht
beabsichtigt.
ISBN: 978-3-947031-23-8 (Taschenbuch)
ISBN: 978-3-947031-24-5 (E-Book mobi)
ISBN: 978-3-947031-25-2 (E-Book ePub)
Covergestaltung: Yvonne Less, Art4Artists
www.art4artists.com.au
Prolog
Ein heißer Tag im Juli neigte sich dem Ende entgegen. Die untergehende Sonne tauchte den Horizont in ein blutiges Rot, gegen das sich die Silhouetten einiger Bisons abhoben, die einst zu tausenden mit ihren Hufen die Erde beben ließen. Der laue Abendwind trug den Klang von Trommeln und alten Liedern über die Ebene des Pine Ridge Reservats.
Chayton versuchte sich auf den monotonen Gesang seiner Brüder zu konzentrieren; auf die Töne der Flöten aus Adlerknochen und das tiefe, beständige Schlagen auf die Pferderohhaut.
Zwei Tage und Nächte tanzte er bereits. Ohne Nahrung zu sich zu nehmen, ohne dass ein Tropfen Wasser seine spröden Lippen benetzt hatte.
Sein muskulöser Oberkörper war mit religiösen Symbolen bemalt und schweißbedeckt. Durch Schnitte in seiner Brust hatte er Holzpflöcke gezogen, an denen Schnüre befestigt waren. Sie führten zu dem Baum in der Mitte des Zeremonienplatzes, der in Chaytons Religion die Weltachse symbolisierte und Verbindung zwischen Himmel und Erde war.
Bis auf einen Lendenschurz aus in vielen Stunden handgegerbtem Leder war er nackt. Die Augen hatte er geschlossen, die langen Haare fielen auf seinen mit Narben übersäten Rücken.
Unbewusst hörte er das Klappern eines Wagens; er kam näher, fuhr vorbei.
Irgendwo bellte ein Hund.
In einem der nahen Häuser wurde ein Radio eingeschaltet. »Hier ist KILI Radio 90.1 …«
Zwei Männer stritten sich lautstark.
Doch schon bald trat all das weit in den Hintergrund.
Er war in Trance.
Wusste sich einerseits im Hier und Jetzt – und andererseits im Nirgendwo.
Er hatte um eine Vision gebeten, die ihm einen Weg zeigen sollte, um seinem Volk zu helfen.
Als einer der wenigen Lakota hatte er es geschafft, einen College-Abschluss zu machen. Er war sogar so gut gewesen, dass es für ein Stipendium gereicht hatte.
Und so hatte er das Reservat verlassen und an der University of South Dakota in Vermillion studiert.
Doch die Welt der Weißen war ihm immer fremd geblieben, war es noch heute, auch wenn er versucht hatte sich anzupassen. Sie war ihm zu laut. Zu grell. Geldgetrieben. Egoistisch. Gefühlskalt.
Also war er zurückgekommen. Aber die Zeit auf der Universität hatte trotz allem ihre Spuren hinterlassen; hatte ihm gezeigt, wie die Menschen lebten, die seinen Vorfahren das Land weggenommen hatten, die so lebten, wie es eigentlich ihnen zustünde. Vieles, was für seine Kommilitonen normal war, war für ihn absoluter Luxus: Essen gehen, einen Kinofilm ansehen, einen Freizeitpark besuchen …
Er war hier in Pine Ridge aufgewachsen, einer der ärmsten Gegenden der Vereinigten Staaten. Er sprach fließend Lakota und Englisch, achtete und lebte die alten Traditionen, während er gleichzeitig die modernen Errungenschaften wie Strom und Telefon nicht missen wollte und nach mehr strebte als das, was er momentan tat und besaß.
Und so fühlte er sich nicht mehr zugehörig. Als würde keine der beiden Welten mehr die seine sein.
Ja, erst nach seiner Rückkehr war ihm bewusst geworden, wie es wirklich um sein Volk stand. Erst jetzt bemerkte er die katastrophalen Zustände, die hier herrschten: die hohe Arbeitslosenquote, die Armut, die Drogenprobleme, die Gewalt, die Ächtung ihrer Kultur, der Verlust ihrer Identität … Eine kulturelle Entwurzelung, die viele in Resignation, Apathie und Depressionen trieb.
Vermillions Zivilisation hatte ihm die Augen geöffnet.
Sein Herz blutete.
Alles in ihm schrie danach, etwas dagegen tun zu müssen. Es konnte, es durfte nicht sein, dass hier und in den anderen Reservaten Kinder starben, weil es so gut wie keine medizinische Versorgung gab; dass alte Männer und Frauen im Winter erfroren, weil ihnen das Geld für Propangas fehlte; dass die Selbstmordrate vier Mal so hoch war wie der Landesdurchschnitt, weil es hier keine Jobs gab …
Seine Gedanken drifteten fort. Sein Geist öffnete sich.
Er sah einen grauen, diffusen Nebel. Sonst nichts. Es war kein Ort – es gab keine Zeit.
Eine Weile schwebte er dahin. Ließ sich treiben, den Pfad suchend, der sein Volk in eine bessere Zukunft führen sollte.
Irgendwann wurden die Umrisse eines Mannes sichtbar; doch sein Gesicht konnte er nicht erkennen.
Etwas Goldenes blitzte auf.
Ein Adler.
Dann begann alles sich aufzulösen.
Chayton verstand nicht. »Hiyá1!«, schrie er in die Dunkelheit.
Aber es war bereits zu spät.
Die Schnur riss; er fiel zu Boden. Blut lief ihm die Brust herab.
Der Gesang verstummte, die Trommeln verklangen.
Für ihn war der Sonnentanz beendet – mit mehr Fragen als Antworten.
~*~
In seiner Hütte brannte Licht!
Reflexartig fuhr Chaytons Hand zu seinem Gürtel, tastete nach einem Messer, doch fand es nicht. Er hatte keines zum Sonnentanz mitgenommen. Im Inneren des kleinen Hauses schwoll das Bellen seines Hundes an und Chayton ließ beruhigt die Hand sinken. Wenn Ringo im Haus war und nicht draußen auf dem Hof, wo er ihn zurückgelassen hatte, als er vor vier Tagen zum Sonnentanz aufgebrochen war, musste ihn jemand hineingelassen haben. Und dieser Jemand war vermutlich Alice. Oder Janice. Sie hatten ihm versprochen, einmal täglich nach seinen Tieren zu sehen – obwohl er wusste, dass sie auch einige Tage ohne ihn zurechtkommen würden. Die beiden Pferde hatten genug Heu und Wasser, Ruby, die Katze, versorgte sich ohnehin weitgehend selbst und kam nur hinein, wenn sie Lust auf menschliche Gesellschaft hatte. Und Ringo? Hatte sich jahrelang ohne einen Besitzer auf den Straßen herumgeschlagen. Er würde klarkommen.
Schweren Schrittes ging Chayton über den sandigen Hof und stieg die wenigen Stufen zum Eingang der Hütte hinauf. Der Sonnentanz hatte ihn erschöpft. Dumpfer Schmerz pochte in seiner Brust, die Schnitte schlossen sich dank der Heilungszeremonie langsam. Die zurückbleibenden Narben würden ihn noch lange an diesen Tanz erinnern. Und daran, dass ihm eine augenöffnende Vision verwehrt geblieben war.
Mühsam zwang Chayton sich, die an seinen Seiten zu Fäusten geballten Hände zu lösen. Er sollte dankbar sein. Dankbar für jede noch so winzige Eingebung, die ihm während der Tage andauernden Zeremonie zuteilwurde. Aber er hatte sich mehr erhofft. Viel mehr.
Mit einem resignierten Laut in der Kehle öffnete er die Tür. Gleich darauf drängte Ringo sich hindurch, sprang um seine Beine und an ihm hoch, ehe er hinaus auf den Hof stürmte und herumzuschnüffeln begann, als wolle er sichergehen, dass tatsächlich nur sein Besitzer diesen betreten hatte.
»Alice?«
Keine Antwort.
»Janice?«
Wieder nichts. Stattdessen ein anklagendes Miauen hinter ihm. Die Rotgetigerte stolzierte an ihm vorbei in die Hütte, würdigte ihn dabei keines Blickes, als sei sie empört darüber, dass er sie vier Tage und Nächte lang alleine zurückgelassen hatte. Als ob es sie stören würde …
In dem kleinen Wohnzimmer brannte eine nackte Glühbirne, die an einem Kabel von der Decke baumelte. Ein flüchtiger Blick zeigte, wer sie angeschaltet hatte: Janice lag auf dem schmalen Zweiersofa, im Halbschlaf tastete sie nach der Katze, die unbeeindruckt quer über sie drüber lief, um sich schließlich auf der Lehne sitzend ausgiebig zu putzen.
Einen langen Moment betrachtete Chayton seine Cousine. Es mochte sowohl dem Anblick des schlafenden Mädchens als auch seiner eigenen Müdigkeit geschuldet sein, dass sich ein gleichermaßen warmes wie drückendes Gefühl in seinem Magen einnistete. Eine seltsame Mischung aus Zufriedenheit, zuhause zu sein und bitterer Traurigkeit und Scham darüber, dass Janice Orte wie diesen ihr Zuhause nennen musste.
Sie war siebzehn. Ging zur Schule – meistens jedenfalls. Sie hatte noch ihr ganzes Leben vor sich. Hatte im Gegensatz zu anderen Teenies im Reservat echte Träume. Ziele, die sie erreichen wollte. Aber ob sie es jemals konnte, darüber wollte Chayton nicht nachdenken.
Er trat zu dem durchgesessenen Sofa und neigte sich zu Janice hinunter, berührte sie vorsichtig an der Schulter. Die Sommernächte in Pine Ridge waren warm; sie trug nur ein dünnes Top. Sein Blick streifte über einen großen blauen Fleck an ihrem Oberarm – vermutlich einer der Gründe, weshalb sie lieber bei ihm auf dem Sofa schlief als in ihrem Zimmer im Haus ihrer Mutter.
»Janice?«
Sie murrte im Halbschlaf.
»Janice, aufwachen.«
Träge blinzelte sie zu ihm nach oben, kniff die Augen zusammen, als Chayton einen halben Schritt zur Seite trat und das matte Licht der Glühbirne auf sie fiel.
»Hab auf dich gewartet. Bin eingeschlafen«, brabbelte sie und streckte sich. »Wie spät ist es?«
So genau wusste Chayton es selbst nicht. Beim Sonnentanz und der anschließendes Heilungszeremonie verlor er jedes Gefühl für Zeit. Für Raum. Und manchmal auch für sich selbst.
»Bald Mitternacht«, vermutete er und ging hinüber in das winzige Badezimmer. »Weiß Alice, dass du hier bist?«
Der Spiegel über dem Waschbecken war nahezu blind. In diesem Moment war er ganz froh darum. Die Wunden auf seiner Brust waren so kurz nach der Zeremonie nicht gerade ansehnlich. Glücklicherweise hatte Janice schon als Kind als Zuschauerin dem Sonnentanz beigewohnt, sodass sein Anblick sie kaum verschrecken konnte. Die Teenies sahen im Reservat weitaus schlimmere Dinge als das.
»Janice?«
Sie erschien neben ihm im Türrahmen, lehnte sich mit mürrischer Miene dagegen.
»Sie kann es sich denken.«
»Hast du ihr Bescheid gesagt?«, beharrte Chayton, ließ kaltes Wasser über seine Hände laufen und neigte sich herab, um sich etwas davon ins Gesicht zu spritzen.
»Nein.« Aus ihrer Stimme sprach Trotz. Von unten herauf warf Chayton ihr einen allessagenden Blick zu, doch er sparte sich jeglichen Kommentar. Janice’ Miene zeigte deutlich, was er dachte: Als ob sie sich wirklich Sorgen machen würde!
Mit einem Schnaufen stieß Janice sich vom Türrahmen ab und ging zurück ins Wohnzimmer, verschwand damit aus Chaytons Gesichtsfeld. Dennoch konnte er überdeutlich vor sich sehen, wie sie sich mit verschränkten Armen aufs Sofa fallen ließ.
»Schickst du mich jetzt nach Hause?«, erklang gleich darauf ihre Frage, deren Antwort sie sowieso kannte. Natürlich würde er sie nicht mitten in der Nacht hinauswerfen, egal wie erschöpft er selbst war und wie sehr er sich nach Einsamkeit und Ruhe sehnte. Merkwürdig, wie sehr man sich etwas wünschen konnte, das man doch tief im Herzen so verabscheute.
»Du kannst hierbleiben«, erklärte er, als er ebenfalls zurück in den Wohnraum trat und Janice wie vermutet auf dem Sofa fand. »Aber morgen früh führt dein erster Weg zu deiner Mutter. Und beim nächsten Mal sagst du ihr Bescheid, wohin du gehst.« Er zögerte einen Moment, setzte dann hinzu: »Egal, ob ihr euch zuvor gestritten habt oder nicht.«
Aus dem Augenwinkel sah er Janice mit verbissener Miene nicken.
»War es schlimm?«
»Was?«
»Der Streit.« Mit einem Kopfnicken deutete er in ihre Richtung. Sie war ein schlaues Mädchen, deutete seine Geste richtig und strich einmal hastig über das Mal an ihrem Oberarm.
»Nicht schlimmer als sonst. Sie hat … mich beim Rauchen hinterm Haus erwischt.«
Im ersten Moment wollte Chayton sie anfauchen, ihr zum wiederholten Mal versuchen klarzumachen, was das verdammte Nikotin anrichten konnte. Doch er tat es nicht. Sie wusste um das, was mit seiner Mutter passiert war. Und er wiederum wusste, dass ihre Beichte vor ihm von tiefstem Vertrauen zeugte. Vor ihm verheimlichte sie nichts. Vor ihrer Mutter jedoch eine ganze Menge. Und Chayton wollte um jeden Preis verhindern, dass sie sich irgendwann auch vor ihm verschloss. Einerseits sicher einem gewissen Egoismus geschuldet, weil es sich einfach gut anfühlte, für jemanden wichtig und eine Bezugsperson zu sein. Vor allem aber, weil er nur so sichergehen konnte, dass Janice nicht wie viele andere Jugendliche im Reservat auf die schiefe Bahn geriet. Er missbilligte es, wenn sie rauchte. Aber viel schlimmer wäre es, würde sie sich tagtäglich betrinken, kiffen oder noch härtere Drogen nehmen. Sich gehen lassen. Abstürzen. Sich der Trost- und Hoffnungslosigkeit hingeben. Er hatte es bei zu Vielen mitangesehen.
»Was hast du die ganze Zeit gemacht, während ich weg war?«, fragte er und riss sich damit selbst aus seinen düsteren Gedanken.
»Vorgestern habe ich euch eine Weile zugeschaut.«
Er hatte sie nicht bemerkt. Natürlich nicht. Keiner der Tanzenden nahm nach Stunden in schmerzvoller Trance noch irgendetwas um sich herum wahr.
»Und heute war ich den ganzen Tag mit Ringo unterwegs. Wir haben geübt. Man-Trailing.« Die Art, mit welchem Stolz sie das letzte Wort aussprach, weckte ein schmerzhaftes Puckern in Chaytons Brust, das ganz sicher nicht den Wunden geschuldet war. Vor Monaten hatte Janice in einer TV-Doku einen Beitrag darüber gesehen, wie Hunde darauf trainiert werden konnten, meilenweit einer bestimmten Spur zu folgen. Wie Hunde auf diese Weise Vermisste gefunden und Menschenleben gerettet hatten. Seitdem hatte sie es sich in den Kopf gesetzt, aus Chaytons Mischling, den er vor zwei oder drei Jahren verletzt und halb verhungert in der Prärie aufgelesen hatte, einen Lebensretter zu machen. Chayton bewunderte sie heimlich für die Energie und den Ehrgeiz, die sie bei dieser Aufgabe an den Tag legte. Er war sich nicht ganz sicher, ob Ringo überhaupt für diese Aufgabe taugte – bislang hatte er ihn nur als Wachhund für seinen Hof eingesetzt und es einfach genossen, einen treuen Vierbeiner an seiner Seite zu haben. Aber wenn Janice ihre Tage damit verbrachte, mit seinem Hund zu trainieren, sollte es ihm nur recht sein. So kam sie zumindest nicht auf leichtsinnige Gedanken.
»Du hörst mir gar nicht richtig zu, hmm?« Aus Janice’ Stimme sprach keinerlei Vorwurf, dennoch fragte Chayton sich sofort, ob er tatsächlich nicht mitbekommen hatte, dass sie noch weitererzählte.
»Tut mir leid. Ich bin … müde.« Resigniert. Enttäuscht. Er führte es nicht weiter aus. »Komm, ich hol dir noch eine Decke und dann gehen wir schlafen.«
Vom Sofa aus nickte Janice ihm zu und gähnte herzhaft, während er sich in das Schlafzimmer zurückzog, das eigentlich mehr eine Kammer war. Darin befand sich eine mit einem fadenscheinigen Laken bezogene Matratze, ein Nachttisch, ein schiefer Schrank und eine wurmstichige Kommode.
Aber dank der Katze zumindest keine Mäuse.
Jedenfalls nicht mehr.
1. Kapitel – Logan
Dass es Frauen gelingen konnte, eine erfolgreiche Karriere beim FBI hinzulegen, war nicht erst seit dem Film ›Das Schweigen der Lämmer‹ bekannt. Logan hatte während seiner Ausbildung auf der Academy so einige Kolleginnen kennengelernt, die mit Sicherheit mehr Eier in der Hose hatten als eine Vielzahl der männlichen Agents. Er hätte persönlich auch nichts dagegen gehabt, das Headquarter des FBI eines Tages in ausschließlich weiblicher Führungshand zu sehen. Einigen seiner männlichen Kollegen würde es vermutlich sogar guttun, von einer taffen Agentin in die Senkrechte gestellt zu werden. Aber möglicherweise hätte er diesen Gedanken nicht laut aussprechen oder wenigstens etwas diplomatischer formulieren sollen.
Gill Subborn, Special Agent in Charge des Field Offices in Minneapolis, saß ihm gegenüber an ihrem Schreibtisch und blätterte in einer Akte. Seiner Akte. Und sie tat es mit einer derart abgeklärten und konzentrierten Miene, als sähe sie die vor sich liegenden Zeilen zum ersten Mal. Und als erschüttere es sie nicht im Mindesten, was Logan seinem Vorgesetzten Joseph Perry an den Kopf geworfen hatte.
Nun, vermutlich tat es das tatsächlich nicht, gestand Logan sich ein. Ihm war bewusst, dass ihm im Kreise seiner engsten Kollegen ein gewisser Ruf vorauseilte. Es war keine wirkliche Überraschung, dass seine vorschnelle Zunge nach inzwischen zwei Jahren bei der Criminal Investigative Division letztlich auch bis zum Headquarter durchgedrungen war. Gill Subborn jedenfalls wunderte sich augenscheinlich nicht über seinen neuesten Ausrutscher.
»Agent Harris«, wandte sie sich nun an ihn und sah ihm direkt ins Gesicht. »Möchten Sie sich zu dem Vorfall, der sich zwischen Ihnen und ASAC Perry ereignet hat, äußern?«
Logan zögerte einen Moment, versuchte abzuwägen, ob es in dieser Situation besser war, den Mund zu halten und gar nichts zu sagen. Aber natürlich entschied er sich dagegen.
»Viel gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen«, meinte Logan und versuchte mit der vagen Aussage, mögliche Klippen zu umschiffen. »SAC Subborn, ich denke, Sie verstehen, in welch angespannter Situation Joseph Perry und ich uns befanden.« Möglicherweise war es den bitteren Erinnerungen an die Kinderleiche geschuldet, dass Logan über seinen Vorgesetzten absichtlich nicht mit dessen offiziellem Titel sprach. Ebenso wahrscheinlich war allerdings, dass ihm schon wieder die Pferde durchgingen, wenn er an Perry dachte und daran, wie schroff er mit der in regelrechte Schockstarre verfallenen Frau umgegangen war, die mit blutverschmierten Händen neben ihrem toten Kind gekniet hatte.
»Was genau wollen Sie damit sagen, Agent Harris?«
Beinahe gewaltsam riss Logan sich von den Bilderfetzen los, die durch seinen Kopf schossen. In seiner Karriere beim FBI hatte er schon mehr als eine Leiche zu Gesicht bekommen und manche waren alles andere als ansehnlich gewesen. Ein totes Kind jedoch war schrecklicher als jede Erwachsenenleiche, ganz egal, wie übel diese auch zugerichtet sein mochte.
Mit Mühe konzentrierte er sich darauf, fest Subborns kühlem Blick zu begegnen.
»Ich will damit nur sagen, dass unser aller Gemüter in diesem Moment möglicherweise etwas überhitzt waren.«
»Das heißt, Sie nehmen zurück, dass Sie …« Ihr Blick huschte eilig, aber nicht fahrig, über die Akte, »… ASAC Perry ein – ich zitiere – ›gefühlloses Stück Scheiße‹ genannt haben?«
Logans Brauen zogen sich für einen Sekundenbruchteil nachdenklich zusammen. Er war sich sicher, Perry als ›einen gefühllosen Wichser‹ betitelt zu haben. Aber wenn es anders in der Akte vermerkt war … Die Akten des Federal Bureau of Investigations logen schließlich nie – offiziell gesehen.
»Nein«, entgegnete Logan mit fester Stimme, »nein, das nehme ich nicht zurück. Ich möchte lediglich klarstellen, dass …«
»Demzufolge lassen Sie Ihre Aussage, Sie würden hoffen, Mr. Perry würde irgendwann von seiner Vorgesetzten – und ich nehme an, Sie meinten mich damit – so hart in den Arsch gefickt werden, dass er endlich etwas anderes spürt, als sein überdimensionales Ego, ebenfalls so stehen?«
Ausgesprochen aus dem Mund der Special Agent in Charge klang die Verwünschung, die er Perry an den Kopf geworfen hatte, tatsächlich ein wenig abstrus. Aber nicht minder erstrebenswert. Gewalt erzeugte kein Mitgefühl für andere, sondern höchstens Gegengewalt, das war Logan klar. Dennoch wäre ihm so manches Mittel recht, um Perry vor Augen zu führen, dass niemand davor gefeit war, vom Schmerz des Verlustes überrannt zu werden. Das Verbrechen machte nicht vor Arroganz Halt. Und schon gar nicht vor der Arroganz derer, die es tagtäglich zu bekämpfen versuchten.
»Nein«, würgte Logan durch seine plötzlich enge Kehle hindurch, »nein, das nehme ich ebenfalls nicht zurück, aber … ich räume ein, dass es unpassend war, Sie in diese Sache mit hineinzuziehen.«
Ein Zucken der Mundwinkel nahm Subborns strengem Gesicht für einen Moment die Härte. Doch ob die Geste tatsächlich amüsiert oder vielmehr mitleidig war, vermochte Logan nicht zu sagen.
»Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Die Sache, wie Sie es nennen, lag ohnehin schon länger auf meinem Schreibtisch. Ihre Akte ist durch Ihren erneuten verbalen Ausbruch lediglich schneller nach oben gerutscht.«
Logan biss sich auf die Zunge, verkniff sich jeden Kommentar. Dass nicht alle Kollegen sein direktes Mundwerk schätzten, war ihm von jeher klar gewesen. Dass sich offenbar schon mehrfach jemand über ihn bei einem der Agents in Charge beschwert hatte, war ihm jedoch neu. Innerhalb der Divisions pflegten die Agents enge Kontakte, oftmals entstanden Freundschaften oder wenigstens Feierabend-Bier-Bekanntschaften. Logan hatte erwartet, man würde persönlich auf ihn zukommen, wenn ein zwischenmenschliches Problem bestand.
»Harris, hören Sie mir zu!« Gill Subborn neigte sich über ihren Schreibtisch hinweg zu ihm. »Bei der Criminal Investigation brauchen wir Leute wie Sie. Leute, die jeden Tag aufs Neue voller Energie und Begeisterung ihren Job verrichten. Leute, die auch in unangenehmen Situationen offen und ehrlich ihren Standpunkt vertreten. Aber was wir nicht brauchen, sind Leute, die sich selbst nicht unter Kontrolle haben.«
Logan öffnete schon den Mund, doch Subborns abwehrende Handbewegung ließ ihn die Lippen gleich darauf fest aufeinanderpressen.
»Sie sind ein guter Agent, Harris. Sie haben ein hervorragendes Gespür, wenn es darum geht, sich an die Fersen eines Täters zu heften. Ihr Gespür dafür hingegen, in welchen Situationen man besser den Mund hält, hält sich mehr als nur in Grenzen.«
Erneut schluckte Logan jedwede bissige Bemerkung hinunter – ganz so als könne er Subborn damit beweisen, dass er sich eben doch am Riemen reißen konnte. Mühsam beherrscht presste er hervor: »Und das heißt?«
»Das heißt, dass ich mich entschieden habe, Sie einer anderen Division zuzuweisen. Einer, bei der Sie Ihren Ermittlerinstinkt ausleben können und bei der es – unter uns gesagt – nicht ganz so dramatisch ist, wenn Sie sich hin und wieder im Ton vergreifen.«
Logans Brauen zuckten bei ihren letzten Worten halb überrascht und halb amüsiert nach oben. In welcher Abteilung des FBI war es bitte mehr oder minder gleichgültig, wenn er Kollegen anschnauzte?
Gill Subborn lehnte sich indessen auf ihrem Bürostuhl zurück und warf Logan einen undefinierbaren Blick zu.
»Sagen Sie, Harris, waren Sie schon mal in South Dakota?«
~*~
»Nicht zu glauben!«, zischte Logan dem Lenkrad, das er mit beiden Händen fest umklammerte, zum wiederholten Mal zu, während er den Ford Crown Victoria den Minnesota State Highway 100 in Richtung Süden hinunterjagte. »Es ist einfach nicht zu glauben!«
Ein Blick in Rück- und Seitenspiegel versicherte ihm, dass ihm keiner der Jungs von der State Patrol auf den Fersen war und er gab noch ein wenig mehr Gas. Nur um gleich darauf zu bremsen und eine Hand vom Lenkrad zu lösen, um die Freisprecheinrichtung zu bedienen. Per Kurzwahl gab er die Nummer des Police Departments von Golden Valles ein. Er hätte gute Lust gehabt, einfach den Notruf 911 zu wählen, denn eine Strafversetzung war in seiner derzeitigen Gemütslage ein verdammter Notfall.
»Golden Valley Police Department, Deputy Barker am Apparat. « Die brummige Stimme des alten Officers kühlte Logans erhitztes Gemüt schlagartig herunter.
»Special Agent Harris«, meldete er sich mit breitem Grinsen, weil es schon vor Monaten zur Gewohnheit geworden war, den besten Freund seines Vaters mit seinem eigenen Dienstgrad aufzuziehen. »Grüß dich, Matt«, schob er gleich darauf versöhnlich hinterher. Er hätte zu gerne ein wenig mit Matt geplaudert, aber immerhin blockierte er mit seinem Anruf gerade die zentrale Nummer des Departments. »Ist mein Dad zu sprechen?«
»Mhm, warte, ich stell dich durch.«
»Danke, Matt.«
Während Logan dem Tuten in der Leitung lauschte, drückte er lautstark auf die Hupe, weil ein Auto vor ihm aus unerfindlichem Grund plötzlich herunterbremste und damit den gesamten Verkehr auf dem Highway ins Stocken brachte.
»Deputy Harris, hallo?«
»Dad, ich bin’s, ich hab … Gottverdammter Idiot!«
Das raue Lachen seines Vaters erklang durch die Leitung und hielt Logan davon ab, dem Kerl beim Überholen den Mittelfinger zu zeigen.
»Hey, Junge, Matt hat mir nicht gesagt, dass du in der Leitung bist. Von wo rufst du an?«
»Auto. Feierabend«, knurrte Logan. Zu seiner Rechten tauchte das Schild der Ausfahrt 42nd Ave/County Rd 9 auf. »Hast du zu tun?«
»Gleich kommt ein Zeuge für eine Aussage vorbei, ja, keine Chance auf einen entspannten Kaffee. Du kannst trotzdem im Department vorbeischauen.«
Kurzentschlossen setzte Logan den Blinker. Normalerweise stattete er dem Department, in dem sein Vater als Police Officer arbeitete, gerne einen Besuch ab. Aber heute zog es ihn nach Hause. Oder in den Boxclub. Er musste Dampf ablassen.
»Ich fahr nach Hause und komm die Tage bei dir und Mom vorbei«, ließ er seinen Vater wissen. »Wollte dir eigentlich nur mitteilen, dass eingetreten ist, was ich befürchtet hatte.«
Ein scharfes Luftholen in der Leitung ließ ihn die Augen verdrehen und ein wenig rasanter als nötig auf die 42nd Ave abbiegen.
»Gill Subborn hat dich versetzt?«
»Strafversetzt«, zischte Logan, »ja, hat sie. Und es ist nicht zu glauben, wohin.«
Stille.
Die Stille vor dem Paukenschlag.
»Zur ICCU.«
Noch immer Stille am anderen Ende der Leitung.
»Indian Country Crimes Unit«, schnauzte Logan der Freisprechanlage entgegen, als müsse er seinem Dad, einem alteingesessenen Cop, erklären, was die ICCU war. Erneut erklang das Schnaufen seines Vaters durch die Leitung.
»Warum regst du dich so auf?«, hakte der nach, klang dabei aber selbst alles andere als ruhig. »Bist du wütend, weil sie dich versetzt hat, oder bist du wütend darüber, wohin sie sich versetzt hat?«
»Beides«, gab Logan bissig zurück und wusste dabei selbst nicht recht, was ihn mehr auf die Palme brachte. Dass Subborn es überhaupt für nötig gehalten hatte, ihn einer anderen Division zuzuweisen. Dass es ausgerechnet die ICCU sein musste. Oder vielleicht sogar der Umstand, dass ihn sein vorschnelles Mundwerk in diese Situation gebracht hatte.
»Ich hab kein Problem damit, für die ICCU zu arbeiten«, erklärte er ein wenig zusammenhangslos und schob hinterher: »Prinzipiell zumindest nicht.«
»Also hast du ein Problem damit.«
Dieses Mal war es an Logan, schwer zu schnaufen.
»Ja«, gab er zerknirscht zu und lenkte den Dienstwagen in die 45th Avenue North in New Hope, seiner Wahlheimat seit inzwischen vier Jahren. »Weißt du, Dad, es ist mir vollkommen egal, ob ich Verbrechen verfolge, die an Weißen begangen wurden oder solche, in denen die indigene Bevölkerung involviert ist. Was mich aufregt, ist, dass Subborn mich nur auf diesen Posten gesetzt hat, weil genügend meiner Kollegen genau das nicht egal ist. Seien wir ehrlich, die Jobs bei der ICCU will keiner. Und jetzt bin ich der Idiot, der in Reservaten herummarschieren und mit semi-motivierten Kollegen zusammenarbeiten darf.« ›Und mit indianischen Cops, die keine Lust auf die weißen Säcke vom FBI haben‹, setzte er in Gedanken hinzu. Er hatte bislang weder im privaten Umfeld noch in seinem Job als Special Agent Berührungspunkte mit der indigenen Bevölkerung gehabt. Doch dass das FBI Straftaten, die auf Reservatsgrund verübt worden waren, mehr als stiefmütterlich behandelte, war ein offenes Geheimnis. Und ein dreckiges noch dazu.
»Verständlich«, vernahm er die tiefe Stimme seines Vaters. »Ich fürchte nur, du kannst jetzt nichts dagegen tun. Lass ein wenig Gras über die Sache wachsen! Mach das, was du immer machst: einen guten Job. Vielleicht merkt Subborn dann, dass deine Division nicht auf dich verzichten kann.«
»Mhm«, brummte Logan und lenkte den Ford Crown Victoria in die Auffahrt vor seinem Haus. »Oder aber, sie stellt fest, dass ich genau der Richtige für die ICCU bin. Wie auch immer ... Dad, ich mach Schluss, bin zuhause.«
»Gut, melde dich bald wieder, mein Sohn!«
»Mach ich immer, weißt du doch. Grüß Mom! Bye.«
Logan stieg aus dem Wagen und schmiss die Fahrertür schwungvoller als notwendig hinter sich zu. Einen Moment lang ruhte sein Blick nachdenklich auf dem schwarzen Ford. Wenigstens hatte Subborn ihm nicht auch einen minderwertigen Dienstwagen zugewiesen.
2. Kapitel – Chayton
Chayton war schon vor Einbruch der Dämmerung wach und versorgte seine Tiere. Zunächst Ringo und anschließend die beiden Pferde. Acatenango und Akira hatte er vor einiger Zeit vor dem Schlachter gerettet – sie hatten nicht die sportlichen Kriterien ihres Züchters erfüllt und waren aussortiert worden. Zuletzt schüttete er ein wenig Trockenfutter in Rubys Napf. Die einäugige Katze war eines Tages plötzlich aufgetaucht, einfach geblieben und hielt seitdem seine kleine Hütte mäusefrei.
Diese lag am Rande von Pine Ridge, dem Hauptort jenes gleichnamigen Reservats, das seine Heimat war. Von ihm gehasst und gleichzeitig geliebt.
Er genoss die Stille, die noch herrschte, bevor die Touristen wie jeden Tag zu Tausenden in Bussen hierhergekarrt wurden und wie Heuschreckenschwärme über sie herfielen. Sie begafften ihn und seine Brüder und Schwestern wie Tiere im Zoo. Fotografierten sie, ohne um Erlaubnis zu fragen; fassten sie an, als wären sie Wesen von einem fremden Planeten.
Was war nur aus ihnen geworden? Aus ihnen, den Oglala-Lakota, diesen einst so stolzen Ureinwohnern dieses Landes, die maßgeblich am Freiheitskampf der Plains-Indianer beteiligt gewesen waren?
Doch so ruhmreich ihre Vergangenheit war – so ungewiss war ihre Zukunft.
Ein leichter Wind kam auf.
Der Wallach schnaubte.
›Verkauft haben wir uns‹, dachte Chayton. ›Unser Land, unsere Seelen – unsere Kultur, unsere Identität. Und wir tun es noch immer. Jeden Tag. Wir tanzen für sie, lassen uns begaffen …‹
Oh, wie er es verabscheute!
Und doch wusste er, dass sie auf die so gewonnen Einnahmen angewiesen waren.
Die Arbeitslosenquote im Reservat lag bei über 80 Prozent, was kein Wunder war, denn Jobs gab es hier nur wenige und die meisten Bewohner arbeiteten außerhalb auf den umliegenden Ranches.
Es gab in dieser Gegend keine Bodenschätze und das Land war größtenteils verpachtet.
Es hatte Jahrzehnte gedauert, bis sich die ersten getraut hatten, eigene Unternehmen zu gründen. Native American Natural Foods vermarktete Tanka Bar, eine traditionelle Speise aus Cranberrys und Büffelfleisch. Und Lakota Solar Enterprises stellte Solarmodule für Heiz- und Kochtechnik her.
Trotzdem lebten mehr als 40 Prozent der Familien unterhalb der Armutsgrenze; in baufälligen Hütten aus Holz oder Wellblech, in ausrangierten Wohnwagen und Trailern, ja sogar in Zelten und Autos. Viele von ihnen ohne Telefon, teilweise sogar ohne Wasseranschluss.
Die Menschen waren arm. Viele vom Alkohol abhängig oder drogensüchtig. Um der Trostlosigkeit zu entfliehen, griffen bereits Jugendliche zu Marihuana oder Methamphetamin.
Chayton konnte sie verstehen.
Hier gab es kaum etwas, womit sie sich die Freizeit vertreiben konnten. Einige Bezirke hatten Jugendzentren, doch es fehlte an Transportmöglichkeiten, damit die Kinder dahin kamen. Und so blieben viele von ihnen zu Hause, spielten, im besten Falle, Basketball, oder hockten vor dem Computer.
Nur die wenigsten von ihnen schafften den Schulabschluss. Wozu auch?
Wer konnte, besserte seinen Lebensunterhalt durch die Jagd auf Kleinwild und durch das Sammeln von Früchten, Samen und Wurzeln auf. Vieles davon zum Eigenbedarf, aber auch zum Verkauf.
Und was die medizinische Versorgung betraf …
Er seufzte, strich Ringo über den Kopf.
Am Himmel zog ein Greifvogel seine Kreise.
Chayton kniff die Augen zu schmalen Schlitzen zusammen. Ein Falke, wenn er sich nicht irrte.
Aber das tat er selten. Die hiesige Flora und Fauna war ihm vertraut; er kannte jeden Felsen, jeden Baum, jeden Fluss im Umkreis von 100 Meilen.
Der Falke stieß hinab, stürzte sich auf seine Beute – vermutlich eine Maus.
Die Katze wandte sich von ihrem noch halb gefüllten Napf ab, rieb ihren Kopf an Chaytons Hosenbein und miaute. Dann setzte sie sich auf die Veranda und begann sich ausgiebig zu putzen.
Es war ein friedliches Bild, das Chayton ein Lächeln entlockte.
Doch es verblasste, als er sich zu dem kleinen Laden aufmachte, um ein paar Dinge einzukaufen.
Aus einem der Wohnwagen, an denen er vorbeikam, drangen laute Stimmen zu ihm heran. Andrew Black Horse stritt mal wieder mit seiner Frau. Irgendetwas flog durch die Fensterscheibe und fiel, zusammen mit einem Regen aus Glassplittern, auf die Erde. Ein Kind begann zu weinen. Vermutlich der kleine Johnny.
Chayton wandte sich ab.
Alles in ihm schrie danach sich einzumischen; das hatte er schon mal getan und es bitter bereut, denn den Preis für sein Eingreifen hatte Ojinjintka bezahlt. Als Andrew wieder zu sich gekommen war, hatte er seine Frau krankenhausreif geschlagen und Chayton gedroht, sollte er es noch mal wagen seine Nase in Angelegenheiten zu stecken, die ihn nichts angingen, würde er ihn umbringen.
Und Chayton war durchaus bewusst, dass er es ernst gemeint hatte. Nicht umsonst hatte Black Horse schon mehr als fünf Jahre im Knast verbracht, unter anderem wegen Körperverletzung.
Chaytons Blick verdüsterte sich; er versuchte die Geister der Vergangenheit zurückzudrängen, doch es gelang ihm nicht.
Sein Vater war ein Trinker gewesen, der sich mit gerade einmal 56 Jahren totgesoffen hatte. Seine Leber hatte nach Jahrzehnten des Konsums irgendwann ihren Dienst eingestellt. Drei Tage hatte er noch im hepatischen Koma gelegen, ehe die Ärzte die lebenserhaltenden Maschinen abgestellt hatten. Es war oft vorgekommen, dass er in seinem Suff seine Frau und seine Kinder angeschrien, beschimpft und verprügelt hatte und nicht selten hatte Chayton zurückgeschlagen; allein schon, um die anderen zu beschützen.
Seine Mutter hatte ihren Mann nur um einige Jahre überlebt, ehe der Krebs sie dahingerafft hatte. Vermutlich würde sie noch leben, wenn sie sich eine Versicherung hätte leisten können und es eine bessere medizinische Versorgung für sie gegeben hätte. Doch es hatte schon eine Ewigkeit gedauert, bis sie überhaupt einen Termin im Pine Ridge Hospital zur Untersuchung bekommen hatte. Nachdem sie das Ergebnis bekommen hatte, war erst relativ spät eine OP gefolgt. Eine Chemo hatte sie sich nicht leisten können. Auch eine professionelle Pflege nicht.
Sie war zu Hause gestorben, unter Schmerzen. Qualvoll. Begleitet von Chayton und seiner Schwester.
Er dachte oft an sie; ja, er vermisste sie noch immer. Ihr Lachen. Ihre Umarmungen. Und – ihren Apfelkuchen, den sie immer zu besonderen Gelegenheiten gebacken hatte.
In Pine Ridge erwachte das Leben.
Die Frauen bauten, in traditionelle Gewänder gekleidet, ihre Stände auf, drapierten ihre Waren. Geflochtene Körbe, gewebte Decken, wunderschön bemalte Schalen aus Ton, bunte Perlenketten, filigrane Traumfänger … Alles, wonach die Touristen verlangten, zu Preisen, die eigentlich lachhaft waren und niemals den emotionalen Wert wiederspiegelten.
Ein Bus näherte sich.
Chayton seufzte und ging zurück, nachdem er alles besorgt hatte, was er brauchte. Er wollte mit den Touristen nichts zu tun haben. Wollte nicht sehen, wie die Kinder bettelten. Denn es brach ihm jedes Mal das Herz.
Er fluchte im Stillen. Über das, was die Weißen ihnen angetan hatten und über seine Hilflosigkeit. Ärgerte sich zugleich über sich selbst, denn zu fluchen war bei seinem Volk verpönt und zeugte von wenig Selbstbeherrschung. Aber er war ja allein und niemand hatte es gehört.
Wütend und verbittert ließ er sich also an dem kleinen, zerkratzten Küchentisch nieder und öffnete den alten Laptop, den die Schule ihm zur Verfügung gestellt hatte.
Ja, auch er konnte sich gegenüber der modernen Technik nicht ganz verschließen, auch wenn der Rest der Hütte den Eindruck machte, als wäre die Zeit stehen geblieben.
Das Wohnzimmer hatte ein zersprungenes Fenster nach Süden hin. Dominiert wurde es von einem ausziehbaren Zweiersofa, demgegenüber ein zerschlissener Sessel mit drei Beinen stand. Vergilbte Telefonbücher bildeten das vierte.
Auf dem niedrigen Couchtisch lagen einige Zeitschriften, die er schon hundertmal gelesen hatte, während eine immer dicker werdende Staubschicht den auf dem Teppich stehenden Röhrenfernseher bedeckte.
Chayton schaltete ihn nur selten ein. Er bevorzugte es, Radio zu hören.
Außerdem gab es noch ein schiefes Regal, in dem einige Bücher standen, die er bereits gebraucht gekauft hatte.
Der Kaffee, den er sich gemacht hatte, war inzwischen kalt. Dennoch schenkte er sich eine Tasse davon ein und trank; verzog das Gesicht, denn er war stark und mittlerweile bitter.
Der Computer brauchte ewig, um hochzufahren.
Zuerst checkte er seine Mails. Doch außer einem halben Dutzend Spam-Nachrichten war nichts von Wichtigkeit dabei.
Sein Bruder saß wegen Drogenhandels im Knast und seine Schwester … Nun, er hatte keine Ahnung, wo seine Schwester gerade war. Sie war mit 16 von zu Hause abgehauen, hatte eine Weile auf der Straße gelebt und wollte Sängerin werden; bis sie einen großen Namen hatte kellnerte sie noch in einem Nachtclub … Sie meldete sich gelegentlich. Meistens, wenn sie Geld brauchte. Erst vor kurzem hatte sie wieder um ein paar Hundert Dollar gebeten.
Als ob er so viel auf der hohen Kante hätte.
Auch wenn er Lehrer war, schwamm er nicht darin. Im Gegenteil – er kam gerade so über die Runden. Nicht einmal um etwas zurückzulegen, reichte es.
Als Einziger in der Familie hatte er es zu etwas gebracht; war vor den Schlägen seines Vaters geflohen und hatte seine Nase in Bücher gesteckt, statt Trost und Vergessen in Drogen oder Alkohol zu suchen. Nur deshalb war sein Schulabschluss so gut gewesen, dass er ein Stipendium bekommen hatte.
Er hatte sehr lange überlegt, was er studieren sollte, um den Menschen hier zu helfen. Denn ihm war in den drei Monaten, die er in einer Pflegefamilie in Edgemont verbracht hatte, nachdem sein Vater ihn halb totgeprügelt und das Jugendamt ihn vorübergehend dort untergebracht hatte, klar geworden, dass es absolut nicht normal war, was in seiner und vielen anderen Familien ablief.
Zum ersten Mal in seinem Leben hatte er Liebe und Zuwendung erfahren.
Doch dann hatte er wieder zurückgemusst. Und das Leben im Reservat mit anderen Augen gesehen. Mit den Augen eines Kindes, das niemals Unbeschwertheit erlebt hatte und das viel zu früh erwachsen geworden war.
Jura, Medizin, Landwirtschaft – er hatte alles in Betracht gezogen und wieder verworfen und war letztendlich bei der Pädagogik hängengeblieben.
In seinen Augen stellte Bildung die Basis für eine gute Zukunft dar.
Lesen, rechnen, schreiben. Wer das konnte, war einigen anderen schon einen Schritt voraus. Wenn er dadurch auch nur einem Kind ermöglichte, diesen trostlosen Ort zu verlassen, hatte er sein Ziel erreicht.
Aber Chayton legte genauso Wert darauf, dass seine Schüler auch die Sprache ihrer Vorfahren lernten. Dass ihnen ihre Herkunft und Kultur bewusst war.
Für viele Kinder war die Schule ein Ort der Sicherheit. Einige von ihnen bekamen hier zum ersten und manchmal auch zum letzten Mal am Tag etwas zu essen, obwohl sie bis zu anderthalb Stunden Schulweg hatten.
Und dennoch war es nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Chayton arbeitete gedankenversunken an den Unterlagen für seinen Unterricht, bis ein Klopfen an der Tür ihn aufschreckte. Er sah auf die Uhr – es war kurz vor zwei. Zu dieser Zeit verirrte sich eigentlich kaum jemand zu ihm.
Ein ungutes Gefühl beschlich ihn, als er aufstand.
Vor seinem Haus stand Alice Red Bird, seine Tante. Das ergraute Haar hing ihr wirr in die Stirn. Die Sachen, die sie trug, sahen aus, als hätte sie sie vor Wochen das letzte Mal gewaschen. Ihre strumpflosen, ungepflegten Füße steckten in Plastiksandalen.
Nun, er war es, zu seinem Bedauern, gewöhnt, sie so zu sehen.
»Ist Janice bei dir?«
Er schüttelte den Kopf. »Nein.«
Alice wühlte in ihrer Handtasche herum; förderte schließlich ein Feuerzeug und eine Packung Zigaretten zutage. »Sie ist letzte Nacht mal wieder nicht nach Hause gekommen. Dachte, sie wäre bei dir«, antwortete sie, zündete den Glimmstängel an, nahm einen tiefen Zug und blies einen Rauchkringel in die Luft.
»Ist sie nicht« Chayton verschränkte die Arme vor der Brust.
»Ob sie sich bei diesem … Teetonkae rumtreibt?«
Chayton seufzte. Alice schien ihre Tochter wirklich nicht gut zu kennen. Das machte ihn wütend und traurig zugleich. »Mit dem ist sie nicht mehr zusammen. Schon seit Monaten nicht mehr«, erwiderte er harscher als beabsichtigt.
»Oh«, war allerdings alles, was sie darauf antwortete.
»Und seit wann genau ist sie weg?«
»Seit gestern. Sie wollte auf ’ne Party.«
Besorgnis machte sich in Chayton breit.
»Bei wem?«
»Bei den Hancocks.«
Janice war jung und vergaß gerne mal die Zeit. Aber abhauen? Einfach so? Ohne dass es einen ersichtlichen Grund dafür gab? Nein, so schätzte er sie nicht ein. Wenn sie mal wieder Abstand von zuhause brauchte, kam sie zu ihm.
»Hast du nachgesehen, ob irgendwas an Klamotten fehlt?«
»Ist alles noch da.«
Chaytons Besorgnis wuchs; wurde zu einem Klumpen in seiner Magengegend. Gedanken kamen in ihm auf, die er eisern zur Seite schob. Es konnte nicht sein, dass Janice wirklich etwas Ernsthaftes passiert war. Nicht Janice …
Er versuchte sich Alice gegenüber nichts anmerken zu lassen. Es würde nichts helfen, wenn sie kopflos im Reservat herumrannte und die Leute verrückt machte.
»Geh du auf jeden Fall zur Stammespolizei und gib eine Vermisstenanzeige auf. Ich pack nur schnell ein paar Sachen und geh sie dann suchen. Sie wird bestimmt nur die Zeit vergessen haben.«
Alica zögerte, nickte dann jedoch, warf die Zigarette auf den Boden, trat sie aus und ging davon.
Chayton packte hastig seinen Rucksack: ein Seil, eine Wasserflasche, einen Erste-Hilfe-Kasten, ein großes Messer, ein paar Vorräte … Er wollte für alle Fälle gerüstet sein.
Es waren schon mal eine paar Jugendliche auf die dumme Idee gekommen, unvorbereitet im Hochsommer in die Badlands zu fahren. Dann war ihnen der Sprit ausgegangen und anstatt an Ort und Stelle zu bleiben und auf Hilfe zu warten, hatten sie sich zu Fuß auf den Weg gemacht und sich verirrt. Eines der Mädchen war an einem Hitzschlag gestorben, die anderen Jugendlichen hatten in letzter Minute gerettet werden können.
»Ú wo1, Ringo! Komm!«
Der Mischling folgte ihm zum Auto und sprang auf die Ladefläche des alten, klapprigen, blauen Pickup Trucks, den Chayton fuhr.
Dieser ließ den Motor an und gab Gas.
Eine Staubwolke wirbelte auf.
Sein erster Weg führte ihn zum Haus seiner Tante. Es war nicht abgeschlossen, und so war es ein Leichtes für ihn, in Janice’ Zimmer zu gelangen.
Er wollte sich selber davon überzeugen, dass alles einen normalen Eindruck machte.
Tatsächlich schien es nicht so, als hätte sie etwas gepackt. Ihre Reisetasche lag im Schrank, die Turnschuhe, die sie sich so sehnlichst gewünscht und die sie zum Geburtstag bekommen hatte, standen neben ihrem Bett.
Chayton biss sich nachdenklich auf die Unterlippe. Sah sich weiter um. Durchwühlte das, was auf ihrem Schreibtisch lag.
Ein paar Mädchen-Zeitschriften. Bücher. Ihre Zeichnungen.
Sie hatte Talent, das musste er ihr lassen.
Eines der Bilder stellte ihn dar.
Er lächelte.
Wurde dann wieder ernst. Er hatte weder ein Tagebuch noch einen Abschiedsbrief finden können.
Das ließ für ihn nur einen Schluss zu: Ihr war etwas passiert.
Gewalt war hier im Reservat an der Tagesordnung. Mord. Suizid. Vergewaltigungen.
Fieberhaft überlegte er, wo er sie finden könnte, ging in Gedanken alle möglichen Orte durch und wollte doch gleichzeitig nicht darüber nachdenken, wo ein Fremder sie hätte hinbringen können, wenn …
Fluchend schlug er mit der flachen Hand gegen die Wand. Sie konnte überall sein! Er hatte keine Spur und Janice wiederum kein Handy. Zumal es wohl ohnehin hoffnungslos gewesen wäre, sie zu versuchen anzurufen.
Er sah zu Ringo, der neben ihm saß.
Dann kam ihm eine Idee.
Aus dem Wäschekorb nahm er sich eines ihrer getragenen T-Shirts; er hoffte so sehr, dass er seinen Plan nicht in die Tat umsetzen musste.
Dann fuhr er zunächst all ihre Lieblingsplätze ab.
Das Diner. Das neu eröffnete Café. Der Sportplatz.
Nichts.
Er wollte die Hancock-Jungs befragen, doch sie waren nicht zu Hause.
Es würde ewig dauern, an jede Tür zu klopfen.
Dabei rann ihm die Zeit davon. Wenn ihr etwas passiert war … wenn sie verletzt war … Hilfe brauchte …
Also musste doch sein Plan B her.
Er hoffte, dass Janice‘ unzählige Man-Trailing Stunden auf fruchtbaren Boden gefallen waren.
Er kniete sich hin und hielt Ringo das gelbe Shirt vor die Nase.
»Na los, Junge, nimm die Witterung auf und dann such! – Iyéya yo2!