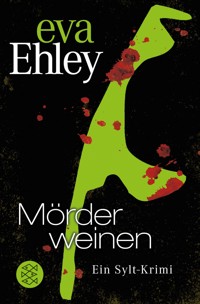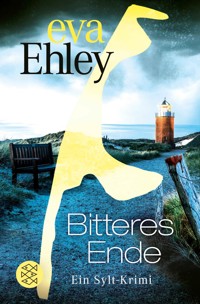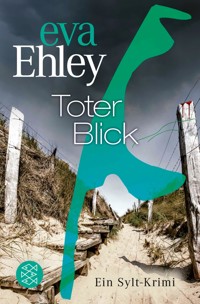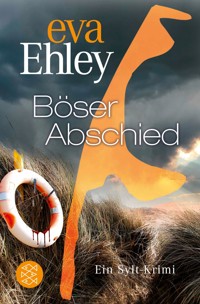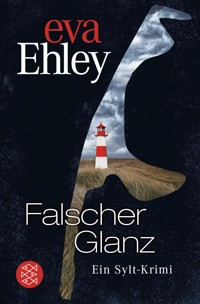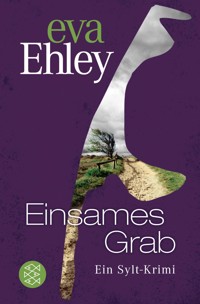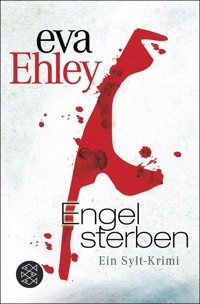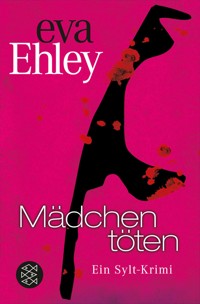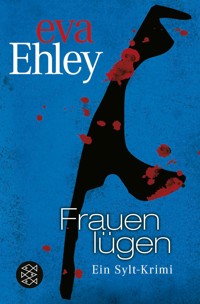9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Jeder hat eine dunkle Seite … Eine durchtanzte Nacht im Berghain. Eine junge Frau. Zuckende Lichter, hämmernde Rhythmen. Dann der totale Blackout. Am nächsten Morgen: Ein ermordeter Taxifahrer. Auf seinem Handy Bilder von nackten Frauenbrüsten. Sie hat noch immer keine Erinnerung. Aber eines der Fotos zeigt ihren Busen. Noch ahnt niemand, dass sie das Opfer viel besser kannte, als alle denken. Doch als die Kripo ihre Fingerabdrücke am Tatort findet, weiß sie, dass sie nur eine einzige Chance hat: Sie muss in ihre eigene Dunkelheit abtauchen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Ehley & Ehley
Verdacht
Roman
Biografie
Nach ihrer überaus erfolgreichen Sylt-Reihe hat Eva Ehley nun ihren Sohn ins Boot geholt. Von London und Berlin aus haben die beiden einen Roman geschrieben, der nicht nur Fans der Sylt-Krimis begeistern wird. Wenn Eva Ehley nicht schreibt, verbringt sie ihre Zeit gern im Garten oder auf Reisen. Ihr Sohn, Philipp Ehley, hat in London Politik studiert und lebt zur Zeit in Paris.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
Verdacht
Prolog
Die Nacht davor
Der erste Tag: Sonntag
Der zweite Tag: Montag
Der dritte Tag: Dienstag
Der vierte Tag: Mittwoch
Der fünfte Tag: Donnerstag
Der sechste Tag: Freitag
Der siebte Tag: Samstag
Verdacht
Prolog
Die ganze Welt glüht. Die Helligkeit schmerzt in Layas Augen, sie brennt sich in ihren Körper. Laya blinzelt und dreht sich weg. Dabei stößt ihr Ellenbogen an etwas Hartes. Eine mannshohe Backsteinmauer, beklebt mit rissigen Plakaten. Dazwischen schimmern zackige Lettern in grellem Pink. Suicide Circus.
Laya liegt auf einem verkommenen Rasenstück. Hinter ihr die Mauer, vor ihr das schrundige Pflaster des Bürgersteigs. Autos und eine Straßenbahn donnern vorbei. Es stinkt nach Benzin und Hundescheiße. Direkt neben Laya vereinen sich am Fuß der Mauer Glasscherben und faulende Weintrauben zu einem grünen Stillleben. Am Himmel geht drohend die Sonne auf. Hell, kalt und klar leuchtet sie jeden Winkel aus.
Laya will sich aufrichten, aber als sie ihre rechte Hand zum Abstützen aufsetzt, durchzuckt sie ein scharfer Schmerz. Die Hand ist blutverkrustet, ein Schnitt zieht sich quer durch den Ballen. Wo kommt das her? Was ist passiert? Stöhnend lässt Laya sich wieder zu Boden sinken. Ein älterer Mann, Kreppsohlen, Cordhose, Windjacke, abgewetzte Aktentasche, mustert sie mit abfälligem Blick und geht weiter, ohne zu fragen, ob er ihr helfen kann. Laya ist froh darüber.
Sie muss sich erinnern. Was ist das Letzte, was sie noch weiß?
Die Schlange vorm Berghain fällt ihr ein, genau, und dann der Ledermantel an der Garderobe. Laya blickt an sich herunter. Den Mantel hat sie an. Immerhin. Aber warum sind ihre Jeans bis zu den Knien schlammbespritzt? Die engen Hosenbeine sind zu harten Krusten getrocknet, eine Rüstung aus Dreck umschließt ihre Waden. Wo bin ich gewesen? Hat es geregnet? Gestern? Heute?
Gedanken wirbeln wild und ziellos durch ihren Kopf. Sie schiebt die heile Hand in die Hosentasche und findet das Handy. Sieben Uhr siebzehn. Dann sieht sie die fünf verpassten Anrufe von David, und ein Teil der letzten Nacht rollt vor ihr ab. Der Türsteher mit dem Gesichtstattoo. Die volle Tanzfläche im Club. Das Tütchen mit dem Pulver. Und alles wegen dieser nervigen Anrufe.
Ich wollte auf keinen Fall mit David reden. … Scheiße!
Die Nacht davor
Auf dem weiten Gelände ist es finster. Die Lichtinseln der Gaslaternen wirken inmitten der Dunkelheit wie uneingelöste Versprechen. Kegelförmig senkt sich das milchig schimmernde Gelb zu Boden, wo es nichts als herumfliegende Plastiktüten, zerborstene Flaschen und ein paar schmierige Verpackungen zu beleuchten gibt. Zwischen den Lichtinseln ist Nacht. Das Areal ist weiträumig von Bauzäunen abgesperrt, an denen überall Fahrräder angeschlossen sind. Dunkel gekleidete Gestalten huschen durch die Finsternis, manche geduckt und hektisch, andere aufrecht und geschäftig. Alle schweigen.
Auch Laya eilt mit gesenktem Kopf über die große Freifläche. Sie steuert das gleiche Ziel wie die anderen an, und vielleicht verschlägt seine erhabene Schäbigkeit ihnen allen die Sprache. Kantig erhebt sich das graue Gebäude gegen den Nachthimmel. Mit seinen vertikal aufragenden Streben wirkt es wie ein strenger Fabrikbau. Oder wie ein Gefängnis. Doch aus den gewaltigen Sprossenfenstern im Obergeschoss dringt zuckendes Licht. Und hinter den dicken Mauern wummern Bässe wie gezähmte Bestien.
Die Schlange vor dem Berghain ist gut sechzig Meter lang, das ist gar nicht mal so viel. Es gehört zur Geschäftspolitik des Clubs, die Schlange nicht abreißen zu lassen. Manchmal wartet man zwei Stunden, und drinnen ist es noch halbleer. Laya ist auch schon hier angekommen, und es standen nur vierzig oder fünfzig Figuren vor ihr. Die Wartezeit blieb die gleiche. Aber jetzt ist Hochsaison. Samstagnacht, kurz nach eins. Partyzeit.
Laya ist eine der wenigen, die allein warten. Ab und an legt sie den Kopf in den Nacken und sieht hinauf zum Berliner Nachthimmel, wo der Mond in seiner eigenen Lichtpfütze schwimmt. Alle Sterne sind weit weg, und wenn Laya nach etwas greifen wollte, würde sie höchstens auf dem schrundigen Asphalt fündig werden. Leere Bierflaschen, zerknüllte Zigarettenpackungen, benutzte Taschentücher, im Wind scheppernde Getränkedosen, der ganze Abfall, den große Menschenansammlungen verursachen, trudelt zwischen den Füßen der Wartenden umher. Viele stehen zu zweit, zu dritt oder in einer größeren Gruppe zwischen den Metallgittern, die den Zugang regeln wie bei der Zollkontrolle am Flughafen. Früher hat diese Ähnlichkeit Laya verwirrt, aber inzwischen leuchtet ihr das Verfahren ein. Es geht auch hier um einen Übertritt, der geordnet vollzogen werden muss. Man betritt nicht nur ein Gebäude, man begibt sich in eine andere Welt mit eigenen Gesetzen. Und wie die Torhüter in den Parabeln stellen die Türsteher des Berghain sicher, dass nur die Richtigen hineinkommen.
Laya macht sich wenig Sorgen darum, ob sie dazugehören wird. Sie ist noch nie abgewiesen worden. Und sie hat es nicht eilig. Sie fühlt sich in der Schlange ganz wohl, nur die Gerüche machen ihr zu schaffen. Parfum, Knoblauch, Schweiß. Die Menschen sind still, fast andächtig. Einige flüstern miteinander, so dass ein ständiges Raunen über den Köpfen schwebt. Es ist, als bewegten sich die Wartenden in einer Blase aus vorsichtigen Tönen auf den Eingang des Clubs zu. Einvernehmlich, friedlich. In ihrem Getuschel dreht es sich immer wieder um das gleiche Thema. Ob man das richtige Styling hat, um Gnade vor den Blicken der Türsteher zu finden. Die meisten Leute sind schwarzgekleidet. Lederhosen, Lackmäntel, Bikerjacken. Viele Nieten, Piercings, Tattoos. Aber es gibt auch Sneaker, löchrige Jeans, einen langen blonden Zopf über einem dunkelblauen Samtcape. Und weiter vorn in der Schlange sieht Laya eine rote Latexhose, einen weißen Disco-Anzug und sogar ein Mädchen im Manga-Kostüm. Leise werden Wetten darauf abgeschlossen, wer von den auffällig Aussehenden abgewiesen werden wird. Laya beteiligt sich schon längst nicht mehr an den Spekulationen. Sie weiß, es ist zwecklos. Wie jeder Torhüter hat auch der Türsteher des Berghain seine eigenen Gesetze, deren innere Logik den normal Sterblichen für immer verborgen bleiben wird.
Laya selbst trägt einen bodenlangen schwarzen Ledermantel, der sie zu einem perfekten Teil der Warteschlange macht. Doch sie hat das Kleidungsstück keineswegs für diese Nacht ausgesucht. Der Mantel begleitet sie schon seit über zwei Jahren; es war ein Glückstag, als sie ihn auf einem Berliner Flohmarkt entdeckt hat. Er ist die perfekte Hülle für Laya, ist ihr Schutz nicht nur vor Kälte und Nässe, sondern auch vor allzu aufdringlichen Blicken, vor der Welt überhaupt. Allein die Berührung des kühlen glatten Leders beruhigt sie. Der Mantel ist Laya längst zur zweiten Haut geworden, und jedes Mal, wenn es Sommer wird und damit definitiv zu heiß, um ihn zu tragen, fehlt Laya etwas, und sie braucht Wochen, um sich an die Nacktheit zu gewöhnen.
Heute Nacht ist der Schutz, den der Mantel ihr gewährt, allerdings löchrig. Denn die Gedanken, die seit Stunden auf sie einstürmen, kann auch er nicht abwehren. Gestern vor zwanzig Jahren ist ihre Mutter gestorben. Katinka die Schöne, Katinka die Kapriziöse. Katinka, die Depressive.
Laya tastet in der Tasche ihres Mantels nach dem Passfoto in dem winzigen Silberrahmen. Sie zieht es hervor und hält es in den Leuchtkegel einer Laterne. Das Glas spiegelt und wirft Reflexe auf Katinkas Gesicht. Trotzdem bleibt das Lächeln der Mutter müde, es wirkt angestrengt und unecht. Dabei war sie, als das Foto entstand, noch jung, genauso alt wie Laya jetzt. Dreiundzwanzig Jahre. Vorsichtig streicht Laya mit dem Daumen über das Gesicht ihrer toten Mutter, das hinter dem Glas geduldig stillhält. Laya muss längst nicht mehr in einen Spiegel sehen, um zu wissen, dass dies auch ihr Gesicht ist. Sie hat die hohe Stirn geerbt, die etwas zu tief liegenden Augen, die gerade Nase mit den weiten Nüstern, die starken Wangenknochen, den geschwungenen Mund. Sie hat auch den zierlichen Körperbau der Mutter geerbt und angeblich sogar ihre sanfte Stimme.
Manchmal sieht Layas Vater seine jüngste Tochter auf eine so seltsame Weise an, dass es schmerzt. Und genau daran will Laya jetzt nicht denken.
Sie lässt das Foto wieder in die Tasche gleiten. Es war dumm, es mitzunehmen, schließlich ist sie hergekommen, um sich abzulenken. Sie ist gekommen, um zu vergessen, um sich zu betäuben, sich zu verlieren in den hämmernden Rhythmen, den krachenden Beats. Sie will ihren Körper so lange schütteln und pushen, bis er abhebt, bis er mit all den anderen Leibern verschmilzt, die sich neben ihr auf der Tanzfläche drängen werden. Laya will sich dem pulsierenden Licht ergeben und den tobenden Tönen mit Leib und Seele ausliefern.
Ein unsanfter Stoß von hinten erinnert sie daran, dass sie aufrücken muss, die gelbe Lichtinsel verlassen und wieder ins Dunkle tauchen. Inzwischen haben neue Partygänger die Schlange um einiges verlängert, und die Türsteher scheinen die Wartenden jetzt schneller einzulassen. Oder abzuweisen. Jeder zweite darf nicht rein. Größere Gruppen schon gar nicht. Laya mustert die Enttäuschten, die sich um Coolness bemühen und nur von ihren schlurfenden, wenig energischen Schritten verraten werden. Sehen sie anders aus als die Erfolgreichen? Vielleicht angespannter. Aber sonst? Es sind sehr attraktive Menschen darunter, auch viele, die Schwarz tragen und sich durch nichts von denen unterscheiden, die hineingelassen worden sind. Die Frau mit dem blonden Zopf und dem Samtcape hat es geschafft. Das Mädchen mit dem Manga-Kostüm nicht.
Als Laya schließlich vor dem Türsteher und seiner Entourage angekommen ist, hebt er für einen Sekundenbruchteil die linke Augenbraue, so dass sich das Gesichtstattoo verzieht. Das Spinnennetz auf der Wange gerät aus dem Gleichgewicht, der Echsenschwanz auf der Stirn zuckt. Dann nickt der Türsteher Laya knapp zu. Sein massiger Körper steckt in einer dunkel schimmernden Ledermontur, auf jedem Finger sitzt ein Silberring, und die Lippen sind mehrfach gepierct. Sven Marquard ist eine Ikone der Berliner Clubszene. Er wird geachtet, geschätzt, gefürchtet, je nach Perspektive. Laya hat ihn wenige Male privat erlebt und kann ihn schwer einschätzen. Er redet nicht viel, scheint aber ein guter Beobachter zu sein.
Taschenkontrolle. Wer Drogen mitbringt, fliegt sofort raus. Die Kameras der Handys werden abgeklebt. Das Bild im Silberrahmen erntet einen erstaunten Blick. »Meine Mama«, murmelt Laya, als wolle sie jemanden vorstellen. Ein Grinsen ist die Antwort. Und Kopfschütteln. Aber sie darf rein.
Laya bleibt stehen und atmet einmal tief durch. Staub, Metall, die Kühle hoher Räume, der Hauch eines Rasierwassers, das scharf und süß zugleich ist. Schnell zahlt Laya den Eintritt, hält die Hand für den Stempel hin, dann geht sie weiter. In dem riesigen Foyer kommt ihr der Sound entgegen. Fordernd und laut. Er knallt ins Blut, er hämmert im Körper. Die Töne wachsen, werden körperlich und hart. Genau so hat sie es gewollt. Genau so braucht sie es heute Nacht. Trotzdem stopft sie sich jetzt zwei kleine gelbe Stöpsel in die Ohren. Nur Irre verzichten auf das Ohropax. Ohne holt man sich leicht einen Hörschaden. Und Laya will durchhalten, abtanzen, bis nichts mehr geht. Mit einer einzigen Bewegung lässt sie den dunklen Mantel von den Schultern gleiten und reicht ihn über die Garderobentheke. Aus dem Augenwinkel sieht sie einen jungen Mann mit Gesichtsmaske und Stachelhalsband, der auf allen vieren unter den Mänteln wartet. Da hat jemand seinen Lustsklaven an der Garderobe abgegeben, denkt sie amüsiert und wendet sich ab.
Zwischen den monströsen Betonsäulen wirken die Leute wie Zwerge. An einer endlos hohen Wand sind auf Hunderten von Aluplatten vergrößerte Schwarzweißfotos angebracht. Die Halle ist dunkel, karg, heilig, von schmutziger Schönheit. In der Luft hängt der Geruch nach Schweiß, Marihuana und Sperma. Zwei schmächtige Jungs schnüffeln an einer Poppersflasche, bevor sie in den Darkrooms verschwinden. Laya war nur einmal kurz dort drin. Es ist schon zwei oder drei Jahre her, und sie braucht das bestimmt nicht noch mal. Zielstrebig steigt sie die Stahltreppe hinauf, der oberen Etage entgegen. Seitlich baumelt eine riesige Gummimatratze an Ketten von der Decke. Vorn öffnet sich die Tanzfläche. Turmhohe Lautsprecher stehen an den Rändern, und unter der Lichtjahre entfernten Decke hängen an langen Stahlleitern weitere Boxen und unzählige Scheinwerfer, die ihre Stroboskop-Prügel auf die wogenden Menschen niedergehen lassen. Leiber zucken, Arme fliegen, Kunstnebel wabert in Schleiern über die Partycrowd. Die Mischung der Leute stimmt, es sind weniger Irre darunter als sonst manchmal. Dafür viele schöne Menschen, Männer und Frauen. Manche sind halbnackt, andere so verschwitzt, dass Kleidung und Haare wirken, als kämen die Leute gerade aus dem Wasser.
Der Untergang der Titanic reloaded in einem stillgelegten Berliner Heizkraftwerk. Der Tempel von Karnak bei Sintflut. Laya hat Mühe, sich nicht von der Wucht der Bässe umhauen zu lassen. Noch ist Platz auf der Tanzfläche, in zwei Stunden wird es hier so gedrängt voll sein, dass man selbst dann nicht umfällt, wenn man ohnmächtig werden sollte. Alles schon vorgekommen.
Ein blendend blauer Lichtblitz zieht Laya zwischen die Tanzenden. Es ist wie ein Sprung in wildes Wasser. Sie taucht in das Meer von Tönen, Licht und Leibern, endloses Hämmern hält sie in Bewegung, wirft sie hin und her, zieht sie hinunter, schleudert sie nach oben. Scheinwerfer kreisen über Köpfen, die unkontrolliert schwingen, ein Ozean aus Haaren und Haut, Mündern und Augen. Alles leuchtet, alles glänzt. Die Beats stanzen Löcher in Layas Hirn. Die Luft um sie herum ist warm und kommt in Schwällen von Licht daher. Der Geruch nach Schweiß und Dope ist noch intensiver geworden. Auf dem Boden liegen winzige Plastiktüten und abgeworfene Kleidungsstücke. Der Atem fließt farbig aus den Mündern, quillt zwischen den Lippen hervor. Gelb, grün, blau. Layas Arme zucken, ihre Beine trommeln, ihr Herz rast. Blitze, Lichtnadeln, Bässe stürzen auf sie ein. Auf sie und die anderen. Lederschwule, Hipster und feengesichtige Mädchen, die aussehen wie vierzehn, Männer mit kohlschwarz geschminkten Augen und aufgespritzten Lippen, Frauen mit rasiertem Schädel. Eine Masse von Körpern, schweißnass und beruhigend warm. Fremde Körper, urvertraut. Sie alle singen, nicken, toben, hüpfen, wiegen sich. Eine wogende Wand aus Fleisch, animalisch und einander zugetan, einig im Feiern der Musik.
Schnell klebt das Tanktop an Layas Brüsten, sitzt die Röhrenjeans auf nasser Haut. Sie arbeitet sich ganz nach vorn durch. Links ist die Bärenecke. Dort feiern die bad boys. Sie sind die Urbevölkerung des Berghain. Schwul, bärtig, muskulös oder fett, oft beides gleichzeitig. Einige stecken in ihrer kompletten Ledermontur, andere tragen nur eine Jogginghose auf den Hüften und ein Handtuch um die Schultern. Zwei sind nackt bis auf einen Stringtanga. Einer trägt nicht mehr als eine Uniformmütze auf dem kahlrasierten Schädel und ein Tattoo auf der rechten Arschbacke. Er schwenkt seinen Hintern auffordernd und lässt den Blick kreisen. Als ein fetter Typ mit seinem Handtuch nach ihm schlägt, stößt der Nackte ein jaulendes Triumphgeheul aus. Dann verschwinden beide hinter einer der turmhohen Boxen.
Laya entert den freigewordenen Platz. Manchmal trifft sie als Frau hier vorn ein schräger Blick. Wirklich angepöbelt wird sie aber fast nie, wahrscheinlich weil sie nicht neugierig ist. Laya ist nicht zum Gucken gekommen, sondern um sich zu verlieren. Sie will da sein, wo alles noch echt ist, wo die Ureinwohner feiern. In der Bärenecke ist es fast wie früher, bevor die vielen Touristen das Berghain entdeckt haben.
Gerade legt der DJ noch einen Zacken zu. Das Ohropax scheint sich in Layas Gehörgängen zu pulverisieren. Ihr ganzer Körper vibriert, es fühlt sich an, als hielte jemand einen Massagestab an ihre Haut. Nein, kein Stab, es ist das Handy in ihrer Hosentasche. Hey, das passt sogar zum Rhythmus, denkt Laya und stampft und hüpft weiter. Sie schwingt die Arme und lässt ihren Kopf vom rauen Hämmern der Klänge beherrschen. Hier könnte sie ohnehin nicht reden.
Aber das Handy gibt nicht auf. Und langsam nervt es. Schließlich drängt sich Laya nach hinten, wo es auf dem Weg zu den Klos minimal ruhiger ist. Vor den Toiletten hat sich eine lange Schlange gebildet. Frauen und Männer nutzen die gleichen Räume, denn bei vielen kann man das Geschlecht gar nicht mehr bestimmen. Außerdem muss, wer so ausgiebig schwitzt, ohnehin selten pinkeln. Es gibt anderes, was man besser in der Abgeschiedenheit einer Klokabine erledigt. Koksen, Vögeln, Sterben.
Wieder brummt das Handy. Das Mädchen direkt vor Laya kichert. Es sieht aus wie ein Kind. Ringellocken und Kulleraugen, aber Netzstrümpfe an den Beinen und eine Figur wie eine Barbiepuppe. Laya lehnt sich gegen die Wand und gräbt mit zwei Fingern in ihrer verschwitzten Hosentasche. Gerade jetzt bricht das Vibrieren ab. Sie schaut aufs Display. Es war schon der vierte Anruf von David.
Was ist?, tippt Laya.
Brauche dich, schreibt David zurück. Jetzt gleich.
Laya zögert. Eigentlich sind sie erst für morgen Abend verabredet. Nicht, dass Laya das so gewollt hätte. Aber ausgerechnet heute Nacht hatte David ein Treffen mit einem DJ aus der Karibik vereinbart, das er nicht absagen konnte oder wollte. Angeblich ist dieser Typ längst für Jahre ausgebucht, und David jagt schon ewig hinter einem Termin her. Da war Laya plötzlich abgemeldet.
David hat Kunst studiert und ein bisschen Film gemacht. Sein Geld verdient er mit Werbung, aber eigentlich versteht er sich als Künstler. Und ein- bis zweimal im Jahr arrangiert David an den unterschiedlichsten Orten völlig irre Installationen, in denen ausgewählte Leute feiern können. Ein Parkhaus, das mit Autowracks vollgestopft wird. Ein verlassener Spielplatz, auf dem sich Nutten in Kinderkleidern tummeln. Zu diesen Partys dürfen nur geladene Gäste. Die Wartelisten sind ellenlang, der Eintritt ist horrend, die DJs sind Weltklasse, die Vorbereitungen dauern Monate. Und alle verdienen sich dabei eine goldene Nase. Die zugelassenen Dealer natürlich auch.
Manchmal hilft Laya ihrem Freund bei den Vorbereitungen, manchmal beschimpft sie ihn wegen dieser Partys. Und heute will sie ganz bestimmt nichts davon hören.
Du kannst mich mal, denkt sie und tippt nur ein Wort: Nein.
Hab dich nicht so. Wo bist du? Berghain? Ich schicke jemanden, der dich abholt. David war noch nie besonders kompromissbereit.
Vergiss es.
Laya stopft das Handy zurück in die Tasche. Sie ärgert sich, dass sie überhaupt reagiert hat. Die ganze Nervosität ist wieder da. Warum ist sie nicht auf der Tanzfläche geblieben? Jetzt ist sie raus. Raus und runter, Scheiße nochmal. Dann fällt ihr Blick auf den schmächtigen Typen, der im Gang zu den Klos Zeug vertickt. Normalerweise ist Laya vorsichtig. Sie verliert nicht gern die Kontrolle. Ab und an nimmt sie mal eine Nase mit David, aber nicht oft. Er macht sich ständig lustig darüber, wie spießig sie ist, aber wahrscheinlich mag er das auch an ihr. Laya ist anders als seine restlichen Freunde. Aber jetzt erscheint ihr die Aussicht auf ein bisschen Ruhe, auf tröstliches Vergessen ungemein verlockend. Und was soll schon passieren? Laya kennt sich ganz gut aus, zumindest theoretisch.
Gerade beginnt das Handy wieder zu vibrieren, und Laya schaltet es kurzerhand aus. Jetzt erst recht. Sie nickt dem Schmächtigen zu und gräbt in der Hosentasche nach einem Schein.
»Was brauchst du?« Er stellt seine Frage leise, beiläufig. Hier kauft niemand, dem er groß was erklären müsste.
»Was hast du?«
»Die ganze Palette. E, Koks, Poppers, Keta.« Er deutet ein ironisches Grinsen an.
»Keta ist gut.« Laya hält ihm den Schein hin. Er zieht ein winziges Tütchen aus der Jackentasche. Layas Faust schließt sich um das helle Pulver. Ketamin ist ein starkes Betäubungsmittel, sie wird also eine Weile nicht mehr tanzen können. Aber sie ist ohnehin aus dem Rhythmus, und vielleicht ist es besser, erst mal runterzukommen. Um diese Zeit ist oben bestimmt noch ein Sofa frei. Und der Stempel auf ihrem Handrücken gilt ja bis Montag früh.
Jetzt rückt die Schlange vor, weil zwei Transen endlich ihre Kabinen verlassen haben. Sie tragen Seidenblusen und sehr kurze Röcke, unter denen knochige Knie hervorstaken. Die High Heels sind mindestens Größe zweiundvierzig, und ihr kehliges Männerlachen hallt laut von den gefliesten Wänden wieder. Ihr Make-up ist verschmiert, die Perücken sitzen schief, aber die beiden haben keine Chance, ihr Outfit zu richten. Im Berghain gibt’s keine Spiegel. Nirgends. Keine Spiegel, keine Fotos, keine Filme. Was im Berghain geschieht, bleibt auch im Berghain. Das ist die Bedingung für Ekstase und Absturz.
Endlich wird eine Kabine frei. Durchatmen, trotz Gestank und Dreck. Laya dreht ihren letzten Geldschein zum Röllchen, zieht den Gürtel aus der Jeans und schiebt das Pulver auf der Schnalle zur Linie. Zwei tiefe Nasenzüge und alles ist weg. Jetzt bleiben ihr noch zehn, vielleicht fünfzehn Minuten, um sich ein abgeschiedenes Fleckchen zu suchen, bevor es losgeht. Und dieses Fleckchen wird ganz bestimmt nicht die Klokabine mit ihren Pisseflecken und den bekritzelten Wänden sein.
Laya geht hoch in die Pannebar. Eigentlich heißt sie Panoramabar, weil man hinter den Fenstern ganz Kreuzberg überblicken kann, wenn dann mal die Jalousien hochgehen. Hier oben sind mehr Heteros als Homos, es ist heller als unten, auch die Musik ist nicht ganz so hart, der DJ spielt House anstelle von Techno. An dem langen Bartresen aus Hartgummi hängen ein paar Pärchen ab. Das Grüppchen von aufgebrezelten Girlies in der Ecke ist bestimmt nicht aus Berlin. Die Mädels sind zu blass, zu blond, zu eifrig. Laya tippt auf Skandinavien. Auf Touristen wirkt die Pannebar weniger beängstigend, aber immer noch schrill genug. Von der Decke baumeln alte Plattenspieler an Eisenketten, und an einer Wand hängt das monströs große Foto eines aufreizend gespreizten Männerarsches. Früher sollen dort zwei geöffnete Frauenschenkel den Blick auf eine riesige Scham freigegeben haben, aber das war vor Layas Zeit. Trotzdem muss sie sich das Bild immer vorstellen, wenn sie hier ist.
Auf einem der gemauerten Sofas geht es gerade heftig zur Sache. Ein Muckibuden-Typ besorgt es einem fetten Schwarzen. Die Blondmädchen kichern. Die Pärchen an der Bar ignorieren das Ganze. Laya merkt, wie ihr von Schritt zu Schritt schwindliger wird. Sie hat nicht mehr viel Zeit, bevor das Keta wirkt. Dann also hier. Sie lässt sich auf das Sofa neben den vögelnden Jungs fallen. Die Latexauflage wirkt trotz ihres Gestanks nach ranzigem Fett halbwegs sauber. Laya legt sich auf die Seite, mit dem Kopf zur Wand. Jetzt kann sie ihren Körper kaum noch spüren. Nur ihr Herz, das in wildem Galopp durchs Irgendwo rast, erinnert sie daran, wer sie ist. Oder war?
Panik steigt in ihr auf. Laya sieht, wie zwei Hände sich in die Latexmatte auf dem Sofa krallen. Sind das ihre? Zwei weitgespreizte Frauenschenkel senken sich über sie. Aber die hängen doch gar nicht mehr hier, denkt sie verwirrt, dann ergibt sie sich der beängstigenden Sogwirkung. Was wäre, wenn ich einfach zwischen die Schamlippen kriechen würde? Bevor Laya diesen total verlockenden Gedanken weiterverfolgen kann, wird ihr Kopf schwer, er lässt sich kaum noch drehen. Hektisch wirft sich Laya herum, ihr Blick gleitet die Wände hinauf, flackernde Lichtbahnen auf rohem Beton, und hüpft über die bunt angestrahlten Menschen. Dann fließen die Farben aus den Dingen, werden fahl und blass, wie auf brüchige Seide gemalt. Alle Bewegungen verlangsamen sich, die Töne ebben ab. Die ganze Welt läuft in Zeitlupe und bleibt schließlich stehen. Laya schwebt in einem leeren Raum, schalltot und kalt. Es riecht nach Verwesung, aber nur von fern. Layas Atem friert, stockt. Sie hechelt, die Luft wird knapp. Kraftlos hebt Laya den Arm. Jemand greift nach ihr und zieht sie hoch, sie fliegt, sie schwebt, sie kracht zu Boden. Die Farben sind jetzt völlig weg. Das Grün, das Blau, das Gelb.
Nur Weiß bleibt.
Und Rot.
Und dieser Mann. Er schwimmt mit Laya im Nichts. Ihre Bewegungen sind simultan, langsam und sanft, sie haben alles Rot der Welt für sich gepachtet, sie baden in der Farbe, das Rot fließt über ihre Körper, vereinnahmt sie und lässt sie in unendlicher Ruhe strahlen. Schön. Laya sinkt in dieses warme, tröstliche Rot, das jetzt einen leisen Ton von sich gibt. Surrend gleichmäßig. Sich erhebend und dann wieder senkend. Der Ton kommt aus ihr selbst, sie hebt und senkt sich mit ihm. Brust, Schultern, Arme. Ihr Atem. Blau und warm fließt er aus ihr heraus, hüllt den anderen ein, schiebt sein Rot ins Violette. Kardinalsfarbe, Tod und Leben. Ewigkeit.
Laya möchte den Kopf zur Seite sinken lassen, sie möchte sich legen, sich eingraben in diese Ewigkeit, aber ein schriller Pfiff lässt sie auffahren. Gelb, hart, scharf. Nadelstiche am ganzen Körper. Sie keucht und beginnt zu schwitzen, Bäche von stinkendem Wasser fließen an ihr herab. Sie wirft den Kopf herum und stößt sich panisch ab, sie zwängt sich ins Dunkel, findet den Spalt zwischen den Schamlippen an der Wand und schlüpft hindurch. Doch dahinter ist es weder dunkel noch warm. Laut krachend die Töne, kalt die Luft, hart der Beton. Für einen kurzen Moment taucht Laya auf. Sie erinnert sich an die Bank, auf der sie liegt. Berghain, Pannebar. Es ist alles in Ordnung. Du musst dich nur beruhigen und von diesem Horror herunterkommen. Du wirst es schaffen, wenn du nur willst.
Plötzlich sind da streichelnde Hände an Layas Körper. Sanft, einschläfernd. Eine säuselnde Stimme, gedämpftes Licht. Und eine unendliche Mattigkeit. Schwerer, tiefer, dunkler als vorher. Laya wehrt sich nicht mehr, sie lässt einfach los. Und sinkt und sinkt und sinkt. Sie atmet jetzt ganz flach, braucht nur noch ein Minimum an Luft, ihr Körper schwebt, ist ganz Luft und Farbe. Rot und Weiß. Ruhe und Vergessen. Endlich.
Der erste Tag:Sonntag
Die ganze Welt glüht. Die Helligkeit schmerzt in Layas Augen, sie brennt sich in ihren Körper. Laya blinzelt und dreht sich weg. Dabei stößt ihr Ellenbogen an etwas Hartes. Eine mannshohe Backsteinmauer, beklebt mit rissigen Plakaten. Dazwischen schimmern zackige Lettern in grellem Pink. Suicide Circus.
Laya liegt auf einem verkommenen Rasenstück. Hinter ihr die Mauer, vor ihr das schrundige Pflaster des Bürgersteigs. Autos und eine Straßenbahn donnern vorbei. Es stinkt nach Benzin und Hundescheiße. Direkt neben Laya vereinen sich am Fuß der Mauer Glasscherben und faulende Weintrauben zu einem grünen Stillleben. Am Himmel geht drohend die Sonne auf. Hell, kalt und klar leuchtet sie jeden Winkel aus.
Laya will sich aufrichten, aber als sie ihre rechte Hand zum Abstützen aufsetzt, durchzuckt sie ein scharfer Schmerz. Die Hand ist blutverkrustet, ein Schnitt zieht sich quer durch den Ballen.
Wo kommt das her? Was ist passiert? Warum sind meine Jeans bis zu den Knien schlammbespritzt? Wo bin ich gewesen? Hat es geregnet? Gestern? Heute?
Gedanken wirbeln wild und ziellos durch ihren Kopf. Sie schiebt die heile Hand in die Hosentasche und findet das Handy. Als sie die fünf verpassten Anrufe von David sieht, rollt ein Teil der letzten Nacht vor ihr ab. Der Türsteher mit dem Gesichtstattoo. Die volle Tanzfläche. Das Tütchen mit dem Pulver …
Wenigstens weiß sie jetzt, wo das Loch in ihrer Erinnerung herkommt. Aber so lange? Das Keta hat sie vielleicht um zwei gekauft. Kann auch halb drei gewesen sein. Jetzt ist es kurz nach sieben. Fünf Stunden?
Was ist in dieser Zeit geschehen? Habe ich die ganze Zeit apathisch auf der harten Bank in der Pannebar gelegen und bin durch fremde Galaxien geflippt? Warum erinnere ich mich dann nicht an meinen Aufbruch? Irgendwie muss ich ja schließlich hierhergekommen sein. Oder habe ich randaliert und man hat mich aus dem Club geworfen? Wohl eher nicht. Keta macht niemanden aggressiv. Oder hat jemand mich begleitet, mir vielleicht sogar geholfen? Den Mantel geholt, mich aus der Pfütze gehoben, die meine Jeans eingesaut hat? Könnte sein. Aber wer sollte mich anschließend am Straßenrand zurücklassen wie ein Stück Dreck? Und warum?
Nichts ergibt einen Sinn. Hilflos sieht Laya sich um. Links von ihr mündet die Straße in eine lange Brücke mit Stahlgeländer und hohen Laternen, die sich über ein Gewirr von Gleisen spannt. Darunter liegt eindeutig der Warschauer Bahnhof. Und am anderen Ufer der Spree erkennt Laya die Mercedes-Benz-Arena. Die Welt nimmt Gestalt an. Zum Glück.
Es ist nichts passiert, beruhigt sie sich. Du hast Mist gebaut, aber alles ist gutgegangen, irgendwie bist du sogar an deinen geliebten Mantel gekommen. Man hat dir noch nicht mal das Handy geklaut, obwohl es neu ist und teuer war. Also reg dich ab, und geh nach Hause. Los mach schon. Hab dich nicht so, die Hand heilt wieder. Weiß der Himmel, wo du die aufgeschnitten hast. Vielleicht an den Scherben neben den fauligen Trauben.
Das Herzklopfen nimmt ab. Laya muss nur hinüberlaufen, in die S-Bahn steigen, nach Hause fahren. Sich hinlegen und ausruhen. Sich waschen. Etwas trinken. Wieder zu Sinnen kommen.
Der Weg zur S-Bahn fällt Laya schwer, ihre Beine zittern, und ihr Atem geht stockend. Auf dem Bahnsteig hält sie Abstand zu den anderen Wartenden, als seien es Feinde auf Kriegspfad. Der billige Weichspülerduft ihrer Jacken wabert durch die Morgenkälte und erinnert Laya an die Waschküche in ihrem Elternhaus. Erst im Waggon legt sich die Panik. Laya ergattert einen Sitzplatz, sackt in sich zusammen. Mit geschlossenen Augen zählt sie die Stationen. Am Bahnhof Zoologischer Garten steigt sie aus. Unterhalb des Bahnsteigs erstrecken sich in einiger Entfernung die Tiergehege. Laya bleibt stehen und blickt über Felsen, Mauern und Wasserbecken. Ein Elefant trottet träge aus seinem Haus und schnüffelt an einer Plastiktüte, die der Wind verweht hat. Die Reflexion des Sonnenlichts lässt Glanzpunkte auf seinem Rüssel hüpfen. Nur sehr wenige Menschen sind auf den gekiesten Wegen zu sehen. Auch der Vorplatz des Bahnhofs ist erstaunlich leer. Sonntagmorgen einer Großstadt. Herbstlicht auf den Bäumen und den Gerüsten der Baustellen. Lange Schatten und ein frischer Wind. Die Stadt wirkt sauberer, als sie ist.
Wie betäubt läuft Laya die Treppen zur U-Bahn hinunter. Dort ist alles wie immer. Kaltes Neon und dieser metallische Geruch. Bevor Laya die einfahrende Bahn hört, spürt sie schon den Luftzug. Nach gut zehn Minuten erreicht sie den Wedding. Hier ist alles echt. Nichts geschönt, nichts gehypt. Aus der U-Bahn treten und runterkommen. Keine Rolle mehr spielen, einfach nach Hause gehen.
Unterwegs begegnet Laya dem Schwulenpärchen mit der Bulldogge, das im Nachbarhaus wohnt. Die Männer grüßen, der Hund bellt. Die alte Frau im Zeitungskiosk winkt aus ihrem Fenster. Laya nickt ihr zu und steuert das Mietshaus an, in dem sie wohnt. Als sie in der Manteltasche nach dem Schlüssel tastet, durchfährt sie ein kurzer Schreck. Was, wenn der Schlüssel weg ist? Doch zum Glück ist er da. Abblätternder Lack auf dem Türrahmen und zerschrammte Fliesen unter den Briefkästen. Im Hausflur riecht es nach Keller, nach kaltem Zigarettenrauch und gedünstetem Rotkohl. Keine besonders noble Bleibe, aber besser als der große alte Kasten, in dem sie aufgewachsen ist. Zehlendorf, Dreißigerjahre Villa. Laya fand schon als Kind, dass es dort spukt. Unglückliche Geister schlichen umher. Martin, Layas Vater, hätte das Haus nach dem Tod der Mutter verkaufen sollen. Oder zumindest alles durchrenovieren, um die Geister loszuwerden. Aber ihm war anderes wichtiger, vielleicht hörte er die Geister auch nicht, weil sein Kopf voller Patientenstimmen war.
Layas Wohnung liegt ebenerdig im Hinterhof mit Aussicht auf Mülltonnen und Fahrräder. Die Wohnungstür knarrt beim Öffnen, es ist ein Geräusch, das für Laya zur Heimat geworden ist. Genauso wie das Scheppern der Flaschen im Glascontainer und der leichte Schimmelgeruch, den sie nicht aus der Wohnung vertreiben kann. Die Räume sind dunkel, Layas Höhle. Es ist nicht gerade luxuriös, ein Zimmer, Küche, Bad, aber warm im Winter und kühl im Sommer. Aus der Dusche kommt heißes Wasser, und auf dem Herd pfeift der Teekessel vom Flohmarkt, bis die Pfeife gegen die alten Fliesen knallt.
Als Laya am Küchentisch sitzt, den Teebecher in der linken Hand, und vorsichtig die ersten Schlucke nimmt, ist es acht Uhr zwanzig. Der Schnitt im Handballen scheint nicht sehr tief zu sein, aber die Haut drum herum ist blau angelaufen und schmerzt bei jeder Berührung. Der Tee besänftigt Laya, und sie beschließt, die Geschehnisse der letzten Nacht auf sich beruhen zu lassen. Der Schnitt wird heilen, und sollte eine Narbe bleiben, wird sie verblassen. Never mind.
Laya trinkt den Becher leer, dann schlurft sie hinüber zu ihrem Hochbett. Sie muss sich unbedingt ausruhen, am besten schlafen, tief und traumlos. Als Laya nach der Leiter greift, beginnt ihr Handballen wieder zu pochen, aber es sind nur ein paar Stufen, bis sie sich in ihr Bettzeug wühlen kann. Das Laken riecht muffig, nach Schweiß und Parfum. Laya mag den Geruch, er tröstet sie wie sonst nur David.
David. Bestimmt hat er letzte Nacht Ersatz für sie gefunden. Eines von seinen Groupies, das glücklich war, dem bewunderten Konzeptkünstler nahe zu sein. Oder eine beliebige Clubgängerin. Wahrscheinlich ist David Laya nicht besonders treu, aber sie fragt nicht danach. Sie mag den Sex mit ihm. Langsam, gründlich, lange. Sie wird sich das nicht zerstören.
Laya fühlt, wie sich ihr Kopf entleert. Ihr Hochbett ist ein geschützter Bereich. Der einzige Mensch, der außer David Zutritt hat, ist ihre Mutter. Das kleine Bild im Silberrahmen liegt immer neben der Matratze. In Layas Fiebernächten kann der kühle Rahmen Wunder wirken. Als Laya ihren Vater vor fünf Jahren um das Foto bat, sagte Martin nur Nimm doch ein anderes. Hier guckt sie so traurig. Und Anna, Layas älteste Schwester, bot ihr sofort zwei fröhlichere an. Aber Laya wollte genau dieses haben. Und sie greift nicht nur in ihren Fiebernächten danach. Jetzt geht das natürlich nicht. Das Bild ist schließlich in ihrer Manteltasche.
Oder?
Laya will die Frage verdrängen, ganz bestimmt will sie das, aber gleichzeitig spürt sie schon, wie der Schlaf sich zurückzieht, wie sich Unruhe breitmacht. Sie wird kein Auge schließen können, ohne das Bild neben sich, sie braucht es gar nicht erst zu versuchen. Katinkas Foto ist ihr Einschlaf-Mantra.
Vieles, was nach dem Tod der Mutter geschehen ist, ist immer noch wirr und bedrohlich in ihrer Erinnerung. Genau deshalb ist das Foto neben ihrem Bett so wichtig. Es stellt die Verbindung zu ganz früher her, zu der Zeit, als Katinka noch gesund war. Als das Bild entstand, war Katinka schwanger mit Anna, ihrem ersten Kind. Und vielleicht hat die werdende Mutter geahnt, was sie erwarten würde. Das Foto dokumentiert die Schwelle zur Krankheit, ist durchsetzt mit Ahnungen, aber noch nicht ohne Hoffnung. Das Foto gemahnt Laya daran, dass es eine Phase vor der Katastrophe gegeben haben muss, in der die Mutter an ein erfülltes Leben für sich und ihr ungeborenes Kind geglaubt hat.
Laya seufzt. Geht das schon wieder los? Genau diesem lähmenden Gedankenkarussel wollte sie in der vergangenen Nacht entkommen. Daher das Berghain, daher das Keta. Leise fluchend schlägt Laya die Bettdecke zurück, robbt von der Matratze und steigt die Leiter herunter. Sie ignoriert den Schmerz in ihrer Hand, durchquert das Zimmer, erreicht die Diele und greift in die Manteltasche. Die ist tief, und Laya sucht gründlich, aber außer der wulstigen Naht im Futterstoff, den Laya vor kurzem selbst geflickt hat, ist da nichts zu tasten. Auch die zweite Tasche ist leer.
Das Bild ist weg.
Laya zittert. Ihre Hände sind eiskalt, die Füße auch. Laya sieht an sich hinunter. Das kurze Schlaf-Shirt in verwaschenem Grau, die knochigen Knie, die nackten Füße mit den schwarzlackierten Nägeln. Die Knie sind blau angelaufen. Unter dem Shirt, das sie trägt, zeichnen sich spitz ihre kleinen Brüste ab. Die Warzen sind hart und kribbeln in der Kälte. Nur in dem verletzten Handballen pocht das Blut heiß und stürmisch, als wolle es sie an etwas erinnern. Aber woran?
Sie weiß nicht, wie lange sie schon hier steht. In der Diele neben dem Garderobenständer, an dem ihr Mantel hängt. Der Mantel mit den leeren Taschen. Noch einmal fährt Laya mit beiden Händen hinein. Da ist nichts außer Krümeln und Staubflocken. Langsam geht Laya in die Küche, setzt sich an den wackligen Holztisch und starrt auf seine Maserung. Ringe schlingen sich umeinander, verlieren sich in immer kleineren Kreisen. Ein psychedelisches Muster, das Layas Blicke bindet.
Warum ist das Foto weg, wenn das Handy, der Schlüssel und sogar ihr restliches Bargeld noch da sind? Gibt es vielleicht eine ganz harmlose Erklärung für sein Verschwinden? Kann es aus der Manteltasche gerutscht sein, obwohl die Taschen doch ungewöhnlich tief sind, so dass Layas Hände bis über die Knöchel darin versinken können?
Laya widersteht dem Impuls, sich augenblicklich anzuziehen und zurück zur Warschauer Straße zu fahren. Was soll das bringen, solange sie nicht weiß, wo sie zwischen zwei Uhr nachts und sieben Uhr morgens war? Und vielleicht gibt es in ihrem Elternhaus ja noch eine ähnliche Aufnahme in einer der dunklen Kisten, in denen die alten Fotos völlig chaotisch durcheinanderfliegen, weil Martin es seit Jahrzehnten nicht schafft, sie zu sortieren.
Aber wer weiß, ob die anderen Bilder nicht immer nur die kranke Mutter heraufbeschwören würden? Denn nach der Geburt des ersten Kindes und nach jeder weiteren Geburt wieder holten die großen schwarzen Vögel Katinka und trugen sie fort ins Land der Depressiven und Enttäuschten. Mehrmals musste Layas Mutter in die Psychiatrie, daran konnte selbst Martin nichts ändern, obwohl er damals schon ein renommierter Analytiker war.
Angeblich hat Katinka behauptet, dass die Töchter ihr die Lebensfreude aus dem Körper saugten. Das ist jedenfalls Martin vor einigen Jahren einmal herausgerutscht, auch wenn sich Laya eigentlich nicht vorstellen kann, dass er sich bei solchen Äußerungen nicht streng kontrolliert. Schließlich ist es ein wichtiger Grundsatz seines Berufs, nur die Dinge auszusprechen, die seine Patienten auch ertragen können. Aber vielleicht gilt diese Regel nicht für die eigenen Töchter.
Laya verdrängt den Gedanken. Sie weiß nur, dass irgendein anderes Foto kein Ersatz wäre. Das verlorene begleitet sie seit ihrem Auszug, es ist längst ein Teil ihres Lebens geworden. Und dieses Teil ist jetzt weg.
Laya sitzt ganz still und lässt die Tränen laufen. Sie tropfen vom Kinn auf die Hände, die bewegungslos in ihrem Schoß liegen. Das Salz brennt in der frischen Wunde und erinnert Laya daran, dass sie noch lebt. Die Mutter ist tot, aber sie kann sich wehren. Sie kann etwas verändern, sie kann das Foto suchen oder sich ein neues besorgen.
Die Gedanken trösten sie nicht. Beim Aufstehen fühlt sie sich wacklig auf den Beinen und ist voller Selbstmitleid. Als ihr Handy klingelt, ist sie froh.
»Ja?« Laya erschrickt, so jämmerlich, so bedürftig klingt ihre Stimme.
»Laya? Bist du das?« Am anderen Ende ist nicht Davids weicher Bariton, sondern die immer etwas zu laute Stimme von Anna, der ältesten Schwester. »Laya? Ich habe dich was gefragt.« Die Mischung aus Strenge und Schmeicheln kennt Laya nur zu gut. Anna ist Psychotherapeutin, wie der Vater. Die haben so was drauf. »Laya, jetzt rede doch mit mir. Was hast du? Was ist mit dir los?«
»Ich bin müde«, murmelt Laya und denkt unwillkürlich: Gut, dass mir niemand das Handy geklaut hat. Das iPhone war ein Geschenk von Anna zu ihrem letzten Geburtstag. Viel zu teuer, so nahe stehen sie sich echt nicht. Außerdem ist Laya nicht so ein Technikfreak. Sie wollte das teure Handy erst gar nicht annehmen, aber Anna hat darauf bestanden und ihr sogar geholfen, es einzurichten.
»Habe ich dich aus dem Schlaf geholt? Das tut mir leid.« In Annas Stimme schwingt kein bisschen Bedauern.
»Anna, hör zu, es passt jetzt gerade nicht besonders gut …«
»Ich will dich nicht weiter belästigen. Ich will dich nur daran erinnern, dass wir heute Mittag verabredet sind.«
»Wieso verabredet?«
Anna seufzt. »Hab ich mir gedacht, dass du das vergessen hast. Wir treffen uns zum Essen. Um eins. Hier in der Forststraße.«
Bitte nicht, denkt Laya sofort. Bitte keine von diesen entsetzlichen familientherapeutischen Zusammenkünften. Alles, nur das nicht! Doch bevor sie etwas erwidern kann, bringt Anna die Kanonen in Stellung und präsentiert das einzig gültige Argument. Mama. In Katinkas Namen ist alles durchsetzbar, in Katinkas Namen kann es kein Fehlverhalten geben.
»Mamas Todestag hat sich zum zwanzigsten Mal gejährt. Das solltest du eigentlich wissen. Martin und ich waren bis gestern auf einer Tagung, darum hatten wir schon vor Wochen beschlossen, uns heute gemeinsam zu erinnern.«
»Ja. Ja, natürlich. Ich hab’s nicht vergessen.« Es ist nur eine halbe Lüge. Katinkas Todestag ist stärker in Layas Gedächtnis eingebrannt als ihr eigener Geburtstag. »Kommt Stella auch?«
»Das will ich stark hoffen.«
Da ist er wieder, der Soundtrack ihrer Kindheit. Die gutorganisierte ältere Schwester, die sich angesichts der Ignoranz, Tolpatschigkeit oder Dickköpfigkeit der beiden jüngeren Mädchen selbst bemitleidet und von dem Vater, der mindestens ebenso überfordert ist, maßlos für ihren erzieherischen Einsatz bewundern lässt. Wenn ich nur noch eine Sekunde länger mit Anna reden muss, fange ich an, die Küche zu verwüsten …
»War’s das?« Layas Stimme klingt rau.
»Na ja, nicht ganz. Eigentlich wollte ich …« Anna unterbricht sich, als wisse sie nicht weiter. Dann seufzt sie leise. »Ach, vergiss es. Den Rest sollten wir besser ein andermal besprechen.«
»Okay. Bis später. Grüß Papa.«
Laya starrt erst das Handy, dann die leere Teetasse an. Gleich darauf wird ihr schlecht. Speiübel, schwindlig. Vielleicht ist es einfach nur die Nachwirkung der Droge. Ich sollte etwas essen und mir noch einen Tee machen. Immerhin kann ich nachher nach einem neuen Bild fragen. Macht man so etwas nicht an Todestagen? Ich müsste noch nicht mal den Verlust des alten beichten. Vielleicht sollte ich vorher David anrufen. Ihm mein Leid klagen. Heulen und mich trösten lassen. Laya stellt die Verbindung her und horcht auf das Klingeln. Aber David drückt sie weg. Auch das noch.
Sie geht ins Bad und nimmt zwei hochdosierte Ibus, die hoffentlich gegen die Übelkeit helfen werden. Dann steigt sie wieder die Leiter zum Hochbett hinauf, vermisst sofort das Bild und schnuppert trostsuchend an ihrer Bettwäsche. Ewig lange wirft sie sich von einer Seite auf die andere, bis sie schließlich in einen unruhigen Halbschlaf fällt, der durchsetzt ist mit Szenen aus dem Berghain und einer irrlichternden Präsenz ihrer Mutter.
Katinka, die inmitten der kollektiv zuckenden Tänzer aus ihrem Silberrahmen tritt und mit verbissener Miene beginnt, sich im Zentrum eines Lichtkegels die Kleidung vom Leib zu reißen. Katinka, die laut lachend in einem der Darkrooms verschwindet und auf Layas immer hysterischer werdendes Rufen nicht reagiert. Katinka, die eine dreijährige Laya ungerührt an der Garderobe abgibt. Das Kind weint und streckt die Hände nach der Mutter aus. Dann sieht es, wie frisches Blut über seinen Handballen läuft.
In heller Panik wacht Laya auf. Der Blick auf die Uhr beruhigt sie nicht gerade. Scheiße, es ist schon halb eins, ich werde niemals pünktlich in der Forststraße ankommen.
Laya stolpert die Leiter herunter. Zehn Minuten später trägt sie eine frische Jeans und einen dicken Pullover unter dem Ledermantel, greift nach Schlüssel und Monatskarte und stürmt aus der Wohnung. In der U-Bahn fällt ihr der Albtraum wieder ein, und sie versucht, die Frage zu verdrängen, was Vater und Schwester dazu sagen würden. Stattdessen ruft sie noch einmal David an. Er nimmt nicht ab, schlimmer noch, er war seit gestern Abend nicht mehr online. Arbeitet er noch? Ist er ernstlich sauer auf sie? Sie wird zu ihm fahren müssen, um die Fragen zu klären, doch das geht erst, wenn sie ihren Besuch in der Forststraße hinter sich gebracht hat.
Die Straße, in der Laya aufgewachsen ist, liegt in einem guten Bezirk, auch wenn die Straße selbst nicht besonders schön ist. Etliche der alten Villen wirken vernachlässigt, die Vorgärten verwildert, die Fassaden renovierungsbedürftig. Auch Layas Elternhaus ist in einem schlechten Zustand. Der elefantengraue Putz blättert an den Ecken ab, eine Dachrinne hängt herunter, und die Ziegel sind von einem hässlichen Pilz befallen. Früher war der alte Kasten wenigstens von einem gepflegten Garten umgeben, aber jetzt wuchern Unkraut und wilde Pflanzen zwischen Rosenstöcken und unbeschnittenem Buchs. Weder Martin noch Anna interessieren sich für die Pflege des Grundstücks. Herbstblätter, matschig vom letzten Regen, liegen auf dem Weg zum Haus. Vom Himmel kommt ein giftiges Licht, das wenig mit dem strahlenden Sonnenschein des Morgens gemein hat.
Laya stößt die Gartenpforte auf, die nie verschlossen ist, und sieht, bevor sie klingelt, kurz auf die Uhr. Sie ist eine satte halbe Stunde zu spät. Zwar lächelt der Vater beim Öffnen der Tür, aber seine Umarmung fällt nicht sehr herzlich aus. Er muss seinen großen Körper weit zu ihr herunterbeugen, denn Laya ist mit einem Meter sechzig die kleinste der drei Schwestern. Martin Wolfen ist über eins achtzig groß und hat einen kräftigen Körper. Er ist Mitte sechzig, was man ihm nicht ansieht. Die mittlerweile schütteren Haare trägt er sehr kurz rasiert. Sein flächiges Gesicht ist erstaunlich faltenfrei. Martin murmelt ein vorwurfsvolles »du weißt ja, wie sehr deine Schwester auf Pünktlichkeit achtet« in Layas Ohr und zieht sie dann in die dämmrige Diele des Hauses.
Kochdünste vermischen sich mit Martins holzigem Rasierwasser und zwingen Laya, ganz flach zu atmen. Während sie den Ledermantel auszieht, stürzt Stella aus dem Esszimmer, drängt sich zwischen Vater und Schwester und drückt Laya fest an sich. Stella hat – wie auch Laya – die filigrane Körperlichkeit der Mutter geerbt, allerdings in Verbindung mit den feinen roten Haaren des Vaters. Würden ihre hektischen Bewegungen diesen Eindruck nicht sofort zunichtemachen, könnte man sie für eine klassische English Rose halten. Doch dafür ist Stella zu temperamentvoll. Sie redet viel und oft unüberlegt, was ihr immer wieder Ärger einträgt. Aber Laya und sie haben sich trotz der vier Jahre Altersunterschied schon als Kinder gut verstanden. Sie waren wie eine geheime Festung gegenüber der Ältesten. Auch jetzt gehen sie Arm in Arm ins Esszimmer, gefolgt von ihrem Vater.
Auf dem alten Eichentisch liegt eine gestärkte weiße Decke, an deren Saum unübersehbar das Monogramm der Mutter prangt. Anna hat das rotgemusterte englische Geschirr herausgesucht, das sonst fast nie mehr benutzt wird. Und sie hat das Silber geputzt. Aber in den Ecken des Esszimmers wehen Staubflocken, und ein Geruch nach Mottenpulver hängt über dem Raum.
Anna sitzt sehr aufrecht am Tisch und blickt sie vorwurfsvoll an. Sie ist die Größte der drei Schwestern. Ihr schwerer Körper steckt in grauer Wolle, über der die kräftigen dunklen Haare einen harten Akzent setzen.
»Hallo Anna, alles okay?«
»Es ist bereits fünfunddreißig Minuten nach eins. Ich hoffe, du genießt deinen Sonderauftritt.«
Es ist eine abschließende Feststellung, ein Urteil ohne die Möglichkeit zur Revision. Niemand erwartet eine Erklärung oder gar eine Entschuldigung. Und was sollte Laya auch sagen?
Die U-Bahn ist ausgefallen. Da hat sich jemand vor die Gleise geworfen. Anna würde ihr nicht glauben. Ihr wäre ohne weiteres zuzutrauen, heimlich im Internet zu überprüfen, ob Laya gelogen hat. Laya lügt viel, meist sogar ohne Not, eher aus Faulheit. Weil es oft einfacher ist. Oder lustiger. Aber das ist eine Kategorie, die Anna nie verstehen wird.
Laya wirft der Schwester einen Blick aus den Augenwinkeln zu. Eigentlich weiß sie gar nicht, wie es aussieht, wenn Anna lacht.
Bei Stella dagegen kennt sie alle Emotionen. Freude, Schmerz, Trauer, Wut. Stella ist impulsiv und offen. Sie trägt ihre Gefühle im Gesicht und steht dazu. Obwohl Stella erst siebenundzwanzig ist, hat sie mehr Falten um die Augen als die ältere Schwester. Vermutlich hat sie gut und gern das Dreifache erlebt. Beim Gedanken an Stellas diverse erotische Fehlgriffe muss Laya grinsen. Irgendwie schafft Stella es immer, sich zielsicher den größten Idioten aus der Meute auszusuchen. Aber vielleicht liegt das auch an ihrem Beruf. Stella ist bei der Kriminalpolizei. Da gibt es bestimmt mehr Idioten als anderswo. Laya blinzelt der Schwester zu, worauf Stella mit den Augen rollt. Reg dich bloß nicht auf, du kennst ja Anna und ihre Pingeligkeit soll das heißen.
Stella sitzt Laya an der Längsseite des Tisches gegenüber. Die beiden Schmalseiten gehören Anna und Martin. So hat die Familie gesessen, seit Laya denken kann, also etwa ab dem Tod ihrer Mutter. Als Kind hat Laya sich oft gefragt, wo eigentlich die Mutter ihren Platz hatte. Aber es dauerte Jahre, bis sie es wagte, dem Vater die Frage zu stellen. Martin sah sie für einen Augenblick an, als verstehe er nicht, was sie wolle, dann aber antwortete er mit der größten Selbstverständlichkeit: Na auf deinem Platz, wo sonst?
Und ich?, wollte Laya wissen.
Du warst drei, als sie starb, da hast du in deinem Hochstuhl direkt neben ihr gesessen.
Laya weiß noch genau, was ihr als Erstes durch den Kopf schoss. Ein Wunder, dass Anna sich nicht sofort Mamas Platz unter den Nagel gerissen hat.
Hat Martin das damals in seiner ebenso wortkargen wie bestimmten Art verhindert? Laya wird es nie erfahren. Der Vater kommentiert so etwas nicht. Er redet überhaupt wenig. Auch jetzt ist er seinen beiden jüngsten Töchtern schweigend ins Speisezimmer gefolgt. Die gefüllten Suppenteller stehen bereits auf dem Tisch, darin die klare Brühe mit den hausgemachten Flädle, eine Spezialität aus Katinkas Wiener Heimat, die Anna perfekt zubereiten kann.
Als die Suppenteller leer sind, steht Laya auf, um Anna beim Abräumen zu helfen. Vielleicht kann das die Stimmung auflockern. Die Schwester wirft einen skeptischen Blick auf Layas verletzte Hand, wartet aber mit ihrer Frage, bis sie allein in der Küche sind.
»Was hast du da gemacht?«
Erst jetzt fällt Laya auf, dass weder Stella noch Martin danach gefragt haben.
»Ich bin ausgerutscht. Auf der Straße. Matsch und nasse Blätter. Kannst du dir ja vorstellen.«
Anna nickt, sie sieht nicht überzeugt aus. »Warst du betrunken?«
»Ich bin dreiundzwanzig Jahre alt. Ich weiß, was ich tue«, schießt Laya zurück. »Aber danke der Nachfrage.«
Anna schneidet den Tafelspitz auf und lässt die dunklen Haare wie einen Vorhang vor ihr Gesicht fallen. Ende der Diskussion.
Sie tragen das Fleisch und die Beilagen auf, und alle beginnen schweigend zu essen, sogar Stella ist ruhig. Ab und an treffen sich die Blicke der jüngeren Schwestern. Resignation liegt darin und ein wenig Müdigkeit. Immerhin fragt niemand nach Layas Studienfortschritten. Sie ist jetzt im zehnten Semester, und bis zu ihrer ersten Staatsprüfung wird es noch dauern. Jura interessiert sie einfach nicht, es war lediglich das Studienfach, das am weitesten von Psychologie entfernt zu sein schien. Längst hat sich diese Annahme als fataler Irrtum herausgestellt, was nicht unbedingt zu weiterem Lerneifer beiträgt. Das Wintersemester läuft jetzt seit drei Wochen, und bisher hat Laya diesen Umstand einfach ignoriert.
Schließlich bricht Stella das Schweigen. »Es gibt wieder einen Mann in meinem Leben. Ich möchte ihn euch gern vorstellen. Er kommt nachher zum Kaffee, das ist doch okay?«
»An Mutters Todestag?« Anna zieht scharf die Luft ein.
»Mutters Todestag war gestern«, korrigiert Stella sie.
Schweigen breitet sich aus. Martin legt bedächtig die Gabel aus der Hand. »Ich finde den Termin auch nicht gut gewählt.«
Laya fährt zusammen. Eine Ich-Botschaft. Verbunden mit einer offenen Kritik. Und das von ihrem Vater. Am Todestag der Mutter. Oder fast. Auch Stella blickt erschrocken auf. Sogar Anna runzelt irritiert die Stirn. Doch Martin lässt sich zu keinem weiteren Kommentar hinreißen.
Beim Dessert klingelt Layas Handy. David ist am Apparat. Endlich. Als sie aufsteht, wirft sie ihren Stuhl fast um, so eilig hat sie es. Draußen im Flur ist es dunkel und still, als hielten sie drinnen den Atem an. Unwillkürlich flüstert Laya.
»David, wo warst du den ganzen Tag? Ich konnte dich nicht erreichen.«
»Das ist doch jetzt nicht wichtig.«
Irgendetwas stimmt mit Davids Tonfall nicht. Er redet sonst nicht so. Kalt und abweisend. Das heißt, er redet schon so – mit vielen anderen, aber eben nicht mit Laya.
»Ich möchte es aber wissen.«
David antwortet nicht.
»Was ist los? Sag doch was.«
»Timo ist verschwunden.«
Timo ist Davids bester Freund. Sie kennen sich aus dem Studium, sind sich im ersten Semester über den Weg gelaufen und seitdem unzertrennlich. Laya hat Timo vom ersten Moment an gemocht, aber sie hasst seine Freundin. Constanze ist eine ziemlich erfolgreiche Modefotografin, und darauf bildet sie sich richtig was ein.
»Seit wann denn?«
»Letzte Nacht.«
David klingt, als telefoniere er direkt aus der Vorhölle. Für Sekunden zieht sich Layas Herz zusammen. Was Timo betrifft, ist David empfindlich.
»Vielleicht ist er versackt«, sagt Laya tröstend.
»Das wüsste ich.«
»Ach komm. Selbst Timo hat ein Leben ohne dich.«
Das wollte Laya gar nicht sagen. Viel zu gefährlich. Aber jetzt ist es nicht mehr zu ändern. Und es klang doch ganz harmlos, oder? Schnell schiebt sie hinterher: »Hast du schon mit Constanze gesprochen?«
»Von der weiß ich es ja. Die beiden haben Zoff gehabt, dann ist Timo raus, und seitdem ist er weg.«
»Na bitte. Er ist abgehauen und schmollt jetzt. Geschieht Constanze ganz recht. – Entschuldige, aber du weißt ja, was ich von ihr halte.«
David lacht, es klingt angestrengt. »Was machst du gerade? Kannst du vorbeikommen?«
»Später. Bin noch bei Martin und Anna.«
»Im Horrorhaus? Du Ärmste.«
»Halb so schlimm.« Wieder eine Lüge. »Stella ist auch hier. Aber gegen fünf kann ich bei dir sein. Okay?«
»Passt. Dann gehe ich vorher noch mal zu Coco, die ist ziemlich durch den Wind.«
Laya zuckt die Schultern und verdreht die Augen. Constanze ist ihr egal. Dieses perfekte Getue geht ihr auf die Nerven. Geschieht Constanze ganz recht, wenn Timo sich aus dem Staub gemacht hat.
Als Laya ins Esszimmer zurückkommt, sind die Dessertschälchen abgeräumt. Ihres war noch halbvoll, aber sie wird deswegen keinen Aufstand anzetteln.
»Wollen wir nicht ein paar Fotos von Mama angucken?«, fragt sie in die Stille.
»Jetzt?« Anna klingt, als habe Laya ihr einen unsittlichen Antrag gemacht.
»Wann denn sonst, schließlich hat Stella für nachher noch jemanden eingeladen. Schon vergessen?«
»Wir können in meinem Arbeitszimmer noch einen Espresso trinken. Laya sieht aus, als hätte sie den bitter nötig.« Martin steht auf und verlässt den Raum. Laya hasst es, wenn er in ihrer Anwesenheit in der dritten Person von ihr redet. Aber immerhin rückt er die Fotos raus. Das haben sie auch schon anders erlebt.
Martin Wolfens Höhle ist dunkel und unordentlich. Viel zu dicht vor dem einzigen Fenster steht eine Blutbuche, deren rotes Laub das Licht filtert. Bei Sturm peitschen die Äste gegen die Fensterscheiben, bei Regen kleben die Blätter am Glas fest und trocknen dort, wenn die Sonne wieder scheint. Die Äste gleichen gierigen Fingern, die unablässig am Fenster schaben.
Jetzt sieht Laya nur die Dunkelheit hinter den Fenstern und drinnen das Chaos und den Schmutz. Zwischen Stapeln von Zeitschriften und lose gebundenen Texten stehen benutzte Kaffeetassen und Teller voller Kekskrümel. In den deckenhohen Regalen stapeln sich die Bücher ohne erkennbares System. Aber Martin findet alles, was er sucht, sofort. Gerade greift er zielsicher nach einer Reihe vergilbter Zeitschriften, wirft sie achtlos auf den Boden und zieht dahinter zwei schwarze Kartons mit silbernen Ecken hervor.
Die Mamasärge haben Stella und Laya die Kartons als Kinder genannt, und einmal ist Anna die Hand ausgerutscht, als sie das Wort gehört hat. Es war die einzige Ohrfeige, an die sich Laya erinnern kann.
In den Kartons herrscht Chaos. Verblichene Schnappschüsse und überscharfe Porträts, Kinderbilder der Mutter aus den Sechzigerjahren und Aufnahmen aus dem Park der psychiatrischen Klinik fliegen durcheinander. Martin hat beide Kisten auf den Boden gestellt und sich dann in den Lehnstuhl am Fenster gesetzt, um damit die größtmögliche Entfernung zwischen sich und die Kisten zu bringen. Schweigend beobachtet er seine drei Töchter, die mit ihren Espressotassen am Boden kauern und vorsichtig die Fotos aus den Kästen heben.
»Guck mal, da hat Mama mich auf dem Arm. Oder ist das Laya?«
»Wer ist denn dieser komische Kerl da hinter Mama mit dem Schnauzbart?«
»Du warst als Teenager aber ganz schön fett, Anna.«
»Wie alt mag Mama hier gewesen sein? Achtzehn? Neunzehn? Uns hat’s da bestimmt noch nicht gegeben.«
Die Schwestern bemühen sich um einen lockeren Tonfall. Sogar Anna macht mit. Martin ist ein strenger Hüter der Fotos, und es ist schon vorgekommen, dass er wortlos die Deckel wieder auf die Kisten gestülpt hat.
Laya kniet mit dem Rücken zum Vater und stapelt immer mehr Bilder zwischen sich und der Kiste. Wahrscheinlich wird sie sich nicht trauen, den Vater um ein neues Foto zu bitten, sondern heimlich eines stehlen. Auf einem steht die Mutter ganz dicht neben Anna und sieht ihre älteste Tochter mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Abscheu an. Laya gefällt dieser Blick, er spiegelt ziemlich genau ihre eigene Einstellung zu der Schwester wider. Aber sie will kein Foto, auf dem auch Anna zu sehen ist. Also entscheidet sie sich für ein Bild, das in irgendeinem Wald aufgenommen worden ist. Flirrendes Licht zwischen Ästen und Blättern, Sonnentupfen auf Katinkas Gesicht. Die Mutter lehnt an einer jungen Birke und blickt geistesabwesend zur Seite. Sie wirkt, als sei sie tief in Gedanken versunken und nehme den Fotografen gar nicht wahr.
Laya schiebt das Foto unter ihr Knie. Als die Schwestern genug gesehen haben und die Bilder wieder einräumen, lässt sie es beim Aufstehen zusammen mit einem Taschentuch in ihrer Jeans verschwinden. Niemand merkt etwas. Im Gegenteil, Martins Laune bessert sich sichtlich, als die Töchter sein Arbeitszimmer verlassen. Seine Miene hellt sich auf, er wirkt auf fast verstörende Weise erleichtert und lässt sich sogar zu einem unternehmungslustigen Vorschlag hinreißen.
»Sollen wir noch eine kleine Runde um den Block drehen, bevor Stellas Verehrer kommt?«
Stella verdreht die Augen. »Papa, bitte.«
Aus dem Herbstspaziergang wird dann doch nichts, weil es draußen zu tröpfeln beginnt. Und als es endlich klingelt, steht ein ziemlich nasser Mann vor der Tür. Er wirkt bullig, hat ein kantiges Gesicht und volle, sehr kurz geschnittene Haare, aus denen Wasser rinnt.
»Ein Schirm wäre hilfreich gewesen«, verkündet er unbekümmert und lässt seine Regenjacke auf die Fliesen des Windfangs fallen. Die nasse Hand wischt er an seiner Jeans ab, bevor er Martin begrüßt.
»Leonhard Böll. Leo, wenn Sie wollen. Schön, Sie kennenzulernen.«
Martin nickt und bittet den Gast hinein. Stellas Gesicht wird bei seinem Anblick ganz weich.
»Wie lange kennst du ihn schon?«, flüstert Laya.
»Schon ewig. Ist ein Kollege von der Mordkommission. Aber gefunkt hat es erst vor ein paar Wochen.«
Leonhard Böll hört sich gern reden, und es scheint ihm nicht aufzufallen, dass er von vier schweigenden Tischgenossen genau beobachtet wird. Vielleicht stört es ihn auch nicht. Die meisten seiner Geschichten handeln vom Polizeialltag, sie haben traurige, manchmal auch komische Pointen. Als Martin fragt, ob er gern bei der Kripo arbeite, zuckt Böll die Achseln. Jemand muss es ja machen, kann das heißen, oder auch fragen Sie mich was Leichteres. Martins Miene wirkt plötzlich abschätzig, und Laya muss unwillkürlich an den Wutanfall denken, den er bekommen hat, als Stella nach dem Abitur verkündete, sie wolle sich bei der Kriminalpolizei bewerben.
Anna hat unterdessen eine Sachertorte serviert, die perfekt ist, wie es das ganze Essen war. Laya trinkt noch zwei Tassen Kaffee und langt kräftig bei der Torte zu. Drogen machen Laya hungrig, das kennt sie schon. Vielleicht ist Essen aber auch nur ihre Art, wieder ins normale Leben zurückzufinden. Normales Leben. Von wegen. Eigentlich ist es zum Brüllen. Drei Frauen und zwei Männer sitzen gesittet an einem fein gedeckten Tisch und machen Konversation, während sie sich eigentlich an die Gurgel springen wollen. Zumindest einige von ihnen. Die anderen wollen vermutlich einfach nur weg. Auch Laya. Nur wohin?
Die Erinnerung an die nächtlichen Vorkommnisse erscheint ihr plötzlich wirr und unwirklich. Am liebsten würde sie nicht mehr daran denken. Oder sich eine eigene Wahrheit für die Zeit des Blackouts zurechtlegen. Ich bin auf der Bank im Berghain weggesackt, irgendwann aufgewacht und hab meinen Mantel geholt. Ich war wacklig auf den Beinen und ungeschickt beim Anziehen, deshalb ist das Bild aus der Tasche gerutscht. Auf dem Weg zur U-Bahn hat mich noch mal die Müdigkeit überwältigt, und ich hab mich aufs Pflaster gesetzt. Da muss ich eingeschlafen sein.
Und die schlammbespritzte Jeans? Die Wunde an der Hand?
Zwischendurch muss ich hingefallen sein, bin wahrscheinlich in einer Pfütze gelandet und hab in eine Scherbe gefasst.
So was eben.
Laya greift noch einmal zur Kaffeekanne. Sie wird einfach nicht munter. Mittlerweile fühlt sie sich eher, als sei sie in eine Art Wachkoma gefallen. Die durchgemachte Nacht, die Anspannung des Vormittags und schließlich die Last des Familientreffens haben sie irgendwie betäubt. Sie hört dem Gast, der immer noch seine Polizeigeschichten abspult, schon lange nicht mehr zu, sondern nickt nur noch mechanisch, wenn es alle anderen tun. Ab und an lacht sie pflichtschuldig. Ihre Gedanken sind bei David, und sie linst häufiger als nötig auf ihre Uhr. Gerade will sie sich verabschieden, da trifft sie ein Blick Stellas, der sie stutzig macht. Irritation steht darin und noch etwas anderes, was Laya so schnell nicht zuordnen kann. Mühsam konzentriert sie sich wieder auf den Redefluss von Stellas Freund.
»… und diese ganzen nackten Brüste hatte der Typ auf dem Handy, das müssen Sie sich erst mal reinziehen. Große Möpse, kleine Möpse. Hängebusen und aufgespritzte. Schwarze, weiße, gelbe.« Als er die Irritation im Blick der anderen sieht, fügt Leonhard Böll hinzu: »Nichts für ungut, kleiner Witz. – Japanerinnen haben ja besonders hübsche Nippel, wussten Sie das eigentlich?« Stellas neuer Lover blickt ausgerechnet Anna provokant an und fährt sich durchs inzwischen getrocknete Haar. »Ist übrigens köstlich, diese Torte. Haben Sie die selbst gemacht?«
Anna nickt und wirkt dabei völlig fertig. Wahrscheinlich kann sie sich nicht zwischen feministischem Zorn und Neugier entscheiden