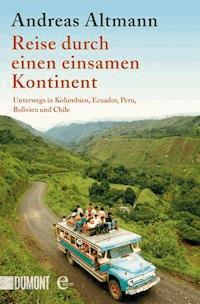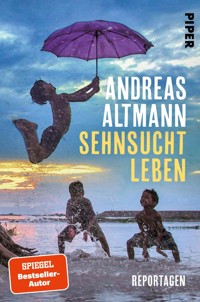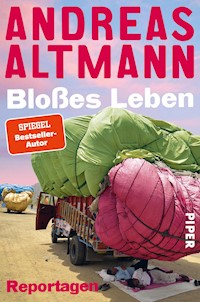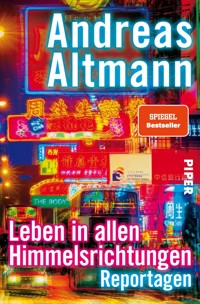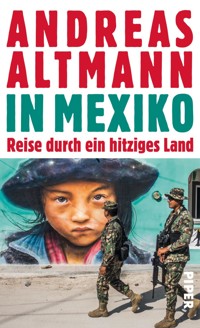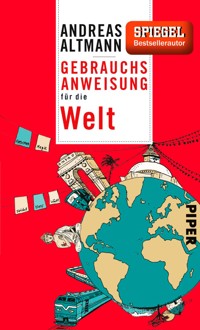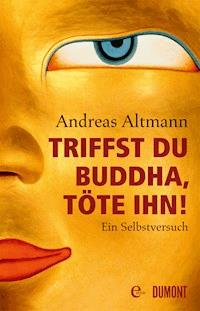9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Andreas Altmann spricht mit Juden, Muslimen, Christen, versucht zu verstehen, was sie bewegt und woher der Hass kommt, der die Palästinner gleichzeitig zu Opfern der israelischen Politik und manchmal zu Tätern macht. Er bereist die Städte und Dörfer mit offenen Augen, rabiat neugierig, immer auf der Suche nach den besonderen Geschichten. Die ihm und uns den Schlüssel in die Hand geben zum Verständnis Palästinas. Und das gelingt ihm in spektakulären Bildern, Erlebnissen und Begegnungen, oft voller Brutalität, oft voller Poesie. Seine klaren und harten Beobachtungen, vor allem seine Schlussfolgerungen werden vielfach Widerspruch hervorrufen, weil der Autor sich von keiner vorgefassten Meinung, Ideologie – und schon gar nicht von einer Religion – den Blick verstellen lässt. Palästina ist eine offene Wunde in der Weltpolitik seit drei Generationen. Auch die große Reportage von Andreas Altmann wird sie nicht schließen können. Aber den Menschen nahekommen, ihr Leben im Schatten der unheilvollen Geschichte und der dunklen Zukunft zu verstehen, das gelingt ihm meisterhaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.deFür meinen Vater, den VerlorenenFür Dich, so nah, so jetztMai 2015ISBN 978-3-492-96679-5© 2014 Piper Verlag GmbH, MünchenCovergestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenCovermotiv: Moises Saman/Magnum Photos/ Agentur FocusKarte: Angelika Solibieda, KarlsruheDatenkonvertierung: Fotosatz Amann, MemmingenAlle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Niemals tut man so vollständig und so gut das Böse,als wenn man es mit gutem Gewissen tut.BLAISEPASCALDer Glaube versetzt Berge. Von Toten. ANONYM
1
Wer ein Buch über diese Weltgegend schreibt, wird scheitern. Israel und Palästina, das ist ein Brandherd, der nicht aufhört zu lodern. Seit über sechzig Jahren entzündet er die Gemüter. Und keine Vision weit und breit, um die zwei Völker zu versöhnen. Unfassbar viele Vernagelte, auf beiden Seiten, versperren den Weg. Unfassbar viele Bücher wurden inzwischen darüber geschrieben. Und keines schien mitreißend genug, sie alle zur Einsicht zu verführen. Ich riskiere es trotzdem: noch ein Buch abzuliefern. Weil mich inzwischen jede Illusion – die Antwort zu finden – verlassen hat. Und weil ich nichts als Geschichten erzählen will. Von den einen, die andere quälen und erniedrigen. Und den anderen, die gequält und erniedrigt werden. Und die Geschichten von Heldinnen und Helden, die es herzzerreißend zäh und tapfer mit ihrer Wirklichkeit aufnehmen. Von Frauen und Männern eben, von denen jeder – all wir anderen – etwas erfahren könnten: über Würde, über Stolz, über schiere Tapferkeit. Und über die Sehnsucht, ein passables Leben zu führen. Klar, vom Irrsinn und der Lächerlichkeit wird auch die Rede sein. Denn das muss man dem winzigen Erdteil lassen: Storys hat er zu bieten, an jedem Eck, zu jeder Stunde.
2
Ruhiger Flug nach Tel Aviv, Ankunft um 2.35 Uhr morgens. Schon auf der ersten Treppe der Ankunftshalle, noch bin ich keine dreißig Sekunden in Israel, werde ich von einem Bewaffneten angehalten. »Your passport!« und »Why are you here?«. Am liebsten würden sie das Land sperren, so unwillkommen scheint man. Dann auf einen hübschen Menschen zugehen, der offiziell und hinter Glas die Pässe prüft. Ich will eisern heiter bleiben. Ich nähere mich lächelnd und bilde mir ein, auf dem Gesicht der jungen Frau für Sekundenbruchteile eine Irritation zu bemerken. Denn eigentlich sollte sie finster sein, den Fremden spüren lassen, dass er unerwünscht ist, nur geduldet. Aber ich bin augenblicklich in Bestform, mein unbeschwertes Grinsen landet und sie lächelt zurück. Sicher bereut sie es gleich. Aber mit einem Lächeln ist es wie mit einem Wort: Jetzt ist es da und nicht wieder wegzumachen. Natürlich muss auch sie die kriegerische Frage stellen: »Why are you here?« Und jetzt antworte ich eiskalt und ernsthaft: »’Cause I like your country.« Den Satz hat sie sicher nicht oft gehört von einem Goi, denkt wohl, dass der Rest der Menschheit Israel für einen Schurkenstaat hält, der mitverantwortlich ist für den Unfrieden in der Welt. Doch jetzt saust der Stempel, begleitet von einem scheuen Wohlwollen. Ich bin entlassen.
3
Glück gehabt. Morgen werde ich in der Zeitung lesen, dass man Touristen – wieder einmal – die Einreise verweigert hat und sie nach stundenlangem Verhör in ein Flugzeug Richtung Heimat verfrachtete. Wer von den Abgeschobenen sein E-Mail-Passwort (sic!) nicht preisgab, galt als jemand, so die Behörden, »der etwas zu verheimlichen hat«. Ich werde auf dieser Reise erfahren, dass der Staat Israel erstaunlich viel zu verbergen hat. Jeder Ausländer gilt folglich und a priori als verdächtig, als Schnüffler, als einer, der Zustände wahrnimmt, die – verhalten ausgedrückt – nachdenklich stimmen.
4
Mit einem Sherut, einem Sammeltaxi, ins siebzig Kilometer entfernte Jerusalem. Ich steige mit einem Rucksack ein und weiß, was jeder (heimlich) denkt: Bombe oder keine Bombe? Die absurde Frage gehört hier zum Alltag. Weil zu oft Selbstmordattentäter vorbeikamen: um Vergeltung zu üben für die Besatzung Palästinas.
Vor mir sitzt ein orthodoxer Jude, Vollbart, Schläfenlocken, man in black: Hut, Jacke, Mantel (im Sommer!), Hose, Strümpfe, Schuhe, alles dunkelschwarz, alles direkt vom Leichenbestatter. Schon die Kleidung – von Kopf bis Fuß – sieht wie eine Rüstung aus, wie eine Barriere nach allen Fronten: um sich vor dem Leben in Sicherheit zu bringen, dem sündenteuflischen. Missmut steigt in mir hoch. Wie immer, wenn ich sehe, wie Religion das Leben in Verruf bringt. Ich würde gern einen Glauben entdecken, der sich nicht nach der »Wiederkunft des Messias« (oder eines anderen göttlichen Rächers) sehnt, nicht nach dem Tod, nicht nach dem – gewiss sterbensfaden – Himmel. Eine Religion, bitte, die das Diesseits verherrlicht und die Liebe zur Welt.
Fahrt über ein schönes Land, die warme Morgensonne hinter den Hügeln. Mein trancemüder Körper, der an Häusern vorbeifährt, deren Fenster bis hinauf in den dritten Stock vergittert sind. Wer durch Israel reist, wird irgendwann die Angst, die unheimliche Angst, verstehen, die hier umgeht. Sie scheint, nein, sie ist der Schlüssel zum »Nahostkonflikt«.
5
Nach einer guten Stunde in Jerusalem. Einchecken in ein Hotel, das im östlichen, muslimischen Teil liegt. Den Israel 1980 annektierte. Dieser Vorgang wird von der internationalen Staatengemeinschaft nicht anerkannt, denn die Palästinenser bestehen ihrerseits auf Ostjerusalem als der künftigen Hauptstadt Palästinas. Dieser Streitpunkt ist eines der entscheidenden Motive der Zwietracht. Keine Seite will nachgeben. Als Außenseiter weiß man nie genau, welches der beiden Lager – Israelis oder Palästinenser – sich bornierter aufführt. Schwer zu sagen, denn sie haben ein Maß an Starrsinn erreicht, das scheinbar nicht mehr zu überbieten ist. Kein Wunder, denn er ist religiös motiviert. Ebenfalls auf beiden Seiten. Denn Jerusalem ist die »heilige« Stadt, mitten im »heiligen« Land. Das klingt nach Realsatire. Müsste man doch lange darüber nachdenken, ob es – wo auch immer – ein Gebiet gibt, auf dem es die letzten paar tausend Jahre unheiliger, mörderischer und erbarmungsloser zugegangen wäre als hier. Mit den drei Monotheismen – Judentum, Christentum und Islam – als Hauptdarsteller. Rastlos verkeilt in »heilige« Kriege.
6
Das Wunder des Reisens. Ich verlasse das Hotel und darf nun alle fünfzig Schritte neue »Bilder« sehen, darf mein Herz bereichern, ja, Gefahr laufen, dass ich etwas nicht verstehe, dass ich überrascht und, wenn ich Glück habe, überwältigt werde. Und ich werde es. Ich gehe durch das Damascus Gate, hinein in den Souk der Altstadt: hundert Gassen, Hunderte Händler, eng, verwinkelt, mit der schönen Aussicht, sich an jeder »Kreuzung« zu verirren. Oder in eine Gruppe Soldaten zu laufen. Mit Sturmgewehren. Das klingt logisch: Wer sich ungesetzlich Besitz aneignet, muss ihn bewachen. Tag und Nacht. Jeder Reisende erfährt gleich zu Beginn, wie schwer bewaffnet das »heilige« Land auftritt. Ach ja, »holy arms« haben sie hier auch.
Aber bald kommt das Warme, so Menschliche: Neben jedem zehnten Stand sitzt ein Mann und verkauft Büstenhalter. Auf keinem Erdteil werden mehr BHs verkauft als auf dem arabischen. Berge von Büstenhaltern verraten Berge von Sehnsüchten. Leider hat Herr Allah beschlossen und als ewige Weisheit von Mohammed verkünden lassen, dass nur verheiratete Brüste angestarrt und geküsst werden dürfen. So liegt er auf jeder dritten Auslage da, der Schwung Spitzenwäsche. Und so gehen minütlich Vulkane voller Lust daran vorbei. Eben jene geschundenen jungen Männer, die stillhalten müssen, bis zur Ehe. Statt Schönheit küssen: immer nur davon träumen. Täglich, nächtlich.
Außerhalb des Bazars, ganz in der Nähe des Jaffa Gate, sehe ich einen Ausschnitt aus dem modernen Leben. Er ist ungeheuer banal und fasziniert gerade deshalb. Direkt vor der Mauer der Altstadt wird im Freien ein Nichts inszeniert, das der Veranstalter, ein Werbefuzzi, pompös »Speeding« nennt. Man denkt an Geschwindigkeit, an Rasen, an Luftanhalten. Und was passiert? 250 Standräder wurden aufgestellt, ungemeine Kräfte walten, Musik plärrt, via Lautsprecher erfolgen Anweisungen, Menschenschlangen bilden sich, Angestellte, Arbeiter und Sicherheitsleute verbreiten die Aura letzter Wichtigkeit, noch mehr Räder treffen ein, Gedränge beim Einlass, Schwitztücher und Mineralwasser stehen bereit, endlich schiebt jemand die Gitter beiseite, das Volk rennt los, man will noch immer glauben, dass eine Sensation – ein Tollkühner segelt mit tausend Luftballons durch die Luft – zum Vorschein kommt, nein, sie schwingen sich auf die Sättel und treten los. Ich frage nach und höre, dass jetzt eine Stunde lang gestrampelt wird. Gemeinsam. Im Stand. Das ist eine hinreißende Metapher, man kann so vieles in ihr lesen.
Ich mache mich auf den Weg zu meinem Hotel. Am Anfang der Salah-an Din Street, gegenüber der Polizeistation, steht eine Gruppe Palästinenser, sie diskutieren. Irgendetwas fällt vor, fünf israelische Soldaten, darunter eine Frau, nähern sich und greifen sich einen Halbwüchsigen heraus. Da ich um Sekunden zu spät kam, kann ich nicht sagen, warum. Der vielleicht Siebzehnjährige wird abgeführt, aber er reißt sich los und verbittet sich, ihn anzufassen. Um die Explosivität der Situation zu verstehen: Jeder Palästinenser, der in Ostjerusalem lebt, betrachtet diesen Stadtteil als den seinen und empfindet nichts als blanke Wut auf die fremde Macht. Natürlich wird Arif – inzwischen hat jemand seinen Namen gerufen – von den fünf überwältigt und Richtung Kommissariat gezerrt. Sie sind in Eile, um dem Volkszorn zu entgehen. Arif wehrt sich weiter, schreit sie an. Mut hat der Junge. Wie eine Stichflamme schießt der Hass aus seinen Augen. Mitten in die Augen seiner Feinde.
In Japan haben sie ein kluges Sprichwort: »Wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, dann sieht alles wie ein Nagel aus«, sprich: Wenn man von keinem anderen Mittel als von Gewalt weiß, dann muss man immer gewalttätig sein. So blind, so misstrauisch, so unbelehrbar ist man geworden.
Spätabends gehe ich nochmals auf die Straße, will lesen und rauchen. Ich frage einen Mann, ob er ein Café kennt, das noch offen hat. Und er nimmt mich bei der Hand, wie einen Sohn. Und wir gehen fünfzig Meter zur nächsten Kreuzung und jetzt kann es Mister Hakim exakt erklären. Ich spüre wieder einmal meine Zuneigung zu alten Männern. Mein unheilbarer Vaterkomplex, die Suche nach dem einen, der beschützt. Ich bilde mir ein, dass diese freundlichen Herren meine Sehnsucht erahnen und deshalb so hilfsbereit reagieren. Mein Wegbegleiter zeigt auf ein Hotel, dort gäbe es eine Dachterrasse.
7
Ich brauche ein paar Tage Ruhe, bevor ich mich monatelang schinde. Im Internet finde ich ein Hotel am See Genezareth, mit Sonne und Pool. Den Namen des Sees hatte ich oft im Religionsunterricht gehört, ich will ihn sehen.
Scharfe Kontrollen am Busbahnhof, mit Metalldetektoren und Röntgengerät. Scharen von Soldaten sind unterwegs. Ich habe einen Fensterplatz. Noch auf dem Weg dorthin fällt mein Blick auf schöne Israelinnen, auch Schöne in Uniformen. Nachlässig haben sie die schwarze, schwere M16 auf den Schoß gelegt. Schönheit und Macht, das sieht – darf man das sagen? – sexy aus, unheimlich sexy.
Wir fahren los und die Jalousien werden heruntergelassen. Auf beiden Seiten. Der Tag ist gerade wieder in Hochform, die Sonne strahlt, draußen liegt Israel. Nein, nun ist Pennerzeit. Vier Fünftel der Passagiere machen die Augen zu und – schlafen. Ich habe stets gedacht, Reisen sei die Zeit, in der man nicht genug bekommen kann von der Welt. Erkläre mir einer die Situation. Immerhin sehe ich zwei Verliebte, die gekonnt flirten. Man kann den Jüngling nur beneiden um das Mädchen an seiner Seite. Ob man sie beneiden soll? Ich bin mir nicht sicher. Denn sie küssen sich und jetzt kommt die klassische Szene, die weltweit allen Prolos gemeinsam ist: Sein Handy klingelt, er lässt die geschwungenen Lippen der gerade Angehimmelten los und redet. Irgendein Blabla, völlig belanglos. Während sie gelangweilt ihr blondes Haar um den rechten Zeigefinger kringelt. Casanova fällt mir ein, der an einer Stelle in seinen Memoiren davon redet, was ein Mann, will er Erfolg bei einer Dame haben, unbedingt tun muss: ihr das Gefühl geben, dass sie gerade das Wichtigste auf Erden ist. Oh, old boy, das war, das war im 18. Jahrhundert, heute ist die Dame genau so lange wichtig, bis es klingelt.
Ich lese eine der großen Zeitungen Israels, Haaretz. Brillante Schreiber und eine durchaus besonnene Linie: weg von der offiziellen Hysterie, dass alle Moslems von der Vernichtung der Juden träumen. Und hin zu einer Versöhnung mit den Palästinensern, sprich zwei Staaten, einmal Israel, einmal Palästina. Soll heißen: Die Besatzung ist ein schweres Vergehen und die jüdischen Siedler haben im Gebiet der Palästinenser nichts zu suchen. Es ist nicht ihr Land, es ist das Land der anderen.
Auf Seite eins steht heute ein Bericht über Madonna, die gestern ihre MDNA-Tour in Tel Aviv begann. Sie nennt den dortigen Auftritt »a concert for peace«. Sie gehört zu jenen öffentlichen Personen, denen keine wahrhafte Geste mehr gelingt. Sie hat die Welt und die Weltbewohner instrumentalisiert. Jeder Konflikt, jede Wunde, jeder Geschundene ist ihr recht, wenn er nur zur Vermehrung der Umsätze beiträgt. Jeder Kommentar wird stets so gewählt, dass nichts als brüllende Zustimmung vom anwesenden Volk zu erwarten ist. Deshalb auch vor israelischem Publikum keine Silbe zur »occupation«. Jede Lüge, jede letzte peinliche Geste taugt, um im Gespräch zu bleiben. Sicher wird sie bald wieder – begleitet von einem ausgesuchten Medientross – nach Afrika fliegen und ein schwarzes Baby einkaufen, das – so einst die Sunday Times – »farblich gut zur Wohnzimmertapete passt«. Jeder Zeitgeist kommt ihr zupass, wenn er nur geistlos ist und ihr erlaubt, sich an ihn ranzuwerfen. Mittendrin verlautbarte sie: »Gibt es Frieden im Nahen Osten, gibt es Frieden überall auf der Welt.« Aua, manche Sätze reichen an Körperverletzung, so brutal dümmlich treten sie auf.
Ein kleiner Spalt bleibt mir, um hinauszublicken. Die Natur soll mich milde stimmen. Ich vermute, sie wurde dafür erfunden. Um uns zu heilen von den Anwürfen des Lebens.
8
Nach zweieinhalb Stunden in Tiberias, ich finde den kleinen Traum, mein Hotel. Runter zum Swimmingpool. Ich darf jetzt schwimmen, lesen und denken. Ich wundere mich über meine Großzügigkeit, seit Jahren habe ich mir das nicht genehmigt. Ich breite meine drei Kilo Zeitungen und Bücher aus, höre die wunderbare Stille und – zucke zusammen. Der »lifeguard« hat mich gesehen und die Anlage aufgedreht. Sicher denkt er, er mache mir eine Freude. Da findet sich wohl kein Platz in der Welt, an dem sie die Stille aushalten. Nichts scheint verdächtiger als die Abwesenheit von Krach. Ich stehe auf und knie vor dem Lebensretter nieder. Bedenkenlos. Auf dass er mich rette vor dem Hinsiechen durch Dezibel. Der Mensch hat Humor, der Tag wird leiser.
In der Jerusalem Post, eher konservativ, eher das Sprachrohr der Regierung, steht ein Artikel, in dem trotzig behauptet wird, dass den Israelis die (schlechte) Meinung des Auslands über ihren Staat egal sein soll. Denn keiner habe das Recht, dem jüdischen Volk Moralpredigten zu halten. Nach allem, was geschehen ist. Statistiken werden aufgefahren, darunter eine aus Deutschland, »dem Land der Nachfahren aktiver Nazis«: Sie besagt, dass 59 Prozent der Deutschen »in Israel eine Gefahr für den Weltfrieden sehen«. Der wütende Ton der Journalistin zeigt, dass es ihr nicht egal ist.
In diesem Buch – in dem hier – wird mit keiner Zeile das Existenzrecht Israels diskutiert. Israel existiert und das ist gut so. Und in keiner Zeile wird darüber nachgedacht, ob man Israel kritisieren darf. Natürlich darf man, nein, soll man, nein, muss man: ohne gleich als »Antisemit« – der penetrante Standardvorwurf – geschändet zu werden. Auch ein Holocaust schützt ein Volk nicht davor, sich in schreckliche Irrtümer zu verrennen. Ich muss doch kein Hasser sein, wenn ich auf Schatten verweise, die das Land überziehen. Ich will doch die Einwohner nicht im Meer versenken oder das Land von der Weltkarte radieren. Diese Art Kritik an den Kritikern ist vollkommen irrational. Wir alle – jeder von uns – bewegen uns nur dann vom Fleck, wenn wir kritisiert werden. Nicht hämisch hinterfotzig, sondern fair und – im besten Fall – wohlwollend kritisch.
Ich komme auch nicht vom Stammtisch gelaufen, um endlich zu sagen, »was endlich gesagt werden muss«. Es ist alles längst gesagt, aber vieles muss oft, so oft, wiederholt werden. Um Konsequenzen zu provozieren. Ich will nicht hartherzig werden, ich will immer davon überzeugt sein, dass jeder Mensch, der fühlt und atmet, das Recht auf ein annehmbares Leben hat. Alle.
Ach ja, Araber, sprich Palästinenser, sind ebenfalls Semiten. Von ihren Missetaten, Scheinheiligkeiten und schauerlichen Fehlentscheidungen wird auch die Rede sein.
9
Mit zwölf habe ich »Exodus« gesehen, einen Film mit Paul Newman und Eva Marie Saint: Jüdische Überlebende brechen nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Schiff Exodus 47 nach Palästina auf. Eine wahre Geschichte. Aber die Briten – noch immer ist das Gebiet ihr Mandat – verweigern den Hunderten das Anlegen. Und schicken sie zurück nach – Deutschland (!). Ich erinnere mich an meine Tränen und meine völlige Ignoranz. Der geschichtlichen Situation gegenüber. Es war wohl das erste Mal, dass ich bewusst das Wort »Israel« hörte. Aber mir gefiel dieser tapfere, unbedingte Wille, seinen Schindern zu entkommen. Nicht aus Schuldgefühl empfand ich mich den Betroffenen so nah, eher: Weil ich schon immer zu jenen hielt, die frei sein wollen, ganz frei. Pathetisch absurd verglich ich ihr Schicksal mit dem meinen: dem Vater, dem Schinder, entfliehen.
Noch heute habe ich die Musik des Films auf meinem iShuffle. In jenem Kinosaal begann meine Verbundenheit mit Israel. Die wuchs. Nicht zu reden von den später gesehenen Dokumentarberichten, sagen wir, aus Bergen-Belsen, in denen Bulldozer KZ-Skelette in Massengräber schoben. Die Nähe blieb, nahm noch zu, als ich zu lesen anfing, ja, notorischer Kettenleser wurde. Und dabei entdeckte, dass die deutsche Literatur zu einem großen Teil von jüdischen Schriftstellern verfasst worden war. Wissen und Geist fand ich schon immer verführerisch.
Aber jetzt bin ich für die Freiheit der Palästinenser. Sie soll ihnen gehören, wie allen anderen auch. Nein, ich bin nicht rührselig, aber Freisein ist das schönste Sein in einem Menschenleben. »Hurriya« heißt das Wort auf Arabisch. Es klingt schwungvoll und poetisch. Wie wohl in jeder Sprache.
Um halb sechs kehre ich zurück in mein Zimmer und höre plötzlich ein Lied. Ich gehe zum Fenster und dieses Lied zieht wie eine Wolke über die Stadt, die unter mir liegt, zieht über die leicht sich wiegenden Palmen, bis hin zum See am Horizont. Ein unfassbar schönes Lied, gesungen von einer warmen Männerstimme. Seltsamerweise steht die Stadt still, kein Auto ist zu sehen, keine menschliche Bewegung. Ich höre und – heule. Noch nie habe ich die Melodie gehört, auch verstehe ich kein Wort des hebräischen Textes. Das ist der innigste Augenblick des Tages: das geheimnisvoll-verschwiegene Tiberias und über ihm – aus unsichtbaren Lautsprechern kommend – schweben Klänge, die nichts als Glück verheißen.
Nach einer Viertelstunde ist der Zauber vorbei. Noch Minuten bleibe ich stehen, warte wie ein Kind, dass es wieder anfängt. Dann gehe ich zur Rezeption und frage. Das Lied trägt den Titel »Shalom aleichem«, Friede sei mit euch, und kündigt jeden Freitagabend den Beginn des Sabbats an, des jüdischen Feiertags. Deshalb der Stillstand. Mir fällt ein, dass die Araber zur Begrüßung »Salam aleikum« sagen, mit der genau gleichen Bedeutung, mit einer so ähnlichen Phonetik. Wie beruhigend, immerhin in der Begrüßungsformel kommt bei beiden Völkern das Wort Frieden vor.
10
Ich schlendere hinunter in die Stadt. Aber ich sehe nur orthodoxe Juden durch die Straßen huschen, sicher auf dem Weg zur Synagoge. Mit dem riesigen Stramel auf dem Kopf, der Pelzmütze (Hochsommer!), die aussieht wie ein dick behaartes Ufo. Da wandelt er wieder, der religiöse Masochismus, der rastlose Wille, sich für seinen Herrgott zu schikanieren. »Schau, Erhabener, ich schwitze wie ein Schwein, aber du willst es so und das macht uns zwei glücklich.«
Wie mich der Anblick dieser Gebuckelten an meinen eigenen (katholischen) Religionsunterricht erinnert. Dieser grenzenlose Zorn auf Leichtigkeit. Das Unerträglichste, auch Unheimlichste, an den drei Weltreligionen scheint ihr frenetisches Verlangen zu bestrafen. Die eigenen Gläubigen, die anderen, jeden. Der Hass auf die Lebensfreude, der bringt sie zum Glühen vor Begeisterung.
Dass Juden an einen Gott glauben, der es gut mit ihnen meint, das ist ein tiefes Geheimnis. Unvorstellbar, wenn man bedenkt, wie sie ihr Herr Jehova geschunden hat. Und noch immer hängen sie an ihm, trotz des unbeschreiblichen Leids, das hinter ihnen liegt. Aber es gibt wohl keinen Irrsinn in der Geschichte des Planeten, für den nicht Tausende, ja, Millionen bereit wären, ihn in die Welt zu tragen.
Religion erinnert mich an eine Liebe, die nie erfüllt wird, die nur auf Versprechungen beruht. Und die von den »Liebenden«, den Gläubigen, immer so interpretiert wird, als ob die Liebe, sprich die Gegenliebe – das wäre die Liebe des »Weltenherrschers« –, dennoch existierte. Da mag ein Desaster nach dem anderen über sie herfallen, da mögen Erdbeben, Tsunamis, Nazis, Kommunisten, Kreuzritter und andere Feuersbrünste sie heimsuchen, da mögen Heerscharen von ihnen in Sekunden ausgelöscht werden. Egal, vollkommen egal, denn kommt nur einer von ihnen davon, dann hat »Gott geholfen«. Dass er den Heerscharen minus eins nicht beigestanden hat, wollen die blindwütig Abergläubischen nicht wahrhaben. Heldenhaft halten sie an ihrer Liebe fest. Wie jene Frau in Frankreich, die jahrelang von ihrem Mann geprügelt worden war, zuletzt krankenhausreif, sich aber – kaum aus der Intensivstation entlassen – vor den Richter warf und um eine milde Strafe für ihren ehelichen Hooligan bat. Ähnlich sie, die Gottesanbeter. Seit Jahrhunderten werden sie geschunden – die Juden können hiervon ein langes Lied singen – und dennoch blicken sie noch immer verzückt in den Himmel. Der kalt bleibt und keinen Finger rührt.
Ich habe einen Freund in Europa, Häretiker wie ich. Ich grinse, weil er mir jetzt in den Sinn kommt. Die lustige Situation passierte während eines Gesprächs, in dem ich ihm wieder einmal erklärte, dass ich völlig außerstande bin, den heilig-unheiligen Bimbam der Religionen zu verstehen. Und Michael plötzlich aufsprang und rief: »Mensch, du hast nichts kapiert! Denn eines Tages werden sich alle Kathos, Muslime und Juden ihr Karneval-Outfit vom Leib reißen und uns jauchzend zurufen: ›We were just kidding, nur Gaudi, natürlich wissen wir, dass alles Humbug ist. Aber wir wollten ein bisschen Spaß haben, uns amüsieren, auch über euch.‹«
Ich bin vor Vergnügen um den Tisch gehüpft, so wunderbar erlösend fand ich sein Hirngespinst, diese träumerische Vorstellung: dass eines Tages alle auf Himmel und Hölle verzichten und keine andere Moral gelten sollte als Achtung vor den anderen. Und vor sich. Und vor dem ganz und gar irdischen Leben.
Ich kehre zurück ins Hotel, die Stadt wirkt wie ausgestorben. Da Tiberias seit dem »Unabhängigkeitskrieg« als »araberfrei« gilt, ist tatsächlich nichts offen, kein Laden, kein Restaurant.
11
Dinner im Speisesaal. Soweit ich sehe, fast nur Juden, erkenntlich an der Kippa auf den Köpfen der Männer. Die meisten sprechen Hebräisch, ein paar Englisch oder Französisch. Keine business people, eher Urlauber. Ich sitze allein und bisweilen spüre ich verstohlen-neugierige Blicke. Auch das Personal ist scheu, sie wissen, dass ich Deutscher bin. Aber die Blicke sind nicht feindlich, eher verwundert: wie wenn ein Fremder ins Schtetl kommt und keiner so recht weiß, was man mit ihm anfangen soll. Im Laufe der drei Stunden (ich schreibe nach dem Essen) taut die Zurückhaltung, der Ober und Kellnerin Ina, Exsoldatin und Medizinstudentin, trauen sich ein paar Worte. Ich bin zwar Sohn eines (einst) aktiven Nazis, aber sie sehen, dass ich nicht über drei Tische schreie, keine Hakenkreuzfahne schwenke und für niemanden und gegen keinen in den Krieg ziehe. Gibt es einen Harmloseren als einen Schreiber, ganz nah der Welt, ganz still so mittendrin?
Als ich Kaffee bestelle, gibt es ihn nur schwarz. Denn, so lerne ich, Fleisch und Milch dürfen nicht zusammen konsumiert werden, dürfen sich nicht im selben Raum aufhalten. So steht es in der Thora, dem »Wort Gottes«. Vor dem Restaurant könnte ich den Kaffee mit Milch trinken. Ich wandere mit der Tasse und dem Mac in die Bar. Hier erlaubt es Jehova. Wie sagte es Einstein, der Göttliche, der Jude: »Jeder Idiot kann die Dinge kompliziert machen. Das Geniale ist es, sie zu vereinfachen.«
12
Schöne Tage am Pool. Ich muss mich nur fünf Meter zum Wasser bewegen und wieder zurück. Aber ich lerne etwas, was mir bisher – seit ich das Wort Israel kenne – gänzlich entgangen war: dass dieses Land auch vollkommen »normal« ist, mit »normalen« Problemen, die von keinem Nahostkonflikt herrühren, nur immer zum banalen oder heiteren oder erschreckenden Inventar der Welt gehören. Und die man überall hört und sieht. Auf allen fünf Kontinenten.
Ich komme mit der Mutter von zwei kleinen Kindern ins Gespräch. Seit Kurzem geschieden, nachdem der Ex sie drei Jahre lang als Sparringspartner für seine Wut benutzt hatte. Nun ist er verschwunden und zahlt keinen Schekel. Sie lässt ihn suchen.
Gespräch mit einem älteren, attraktiven Ehepaar aus Los Angeles, Sepharden, deren Eltern in Marokko gelebt haben. Sie sprechen kein Wort Hebräisch und gehen ungemein elegant miteinander um. Ein Traumpaar, das hier Verwandte besucht. Sie sind neugierig und fragen nach Deutschland. Ich berichte, dass mehr Israelis denn je nach Berlin auswandern. Das ist eine befremdliche Information, aber so ist es.
13
In diesen Breitengraden muss nicht viel Zeit vergehen, um wieder an die politische, sprich religiöse Wirklichkeit erinnert zu werden. Gespräch mit der schönbusigen Soila, die lässig die Füße ins Wasser hängen lässt. Zu witzig, denn ich wollte mit ihr flirten und erfahre sogleich, dass die Finnin sechsundzwanzig Jahre alt ist und das Hirn einer Sechsjährigen mit sich herumträgt. Sie ist Christin, »pentacostal christian«, also Angehörige einer Freikirche, die an die (wörtliche) Unfehlbarkeit der Bibel glaubt und vom Herrn Jesus als persönlichem »Lord« und »Savior« schwärmt. Überkommt die Gläubigen die Schwärmerei besonders heftig, so sprechen sie »in Zungen«: Hunderte stottern dann, wild gestikulierend, unverständliche Laute. Wer das als Außenstehender miterleben darf (wie ich einst, ich Glücklicher), fühlt sich wie mitten in einer Irrenanstalt.
Soila hat Krankenschwester gelernt und gerade einen bible study course in Jerusalem hinter sich. Und redet genau wie jemand, dem frisch das Hirn gewaschen (beschmutzt?) wurde. Kostproben: Israel ist hier der Meister, weil Gott den Juden das Land (sie meint Gesamtpalästina) geschenkt hat. So steht es geschrieben und so ist es auf ewig wahr. Und wer Jesus nicht als seinen Erlöser anerkennt, der wird in die Hölle fahren. Denn jeder hat heute die Chance, ihn zu erkennen, auch ein Muslim im hintersten Arabien. Denn er sieht ja fern und erfährt somit vom Retter der Welt. Wenn er nur will. Ja, Jesus hat sich für uns geopfert, hing am Kreuz für unsere Sünden, ja, keine andere Religion hat einen so lieben Gott.
Soila, die aussieht wie ein Covergirl, hat sich bereits mit fünf Jahren zu Jesus bekannt und ihr »Herz beschneiden lassen«. Symbolisch, da ja auch Pentacostal-Herzen keine Vorhaut bzw. Klitoris besitzen. Sie kündigt freudestrahlend die baldige Wiederkunft des Messias (alias Jesus) an: »Soon« würde er kommen. Ich frage nach und höre: »Very soon!« Denn, so wissen es die Bikinischönheit und die Bibel: »Die Welt ist verrottet, das Teuflische wuchert überall.« Ich bitte um ein Beispiel der Verkommenheit und Soila – als hätte sie meine niederen Gedanken entdeckt – faucht triumphierend: »Sex vor der Ehe!«
Nun, all das Niederträchtige wird in Bälde aufhören und der Herr der Herrlichkeit »tausend Jahre herrschen«. So lange brauche er, um den irdischen Saustall aufzuräumen. Nach dem tausendsten Jahr lässt er den Teufel frei, um zu prüfen, ob tatsächlich alle »wirklich gut« sind. Und erst danach öffnet Dschissas die »Bücher«, in denen natürlich auch alle vor- und außerehelichen Geschlechtsverkehre stehen. Und dann ist »doomsday«, der Jüngste Tag, und jetzt hat die Liebe des Herrn ein Ende und das große Höllensausen nimmt seinen Anfang.
Leicht erschüttert trotte ich zu meinem Liegestuhl zurück. Statt zu siegen, kenne ich nun eine Vernagelte mehr. Wie soll hier Frieden ausbrechen, wenn so viel grausiger Schwachsinn die Köpfe vernebelt?
Ich träume: Hätte ich ein Handy, würde ich mir eine App herunterladen, die nicht den nächstgelegenen Shop verrät, in dem man Crocs-Gummischuhe kaufen kann, sondern aufblinkt, wenn sich eine Person in meiner Nähe befindet, die mit Hirn und Vernunft durch die Welt geht. Ein Weltmann eben oder eine Weltfrau, die sich spirituell von nichts anderem verführen lassen als von einem geistesgegenwärtigen Humanismus. Fernab aller barbarisch wütenden Götter.
14
Ich mache mich auf den Weg. Der folgende Tag, und nur er, ist dem »heiligen« christlichen Land gewidmet. Um die Komplexität des Brandherds besser zu verstehen. Hier im Norden Israels, in Galiläa, gibt es Wundertaten zuhauf. Nicht aus der Jetztzeit, denn da gibt es keine Wunder. Aber in der Uraltzeit, da schon. Frohlocken sie. Alle vom Gottessohn vollbracht und bis heute mit Hosianna verbreitet. Dass nicht ein einziges geschichtlich bewiesen ist, spielt keine Rolle. Pilger wollen nicht ihren Verstand ausbeuten, sie wollen ihn verlieren. Sie wollen nicht wissen, sie wollen staunen. Zudem kommen Hunderttausende als Touristen, sprich, der Hokuspokus ist ein Bombengeschäft, er schafft Arbeitsplätze und Millionenumsätze. Natürlich geht es nicht um Wirklichkeit, sondern um Schekel: Kaum gab es den Jesus Trail, auf dem, so der Unternehmer, »Jesus Wunder wirkte«, legte ein anderer den Gospel Trail an. Auf einer ganz anderen Route. Das Wundersame auch hier: Wunder über Wunder. Das allerschönste Wunder ist noch in Planung: Nicht weit entfernt soll ein Holy Land Christian Theme Park betontriumphal hochgezogen werden. Ein American Wonder, eine Art Disneyland, um die Hirnschmelze und den Cashflow nicht abreißen zu lassen.
Dass diese Provinz auch von Kriegsschauplätzen wimmelt, auf die stets die geballte christliche Nächstenliebe – Kreuzritter gegen Moslems und Juden – niederging, versteht sich von selbst. Der Glaube versetzt Berge. Von Toten.
Mit dem Bus nach Tabgha. Nach zwanzig Minuten sagt der Fahrer, ich solle aussteigen und »rechts runter« gehen. Ich gehe rechts runter und stehe irgendwann vor dem Pilgerhaus, Eigentum des »Deutschen Vereins vom Heiligen Lande«. (Chef des Vereins ist Joachim Kardinal Meisner, Erzbischof von Köln, der sich bereits einen soliden Namen als Hetzredner gegen Homosexuelle und »entartete Kunst« gemacht hat.) Hier gibt’s ein 120-Euro-Bett für unbedürftige Pilger und einen direkten Zugang zum See Genezareth. Denn dort, so die grandiose Idee, spazierte Jesus übers Wasser: Kaum hatte er seine Jünger – sicher im Boot – erreicht, fielen sie vor ihm auf die Knie. Vor dem Wasserheiligen. So habe ich es in der Schule gelernt. Menschen auf Knien, das ahnte ich schon damals, sind das Markenzeichen jeder Religion.
Ich nähere mich dem Ufer und es ist wunderbar friedlich. Schilfrohre wiegen sich leicht im Wind und ich tapse mit nackten Füßen in die sanften Wellen. Noch brennt das Land nicht, noch kühlt der Morgen. Da ich ein (relativ) bescheidener Zeitgenosse bin, genügt das heutige Wunder durchaus: im See Genezareth stehen und am Leben sein und den Flügelschlag der Möwen hören. Und niemand muss sich vor mir erniedrigen und niemand muss mich anbeten und niemand – nicht einmal das – muss mich, den Glücklichen, zur Kenntnis nehmen.
15
Zu Tabgha gehört auch die Brotvermehrungskirche. Unter dem Altar ragt ein Stück Felsen heraus, auf dem, laut Märchenonkel Matthäus, die zwei Fische und fünf Brote lagen, die der Wunderknabe Jesus wundersam vermehrte. Sicher ist, dass diese Nachricht zur formidablen Geldvermehrung beitrug. Denn das Volk drängelt, in zehn verschiedenen Sprachen wiederholen Touristenführer – ohne den Hauch eines Zweifels – das Märchen. Zudem kann man nebenan kiloweise shoppen: das Jesuskind im Heu, Untertassen mit Fischmotiven, Schafe aus Holz, ach, den ganzen einschlägigen Krimskrams.
Nur Minuten entfernt kommt man zu einem Tor, an dem »Private Holy Place« steht (den Spruch werde ich an meine Wohnungstür nageln). Dahinter liegen ein Prachtgarten und die Church of the Primacy of St. Peter. Hier, so die ewige Wahrheit, hat Jesus seinen Apostel Petrus zum »Stellvertreter Gottes auf Erden« eingesetzt. Man sieht eine Statue, der Herrgott stehend und der Mensch Peter, wie üblich, kniend, Text darunter: »Feed my sheep«, genau so: Nähre meine Schafe! Ich verstehe, der Schafshirte auf Knien und die Schafe blökend. Verführerischer kann eine Botschaft nicht klingen.
Hinauf zum Mount of Beatitudes, dem Berg der Seligsprechungen, dorthin, wo Jesus – so die nächste Legende – die weltberühmte Bergpredigt hielt. Steiler Weg, auf halber Strecke hole ich ein amerikanisches Ehepaar ein, schweißtriefend neben dem Staubweg ausruhend. Ich frage, wo genau die Predigt stattfand, und der Mann antwortet: »Genau hier!« Aber warum hier und nicht weiter oben? Und der Witzbold, trocken: »Weil es bei dieser Hitze keiner nach oben geschafft hätte.«
Ich bin tapfer und erreiche die Kuppe. Hier steht die Church of Beatitudes, erbaut in den Dreißigerjahren des letzten Jahrhunderts. Umgeben von einem formidablen Park und einem mächtigen Gitter mit verschlossenem Tor. Das erst wieder um 14 Uhr geöffnet wird. Ich klingle und etwas Unerwartetes passiert: Keiner antwortet, dann kommt ein Auto, das Tor gleitet zur Seite und der Wagen verlässt das Gelände. Und ich schlüpfe hinein. Zentimeter, bevor sich die Zufahrt wieder schließt. Aber jemand hat mich dabei beobachtet und ruft: »Hey, it’s closed, please leave.« Nun das kleine Wunder: Ich sage, dass ich nur einmal im Leben hierherkomme und in zwei Stunden längst woanders sein muss. Und dieser Mensch – obwohl »jeder bestraft wird, der sich unerlaubt auf dem Gelände aufhält« – bleibt ein Mensch, der nicht züchtigen, sondern hilfsbereit sein will. Ich darf bleiben, solle mich jedoch »diskret« bewegen.
Allein durch die Prachtanlage, die Franziskaner hier leben durchaus beneidenswert. Ein Märchengarten, die eleganten Häuser, alles blüht und strahlt. Und keine Menschenseele zu sehen: Mittagszeit, in der wohl die orientalische Schläfrigkeit umgeht. An der runden Kirche vorbei und mich setzen. Ich rauche (nicht vorstellbar die Strafen) und blicke auf den See, auf das Jordantal. Ich fasse es nicht, wie schön die Welt sein kann. Nicht überraschend, dass sie hier – von meinem Kinn tropft der Schweiß – von Wundertaten delirieren. Bei so viel Herrlichkeit, so viel Hitze, so viel Entrücktheit.
Als ich aufbreche, gehe ich auf ein Schild zu, auf dem der berühmteste Satz der berühmtesten Predigt steht: »Glücklich die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich.« Sogleich durchzuckt mich ein Flash aus meiner Kindheit: Immer wieder hatte ich schneidende Dispute mit meinem Vater, wobei ich höllisch aufpassen musste, um seinen perfiden Gehirnwindungen folgen zu können. Er wollte mich auf Biegen und Brechen intellektuell beherrschen, wollte mir einreden, dass ich das Denken und Antworten ihm überlassen solle, er wisse schließlich alles besser. Ja, alles. Es ging um Macht, was sonst.
Heute bin ich dem Machthaber dankbar. Weil seine Unbelehrbarkeit mich hellhörig machte. Als ich im Religionsunterricht diese Maxime aus der Bergpredigt zum ersten Mal hörte, war ich sofort auf dem Quivive: Denk nicht, du bist das Schaf, das tut, was er (der Vater) oder was sie (die Pfaffen) dir anschaffen. Und damit der Machtanspruch noch mächtiger klingt, spricht ihn kein Sterblicher, sondern der Unsterblichste höchstpersönlich. Doch der biblische Aufruf kam zu spät, ich war bereits immun. Arm im Geiste? Gibts ein armseligeres Leben? Doofsein als Bedingung fürs Glück? Oben ohne, das hätten sie gern, die Gottesmänner. Der himmelblöde Satz ist eine Bankrotterklärung.
16
Nach einem Umweg über Kafarnaum, das als Village of Jesus verkauft wird, fahre ich per Autostopp zurück nach Tiberias. Hier gibt es einen Dokumentarfilm zu sehen, Galilee Experience. Das einstündige Filmchen ist gewagt. Begleitet von dramatischer Musik hört man aus dem Off, dass Galiläa und der Rest von Palästina als göttliches Geschenk auf die Juden herniederkamen. Bescheidener wird es nicht formuliert. Was für ein aberwitziger Gedanke: Der Überirdische verschenkt Ländereien an ein Volk. Dass andere Völker leer ausgingen, fällt hier keinem auf. Ein solches Denken ist politisch hochbrisant: Damit rechtfertigt ein großer Teil der israelischen Öffentlichkeit seinen Anspruch auf das gesamte Land. Und noch etwas Erstaunliches: Die Araber von Palästina (erst nach 1948 nennen sie sich Palästinenser), die hier seit über tausend Jahren leben, werden in dem Streifen weder verspottet noch bekämpft noch vertrieben, nein, sie kommen überhaupt nicht vor. Mit keinem Wort. Es gibt sie einfach nicht. Das stärkt die nächste Legende: »Ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land.« Wie notierte es Max Frisch einmal? »Jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält.« So ähnlich funktioniert es wohl auch bei Nationen.
17
Bevor ich abends zu schreiben beginne, lese ich die Rede, die mein israelischer Lieblingsschriftsteller David Grossman in der Frankfurter Paulskirche hielt. Aus Anlass des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, der ihm 2010 verliehen wurde. Ich habe sie damals auf meinem Mac abgespeichert. Jetzt ist die richtige Zeit, sie nochmals anzuschauen. Weil mich immer nach einem Hellsichtigen verlangt, wenn zu viel himmlischer Stuss meinen Kopf verdunkelt. Grossman ist ein rastloser Kritiker der Besatzungspolitik und ein penetranter Fürsprecher der so einfachen Idee, dass den Palästinensern dieselben Menschenrechte zustehen wie den Israelis. Ein »Linker«, der sein Land liebt. Und es kritisiert. Und dafür von den Rechten als »selfhating jew« beschimpft wird.
So sieht es aus: »Antisemitisch« sind wir zwischenrufenden Ausländer, »sich selbst hassende Juden« sind alle Inländer, die aufmucken und nicht mit dem Hammer in der Hand auf jeden Araber losrennen: Israelis eben, die zu der fulminanten, ewig (irdischen) Wahrheit durchgedrungen sind, dass es vom Herrgott bevorzugte Menschenkinder nicht gibt. Nur uns, irgendwie gleich, irgendwie verschieden, irgendwie voller Sehnen nach einem guten, innigen Leben.
Doch Grossman erzählt in seinem Vortrag noch von etwas anderem: vom Glück des Schreibens. Wie ihn die Suche nach Sprache, seiner hebräischen, aus einer abgründigen Depression zurückholte: nach dem Tod seines Sohnes Uri, der als junger Soldat 2006 im Zweiten Libanonkrieg umkam. (Mit 44 toten Israelis, davon 19 arabisch-israelischen, und knapp 1200 libanesischen Toten und Hunderten von Verletzten.) Wie ihn das Aufspüren des einen Worts, des einzig richtigen Worts – und beschriebe es eine Tragödie – die Freude am Existieren, die Freude am Arbeiten wiederfinden ließ. Trotz der in Hass getränkten Umgebung, trotz aller Tränen der Mütter und Väter. Sprache als Herzmassage. Auf dass es erneut anspringt und schlagen will.
18
Am nächsten Morgen auf nach Nazareth, wo Frau Maria Muttergottes fleckenlos empfangen hat. Unvorstellbar, dass ein Gottessohn via männliche Geilheit (von der weiblichen gar nicht zu reden) in die Welt kam. Gezeugt wurde er folglich vom (sexlosen) »heiligen Geist«. Oh, heiliger Schwachsinn.
Wieder sitzen viele Soldaten im Bus. Das ist eine seltsame Situation. Denn vor den Fenstern liegt ein wohlhabendes Land, kein Haus brennt, keine hungernden Kinder streunen, keine Verzweiflungsschreie, kein Tropfen Blut zu sehen. Das Einsatzgebiet der so jungen Schwerbewaffneten liegt nur ein paar Kilometer entfernt. Da, wo Palästina beginnt. Und die Palästinenser sagen: Ihr Israelis unterdrückt uns! Und die Unterdrücker sagen: Wir unterdrücken euch, damit ihr uns nicht vernichtet!
Nach dem Holocaust hat sich Israel geschworen: Keiner wird mehr versuchen, das jüdische Volk auszulöschen! Und nie mehr werden Juden wie fügsame Hammel in die Gaskammer trotten! Denn wir werden uns wehren, mit aller Macht, mit aller!
Wie gut man das verstehen kann, ja, nachfühlen und begreifen. Aber inzwischen ist Israel erblindet, die unerträglich schmerzhafte Erinnerung an die Shoa verstellt jeden Blick auf die Gegenwart.
Heute entdecke ich während der Fahrt einen Soldaten, der die M16 auf seine Knie gelegt hat und darüber einen Moleskine-Schreibblock. Und schreibt. Still, konzentriert, wie einer, der etwas mit sich klären, wie einer, der mit etwas fertig werden muss. Er scheint unberührbar. Heimlich blicke ich zu ihm hinüber. Er soll von meiner Bewunderung nichts erfahren. Ich will das Bild so lang wie möglich genießen.
19
Wer nach Nazareth kommt, fährt zuerst durch »Nazareth Illit«, die upper city wurde Anfang der Fünfzigerjahre gegründet. Rein jüdisch, als Gegengewicht zu »Old Nazareth«, das als arabische Hauptstadt Israels gilt. Hier wohnen die Palästinenser, von denen viele einen israelischen Pass besitzen. Mit dem (unsichtbaren) besonderen Kennzeichen im Dokument: Bürger zweiter Klasse. Sie machen etwa zwanzig Prozent der Gesamtbevölkerung aus und es gibt keinen zivilen Bereich – die Statistiken sind erdrückend –, in dem sie nicht benachteiligt werden. Wie jetzt, hier in Nazareth: Eine Umgehungsstraße ist geplant, nur der jüdischen Bevölkerung zugänglich. »Apartheid« ist ein anderes Wort, das gut zu diesem Land passt.
Ach ja, viele Palästinenser kamen nach der Vertreibung 1948 wieder heimlich in ihre Heimat zurück. Heimlich, da die Israelis alles versuchten, sie daran zu hindern.
Ich checke unten ein, mitten im Wirrwarr der kleinen Gassen. Das Gepäck abladen und losgehen. Als Erstes komme ich an einer kleinen Moschee vorbei, über der ein mächtiges Transparent hängt, der Text (ich kopiere auch die Fehler): »And whoever seeks a religion other than Islam, it will never be accebted of him, and in the Hereafter he will be one of the losers.« Unterschrieben mit »The Coran«. Also, wer immer nach einer anderen Religion als dem Islam sucht, der wird von ihm (= Herrn Allah) nicht akzeptiert und gewiss im Nachleben als Niete auftreten. Das hieße, schmucklos formuliert: Ewigkeiten lang wird sich keine Jungfrau, nicht eine von den versprochenen achtzig, um den Loser kümmern. Man sieht, auch im »Mohammedanertum« – so hieß es in meiner Jugend – spielt das Hirn keine Rolle.
Hundert Meter weiter steht die »Himmelfahrts-Basilika«, die christliche Konkurrenz. Auch bei ihr sind die geistig Bescheidenen willkommen. Gleich links im Vorhof sieht man Maria, die Schutzpatronin aller Jungfrauen. Als Denkmal. Von hier, so heißt es, ist sie zum Himmel durchgestartet. Der Sockel als Abschussrampe. Ein Reiseleiter gestikuliert und erklärt den Umstehenden, ohne mit der Wimper zu zucken, wie er damals vor 2000 Jahren vonstattenging, der Senkrechtstart nach oben. Das muss man dem Holy Land zugestehen: Nirgends auf Erden beweist Religion so radikal, dass sie für die Bedürfnisse eines Schafs – die Bibel war ja so freundlich, das passende Wort zu liefern – maßgeschneidert wurde. Schafe sind allen Himmlischen die Lieblingsmenschen.
Hier ein hinreißendes Beispiel: Voller Freude hatte ich gelesen, dass die Annunciation Road einst »Casanova Street« hieß. Ah, der Italiener, der Weltmann, der Polyglotte, der Belesene, der Flaneur, der Reisende, der Schriftsteller, der siebzehnjährige Doktortitel-Inhaber, der Expriester, der betrunken von der Kanzel fiel, der Pfaffenspötter, der Gesprächspartner von Friedrich II. und Voltaire, der Frauenanbeter, wer hätte ihn nicht gern zum Freund gehabt. So stürme ich ins Tourist Office und frage hochgestimmt, ob denn meine Information über die – leider bedauerliche – Namensänderung der Straße stimme:
Yes, this is correct.
Did Casanova ever travel to Nazareth?
Yes, he came around 1970.
This seems impossible for he died over 200 years ago.
No, no, he came around 1970.
Mythenbildung in Echtzeit. Da scheint der Orient unschlagbar. Nach einer halben Stunde weiß ich, dass mich ein Druckfehler irreleitete. Es hätte »Casa Nova Street« (Neues-Haus-Straße) heißen müssen. Und sie wurde natürlich nicht nach dem Wunderknaben benannt, sondern nach einer Pilgerpension. Wie unsexy.
20
Zu Beginn der Al Bashara Street, auf der links und rechts Devotionalienläden stehen, treffe ich einen Palästinenser, um die vierzig, er soll Zeki heißen (was klug bedeutet, intelligent). Er ist Araber, ihm gehört eines der Geschäfte. Zeki überrascht mit einem ganz westlichen Zynismus. Als (heimlicher) Ex-Muslim grinst er nur, wenn die christliche Kundschaft nach einschlägiger Ware verlangt. »Angst ist eine unheimliche Triebfeder«, meint er, »sie finanziert meinen Lebensunterhalt.« Zeki ist der zweite Araber auf meinen langen Reisen, der sich als Atheist outet. Mir gegenüber, dem Fremden. Vor seinen Islambrüdern wäre das undenkbar. Das Gatter verlassen gilt ja als Todsünde.
Minuten später kommt sein Vater vorbei und es wird klar, dass Zynismus erblich sein kann. Die beiden wetteifern um die Sinnlosigkeit des Lebens. Und sie haben Charme, es gibt Tee und Zigaretten, drei Stühle stehen sogleich auf dem Trottoir. Echte Nihilisten. Vater Azmi feuert einen Satz ab, den Cioran, der Philosophen berühmtester Schwarzseher, nicht kaltschnäuziger hätte formulieren können: »Der Hauptgrund für unser Unglück ist die Tatsache, dass wir geboren wurden.« Mit solchen Eisbrocken im Mund vergeht eine vergnügte Stunde. Ich mag die zwei, schon deshalb, weil sie Widerstand leisten und mich nicht mit biblischem Weihrauchgeleier heimsuchen. Es wird noch besser, jetzt gibt es absurdes Theater, öffentlich, mitten in Nazareth: Ein ambulanter Händler mit einem Sack frommen Klimbims setzt sich dazu. Man kennt sich. Halim (so heißt er tatsächlich) packt aus und Vater und Sohn nehmen die Teile in die Hand, drehen sie, prüfen sie. Dicke Bibeln, das Herz Jesu als Messingrelief, Rosenkränze, Fläschchen mit »Reinem Wasser vom Jordan« und »Erde aus Jerusalem« und »Weihrauch vom Heiligen Land« und – unschlagbar – »Jungfräulichem Olivenöl von Golgota«. Ich frage verdutzt: »Alles hierher gebracht, original verpackt?« Die drei kichern und klären auf: »Die Flakons werden in Halims Hinterhof abgefüllt, ein paar Straßen weiter.« Zuletzt wird die Schachtel mit den Kruzifixen ausgepackt, fachmännisch ziehen die beiden potenziellen Käufer am Plastikleib des Gekreuzigten. Ob der Erlöser auch fest am Holz klebt.
21
Durch die Kasbah flanieren. Entlang der engen Nebengassen, ganz still, mittagsschläfchenstill. Ein paar Meter über mir tropft die aufgehängte, sich sanft wiegende Wäsche. Und dahinter nur Blau, nur Himmel. In solchen Momenten träume ich davon, hier, im dritten oder vierten Stock, eine Wohnung zu mieten, nur einen Raum, nur einen Tisch, nur einen Stuhl. Und im Eck der Futon. Und ich schreibe. Das ist mein Lieblingsglück. Weil ihm nichts fehlt. Weil es mich vollkommen erlöst von anderen Wünschen. Nicht für immer, aber für Stunden überkommt mich, so allein, so unauffindbar, die schönste Einsamkeit der Welt.
22
Ich will mich nicht schonen und besuche das Nazareth Village, ein auf uralt getrimmtes Dorf, uralt wie das erste Jahrhundert: »Sieh dir das Leben an, wie Jesus es kannte.« So, sagen sie, muss es ausgesehen haben in Zeiten, in denen der Gottessohn hier wandelte. Nach der Kasse wandeln die Teilnehmer zuerst einmal in den gift shop, hier kann man sich eine »Bundeslade zum Selberbasteln« einpacken lassen. Und – noch vielversprechender als bei Halim – ein »Extra Virgin Olive Oil«. Gewiss für die extra widerständigen Jungfrauen.
Dann über ein paar Hektar Dorfgemeinschaft wandern, in der Schauspieler als Weber, Schafshirten, Schmiede und spielende Kinder verkleidet das Dorfleben Jesu vorführen. Es menschelt angenehm. Einer der Komparsen, der den Esel spazieren führen soll, hat die Ankunft der Gruppe verschlafen und muss von unserem Guide diskret geweckt werden. Zedern und Mandelbäume, Misthaufen, sogar ein Wachturm stehen herum. Wir sind praktisch in den Fußstapfen des Herrn unterwegs.
Der Wahn ist das kostbarste Gut einer Religion. Nicht umsonst gibt es in der Medizin den offiziellen Begriff vom »Jerusalem-Syndrom«. Bis zu zweihundert Frauen und Männer werden pro Jahr in die umliegenden Psychiatrien der Stadt eingeliefert, weil sie plötzlich von der – oft für die anderen lustigen, oft für sie selbst unheilvollen – Hysterie erfasst wurden, zum Personal der Bibel zu gehören. Und schlagartig als Samson oder Johannes der Täufer oder Prophet Elias oder Jungfrau Maria oder – in der Hauptrolle – als Jesus Christus durch Israel spazieren. Manchmal als zündelnde Radaubrüder, manchmal als Künder der Wiederkunft des Messias, manchmal als närrische Jungfern, die nach Bethlehem aufbrechen, um »ihr Baby« dort zu suchen.
23
Abends im Hotel, schreiben. Ein arabisches Hotel, das Personal lacht, Witze fliegen durch den Raum und Salim macht mir schöne Augen. Und bringt, unaufgefordert, einen Teller voller Melonenschnitten. Wir zwei wissen unverzüglich, was es geschlagen hat. Lächelnd fragt er, ob ich verheiratet sei, und da ich mit Nein antworte, will er wissen, wie die Situation der Schwulen in Frankreich aussähe. Ob auch so verlogen wie hier. Wieder Nein, denn unbeschwerter und schwuliger als in Paris kann es sich ein Homosexueller nicht wünschen. In manchen Cafés geht es zu wie in Arabien: nur Männer.
Salim will alles über meine eigenen Erfahrungen in Sachen Männerliebe wissen. Ob »frotti-frotta«, ob oral, ob alles zusammen? Wie jeden sinnlich begabten Menschen regt ihn das Reden über Sex an. Ich plaudere gern mit Homos, denn (fast immer) sind sie absolut heiligenscheinfrei, ganz unbelehrbar von religiösen Horrorszenarien, die für sie, die schlimmsten Todsünder, vorgesehen sind. Dass sich Salim hier, in seiner bigotten (arabischen) Gesellschaft, vor der Öffentlichkeit hüten muss, auch klar. Ob als Christ, wie er, oder als Muslim: Der Hass auf Andersfühlende hält sich bei allen Gottesanbetern die Waage.
Salims eigene Geschichte klingt wundersam versponnen: Als ehemaliger Theologiestudent ist er aus dem Priesterseminar in Rom geflohen, nachts hinaus in den strömenden Regen. Der Kampf zwischen seinem Körper und der offiziellen Moral war unerträglich geworden. Doch nach der Befreiung kam die nächste Fessel, wieder aus seiner Umgebung: kam die Heirat. Und drei Kinder. »Nein«, sagt er, »du kannst dich hier nicht outen, du musst eine Maske tragen.« Sanft legt er in einem heimlichen Augenblick die rechte Hand auf meinen Nacken, fragt wispernd, ob er nicht nach Mitternacht an meine Tür klopfen dürfe. Ich lächle verschwörerisch.
24
Frühmorgens mit einem Sherut nach Jenin (sprich: Dschenin), der ersten größeren Stadt im Norden eines Gebiets, das geografisch neutral »Westjordanland« (westlich von Jordanien) heißt. Und das die Religioten »Judäa und Samaria« nennen, da sie es als Provinzen von »Eretz Israel« betrachten, von Groß-Israel. Und das die Palästinenser mit dem einzigen Namen bezeichnen, der ihm gebührt: »Palästina«.
Hier ein paar Daten: Am 29. November 1947 beschlossen die Vereinten Nationen – auch eingedenk des Holocausts – die Teilung des Gebiets, das lange zum Ottomanischen Reich gehörte und von 1922 bis 1948 von den Briten als Mandat verwaltet wurde. Ein Teil – so der klare Auftrag – sollte von nun an den Juden gehören, der andere den Arabern. Die einen akzeptierten und die anderen – noch nie begabt für Realpolitik – lehnten ab. Und zogen, unterstützt von sechs (arabischen) Staaten, in den Krieg. Und Israel, der am 14. Mai 1948 neu gegründete Staat, nahm die Herausforderung an: Der »Unabhängigkeitskrieg« begann. Den die Bedrängten haushoch gewannen, nebenbei viel Land eroberten und etwa 750000 Palästinenser aus ihren Dörfern und Städten vertrieben. (Dass laut offizieller israelischer Geschichtsschreibung – Stichwort: »Wie es wirklich war« – niemand vertrieben wurde, versteht sich von selbst.) An diese Monate, bis Sommer 1949, erinnern sich die Palästinenser noch heute unter dem Namen »Nakba«: Tragödie.
Im Juni 1967 kommt es zum berühmten »Sechs-Tage-Krieg«, wieder angezettelt von Ägypten. Und Israel siegt ein weiteres Mal souverän, wieder wird Palästina kleiner und wieder machen sich Tausende auf die Flucht. So streiten sie nun seit 45 Jahren um den Rumpf, der – nach 1967 – von Palästina geblieben ist: um das geschrumpfte »Westjordanland« und um Gaza, den winzigen Landstrich im Süden Israels. (Zusammen etwa 6200 Quadratkilometer, ein Zwölftel der Fläche Bayerns.) Beide Teile zusammen machen ein Gebiet aus, das fast um die Hälfte (!) kleiner ist als jenes, das den Arabern einst von der UNO zugesprochen worden war.
Die meisten Palästinenser wären heute mit dem verbliebenen Territorium einverstanden, wenn sie a) einen eigenen Staat bekämen, wenn b) Ostjerusalem ihre Hauptstadt würde und wenn c) die Flüchtlinge zurückkehren dürften. Allen drei Forderungen widersetzt sich Israel. Beide Seiten (ich wiederhole mich) legen eine Borniertheit – immerhin der längste Konflikt der modernen Geschichte – an den Tag, ja, eine Unfähigkeit, mit der Wirklichkeit umzugehen, die auf geradezu unheimliche Weise überrascht. Wobei die israelische Borniertheit – unterstützt von militärischer Power und den USA – immer siegte: Seit 1947 – alle Konflikte, Attentate, gezielten Tötungen und Aufstände gerechnet – kamen viel, viel mehr Palästinenser ums Leben als Israelis. Und viel, viel mehr wurden verwundet. Und unendlich viele, nur Palästinenser, wurden verjagt. Die Unverhältnismäßigkeit, mit der hier ein Gegner auf den anderen losgeht, macht staunen.
Die rabiate Aggression Israels hat ein Hauptziel: die (jüdische und völkerrechtswidrige) Besiedelung Palästinas, eben jenes Rests, der den Palästinensern nach dem 1967-Krieg geblieben ist. Und sie folgt einem alten Muster. Als Beispiele sollen Australien und Amerika dienen: Der »Weiße Mann«, der »westliche«, kommt und nimmt sich das Land. Mit Mord und Totschlag, mit Verjagung und blankem Diebstahl. In Australien haben wir heute, als Resultat der Verachtung, die dämmernden Aborigines, die Ureinwohner, die sich – ein großer Teil – von der Gewalt nicht erholt haben, gebrochen sind, alkoholverseucht. Und in den USA stiegen die »native Americans«, die in meiner Kindheit »Indianer« hießen, nicht minder dramatisch ab: Sie dösen, ebenfalls vom Feuerwasser erledigt, in ihren Reservaten.
Ja, richtig, die Eroberung Palästinas ist damit nicht zu vergleichen, nie hat die israelische Armee das palästinensische Volk abgeschlachtet. Die Gier nach Land allerdings ist dieselbe, nur die Mittel, diese Gier zu befriedigen, sind andere. Das Ziel ist folglich nicht die Vernichtung des Gegners, sondern seine »Abschiebung«: ins Ausland, in die Welt, nur weit weg von der »Hauptstadt Jerusalem«, nur weit weg vom jüdischen Staat. Aber das funktioniert nicht. Die Palästinenser sind auf sentimentalste Weise mit ihrer Erde verbunden, sie wollen, nein, sie können nicht loslassen. Denn seit Hunderten von Generationen leben sie auf ihr, stolz und renitent. Und fest entschlossen, nicht klaglos zugrunde zu gehen, sich nicht – wie andere Entwürdigte – aus schierem Unglück zu Tode zu saufen. Sie wollen kämpfen und leben.
25
Ende der Leseprobe