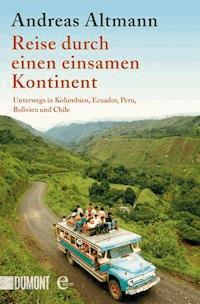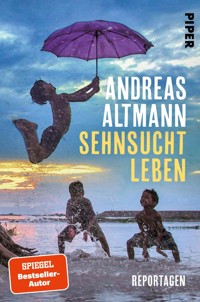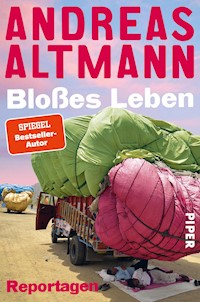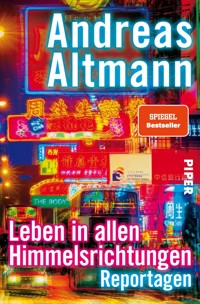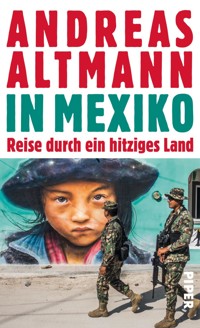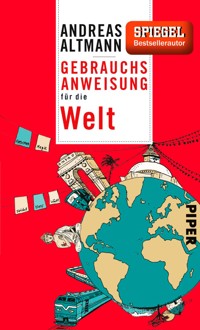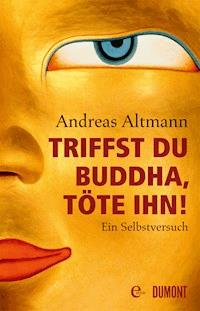8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Andreas Altmann ist Deutschlands bekanntester Reiseschriftsteller. Ihn treibt eine unstillbare Neugier, die Sucht nach Leben. Er geht weite Wege, um Neues zu entdecken: Geschichten und Menschen, die mit unserer gewöhnlichen Realität wenig gemein haben. So trifft er eine Geisha zum Dinner, spielt den Sünder bei einem amerikanischen Televangelisten ebenso wie »Gott« auf der Südseeinsel Tanna. Ein andermal lässt er sich als Sex-Schwächling bei indischen Quacksalbern kurieren, dann wieder als Zen-Schüler in einem Tempel in Kyoto auf den rechten Weg führen. Es ist ein Kosmos des Kuriosen, des Andersartigen, des Menschlichen, den Andreas Altmann in diesen ›Geschichten von unterwegs‹ präsentiert. Es sind Geschichten, die sich einbrennen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Andreas Altmann
SUCHT NACH LEBEN
Geschichten von unterwegs
eBook 2010
© 2009 für die deutsche Ausgabe:
DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Zero, München
ISBN eBook 978-3-8321-8505-3
ISBN App 978-3-8321-8524-4
www.dumont-buchverlag.de
Für Jene, bei der ich zu glitzern beginne, wenn sie am Horizont auftaucht
Für Dietrich Haugk, meinen verehrten Übervater
Grace Jones:
Bulletproof Heart
Joseph Beuys:
Jeder Mensch muss sich verschleißen.
Joan Didion:
Allzu schnell vergessen wir das,
was wir niemals glaubten vergessen zu können.
Wir vergessen, was wir uns einmal zuflüsterten
und was wir träumten.
VORWORT
Ein gewisser Simeon Stylites, etwa 390 nach unserer Zeitrechnung geboren, saß siebenunddreißig Jahre auf einer Säule. Von dort schrieb er Briefe und Reden. Bis er am 2. September 459 starb. Heute ist er vergessen und doch in aller Munde. Der asketische Sonderling erfand die »Kolumne« – von lateinisch columna/Säule – und gelangte somit, für immer unsterblich, in unseren Wortschatz.
Der Mann war klug genug und kam ein halbes Leben lang mit ein, zwei Quadratmetern aus. Dadurch unterscheidet er sich von einem Reporter neuerer Zeiten. Der scheint weniger klug, weniger wissend. Braucht er doch die ganze Erdkugel, um den Stoff zu finden, von dem er anderen erzählen will. Dennoch, das Verzichten, das Sonderliche, das haben der Säulenheilige und die Weltreisenden gemeinsam. Immer stillsitzen und den Kopf nach eigenen Gedanken ausleuchten scheint so anstrengend wie immer den Ranzen zu schnüren und loszujagen. Auf seltsame Weise, so ist zu vermuten, treibt sie dieselbe Sehnsucht: die Sucht nach Leben, nach Intensität, ja die schöne wahnwitzige Idee, etwas zu erfahren vom Vielerlei, vom Allerlei der Welt. Der eine aus der Vogelperspektive in achtzehn Metern Höhe, der andere in Augenhöhe mit allen, die ihm begegnen. »Jeder Mensch ist mein Niveau«, hörte ich einmal einen amerikanischen Schriftsteller sagen. Das ist ein bravouröser Satz, er ist vollkommen wahr.
Zuerst hieß der Untertitel dieses Buches nicht »Geschichten von unterwegs«, sondern »Anschläge von unterwegs«. Ein kleines Wortspiel. Anschlag als Tippen auf der Tastatur, und Anschlag als Attacke auf andere. Nicht auf ihren Leib und ihr Leben, doch auf ihre Gedanken und ranzigen Gewohnheiten. Ein Buch als Störenfried. Um die Friedhofsstille in unseren Köpfen zu verscheuchen, um uns wieder an den Witz »ewiger Wahrheiten« zu erinnern, um uns einzubläuen, dass uns nichts anderes sicher ist als dieses eine Leben. Wie sagte es Franz Kafka: »Ich glaube, man sollte überhaupt nur solche Bücher lesen, die beißen und stechen.«
Nun denn, wir anderen Schreiber, die nie Genie waren und nie eins werden, müssen uns bescheiden. So habe ich nur einen Teil von »Sucht nach Leben« mit dem Presslufthammer geschrieben, die andere Hälfte soll verzaubern und – wieder und wieder – vom Reichtum der Welt erzählen. Von den wunderbar wunderlichen Versuchungen und Belohnungen, die sie für jeden Welthungrigen bereithält. Schreiber und Leser als Goldgräber und Schatzjäger. Und die Sprache als Mittler, als Verbündete zwischen allen, die hungern und dürsten. Dabei könnte uns ein zweites Genie beistehen, Miguel Cervantes, der Verfasser des Don Quijote: »Die größte Dummheit scheint, das Leben so zu sehen, wie es ist, und nicht, wie es sein sollte.«
Noch etwas. Damit kein Missverständnis verstört. Der Autor ist keine moralische Anstalt, kein »gutes« Beispiel. Nichts schläfert erfolgreicher ein als Moralpredigten. Weil sie voraussehbar sind, nie überraschen. So schreibe ich zuallererst für mich. Um die eigenen Hohlstellen, Übel und Feigheiten zu entdecken, ja auszuhalten und – wenn irgendwann genug Kraft und Entschlossenheit vorhanden – zu überwinden. Oder zu lernen, die Niederlagen hinzunehmen. Ich schreibe, wie ich lese. Sprache – die eigene oder die fremde – soll mir helfen, nicht aus der Welt zu fallen. Dem Leser, vermute ich mal, ergeht es ähnlich. Auch jenem, der keine Zeile schreibt.
Als Letztes ein konkretes Beispiel. Jemand erzählte mir, dass Elke Heidenreich sich einst bei Biolek als krebskrank geoutet hatte. Ich reagierte unwirsch, ich mag es nicht, wenn Zeitgenossen ihre Leberzirrhosen, Menstruationskrämpfe oder Metastasen öffentlich, via bunten Abend, ausbreiten. Irgendein Schamgefühl hindert mich daran, solche Beichtstunden aufregend zu finden. Ich erfuhr aber noch, dass Heidenreich einen Grund für ihr Tun angab: sie wolle anderen Mut machen, denen ihr Körper Vergleichbares zumutet. Damit sie nicht einknicken, sondern den Kampf gegen den potentiellen Killer aufnehmen. Das imponierte mir sofort, klang schlüssig und menschennah. Und ich sah die Parallele zwischen jenen, die Bücher schreiben, und jenen, die nach ihnen suchen. Einer erzählt dem anderen von seinen Wunden und Träumen. Das hilft, ich schwöre, allen beiden.
SUCHT NACH LEBEN
Fahrt von Seoul in den Süden, zum Meer. Der vollbesetzte, leise Bus. Die Koreaner schliefen, waren müde vom Chusok, dem Erntedankfest. Ich blickte hinauf zum strahlenden Vollmond. Keiner wachte zuverlässiger über meine Schlaflosigkeit. Frühmorgens erreichten wir Pusan, die Hafenstadt. Ich wollte an Bord, wollte rüber nach Japan.
Beim Gedränge vor der Passkontrolle fiel mir ein Mann auf. Er drängelte nicht. Mittelgroß, kurze Haare, ein grauer Überwurf mit einer Schnur als Gürtel, die nackten Füße in den Sandalen. Sein heiteres, intelligentes Gesicht, in der linken Hand hielt er ein Bündel, sein Gepäck. Asiaten sehen immer jünger aus, als sie sind. Ich vermutete Mitte dreißig. Ich ließ ihn nicht aus den Augen.
Nach dem Abendessen, wir waren bereits unterwegs, sprach ich ihn an, bat ihn an meinen Tisch. Ohne Zögern nahm er Platz und stellte sich mit dem Namen Sota vor. Über Kioto wollte er zurück in die Staaten, in Vermont leitete er einen »Sangha«, ein buddhistisches Zentrum. Er sprach gleichmütig, ohne Prätention, erzählte vom Tagesablauf im Kloster, von der strengen Disziplin. Dann verstummte er, blickte hinaus auf die See, deren Wellen heftiger wurden. Die Ober verteilten Tüten an die Passagiere. Irgendwann sagte der Mönch: »Nicht reden tut gut«, Pause, Geduldspause, dann: »Der Weg ist das Ziel.«
Uff, die Kalendersprüche des Meisters. Meine Begeisterung flaute ab. Die Phrasen hätten von Paulo Coelho stammen können, der als orientalischer Klosterbruder vermummt aus dem Schatzkästchen seiner innig gehorteten Albernheiten plauderte. Musste man sieben Stunden täglich meditieren, um das herauszufinden? Dass nicht reden guttut? So gut eben wie bisweilen reden. Weil im rechten Moment den Mund aufmachen heilen kann und schweigen das Leid nur vergrößert. Was für ein esoterisches Geraune, was für ein Gehabe, Sätze loszulassen, die – auf den Kopf gestellt – nicht minder stimmten. Ach – noch furchterregender – das Gesülze vom »Weg als das Ziel«. Tausend Mal nein. Hält einer, bitte, einmal inne und hängt den Satz in die Höhe, hoch genug, um ihn in seiner ganzen Dümmlichkeit zu betrachten.
Ich war vor zwei Monaten von Europa hierher gereist, weil ich ein Ziel hatte, weil mein Kopf vor Sehnsüchten platzte, die er leben wollte, weil ich bestimmte Männer und Frauen treffen wollte, weil mich – es ging mir schlecht, ich suchte einen Ausweg, ich suchte einen Beruf – nichts anderes trieb, als ein Ziel zu finden, das ich imstande war zu erreichen. (Und dann das nächste, und dahinter wieder eins.) Ich wollte zielen und treffen. Mich nicht immer – wie bisher – ziellos auf den Weg machen, den berühmten, der kein Ziel haben soll. Ja, zugegeben, auch ich hatte diesen Nonsens nachgeleiert. Geistlos, ergriffen, beeindruckt vom ätherischen Weihrauch, mit dem der Satz daherkam. Was für ein Merkspruch für Nieten, die nie dort eintreffen, wo sie eigentlich – hinter all dem erhabenen Dusel, mit dem sie ihre Halbherzigkeiten rechtfertigen – eintreffen wollten.
Dem röchelnden Herzkranken in einer Ambulanz, die im Stau nicht weiterkommt, rufe ich beschwingt zu: »Don’t worry, relax, nicht das Krankenhaus ist das Ziel, nein, der Weg dorthin!« Und dem Aids-Verseuchten klopfe ich generös auf die Schulter: »Hey, Abkratzer, du lernst es auch nicht! Nicht das Medikament ist wichtig, sondern die vielen Jahre zu seiner Entdeckung!« Und dem nächsten Hungerspecht, dem ich in Afrika begegne, will ich eine Lektion erteilen: »Mensch, Skeletti, genieße den Weg zur Hirsesuppe! Sie wird kommen oder nicht, Hauptsache, du bist unterwegs!« Und der Fünfundzwanzigjährigen, die sechs Jahre als Bedienung jobbte, um sich ihr Medizinstudium zu finanzieren, schreibe ich nach dem verfehlten Examen einen Trostbrief: »Liebe Adele-Bernadette, lass los! Auch Kellnern kann schön sein, auch dort wird deine Buddha-Natur knospen und gedeihen!«
Nichts als die reine Idiotie. Der Röchler will sein Herz zurück, der Infizierte sein Immunsystem, der Afrikaner ein Gefühl von Sattsein und die Durchgefallene hasst Bierkrüge schleppen und will als Ärztin ihr Geld verdienen. Sie alle, ohne Ausnahme, machten sich auf den Weg, um ans Ziel zu gelangen. Ohne ein Ziel wären sie nicht losgegangen. Das Ziel ist das Ziel. Jetzt stimmt der Satz.
Nicht um ein Jota anders bei mir. Ich war nach Asien aufgebrochen, weil ich noch immer nicht wusste, was aus mir werden sollte. Ich fuhr noch in einem Alter Taxi, in dem andere bereits ihre Vorfrührente verhandelten, hatte den Job (und mich) jede Nacht widerwärtiger gefunden, hatte bereits in zehn anderen Berufen bewiesen, dass ich für keinen taugte, dass keiner imstande war, mir einen Hauch von Erfüllung und Freude zu verschaffen. Hatte inzwischen als Spüler, Privatchauffeur, Anlageberater, Straßenbauarbeiter, Buchklub-Vertreter, Nachtportier, Dressman, Postsortierer, Parkwächter und Fabrikarbeiter gejobbt. Ohne Vergnügen, ohne Zukunft, ohne einen Funken Hingabe.
Ich hatte genug vom Weg, ich wollte mein Leben in den Griff bekommen, wollte einen Platz finden, der meinen Ansprüchen und Hirngespinsten entsprach. Natürlich jagte mich nebenbei die Angst, dass die Talente nie reichen würden für das andere, das geträumte Leben. Aber meine Hybris war penetranter als meine Ängste, ich bestand darauf: Eine Ziel musste her, ein Hit, das berauschende Gefühl, dass ich existierte.
All das stürzte jetzt wieder auf mich ein, als Mister Sota seinen spirituellen Stuss vor mir ausbreitete, diese miefen Phrasen, die wie Nullen daherkamen und wie Nullen hinterm Perlmutterdunst verpufften. Seine zwei Sätze reichten und alle Wunden sprangen wieder auf, alle Narben bluteten von neuem, alle Wut auf mich (und die Welt) kam zurück.
Etwas Seltsames passierte. Und ich weiß bis heute nicht, ob der Mönch mich nur provozieren, nur wissen wollte, wie ich auf seine Plattheiten reagieren würde. Was ging in ihm vor, als wir schweigend am Tisch saßen? Hatte er mein wütendes Gesicht gesehen? Meine wütenden Gedanken gelesen? Meinen Überdruss gespürt? Jedenfalls ergriff er plötzlich meine linke Hand und sprach den aberwitzigen Satz: »Du wirst leiden, um dich zu finden.«
Das gefiel mir sogleich, die sieben Wörter waren pathetisch und wahr. Und schleuderten mich erneut zurück in einen Strudel von Rückblenden. Ich wollte immer glauben, dass ich das war – vielleicht war –, was die englische Sprache mit dem schönen Wort »latebloomer« bezeichnete. Ein Spätblüher, ein Spätzünder. Einer, der länger brauchte als andere, länger irrte, sich irrte. Aber doch irgendwann den Zweck in seinem Leben erkennen würde. Das, was endlich Sinn stiftete, ihn rüstete. Frühbegabte sahen anders aus, sie kamen mit dem Schraubenschlüssel oder einem Saxophon auf die Welt, wussten von Anfang an, wohin sie gehörten. Ich nicht. Nach der Reparatur eines Irrtums bereitete ich den nächsten vor. Ich hetzte von einer Niederlage in die nächste. Ich wollte – neben den Jobs – Radrenn-Profi werden (Rennräder gekauft, Rennen gefahren), dann Mister Body Building (Hanteln, Bullworker und Drückerbank gekauft, Verein beigetreten), dazwischen ein Gitarren-Gott (Gitarren gekauft, Stunden genommen), hinterher ein Schlagzeug-Gott (Schlagzeug gekauft, Autodidakt), anschließend Popstar werden (Band gegründet und von ihr gefeuert worden) und zuletzt Filmschauspieler (Schauspielschule besucht, an Theatern gespielt, TV-Rollen, wieder gefeuert). Ich wollte drei Studien auf einmal (mich an verschiedenen Universitäten immatrikuliert), ich wollte alles und wurde nichts. Ich war entweder Letzter oder Vorletzter. Oder noch trüber, nur Durchschnitt, nur einer von vielen.
Mag sein, dass ich leiden würde. Weiterhin, noch immer. Klar war, dass ich bis zu diesem Abend, mitten auf dem Japanischen Meer, schon reichlich gespendet hatte. Die Liste der Ausweglosigkeiten war lang, der Demütigungen, der Sackgassen, der Tage und Nächte, an denen ich mein Leben als Loser aushalten musste. Dabei begannen früh die Rettungsversuche. Schon als Elfjähriger trat ich meine erste Therapie an, auf dem Überweisungsschein stand: »Schwererziehbarkeit«. Mir gefiel das Wort, irgendwie plusterte es mein Ego. Ich Narr, wäre mir bewusst gewesen, was auf mich zukam, ich hätte kleinlauter reagiert. Andere Therapien folgten, über zwei Jahrzehnte, auf verschiedenen Kontinenten. Immerhin hatte ich begriffen, dass trotz der Kinnhaken und Fallen eine Kraft in mir loderte, die von den Pleiten nichts wissen, die noch immer nicht wahrhaben wollte, dass ich am Endpunkt meines Glück und meiner Begabung angekommen war. Die renitent sich sträubte. Diese Sucht nach Leben, die hatte ich schon. Sie schien immer da.
Sota ließ meine Hand los. Mir war, als hielte er genau so lange, wie die Erinnerungen durch meinen Kopf brausten. Er sagte ruhig: »Du kannst mir drei Fragen stellen.« Ich ertappte mich dabei, trotz der Überraschung, dass ich keinen Atemzug lang zögerte und sofort startbereit war. Kein Wunder, denn ich stellte sie mir jede Stunde. Ich sagte noch, dass ich nur eine Frage hätte, nur eine einzige. Von ihr hinge alles ab. Sota nickte nur, und ich legte los: »Wird mein Leben so, wie ich es will, kreativ, werde ich das tun, was ich liebe, was mich erfüllt?« Und der Buddhist antwortete trocken und umweglos mit »ja«, schloss kurz die Augen und setzte nach: »Allerdings unter zwei Bedingungen, die erste: Du musst schreiben. Mag sein, dass du in deinem früheren Leben schon einmal mit Sprache zu tun gehabt hast. Vielleicht als Prediger, als Wandermönch. Möglich, dass du als Ketzer verbrannt worden bist. Ich spüre viel Hass in dir. Zweitens, du musst lernen, deine Einsamkeit auszuhalten. Oft ist deine geistige Verfassung zwiespältig und schwach. Dann flüchtest du in Sex. Halte das Alleinsein aus, setze es schöpferisch um. Trödle nicht, bis zu deinem nächsten Geburtstag muss ein Buch von dir erscheinen.«
Irritiert blickte ich auf den Koreaner. Woher wusste er, dass ich schreiben wollte? (Auch das noch!) Seit ich in Pusan angekommen war, hielt ich kein Blatt Papier in Händen, keinen Notizblock, keine Seite Buch, nichts, was irgendeinen Rückschluss erlaubt hätte. Woher kannte er meine Wut? Meine Bereitschaft, vor jeder Herausforderung – sobald das Strohfeuer verglüht war und die tatsächlichen Forderungen auftraten – davonzurennen? Erstaunlich auch sein Hinweis auf die Deadline. Immerhin noch elf Monate, um rechtzeitig das Orakel zu erfüllen.
Jetzt hätte ich viele Fragen gehabt, aber Sota verwies auf die späte Stunde, stand auf, verbeugte sich und verließ den Speisesaal. Das war ein guter Abgang, stilsicher und mysteriös. Keine Diskussionen jetzt, keine Erklärungen, keine Fußnoten.
Eine Viertelstunde später machte ich mich auf den Weg nach unten, zum Schlafraum. Über hundert Leute übernachteten hier, ein paar flüsterten noch. Ich rauchte, durch die Fenster fielen die hellen Strahlen des Monds. Ich fand keine Ruhe, kletterte zurück aufs Deck, schlenderte zum Bug. Die warme Brise, das märchenstille, hell glänzende Meer, das Gleiten des Schiffs. Woody Allen wusste es so genau: »Was wäre ich glücklich, wenn ich nur glücklich wäre.«
Ganz vorne, neben der Ankerwinde, sah ich den Mönch sitzen, ein Schatten, nicht eine Bewegung. Dieser Mensch tat das, was er wohl am besten konnte, er meditierte. Mir fiel wieder ein, dass ich auch etwas können wollte, was ich am besten konnte. Noch fünf Stunden nach Japan.
Erstes Nachwort. Ein knappes Jahr später lud ich meine Freunde ein. Ich trank, um mich zu beschwichtigen. Um Mitternacht entnahm ich einem schmalen Paket – es kam an diesem Morgen per Express – ein Buch. Der Absender war ein Verleger, das Buch hatte ich geschrieben und seit ein paar Minuten feierte ich meinen Geburtstag.
Zweites Nachwort. Ich denke noch immer mit Dankbarkeit und Staunen, auch mit einem Grinsen, an Sota. Weiß noch immer nicht, ob er ein gerissener Hallodri oder ein »Seher« war. Fest steht, alles hat er nicht gesehen. Oder wollte nicht alles sehen. Aus Taktgefühl? Aus Blindheit? Wie auch immer, es kam der Moment, in dem ich stark genug war, um zu begreifen, was ich produziert hatte: ein mäßiges Buch, stichig vor Selbstmitleid, humorlos, voller »Bekenntnisse«, die ich heute nur noch unter Androhung einer Enthauptung riskieren würde. Und der Mönch war freundlich genug, mir ebenfalls die Information zu unterschlagen, dass ich bald Geld hinlegen musste für den »Druckkostenzuschuss« und wieder Geld, um die Drucksachen eines Tages ordnungsgemäß verramschen, nein, einstampfen zu lassen. Ja, mir die knallharte Wahrheit verheimlichte, dass der »Verleger« wegen mir den Verlag gründen und wegen mir – das war unser gemeinsames Schicksal – pleite gehen würde.
Drittes Nachwort. Heute bin ich auch dem Flop dankbar. Denn auf den vielen Seiten, überladen mit verbalen Schandflecken und inbrünstigem Pathos, gab es ein paar halbe Seiten, die »stimmten«, die den Weg Richtung Notausgang wiesen und radikal mit allen Alternativen aufräumten. Ich erkannte auf den hundert oder zweihundert Zeilen, dass mir nichts anderes mehr blieb als zu – schreiben. Dass ich keinen Broterwerb entdeckt hatte, sondern das einzige Vehikel, mit dem die Chance bestand, davonzukommen. Mit eben dem Elegantesten, was wir je erfunden hatten. Mit der deutschen Sprache: als Giftschleuder gegen alles, was verwundete, als Rettungsboot, als Fallschirm, als Lungenmaschine, als Sauerstoffgerät, als Trostpflaster und Schlupfloch, als Tarnkappe und fliegender Teppich, als Hauptnahrungsmittel und Droge.
VERRÜCKTHEITEN
UND ANDERE FREUDEN
ELEGANT REISEN
»You, Mister!«, wie ein Tomahawk landete der Satz in meinem Rücken. Ungerührt ging ich weiter, ich hieß nicht You Mister, ich wollte nicht gemeint sein. »You, Mister!«, der zweite Tomahawk sauste. Aber auf geheimnisvolle Weise landete er sanfter, wie ein Versprechen. Gegen alle Gewohnheit drehte ich mich um, und da stand er, zehn Schritte weit weg, lieb, bauchig, lächelnd.
»My name is Sandy, please come in!« Sandy, der Schneiderladen-Besitzer und Lockvogel. Da ich in Paris lebe, habe ich den absoluten Blick für schlecht sitzende Männerhosen. Erbarmungslos zoomte ich auf des Verführers Nähte, das verräterischste Zeichen für Schluder und Unbegabung. Aber sie saßen, Sandy trug ein Meisterwerk, beruhigt trat ich ein.
»Entweder man hat eine gute Figur oder einen guten Schneider!«, sagen sie in Manhattan. Ich befand mich gerade in einer Seitenstraße von Bangkok und wusste plötzlich, dass nur noch vierundzwanzig Stunden fehlten, bis ich endlich ungeniert über die Fifth Avenue flanieren durfte. Ich fand ein sexy Grau, blätterte im L’UOMO, dem italienischen Modemagazin, das lässig herumlag, fand den schönsten Mann und legte den Finger auf seine römischen Schultern: »This one, please!« Der Herrliche trug einen Zweireiher, der in Bälde mir gehören sollte. Sandy, ganz unaufgeregt: »Good choice, let’s do the fitting.«
Während der Master Tailor behände alle Gliedmaßen abmaß, fluteten ein paar Bilder durch meinen Kopf. Auf geheimnisvolle Weise schienen sie dafür mitverantwortlich, dass ich jetzt vor einem Spiegel stand und elegant aussehen wollte. Vor zwei Tagen hatte ich mich noch in Phuket befunden, einem der inoffiziellen Open-Air-Puffs Thailands. Kurz zuvor hatte (auch) hier der Tsunami den Strand verwüstet. Ich war angereist, um einen vermissten Freund zu suchen. Dreihundert Meter und sechsunddreißig Stunden von der Verwüstung entfernt hatte sich die Spaßguerilla schon wieder erholt. Disco-Pop dröhnte und viele (weiße) Dicke führten ihre nackten Ranzen spazieren, während neben ihnen – Händchen haltend mit den Massigen – die einheimischen working girls stöckelten.
Allmächtiger, was las man nicht in der Presse über das männliche Geschlecht, das sich nun sputete, die Frauen in Sachen Body-Wahn einzuholen. Dass auch Männer angefangen haben, weltweit Hundert-Millionen-Beträge in die Verschönerung ihrer Oberfläche zu investieren. Mag alles stimmen, aber hier war dieser Trend noch nicht ausgebrochen. Man wollte die Nonchalanten fast beneiden um die Mühelosigkeit, mit der sie ihren Wanst in der Öffentlichkeit vorführten.
Als ich am nächsten Nachmittag ein zweites Mal den Master’sShop verließ, war ich das, was die Manhattaner einen »sharp dresser« nennen. Der Zweireiher saß wie aufgebügelt. Lang lebe Sandy, er zieht Männer an, er verschönert die Welt.
BILANZ EINES LOSERS
Kundar sagte fürsorglich: »Achtung, Betrüger in der Stadt.« Der Satz fiel in Asien, aber er passt zu jedem Erdteil. In seiner Stadt, so berichtete der Germanistik-Student, näherten sich Männer einem Ahnungslosen und versprachen listig: »Komm mit, ich habe eine Schwester, die in deinem Land studiert.« Und manövrierten das Opfer an einen Ort, wo sie dem freudig Erregten versprachen, die Wartezeit mit einer Tasse Tee (voll Schlafmittel) zu verkürzen. So lange verkürzen, bis der arme Teufel geplündert wieder aufwachte.
Der umsichtige Kundar, ach seine vergebliche Fürsorge. Denn bei den hiesigen Temperaturen würde mir bisweilen die Konzentration verloren gehen, würde ich auf so manchen Filou hereinfallen und so manchen Heiligen übersehen.
Trotzdem, an vielen Stellen war ich unverwundbar. Unverführbar. Denn auf Reisen kaufe ich nichts, nur Essen und Trinken, nachtweise ein Bett, investiere in Schmiergelder für den Schaffner, um einen letzten Sitzplatz zu erhalten, verwende woanders die Scheine zur Erpressung, erpresse Storys, kaufe zwei Bustickets und lasse nur einen Zeitgenossen neben mir Platz nehmen, der verspricht, eine Geschichte zu erzählen. Immer will ich Vergängliches einkaufen, nie Souvenirs, nie ein Ding, das man schleppen muss, das behütet, abgestaubt, ja, bewacht werden muss. Nie habe ich ein Eigenheim besitzen wollen, nie einen Quadratmeter Land, nie eine »Immobilie«, nie etwas Unbewegliches. Meine Andenken, meine Erinnerungen sind virtuell, mehr oder weniger konfus auf mein Herz, meine Großhirnrinde und die Festplatte meines Mac verteilt.
Ich wäre gern jener, den der palästinensische Publizist Edward W. Said »einen Intellektuellen« nannte, »der wie ein Schiffbrüchiger mit dem Land zu leben lernt, nicht auf ihm. Nicht wie Robinson Crusoe, dem es darum ging, sein kleines Eiland zu kolonisieren, sondern eher wie Marco Polo, den niemals der Sinn für das Wunderbare verließ und der immer ein Reisender war, ein zeitweiser Gast, kein Beutemacher, kein Eroberer, kein Aggressor.«
Kundar nannte Typen wie mich einen »no-issue-man«, einen Ohne-Ergebnis-Mann, einen eben, der nichts für die Gesellschaft geleistet hatte. Kein Haus hochgezogen, keine Großfamilie gegründet, ja nicht einen Sohn vorzeigen kann. »Leben heißt zeugen«, meinte der Dreiundzwanzigjährige. Er meinte es barsch und ungeduldig. Mit der Liebe zur deutschen Sprache hatte der junge Kerl die Liebe für schwerwiegende Gedanken verinnerlicht. Dennoch gelang uns ein heiterer Abschied, jeder mit seinen Träumen im Kopf. Kundar wollte die Einehe, die Windeln aufhängen, die lebenslangen Ratenzahlungen. Ich will die Leichtigkeit, den Swing, die schöne Nutzlosigkeit.
BLAU SEIN UND KICHERN
Eines Nachmittags schlenderte ich durch den El Khalili Bazar in Kairo. Verschlungen, riesig, hinter jeder zweiten Ecke lauerte eine Überraschung. Und diesmal, es war mein dritter Besuch, erwischte es mich. Denn Fahti hatte ein Auge auf mich geworfen, sogleich verriet er: »You are someone very special.« Nicht wie alle anderen wäre ich, er wüsste Bescheid: »Ich sah dich, ich kannte dich.« Fahti, das Schlitzohr, sein bravouröser Eröffnungssatz diente als erste Breitseite, um den potentiellen Kunden weichzuklopfen. Nach siebzehn Umwegen hatte er mich dorthin manövriert, wo er mich haben wollte. In seinem Box Shop, einem Sammelsurium verschieden kleiner Holzkisten.
Sieben Golden Books lagen herum, die Odensammlung einer höchst zufriedengestellten Kundschaft. Bevor ich sie durchblättern durfte, erwähnte Fahti vertraulich, dass eine »letzte handgemachte Originalschatulle noch vorrätig wäre.« Ich blätterte und sah lauter Opfer mit letzten handgemachten Originalschatullen. Neben den Fotos standen ihre fröhlich gekritzelten Dankesschreiben. Verführer Fahti lächelte scheinheilig bescheiden. Martin A. aus Berlin gestand: »Zuerst dachte ich, mein Gott, wieder einer dieser Abzocker, aber einem Holzkästchen konnte ich dennoch nicht widerstehen. Doch jetzt kann ich echt nichts mehr schleppen.«
Ich blieb standhaft, eisern standhaft. Obwohl Fahti alle Register zog und zu allen Mitteln griff, um mich zu versuchen. Tee gab es, die Wasserpfeife, drei Runden Hasch, ein Sonderangebot, einen Superkredit, »all creditcards accepted«, nein, »all currencies accepted«, ja zuallerletzt der bedrohliche Hinweis, dass die einzig noch verfügbare handgearbeitete Schatulle »in einer Stunde weg sein könnte«.
Das war geschwindelt, denn um diese Zeit saß ich noch immer auf dem Sofa, jetzt blau wie Fahti vom Dattelschnaps. Zuletzt tränten uns die Augen, denn im Golden Book Number five entdeckten wir Doris L., die begeistert notiert hatte: »Viel Glück gehabt. Beim freundlichen Fahti, der auch deutsch spricht, eine letzte handgearbeitete Originalschatulle erstanden. Genau das passende Geschenk für Alf.«
Als der englische Schriftsteller T. E. Lawrence nach seiner Zeit als Lawrence von Arabien nach Europa zurückkehrte, wurde er gefragt, was er am innigsten vermissen würde. »Die Freundschaft, die Gastfreundschaft.«
HÖLLISCH SCHÖN
Als ich nach Mitternacht um ein Häusereck eilte, stand ein Mann mit leprafaulen Händen im Weg, die Arme ausstreckend und »Ram, Ram« krächzend. Er zeigte sein verdorbenes Fleisch als Beweis für die Heimsuchung, die über ihn gekommen war. Und Lord Ram, sein mächtiger Gott, sollte jeden zur Übergabe von Geld überreden. Eine Straßenlampe flackerte auf das Gesicht des Krüppels. Ich brannte ein Zündholz ab und steckte ein paar Scheine zwischen seine Fingerstumpen. So dunkel waren sie.
Mitte des 17. Jahrhunderts entstand das heutige Old Delhi. Bisher wurde keine Sprache erfunden, um den Schlund zu beschreiben. Im Red Fort, dem Wahrzeichen, ließ der Bauherr damals in die Mauern meißeln: »Gibt es ein Paradies auf Erden, dann ist es das, dann ist es das, dann ist es das.« Nicht weit davon entfernt kritzelte ein Besucher des 21. Jahrhunderts: »If there’s hell on earth, it might be here, it might be here, it might be here.«
Beide Sätze erzählen von der Wirklichkeit. Old Delhi gilt als Ort schwindelerregender Daten. Zwei Millionen indische Menschen und indische Tiere wimmeln auf fünf Quadratkilometern Erde. Zuwachsrate: rasend. Ächzende Schimmelbuden und rindviehverschissene Gassen, Verkehrsorgien, ein Drogennest, Hinterhofprostitution, Steinzeitarbeit, das zum Himmel schreiende – ja sie schreien es – Unglück kaputt geborener Zombies.
Wer sich her wagt, sollte sich vorher wappnen. Um die Seitenblicke in die Hölle zu bestehen. Hat einer Glück, betritt er zwischendurch das Paradies. Hat einer viel Glück, betritt er es immer wieder.