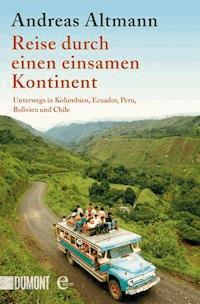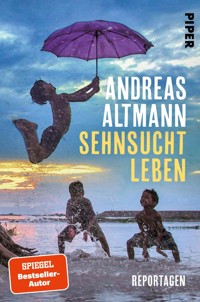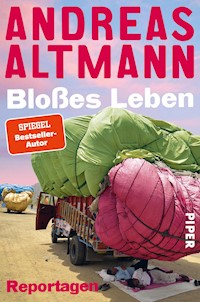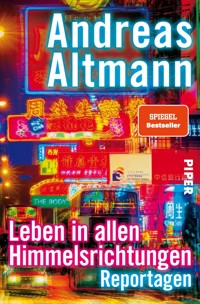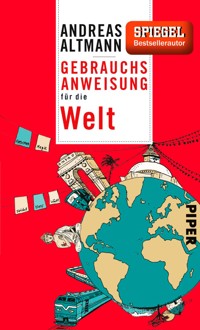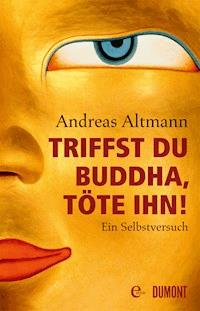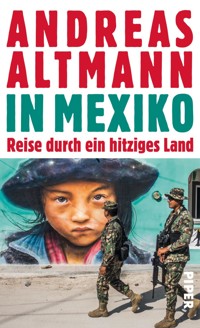
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mexiko – das glühende Land, dieser riesige Staat, der zuletzt durch den Streit um Trumps Mauer Schlagzeilen machte, wird von Andreas Altmann in seinem neuen Buch mit klarem Blick beschrieben. Altmann hat selbst eine Zeit lang in Mexiko gelebt, für sein Buch kehrte er zurück. Er reist für seine Reportage kreuz und quer durch die mexikanischen Bundesstaaten und erzählt von besonderen Orten und Menschen. Er sammelt Geschichten, die Hirn und Herz erfreuen, sie beglücken, sie traurig machen. Ein Land voller Widersprüche, voller Freude und Schrecken. Wie gewohnt lässt Altmann nichts aus, er schaut hin, er will wissen. Ein Buch, das den Leser mitreißt und zum Nachdenken und Mitfühlen einlädt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover & Impressum
Karte Mexiko
Motto
Vorwort
1 Dieser Augenblick: wenn das Flugzeug...
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.deAber ja, gewidmet der unglaublichen MinderheitISBN 978-3-492-99212-1© Piper Verlag GmbH, München 2018Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenCovermotiv: Francesca VolpiKarte Mexiko: Peter Palm, BerlinDatenkonvertierung: Fotosatz Amann, MemmingenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Sinnliche Massage! – Du bist nicht unsterblich! – Rufe heute noch an!
Werbeposter in einer mexikanischen Stadt
Ich verschiebe den Tod, indem ich lebe, indem ich leide, indem ich riskiere, indem ich gebe, indem ich verliere.
Anaïs Nin
Hiersein ist herrlich. Alles. Die Adern voll Dasein.
Rainer Maria Rilke
VORWORT
Das wird kein Reisebuch. Es wäre überflüssig. Jede Hausmauer in Mexiko wurde bereits beschrieben, Millionen Fotos zirkulieren im Netz, Hunderttausende Webseiten gibt es. Auf Youtube kann man den Rest seiner Lebenszeit mit dem Betrachten einschlägiger Beiträge verbringen.
Was tun? Das Einzige, was so ein Unternehmen – noch ein Buch – rechtfertigt: Der Reporter wirft einen sehr eigenmächtigen, auch provozierenden Blick auf alles, was ihm über den Weg läuft. Auf Frauen, auf Männer, auf alles, was an ihm vorbeizieht, was ihn entflammt und mitreißt, was ihn heulen lässt und bitter sein, alles, was seine Begabung zur Menschenliebe und Freundschaft weckt, was seine Wut und Verachtung provoziert, alles eben, was (weltwachen) Menschen gemeinsam ist: die Neugier auf das Leben anderer.
Je radikaler der Schreiber sich ausliefert, je verwundbarer er sich herzeigt, desto inniger verführt er den Leser zur Teilnahme. Der Schreiber als Katalysator, um Nähe herzustellen. Nähe zum Fremden, an dem so vieles uns fern ist. Und vieles so nah.
Ich – jetzt bin ich selbst Leser – will von einem Buch entführt, ja, gebeutelt werden. Ich bin nicht zimperlich. Solange ich hinterher eine Spur weniger ignorant bin, will ich nicht klagen. Der Autor darf ruhig schwitzen und in Not geraten. Das muss er, sonst ist er mein Geld und meine Lebenszeit nicht wert.
Ich will erklären, wie ich mir – nun als travelwriter – das Schreiben im 21. Jahrhundert vorstelle: dass in der Nähe von Kairo Pyramiden herumstehen, wissen sogar die, die von der Welt nichts wissen wollen, sprich, viele. Also muss manmit einer Geschichte zurückkommen, die überrascht. Nicht der uralte Senf der uralten Pharaonen, nein, irgendein Dreh muss in der Story auftauchen, von dem vorher niemand wusste, okay, einige nur wussten. Ja, es würde reichen, wenn der Verfasser das, was er gesehen und gehört hat, auf unerwartete, besser, auf verblüffende Weise interpretiert. Wenn er, jetzt kommt es, etwas Erstaunliches anbietet. Keinen Scoop, keine atemberaubende breaking news, einfach etwas, das mich – nun wieder Leser – mit Dankbarkeit erfüllt, und ich, durchaus begeistert, ausrufe: So kann man es auch sehen!
Erstes Beispiel, heiter: Marilyn Monroe, ach, hunderttausend oder hundert Millionen Mal haben wir schon gelesen, dass sie eine süße Piepsstimme hatte, dass sie busig und unvorstellbar fotogen war, dass sie nie ihren Text konnte und Tony Curtis ihr bei den gemeinsamen Dreharbeiten zu »Some like it hot« gedroht hatte, in den Irrsinn zu gehen. Ach, wär’s da nicht herrlich gewesen, wenn ich – ich meine ja nur – von ihr erhört worden wäre und jetzt etwas, gewiss Herrliches, zu erzählen hätte?
So ähnlich, denke ich, müssen Bücher über die Welt sich anhören. Surprise me, scribbler! Dann werde ich dich anlächeln und dir Treue schwören.
Zweites Beispiel, wenig heiter: Im »Neuen Testament« – Lukas 7,36–50 – steht, dass Herr Jesus einer »Sünderin« ihre »sexuellen Sünden« vergab. So wurde es uns in der Volksschule eingetrichtert: Der heilige Jesus erbarmt sich der unheiligen Prostituierten. Ach ja, nachdem sie ihm »die Füße geküsst und gesalbt« hatte. Kniend, versteht sich. Bis ich, inzwischen erwachsen, die Interpretation dieser Stelle von einer amerikanischen Frauenrechtlerin las, die viel einleuchtender klang: Die Anmaßung von Männern, die sich einmal mehr als Moralapostel aufspielen und dem Weib – natürlich verkommen und natürlich eine Nutte – »vergeben«. Kein Wort über ihre gewiss rüde Kundschaft, kein Wörtchen über ihre Zuhälter, keine Silbe über die Scheinheiligkeit der damaligen Gesellschaft, die käufliche Frauen gegen ein Almosen vögelte und sie hinterher ächtete. Das ist es: Plötzlich sah ich die Szene unter einem Aspekt, der zum Andersdenken führte.
Ein letzter Zwischenruf: »In Mexiko« wird wieder ein Bericht über die so genannte Dritte Welt. Ich will mich bemühen, nicht nur black storys abzuliefern. Vor Jahren hat Elke Heidenreich (wohlwollend) ein Buch von mir besprochen. Eines über Afrika. Zuletzt erwähnte sie, dass sie sich schon lange nicht mehr in die dunklen Ecken unserer Erde wagt. So mitgenommen sei sie von dem, was sie einst sah. Ich bin noch nicht so weit. Aber nah dran. So will ich nichts Schönes übersehen. Und nichts Vergnügliches. Um meine Wundstellen damit abzutupfen. Und die der Leser.
Aber gewiss, Mexiko verfügt über einen bestechenden Trumpf: Wer hier entlangreist, wird gleichzeitig an einem Crashkurs zum Thema »Wer bin ich?« teilnehmen. Links und rechts warten Erfahrungen, die jeden überhäufen. Mit dem, was wir alle ersehnen: vehemente Gefühle und Erkenntnisse, die ganz hellblauen, die ganz dunkelschwarzen. Jeder, wenn er sich nur traut, wird beim Wahrnehmen der Fremde etwas über sich begreifen, selbst das Wunderlichste, das Verborgenste in ihm. Reisen ist auch eine Reise nach innen. Der Schatz Mexiko gehört jedem, der noch immer hungert. Mehr kann ein Land der Welt nicht schenken.
1
Dieser Augenblick: wenn das Flugzeug die Piste hinunter rast und hinauf in den Himmel von Paris klettert. Der stets am schönsten ist, wenn ich ihn verlasse.
So leicht die Minuten. Ich will sie festhalten. Wie jeden Atemzug Wärme. Um mich zu wappnen für die Reise. Dreizehn Stunden später werde ich in Mexiko landen, und ich ahne, nein, ich weiß: Das Land wird mich fordern.
Noch einen Moment habe ich abgespeichert: Vor dem Check-in ging ich auf den einzigen freien Sitzplatz zu. Und der Mann daneben sah mich kommen, lächelte und räumte sein Gepäck weg. Was für eine souveräne Eleganz. Andere tun, als würden sie einen nicht sehen. Und machen erst (missmutig) frei, wenn man sie darum bittet. Er, dieser Fremde, er teilt. Seltsamerweise fiel mir ein Bericht über einen mexikanischen Fechter ein. In seiner Garderobe standen drei Wörter an der Wand: Calma / Alegría / Fuerza, Ruhe, Freude, Stärke. Wie beneidenswert.
Zwischenstopp in Amsterdam. Vorbei an den neumodischen Gaskammern, die wie Telefonzellen aussehen. In jeder steht ein Raucher. Die Rache der Gesundheitsterroristen: die Sünder vergasen.
Nicht weit davon findet sich ein kleines Glück, ein Meditation Centre. Ganz weltlich, ein Raum mit Kissen, keine Möbel. »No phone« heißt es am Eingang. Hier darf man eintreten und einen sagenhaften Zustand genießen. Stille. Ich lümmle am Boden und kann nicht still sein. Ich spüre meinen ruhelosen Körper, mein unruhiges Herz.
Als ich die Augen öffne, sehe ich einen Mann hereinkommen, der einen farbenfrohen Überwurf trägt. Ich denke sofort an einen Besuch in Auschwitz. In einem Teil des Lagers, so erklärte man uns, trugen Häftlinge bizarrerweise bunte Decken, deshalb nannte man die Ecke im damaligen KZ-Jargon »Mexiko«. Irgendwann frage ich den Fremden. Gewiss, er fliegt zurück in seine Heimat.
Ruhiger Flug. Ich lese, wie immer, weil ich in 10.000 Metern Höhe nicht schlafen kann. In einem Zeitungstext über das Reisen fordert der Autor uns Leser auf, »in Demut unterwegs zu sein«. Was für ein wunderliches Blech. Als Büßer durch die Welt? Nijet! Ich habe einen anderen Rat in petto: Reise selbstbewusst, mit einer grundsätzlich freundlichen Ausstrahlung.
Am frühen Abend des nächsten Tags in Mexico City. Dieses Trancegefühl nach einer durchwachten Nacht. Die Stadt ist ein Moloch, aber ich bin zu müde, um mich zu wehren. Der Bus schaukelt durch die Straßen, und die Lichter hinter dem Fenster schaukeln mit.
In einem Hotel absteigen, in dem ein fantasievoller Besitzer wirtschaftet. Im Bad meines Zimmers steht der poetische Satz: »Je mehr Wasser wir verbrauchen, desto weniger Paradies haben wir.« Ich höre meinen Nachbarn duschen, endlos. Ihm ist das Paradies egal.
2
Frühstück, ach, diese bedenkenlos lächelnden Mexikaner, ihre Nonchalance im Umgang mit der Wirklichkeit. Auf den drei Fernsehschirmen laufen drei Schlachthofgeschichten. Und alle vier, fünf Minuten wird ein Mensch geschlachtet. Doch niemand nimmt Notiz. Eine Frau schreit um ihr Leben, und jemand ruft: »Un café americano, por favor.« Hat Leichtigkeit damit zu tun, dass man dicht macht? Dass man die Welt nicht mehr zulässt, sie wegblendet?
Hinein in die Stadt, vor zum Zócalo, dem Zentrum der 20 Millionen. Hier vor genau zehn Jahren haben sich 18.000 Frauen und Männer ausgezogen, um von Spencer Tunick fotografiert zu werden. Der Fotograf hatte vor langer Zeit seinen einzigen Einfall: Leute vorzuführen, indem er sie als nackte Herde zusammentreibt und ablichtet. Sorry, Kunst, klar. So schwachsinnig kann eine Idee gar nicht sein, auf dass es nicht Heerscharen von Willigen gäbe, die mit Eifer dabei sind.
Jetzt ist das Malheur passiert, mein Hirn steckt voller Splitternackter. Und ich sehe die Mexikanerinnen und Mexikaner an mir vorbeigehen, durchaus angezogen, aber in meinem Kopf plötzlich hüllenlos. Und da ich vor Tagen gelesen hatte – ich bin also unschuldig –, dass das amerikanische und das mexikanische Volk um den Spitzenplatz in der Weltrangliste der Superpfünder kämpfen, bin ich unfreiwillig versucht, genauer hinzublicken.
Nein, versprochen, ich bin weiser geworden. Nein, ich werde mich diesmal nicht lustig machen, sie nicht auslachen. Ich will über sie nachdenken, will ihr Geheimnis heben.
Ich habe mir vorgenommen, vorsichtiger zu kritisieren. Reiner Spott riecht billig. Zudem fängt niemand ein neues Leben an, weil ich an ihm herummaule. Ironie soll mich retten. Und Leichtigkeit. Keine Sorge, ich bin auch heute kein Gutmensch, der sich jeden und alles schönredet. Das geht nicht, auch nicht in Mexiko. Denn wir haben keine heiligen Mexikaner. So wenig, wie in Deutschland heilige Deutsche herumstehen. Wir haben immer nur Frauen und Männer, denen man sich nah fühlt, und andere, an denen man achtlos oder grimmig vorübergeht, und wieder andere, die man gern zu seinen Freunden zählen würde.
3
Zurück zu den Überschwappenden. Das Problem ist hier zur nationalen Chefsache erklärt worden. Jeden dritten Tag trompeten es die hiesigen Medien in die Welt. Ein Volk riskiert, unter einem Fleischgebirge zu ersticken. Dass es so weit kommen konnte, ist umso wunderlicher, als viele MexikanerInnen – bevor die Fresssucht sie überwältigt – ausgesprochen gut aussehen, ja, beneidenswert wohl geformt auftreten.
Wie sensationell dehnbar Körper sind. Wie unglaublich folgsam jeder dieser Leiber seine enorme Last mit sich herumträgt. Statt zu murren und zu streiken. Nein, jeden Tag muss er mehr schleppen und jeden Tag – gewiss eine Spur geräuschvoller ächzend – macht er sich brav auf den Weg und trägt den Menschen, der ihn so schindet, durch den Tag. Faszinierend. Wie kann man etwas so lieblos behandeln, das uns so treu bis zum letzten Schnaufer begleitet. Nein, ich bin kein Fan des Schönheitswahns, ja, ich hasse den Terror, mit der die Kosmetikindustrie uns nachstellt, uns bloßstellt, nein, ich predige keine Traummaße. Aber ich bin wieder einmal, wie so oft in meinem Leben, fassungslos.
In Mexiko geht es zu wie sonst in der Welt: Die Reichen sehen – laut Statistik – schlanker aus, sie haben das Geld für die passende Ernährung, für das Fitness-Studio, für die zuständige Information. Die Armen nicht, sie haben das alles nicht, dafür die mächtigen Kilos. Okay, die Superarmen haben nicht einmal das, die sind wieder dünn. Selbst die schlechte Kost ist unbezahlbar.
Natürlich werde ich das Geheimnis nicht lüften. Aber einen Grund weiß ich, der auf viele »Andersdünne« – diesen Ausdruck gibt es tatsächlich – zutrifft. Hier die Geschichte.
Als ich einige Zeit in Mexico City lebte, um die Mühsal einer neuen Sprache auf mich zu nehmen, lernte ich Jimena kennen, die an derselben Schule Englisch studierte. Die 19-Jährige bewegte sich wie ein schönes Tier. Vor jedem Kuss schleckte ich mir die Finger ab. Aus Dankbarkeit. Jimena war warm und neugierig, wir taten uns gut.
Sieben Jahre später, nun als Reporter mit einem Auftrag, landete ich wieder in der Hauptstadt. Ich rief sie an, und wir verabredeten uns. Was ich besser nicht hätte tun sollen. Never go back to your dreams. Als die jetzt 26-Jährige das Restaurant betrat, erkannte ich sie nicht. Auf eine umwerfend attraktive Frau war ich gefasst, und ein kolossal deformierter Mensch, zweieinhalb Mal voluminöser, näherte sich meinem Tisch. Sie wusste um die Katastrophe, und ich fragte sie wie hypnotisiert: Warum? Gentlemen tun das nicht, aber ich war getrieben von dem Wunsch zu wissen: Wie konnte das passieren? Eine Schönheitskönigin, noch dazu klug, hatte ihren sagenhaften Schatz verspielt.
Jimenas Antwort, hier auf Stichpunkte verkürzt, klang irgendwie banal und irgendwie dramatisch: Bald nach unserem Abschied lernte sie einen Mann kennen, heiratete ihn und bekam ein Kind. Und jede Sehnsucht zerstob. Kein Studium in den USA, kein Gatte, der täglich zum Verlieben einlud, kein Baby, das sie unbedingt, unbedingt so früh, gewollt hätte.
Sie sei eben kein Wutmensch, nein, sie habe geschwiegen, nie rebelliert und alles – um sich über den Absturz zu trösten – in sich hineingefressen. Wörtlich. Und so versank der letzte Traum, der vom Schönsein und Begehrtwerden.
Ich stehe noch immer am Zócalo, als ich mich an Jimenas Geschichte erinnere. Und ich denke plötzlich, dass alle uferlos Dicken eine Wunde in sich tragen, die sie jeden Tag mit Kalorienbomben besänftigen. Klar, viele Gründe gibt es, um dem eigenen Leib die Fürsorge zu entziehen. Doch ein (verborgener) Schmerz ist einer davon.
4
Zócalo, hier hat Konquistador Hernán Cortés auf dem von ihm zertrümmerten Marktplatz der Azteken la ciudad de México gegründet. Was haben die Spanier im Namen ihres Herrgotts in dieser Weltgegend gemordet und ausgerottet. Und was haben sie an Architektur, an grandiosem Größenwahn der Menschheit geschenkt. Der Plaza de Armas – so hieß der Zócalo früher – steht auf der Weltkulturerbe-Liste der UNESCO.
Ich gehe in die Kathedrale, sie ist der »heiligsten Jungfrau Maria über den Himmeln der Stadt« gewidmet. Sie ist die berühmteste »Unbefleckte« der Welt und sie schwebt nicht nur hier, sondern über (fast) jedem der 124 Millionen Einwohner des Landes. Nirgends auf dem Globus wird so inbrünstig zu ihr gebetet. Mit offensichtlich geringen Erfolgsaussichten. Entweder flüstern die Gläubigen nicht glühend genug oder die »Mutter Gottes« ist taub. Oder sie ist, so behaupten die fünf Prozent Atheisten, eine Schimäre. Wie auch immer, die Gegend hier, die Vereinigten Mexikanischen Staaten, gehört zu den mörderischsten Landstrichen, die zurzeit von sich reden machen.
Religion wird ein Thema in diesem Buch, unvermeidlich. Zu mächtig und allerorten tritt sie auf. Aber wie bei den Überdicken werde ich mir Mäßigung auferlegen. Nicht mit Feuerzungen das Gebaren der Religiösen kommentieren. Ich will jedoch herausfinden, einmal mehr: Warum? Warum dieses fieberhafte Verlangen nach Gott? Wo wir doch – wenn wir nur mit hellen Sinnen durch die Welt gehen – erkennen müssen, dass wir keinen haben. Keinen lieben Gott, auch keinen bösen. Wir haben nur uns. Nur Frauen und Männer, die uns in Zeiten der Bedrängnis beistehen. Oder eben nicht.
Wie sagte es William Blake: »Some are born to sweet delight, some are born to endless night.« So, genau so. Die einen – egal, ob radikal gottesfürchtig oder grundsätzlich gottlos – kommen unter die Räder. Und die anderen – wieder vollkommen unabhängig von Frömmigkeit oder Heidentum – erleben »süße Wonnen«. Glück muss her, die fantastischen Zufälle, die trefflichen Gene, dann kommt einer schwungvoll durch. Fehlt das eine oder das andere, dann bröckelt das Leben, wird armselig und hundsgemein.
Wie hier in Mexiko. Wenige Wochen später wird in den Zeitungen stehen, dass die vergangenen dreißig Tage die gewalttätigsten waren, ja, das Land einen Pegel an Grausamkeit erreicht hat, von dem das moderne Mexiko vorher nichts wusste.
Als der Gesandte von Montezuma II., dem vorletzten Herrscher der Azteken, Hernán Cortés fragte, warum er so besessen von Gold sei, antwortete der Spanier bemerkenswert wahrhaftig: »Meine Gefährten und ich leiden an einer Herzkrankheit, die nur Gold heilen kann.«
Das Gold, das nie gefunden wurde, heißt heute »drogas«. Und gewiss hat Cortés seine Gier und seine Begabung zum Blutrausch weitervererbt. Hunderttausende arbeiten aktuell im drug business, und wer fleißig die Presse durchblättert, findet jeden Tag Fotos von Leichen mit abgehackten Köpfen. Die ganz Gründlichen hacken auch Arme und Beine ab. Drogenhändler unter sich, rund um die Uhr schwer bewaffnet, das Hackebeil stets auf dem Rücksitz. Abtrünnige, Informanten, Konkurrenten und Überläufer müssen zweifach bestraft werden: mit dem Tod und mit der absoluten Entwürdigung.
Bis ans Ende der Reise wird mich der Widerspruch erstaunen zwischen dieser schier rastlosen Hilfsbereitschaft der vielen und dieser (stattlichen) Minderheit, die das Land in Atem hält.
5
Ich bin noch immer in der Kathedrale. Der Pfarrer lobpreist gerade das Paradies, er weiß sogar, dass »das Himmelreich Gottes nah ist«, ja, Vertrauen täte gut, »damit die Menschheit sich aufs überirdische Reich vorbereite«. Vor einer Stunde bewunderte ich im Palacio Nacional, dem Sitz der Regierung, ein riesiges Wandgemälde von Diego Rivera, dem berühmten Maler und Mann der noch berühmteren Frida Kahlo. Ein Teil des Kunstwerks hieß »la lucha de clases«, der Klassenkampf, dort sieht man Karl Marx, wie er einem Bauern, einem Arbeiter und einem Soldaten von der sonnigen Zukunft – organisiert vom Kommunismus – vorschwärmt.
Ach, die Sehnsucht der Menschlein, sich eine leuchtende Ferne vorzugaukeln. Die Gegenwart gefällt uns nicht. Seit Urzeiten ist das so. Wie das Verlangen nach Märchen, die uns – mit oder ohne Herrgott – vertrösten sollen.
Zugegeben, ich bin spirituell unbehaust. Als Notaggregat habe ich mich für den Humanismus entschieden. Alles, was lebt und atmet, zu achten ist strapaziös genug. Für die höheren Heldentaten wie »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst« oder »Verzicht auf Eigentum« bin ich zu schwach. Ich liebe nicht jeden, und ich will mein Fahrrad, meinen Mac, mein Bankkonto und meine Pariser Wohnung behalten.
6
Zwei Mauern weiter, fünfzig Meter links von der Kirche, stehen die ambulanten Handwerker, die Tagelöhner, einer neben dem anderen, den Sack mit dem Werkzeug vor sich, mit dem Pappdeckel, auf dem steht, was sie anbieten: Fliesenleger, Dachdecker, Klempner, Maurer. Warten, bis einer vorbeikommt und sie anheuert. Für den Tag. Und ist der vorüber, stehen sie wieder an und warten. Ich beame mich in Nestors Kopf, den Anstreicher. Der erzählt, dass er manchmal drei Tage hintereinander dort Position bezieht, und niemand ihn abholt. Ja ich, alias Nestor, weiß nun, dass ich sechs Mal die Woche hier antanzen muss, um – so poetisch sagt er es – »buscar la vida«, das Leben zu suchen, sprich, Arbeit zu finden. Die mich und meine Familie ernährt.
Auch das habe ich mir vorgenommen für dieses Buch: Einblicke ins harte, unlustige Leben zu beschreiben – so gut ich es vermag. Aber am Schluss auf jede Pose der Ergriffenheit zu verzichten. Weil sie mir heute eher peinlich erscheint. Und eine Spur unwahr. Denn wäre ich tatsächlich erschüttert, ich würde den armen Teufeln helfen. Nicht nur mit wohlfeilen Sprüchen. Die nichts kosten, zu nichts verpflichten, mich nur öffentlich herausputzen. Von jetzt an: dem Leser von der Wirklichkeit berichten und dann den Mund halten. Taugt die Szene, wird sie wirken. Taugt sie nicht, hilft auch kein nachgeliefertes Tränenmeer.
Die (endgültige) Umkehr brachte ein Interview in der »New York Times« mit Ryszard Kapuściński, dem Reporter, dem so eleganten Stilisten. Das Gespräch bewegte sich auf einer erstaunlichen Flughöhe, bis der Pole mit Weihrauch auf der Zunge zu reden begann. Der Gipfel der Rührung über sich selbst war der Satz: »Ich bin eine Stimme für die Armen.« Aua, nein, Ryszard, das bist du nicht. Denn ein paar Tage bei den Elenden abhängen, dabei Geschichten kassieren, für die man später bezahlt und berühmt wird, und ja – welch Glück – nach dem Zuhören wieder verduften dürfen: Das alles sind Nachrichten aus einem Luxusleben, das mit der Existenz der Abkratzer wenig, falsch, nichts zu tun hat. Tell their story! Und dann Punkt, ohne Nachsatz, ohne uns – getragen von pathetischem Gedöns – von der eigenen Hochanständigkeit zu berichten.
Nun, der Gute ist längst tot, aber die Predigt soll auch mir gelten. Wir alle unterliegen der Versuchung, uns glorreicher auszustellen, als wir sind.
7
Jagd auf Raucher, überall. Sogar über manchen Caféterrassen hängt »NOFUMAR«. Das ist sehr erheiternd, denn die Riesenkrake Mexico City produziert täglich weltrekordverdächtige Mengen Schadstoffe, so ätzend, dass man sich jeden Abend zur Dialyse begeben sollte, um sein Blut von den Abertausend Tonnen Kohlendioxid zu reinigen, die sie hier in die Luft schleudern. Deshalb der Politiker letzter Schluss: Nicht die Autofahrer sollen zu Hause bleiben, sondern die Raucher. Diese Weisheit gilt weltweit. Das erinnert mich an einen Cartoon, auf dem man einen Mann sah, der an das Tor einer Schule ein »No Smoking«-Verbot nagelte, während im Hintergrund eine Windhose näherdonnerte. Der Witz dieser Zeichnung als Sinnbild für die Treffsicherheit, mit der wir unseren tatsächlichen Problemen ausweichen.
8
In mehreren Nebenstraßen, die vom Zócalo wegführen, lehnen an den Wänden Helme, Schilder und Schulterpolster, Knie- und Schienbeinschützer. Ein flüchtiger Blick könnte vermuten lassen, hier stehen die Rüstungen der Spartaner. Nur die Speere fehlen. Nein, sie gehören zu den Polizisten, die in vergitterten Bussen und Panzerwagen Stellung bezogen haben. Seltsam, die Gegend ist ruhig, keiner schreit, keiner demonstriert. Ich frage und höre, dass ihr Auftrag »vigilancia« heißt, Überwachung. Dabei nicken sie Richtung Geschäfte, verstanden. In dem Viertel arbeiten die Schmuckhändler, viel Gold liegt in den Schaufenstern.
Ich werde noch erfahren, dass Wertgegenstände, die von mexikanischen Bullen bewacht werden, bei ihnen nicht unbedingt am besten aufgehoben sind. Wertvolle Produkte – und die wertvollsten im Land heißen Kokain, Heroin und Methamphetamin (= Crystal Meth, dagegen ist Koks eine Aspirintablette) – verschwinden oft in umsichtigen Polizeihänden. Der Berufsstand gilt als ultrakorrupt. Knapp die Hälfte davon, so seriöse Untersuchungen, wirtschaftet im »narco negocio«, wobei die hilfsbereiten Ordnungshüter die verschiedensten Dienste übernehmen: Sie halten die Verbindung zwischen Staatsmacht und Verbrechersyndikaten. Sie informieren rechtzeitig über Razzien. Sie dealen eigenhändig, verkaufen die beschlagnahmte Ware selbst. Sie greifen nicht ein, wenn ein Kartell in einer Gegend – nur ein Beispiel – Bauern terrorisiert, die sich weigern, auf ihren Feldern Mohn anzupflanzen. Sie organisieren den reibungslosen Waffenhandel, indem sie aus staatlichen Munitionskammern den wichtigsten Nachschub – vor allem AR-15, Berettas und Glocks – entwenden. Sie lassen sich als »sicarios« verpflichten, als Mörder, die – im Schutze eines offiziellen Polizeieinsatzes oder als inoffizielle Todesschwadronen – die Gegner ihrer Auftraggeber liquidieren. Statt sie zu verhaften, was gefährlich wäre, denn ein Verhafteter könnte plappern.
Doch es gibt noch eine dritte Kraft, die eifrig am Ruin des Landes mitarbeitet: die Politiker-Kaste. Journalisten, die seit Jahrzehnten darüber recherchieren, gehen davon aus, dass über vierzig (!) Prozent dieser gefallenen Staatsdiener als Schreibtischmörder und/oder maßgeblich als Promoter, Hehler und Schutzpatrone den Drogenbossen (und kollaborierenden Polizisten) zuarbeiten. Ich werde noch Paradebeispiele liefern, die so aberwitzig klingen, dass man sie nicht ohne Amüsement zur Kenntnis nimmt.
Bin ich hemmungslos ehrlich, dann lauert in einer dunklen Ecke in mir (auch) Bewunderung für diesen Abschaum. Nein, nicht für ihre Bestialitäten, aber für diesen Glauben, unberührbar zu sein, diese skrupellose Überzeugung: Ich bin Gott!
Sorry, ich habe mich verlaufen. Doch wer Polizisten in Mexiko begegnet, den überfallen so manche Nebengedanken. Auch die frohgemuten. Ich bekomme Augenblicke geschenkt, die ich noch nie erleben durfte.
Wie jetzt: Zwei Polizisten betreten einen 7-Eleven-Laden der Supermarktkette. Eine Frau und ein Mann, die nonchalant hereinschlendern und – ich sehe sie, aber sie sehen mich nicht – so tun, als wären sie Kunden. Doch blitzschnell hinter dem Getränkeautomat verschwinden und – sich küssen. Zwei schwer Bewaffnete umarmen sich schwer verliebt. Und er streicht ihr über den Busen unter der engen Bluse, und sie drängt sich ihm entgegen. Begeistert schaue ich hin.
Oder: Auf dem Bürgersteig überholt mich ein junger Kerl, der plötzlich nach links ausschert und einer Polizistin in den Hintern zwickt. Und weitergeht. Sie dreht sich um und lächelt. Ich frage sie, wie das? Und sie, entspannt: »Ah, es un loco«, er ist verrückt.
9
Weil wir bei den lächelnden Frauen sind, hier noch ein Blick in einen Sexshop. Erfreulich, denn im Schaufenster sieht man eine Frau, okay, den Pappkarton einer Frau, die selig die Augen verdreht, denn sie erfreut sich gerade am »Satisfyer«, dem neu eingetroffenen Dildo. Die Sprechblase über ihrem Kopf blinkt: »¡Soy feliz!«, ich bin glücklich. Wie lange mussten Frauen darum kämpfen, bis sie von ihrer Lust reden durften? Ohne dafür gelyncht zu werden?
Sehr lange. In Mexico City steht ein »Museo de la Tortura«, ein Foltermuseum. Man zeigt etwa siebzig Gerätschaften, die erfunden wurden, um Menschen, weltweit und öffentlich, zu quälen. Viele schindeten, andere schindeten und töteten. »La Santa inquisición« als emsigster Auftraggeber für jede Art Höllenpein. Vor allem Frauen waren Opfer. Schon Äußerungen gegen die »männliche Anmaßung von Gewalt« plus die grundsätzliche Verachtung Frauen gegenüber reichten, um sie die Allmacht der Herrschenden spüren zu lassen. Besonders gefragt war die »Eiserne Maid von Nürnberg« (deutsche Qualitätsarbeit wurde überall geschätzt): ähnlich einer länglichen Taucherglocke, in die sich die Unselige hineinstellen musste, das Monstrum dann geschlossen wurde und unzählige Eisenspitzen – von oben bis unten und rundum – in den Körper drangen. Aber nicht an den lebensbedrohlichen Stellen. Eine Teufelsfinte, um das Sterbendürfen so lange wie möglich hinauszuzögern.
Der Kampf um Respekt, das ist ein zäher Kampf. Auch der steht jeden zweiten Tag in den Zeitungen: wie Frauen um ihre Rechte streiten, wie sie sich auflehnen gegen die Arroganz des Macho-Männchens, gegen die Gewaltlust der einen gegen die anderen. Die Regierung hat vor Kurzem härtere Strafen für jene beschlossen, die glauben, dass das Mittelalter nie aufhört und Züchtigung – bis hin zum Totschlag – das übliche Mittel ist, um Meinungsverschiedenheiten zu regeln.
10
In einem einfachen Restaurant hinter den Markthallen lerne ich Glorietta kennen, um die fünfzig, mit einem wachen Gesicht. Wir kommen ins Gespräch, weil ich wissen will, was die vielen Prospekte auf ihrem Tisch bedeuten.
Glorietta ist campesina, Bäuerin, sie reist im Auftrag einer Genossenschaft durch das Land, um aufzuklären: über den Giganten Monsanto und sein massives Bestreben, den hiesigen Markt mit transgenen Maissorten zu überrollen. Sie hat Samenproben dabei, ihre Unterlagen, ihre Bücher. Seit Wochen ist sie unterwegs. Sie geht davon aus, dass der amerikanische Konzern die zuständigen Entscheidungsträger kauft. Um sie gefügig zu machen.
Niemanden, absolut niemanden werde ich auf dieser Reise treffen, der nicht Politiker, auch jener Partei, die man gewählt hat, für »criminales« hält, für eine Horde niederträchtiger Abzocker, denen jede Quelle recht ist, um ihre Gier nach Pesos und Dollar zu stillen. Die nie gestillt wird. Gier ist unstillbar.
Fragen an Glorietta zum Thema Drogen. Wie sie sich die Maßlosigkeiten erklärt, die maßlose Gewalt. Und die Indigene wird die Erste (von vielen) sein, die ausweicht. Es scheint, als wollten die Mexikaner nicht darüber reden. Dafür gibt es, ich werde es noch erfahren, verschiedene Gründe, zuerst: Zweifellos sehe ich anders aus als der »typische« Einwohner des Landes, dennoch fehlt das Vertrauen, sprich, sie wissen nicht, auf wen sie sich einlassen. Ich könnte ein Gringo sein, der irgendwo seine dreckigen Hände im Spiel hat, ein Reporter, der sie aushorchen, ein Spitzel, der sie überführen will. Das klingt absurd, doch manche meiner Gesprächspartner haben derlei angedeutet. Das Misstrauen ist beachtlich. Sogar in der eigenen Familie.
Zweitens: Sie schämen sich der Zustände und dessen, was die Welt aus Mexiko berichtet. Das ist ein globales Phänomen, kein Fleck auf Erden will, dass man schlecht über ihn redet.
Letzter Punkt: Sie verdrängen den Irrsinn. Es gibt ihn, aber man will nichts (mehr) davon hören. Denn der Irrsinn dreht sich im Kreis, und niemand findet den Weg zu einer Lösung. Wozu also darüber sprechen?
Herzlicher Abschied von Glorietta, die keine Ausrede akzeptiert und meinen Kaffee bezahlt. Calor humano, menschliche Wärme, die haben sie hier auch. Mucho.
11
Eine der innigeren Vergnügungen in der Ferne: durch eine Stadt flanieren, die man nie wirklich kennen wird. Da zu wuchernd, zu ausufernd, da ohne Ende.
An einer Straßenkreuzung turnen drei Halbwüchsige. Immer wenn eine Straße per Ampelrot blockiert ist, stellen sie sich auf und legen los. Der junge Kerl schwingt sich auf sein zweieinhalb (!) Meter hohes, einrädriges Rad, kickt mit dem rechten Fuß seinen Panamahut auf den Kopf, pfeift ein Lied, balanciert je einen Ball auf seinen Zeigefingerspitzen und jongliert anschließend einen Wirbel von Keulen, die ihm die Mädels zuwerfen. Das Trio ist eine Augenweide, ihr Swing, ihre Souveränität, die Eleganz der Körper. Und er, der Hübsche, ist der König der Welt, sie gehört ihm jetzt, und alle fünf Minuten wird er Neid und Bewunderung ernten. Und Pesos, wenn er kurz vor dem Überspringen auf Grün mit dem Hut entlang der Autos läuft.
Was für ein Privileg, Frauen und Männern zuzusehen, die etwas können, ja, deren Können wie Zaubern aussieht. Und die dabei gleichzeitig die Lebensfreude ihrer Umgebung ankurbeln. Angesichts von Leuten, die ihren Zeitgenossen zielgenau Mühlsteine aufs Herz wuchten, sollte man für sie, die Befeuerer, einen Feiertag einrichten, sagen wir, einen »Tag der Menschenfreunde«.
12
Ich komme an einer Autowerkstatt vorbei, Männer unter sich, die begeistert Blech reparieren. Radiogeplärr. Ich höre einen meiner spanischen Lieblingssongs: »Desnúdate Mujer«, zieh dich aus, Frau, »yo quiero ver también el arte que tu tienes cuando haces el amor«, ich liebe es, deiner Kunst beim Liebemachen zuzuschauen. Von Frankie Ruiz, längst mit 40 dank einer Leberzirrhose verendet. Das Lied ist macho, aber sweet macho, gesungen von einem, der wie so viele überwältigt ist von weiblicher Schönheit. Und Frauen fallen mir ein, die einer solchen Aufforderung – »desnúdate« – mit Freuden nachkommen. Und dem begehrenden Mann keine Moralpredigt halten.
13
Die Stadt bietet Gegensätze. Am Zaun entlang des Parque Chapultepec hängen Fotos, große Fotos, grandiose Fotos, die von den Wundern Mexikos berichten. Und seinen Wunden, seiner unheimlichen Armut. Eines haut um. Man sieht – fotografiert durch einen entkernten, auf der Müllhalde gelandeten Fernseher – eine alte Frau, die im Abfall nach etwas Essbarem sucht. Der Titel, meisterlich: »Reality Show«.
Auf nach Coyoacán, das Viertel hat koloniales Flair und wenig Hungernde. Ich komme am weltberühmten »casa azul« vorbei, in dem Frida Kahlo bis zur ihrem Tod 1954 wohnte. Mit dem überdicken Diego Rivera, den sie als Frosch mit weißlich-grüner Haut bezeichnete, mit wabbeligen Hängebrüsten. Der sie liebte und nebenbei eifrig mit anderen Frauen schlief. Was sie ihm mit zahlreichen Liebhabern (und Liebhaberinnen) heimzahlte. Sie heirateten zweimal und kamen nie voneinander los. »Ich vermisse uns«, soll er gesagt haben, als Antwort auf ihre Frage, warum er sie nicht verlassen könne.
Frida stänkerte oft über Riveras ausufernden Körper. Wie ich das jeder Frau gönne. Wir Männer tun das auch. Ach, das heuchlerische Bestehen auf die rein »inneren Werte«. Verlogener geht es nicht.
Das »blaue Haus« ist längst Museum, und an diesem Nachmittag wartet eine Menschenschlange – ich schreite sie ab – von 211 Schritten davor. Was für ein Triumph. 65 Jahre nach ihrem Todestag gedulden sich Hunderte, jeden Tag, um sie zu bewundern. Wie sagte es André Breton: »Fridas Kunst ist wie eine Schleife um eine Bombe.« Eine Vulkanfrau lebte hier.
Die Mexikanerin wurde von den Göttern mit allem beschenkt, mit Schönheit, mit Drama, mit Leid, mit Erfüllung und mit dem Kostbarsten: ihrem Genie, dem Malen. Um dieses Leben auszuhalten.
Nicht weit davon, nur ein paar Ecken entfernt, steht das Gebäude, in dem Leo Trotzki die letzten eineinhalb Jahre vor seiner Ermordung verbrachte. Rivera und Kahlo, bereits Ex-Kommunisten, hatten sich bei der mexikanischen Re-gierung für seinen Asylantrag eingesetzt, für einen Mann starkgemacht (mit dem Frida dann ins Bett ging), der neben Lenin und Stalin zu den führenden Köpfen der russischen Revolution zählte: der die Rote Armee aufgebaut hatte und – eher voraussehbar – bald Stalins Todfeind wurde. Und die Flucht antrat.
Trotzkis Burg – er musste immer um sein Überleben fürchten – ist ebenfalls der Öffentlichkeit zugänglich. Aber hierher kommen nur wenige Besucher. Nun, Señora Kahlo war sinnlich und produzierte sinnliche Dinge, und Trotzki war eine eher unwirtliche Intelligenzbestie, von der noch heute keiner sagen kann, ob er – wäre er an die Macht gekommen – sanfter mit der Menschheit umgesprungen wäre als Josef Wissarionowitsch Stalin, der ehemalige Priesterseminarschüler.
Ich bin hier, weil ich vor Jahrzehnten den Joseph-Losey-Film »Die Ermordung Trotzkis« gesehen hatte. Mit Richard Burton als Hauptdarsteller und Alain Delon als dessen Mörder Ramón Mercader. Und Romy Schneider als dessen Freundin. Am 20. August 1940 kam Mercader – Spanier, Stalinist und von Moskau als Henker beauftragt – gegen 17.20 Uhr in das Haus. Monatelang hatte er sich das nötige Vertrauen erschlichen, immer mithilfe seiner (ahnungslosen) Verlobten, die zugleich eine Mitarbeiterin des berühmten Flüchtlings war. Betrat das hochheilige Arbeitszimmer, legte Trotzki einen Bericht mit Bitte um Durchsicht vor, wartete, bis sich der 60-Jährige über das Manuskript gebeugt hatte, zog den mitgebrachten Eispickel hervor und holte aus. Am nächsten Tag erlag Trotzki im Krankenhaus seinen Verletzungen. 300.000 nahmen an seiner Beerdigung teil, Mercader musste für zwanzig Jahre ins Zuchthaus, wurde anschließend abgeschoben und starb – hoch geehrt als »Held der Sowjetunion« – in Havanna. An Krebs, noch nicht 65.
Trotzki, hieß es, verfügte über das kostbarste und bestorganisierte Gehirn, das je auf so dramatische Weise umkam.
Das Anwesen gleicht einer Festung, drei Wachtürme, hohe Mauern, die Unterkünfte für die Leibwächter und das Gesinde, Hasenställe. Nirgends Protz, kein Luxus. Es gibt Filmaufnahmen, die den Hausherrn beim Hühnerfüttern zeigen. Die Wohnräume sind eher rustikal, bemerkenswert der Raum für seine Sekretäre. Blick auf eine Edison Dictating Machine, damals Hightech, um Sprache aufzunehmen. Im Schlafzimmer sieht man noch die Einschläge eines früheren (misslungenen) Anschlags. Eine Eisentür führt ins Arbeitszimmer, links die Bücherwand, auch mit deutschen Büchern (wie Lenin hielt sich Trotzki eine Zeit lang in München auf), amerikanische, französische Literatur, Jack London, Hemingway, Sartre, Gide, eine Biografie über Madame Curie. Rechts ein schmales Bett, der Meister litt an Migräne, musste sich immer wieder hinlegen. Und natürlich der überladene Schreibtisch, an dem er zwölf bis vierzehn Stunden täglich arbeitete. Im hübschen Garten steht ein Grabstein mit Hammer und Sichel, unter dem seine Asche liegt. Wie die seiner Frau Natalja. Sie ist eine der wenigen aus Trotzkis Familie und Verwandtschaft, die der Vernichtung durch Stalins Schergen entging.
Beim Verlassen des Grundstücks denke ich voller Wertschätzung an Mexiko. Während Europas schwerster Jahre – Nazizeit, Kriegszeit – hat das Land nicht nur Kommunisten aufgenommen, sondern auch viele Hitlergegner, deren Leib und Leben von dem noch besesseneren Massenmörder bedroht wurde.
Irgendwie mochte ich Trotzki, vielleicht hatte es mit Burtons Darstellung zu tun. Damals wusste ich nicht, dass jene, die vom besseren Menschen in einer besseren Welt träumen, ja, sich als glühende Erlöser aufführen, dass genau sie sich später als die talentiertesten Schwerverbrecher outen würden. Trotzki hatte schon vor seinem Streit mit Stalin Anzeichen bemerkenswerter Brutalität gezeigt. Gewiss hätte sie ihn zu schauerlichen Großtaten verführt, wenn er als Alleinherrscher in die Sowjetunion zurückgekehrt wäre.
14
Mit einem Bus zurück ins Zentrum. Ich beobachte einen Mann, nicht jung, nicht alt, der während der langen Fahrt – Rushhour – mehrmals aufsteht und seinen Platz anbietet, Ticketgeld an den Fahrer weiterreicht, älteren Leuten (er sitzt ganz vorne) beim Einsteigen hilft. Absurderweise denke ich für Augenblicke, dass er sich irgendwann vor uns aufstellt und zu predigen beginnt, ja, uns wissen lässt, dass er früher Gangster war und Frauen verprügelte, aber eines Nachmittags Gottvater über ihn kam und ihn auf den rechten Pfad führte. Nichts davon, er ist einfach Ritter, ohne Zirkus, ohne den Blick dessen, der weiß, dass er Gutes tut und die Welt auf ihn schaut. Der Mensch ist lässig und unaufgeregt. Ich erinnere mich an die Mail eines Lesers, der meinte, dass ihm die Tränen kommen, wenn er einen Akt von cooler Hilfsbereitschaft beobachtet. Wie ich das verstehe.
15
Im Norden der Stadt liegen die beiden Basiliken, die der »Santa María de Guadalupe« geweiht sind. Der Ort ist weltberühmt. Manche rutschen in die neue hässliche oder die alte schiefe, so ansehnliche Kirche. An jeder Ecke ein Laden mit »artículos religiosos«, hunderttausendfach bunter Klimbim. Ausgesprochen witzig die tragbaren Wiegen, maßgezimmert für den Heiland als Baby-Heiland. Ja, mannshohe (!) Jesusjünger gibt es zu kaufen: Heerscharen von Heiligen, stets um den Gottessohn geschart und gewiss alle einen Kopf kürzer als er.
Aber ja, ich hab’s geschworen, ich will nicht lästern oder – ich bin ein Schwächling – nur verhalten aufmucken. Zudem werde ich mit zwei Situationen belohnt, von denen man nur lernen kann: In einer Seitenkapelle, in der fleißig und kniend gen Himmel geklagt wird, entdecke ich – scheinheilig ebenfalls auf Knien und nach links schielend – ein Paar. Schon wieder. Diesmal hinter einem Beichtstuhl (!) versteckt und innigst zugetan. Bestimmt noch ein atü leidenschaftlicher als die Polizistenbraut und ihr Bräutigam. Und ich denke, dass neunzig Prozent der hier anwesenden Männer – die auf jeden Fall – sogleich tauschen würden. Denn Schmusen heilt, wissenschaftlich und empirisch bewiesen. Und entzückt. Während noch immer keine Beweise vorliegen, dass Knien auf kaltem Steinboden zur Lebensqualität beiträgt.