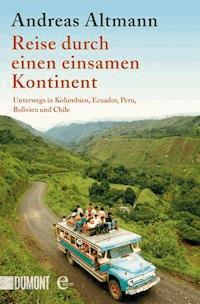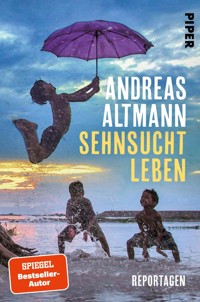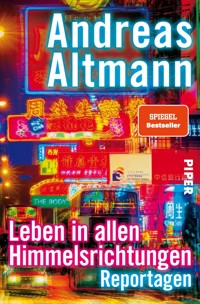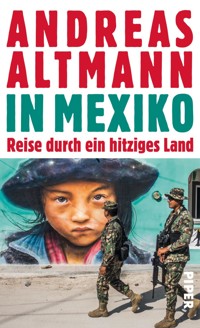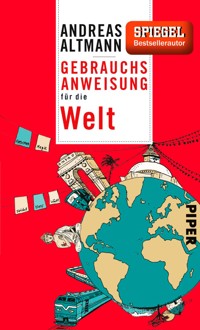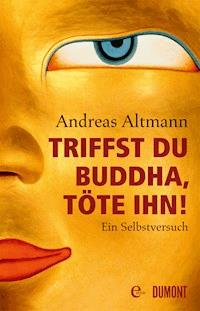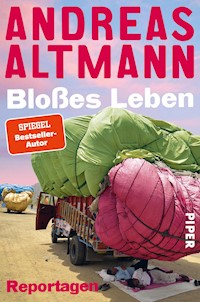
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der große Reiseautor wieder in Bestform Besondere Begegnungen, ungestüme Landschaften, wertvolle Erkenntnisse – das Reisen erweitert nicht nur unseren Horizont, sondern lehrt uns zu leben. Und wer kann uns dieses Leben in seiner rohen, manchmal erschreckenden und meist überwältigenden Vielfalt besser nahebringen als der begnadete Reporter Andreas Altmann? In dieser Auswahl seiner gefeierten Reportagen lässt er uns an seinen Begegnungen in aller Welt teilhaben, erzählt von den unterschiedlichsten Menschen und ihren Schicksalen und nimmt uns mit nach Lappland und in den Sudan, nach Mumbai und Chicago, zu Kamelrennen und Himalajawallfahrten. Das immerwährende Interesse an anderen Menschen und ihren Umständen treibt ihn vorwärts. Bloßes Leben in einem Band.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Salomé und Samuel.Denkt immer daran, ihr könnt schaffen, was ihr wollt.
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotiv: SHAUKAT AHMED / Kontributor / Getty Images; Guillaume Galtier / unsplash
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Motti
Widmung
VORWORT
SCHÖNE WELT
ISLAND
ARC DE TRIOMPHE
BÄRENWEG
KIRGISTAN
LIDO DE PARIS
ROUTE 66
AMSTERDAM
THE KEYS
HERAUSFORDERNDE WELT
DIE TODESWALLFAHRT
DIE ZAPATISTEN
EIN SCHWEIZER IN KABUL
KUBA
NUBA
PEKING
KAIRO
UNITED STATES NAVAL ACADEMY
GEHEIMNISVOLLE WELT
BEYOGLU
DER TANZ ÜBER DAS FEUER
DOMINICA
PASHMINA
SAGENHAFTE WELT
BIBLIOTHECA ALEXANDRINA
CHICAGO BLUES
QUEENS PARK RANGERS
UNGLAUBLICHE WELT
DER GRÖSSTE BAHNHOF DER WELT
FRITZ PAWELZIK
OLD TUCSON
AUSSICHTSLOSE WELT
MEXICO CITY
DOUZ
HOMELANDS
HONGKONG
KORRUPTION IN KENIA
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Nelly Sachs:
Alles beginnt mit der Sehnsucht.
Warsan Shire:
Letzte Nacht, kurz vor dem Schlafengehen, nahm ich den Globus vom Regal auf meinen Schoß, strich sanft mit dem Finger über die Welt und fragte: »Wo tut’s denn weh?« – »Überall,« flüsterte sie, »überall.«
Simone de Beauvoir:
Ich liebe das Leben so sehr und verabscheue den Gedanken, eines Tages sterben zu müssen. Und außerdem bin ich schrecklich gierig; ich möchte vom Leben alles, ich möchte eine Frau, aber auch ein Mann sein, viele Freunde haben und allein sein, viel arbeiten und gute Bücher schreiben, aber auch reisen und mich vergnügen, egoistisch und nicht egoistisch sein.
Charles Bukowski:
Wir werden alle sterben, jeder von uns, was für ein Zirkus. Das allein sollte uns dazu bringen, zu leben, zu lieben. Aber das tut es nicht. Wir werden terrorisiert von Kleinigkeiten, zerfressen von gar nichts.
Das Buch ist einer Frau gewidmet, die ich nicht kenne. Ich habe sie nur eine halbe Stunde lang gesehen. Von fern, vielleicht aus fünf Meter Entfernung. Ich bin sicher, dass sie mein Anstarren nicht bemerkt hat.
Sie saß und las. Auf einer Bank, mit dem Rücken zur Wand eines Cafés. Sie las wie jemand, der zu einer Spezies gehört, die man für ausgestorben hielt: ganz da, ganz dabei, ganz eins mit dem Buch. Nicht einmal ließ sie die Seiten los, kein Suchen nach dem Handy in der Handtasche, kein Reagieren auf die Geräusche und Stimmen im Raum. Nichts. Das einzige Lebenszeichen kam, als sie umblätterte. Dann wieder totenstilles Versinken.
Bis sie, die halbe Stunde war vorbei, den Kopf hob und die Augen schloss. Es war der Augenblick, in dem mir Rilkes Gedicht »Der Leser« einfiel, er schreibt da: »… bis er mühsam aufsah alles auf sich hebend, / was unten in dem Buche sich verhielt.« Dieser Leser war sie, die Fremde. Sie war ein Wunder, sie kam von einem fernen Stern. Sie ist der Traum jeden Autors.
VORWORT
Es war mitten in Afrika. Ich musste über den Kongo, um ins Nachbarland zu gelangen. Die Strömung war heftig, und nur eine müde Piroge stand zur Verfügung. Doch Fährmann Nio lächelte nonchalant und meinte: »Pas de problème.« Wir legten ab.
Es schaukelte gemein, und eine schwungvolle Welle mehr hätte gereicht, um uns zwei ins Wasser zu kippen. Samt Rucksack. Mit je einer Hand hielt ich mich links und rechts am Bootsrand fest. Wie jemand, der sich an die Armstützen seines Sitzes klammert, wenn das Flugzeug in Turbulenzen gerät. Wie kindlich.
Ich wurde nicht gelassener, als mir ein Spruch aus dem fernen Indien einfiel. Wie wahr er klang und wie wenig nervenschonend: »Du bist das, was von dir bleibt, wenn du bei einem Schiffbruch alles verlierst – und du nackt den Strand erreichst.«
Dennoch, der Satz gefiel mir. Er war eindeutig und unvorstellbar. Wie das Foto, das ich als Junge in einem Buch mit dem Titel »Katastrophen von heute« entdeckt hatte: Man sah einen Mann aus einem brennenden Haus fliehen. Darunter stand, dass Herrn Hans W. nichts geblieben war. Nur das bloße Leben. Und die drei angesengten Kleidungsstücke am Leib. Hans im Unglück.
Ich habe zwei Zimmerbrände hinter mir, kein Vergleich zum Verderben eines Flammenmeers. Sachen gingen verloren, und der tiefe Schreck ließ irgendwann nach. Die lebenslange Furcht vor Feuer, die blieb.
Die kleineren Malheurs mag ich. Ich bin clever genug, um aus ihnen zu lernen. Aus den großen Debakeln wohl nicht, bin unsicher, ob ich es mit Desastern aufnehmen könnte oder nicht doch zerbrechen würde.
Alles weg, das ist eine ungeheuerliche Aussicht. Alles, auch die Freunde, die den Untergang oder die Feuersbrunst nicht überlebten. Auch die Freundin, alles, was nah war, unersetzlich nah.
Nios Lächeln sollte recht behalten. Nur leicht durchnässt erreichten wir das Ufer. Dort warteten bereits die Grenzer auf mich, den weißen Mann. Ihre Haltung war unmissverständlich. Ich legte ein paar schmutzige Scheine in den Pass und konnte passieren.
»Bloßes Leben« hat verschiedene Bedeutungen. Die oben erwähnte – nichts bleibt dem Menschen – ist wohl die brutalste. Eine andere Form – ich will über sie berichten, obgleich sie kaum zum Ruhm des Autors beiträgt – erzählt von einem Umstand, in dem kein Teil des materiellen Besitzes abhandenkam, auch niemandem Leid geschah. Nein, alles durfte ich behalten, und doch war ich bloß und hilflos. »Bloß«, da aller Fähigkeiten beraubt. Eine peinsame Erfahrung, aber gewiss lehrreich.
So war es: Eine Frau hatte mich eingeladen, und ich folgte ihrer freundlichen Bitte. Ich fuhr zu ihr, obwohl mein physischer Zustand nach einem schweren Unfall desolat war. Doch die Aussicht auf Nähe und Eros verhinderte den Blick auf die Wirklichkeit. Ich stieg in den Zug.
Luisa war vorgewarnt und reichte mir gleich auf der Fahrt vom Bahnhof zu ihrer Wohnung starke Schmerzmittel. Die, wie das halbe Dutzend zuvor, keinen einzigen Schmerz linderten.
Bisweilen tut man Dinge, die man schon bereut, während man sie tut. Ich fühlte mich wie ein Betrüger, der längst ahnt, dass er für etwas anreist, zu dem er nicht imstande sein wird.
Luisa war selbstbewusst – nicht ohne Grund. Sie sah gut aus, verdiente erfolgreich ihr eigenes Geld, war von niemandem abhängig. Drei so begehrenswerte Eigenschaften. Ach ja, zudem redete sie freundlich und vergnügt.
Ihr Zuhause hatte alles, was es für ein Liebeswochenende brauchte. Das einzige Accessoire, das fehl am Platz war, war ich.
Nur mit Mühe schaffte ich die vier Stockwerke hinauf in ihr Penthouse. Seit dem Zusammenstoß zwischen mir, dem Radfahrer, und dem Täter, dem Autofahrer, war mein Skelett aus den Fugen geraten. Wann immer ich es bewegte, fuhr ein Blitz in mich.
Wir plauderten, es gab Kaffee, und die mitgebrachten Blumen standen neben der Schale mit Keksen. Da wir wussten, worauf wir uns einließen, kam es bald zum ersten Kuss. Er gelang mir noch, denn Luisa, die Biegsame, beugte sich vor zu meinem Mund. Warmer Kuss, der alles versprach.
Alles umsonst.
Irgendwann verschwand Luisa, und als sie in die Küche zurückkam, war sie nackt, lächelte und begann zu tanzen. Was für ein Geschenk für einen Mann, dachte ich, und wie vollkommen stimmig die Situation war. Luisa wollte vögeln, und wundersam unbekümmert zeigte sie ihre Trümpfe.
Wieder umsonst.
Mein Gerippe war inzwischen versteinert. So zumindest fühlte es sich an. Nur die Hand auszustrecken, ja die kleinste Absicht, den Torso zu bewegen, jagte einen feurigen Stich durch mein Nervensystem. Die vom Schock der Kollision miteinander verklebten Faszien wimmerten beim winzigsten Ruck. Undenkbar, hier als Liebhaber aufzutreten. Ich war impotent, von Kopf bis Fuß. Nichts blieb mir an diesem Tag (und in der folgenden Nacht) als das Leben. Ich lebte, nein, ich war am Leben, aber mehr nicht. Nicht der begehrlichste Reiz auf Erden konnte es mit meinem verwundeten Leib aufnehmen.
So weit die zweite Bedeutung von »bloß« und »Leben«.
Nun kommt die dritte, die wichtigste, die, von der im Buch die Rede sein wird. »Bloßes Leben« als Ausdruck von äußerster Innigkeit. In den 31 Geschichten passieren immer wieder Momente, die deshalb so intensiv sind, weil sie nichts anderes benötigen als die Bereitschaft, diese Augenblicke zu leben. So ein ultimatives Jetzt, das absolute Wissen, dass der Zauber, der kleine oder größere Rausch, nur Wert hat, wenn man von Anfang bis Ende dabei ist. Dass kein Zaudern sein darf, da sonst das Geschenk – und dauerte es nur Minuten – entschwindet. Jede Faser soll zucken, soll versichern, dass einen gerade das verheerend grandiose Gefühl durchflutet, unverbrüchlich anwesend zu sein: herzflimmernd und mittendrin.
Solche Euphorien scheinen nötiger denn je, da wir uns auf eine Gesellschaft hinentwickeln, die jede sinnliche Anstrengung – sinnlich im Sinne von: physisch erfahrbar – auf Biegen und Brechen abschaffen will. In zukünftigen »Smart Houses« ist selbst das eigenhändige Hochheben des Klodeckels verboten. Lieber aufs Smartphone tupfen, als Muskeln zu spüren. Lieber nichts spüren als spüren. Der Körper ist verdächtig, der kann weg.
Die hedonistische Tretmühle – was für ein Traum! Was für ein Albtraum!
Eines Tages wird uns beim Verlassen der Wohnung automatisch eine Windel verpasst, und mit dem Babyfon in der Hand dürfen wir nach draußen. Für den Fall, dass es zu nieseln beginnt und wir unverzüglich um Hilfe betteln müssen: Bitte sofort nach Hause evakuieren! Ins Hyggereich mit Sofa und Kuscheltieren – und garantierter Windstille. Ich warte noch auf die stufenlos einstellbare Heizung für den Fahrradsattel. Den Motor haben wir ja schon. Keiner braucht mehr Angst zu haben, dass sein Body zu irgendetwas nütze ist.
Studien bestätigen es: Sex steigt ab, immer weniger können sich dazu aufraffen. Wie verständlich, denn viel aufregender, als einen Menschen zu beschmusen, ist es, wie offensichtlich, mit Plastik zu spielen. Das kann man hernehmen, weglegen, es riecht nicht, es widerspricht nicht, es ist berechenbar und landet, wenn unbrauchbar, im Müll. Entschieden anstrengender ist da ein Zweibeiner, der nicht sofort pariert, der eigensinnig ist, der sich nicht so umstandslos entsorgen lässt.
Ich poche auf mein analoges Leben, das keinen Wert darauf legt, rundum »connected« zu sein. Ich will auf die Welt glotzen und nicht auf ein handtellergroßes Display, ich will nicht zermalmt werden von Geschwätz, das durch den Cyberspace wabert. Gleichzeitig, wie menschenfreundlich, verschone ich die Umwelt mit den Pipinachrichten aus meinem Alltag.
Als ich zum ersten Mal von Jugendlichen hörte, die sich ritzen, um sich via Schmerzen irgendwie wahrzunehmen, irgendwie den Moder der braven, schauerlich voraussehbaren Jahre auszuhalten, habe ich sie sofort verstanden. Ich ritze mich nicht, doch ich haue ab. Irgendwohin, fast egal, wohin. Nur schimmeln darf es dort nicht. Seltsam, aber oft werde ich belohnt für die Beschwernisse. Ich treffe Frauen, ich treffe Männer, und Geschichten passieren, die fremd und wunderlich klingen. Jedenfalls weit weg vom Mief des ewig Gleichen.
»Am Grabe der meisten Menschen trauert, tief verschleiert, ihr ungelebtes Leben«, keine Ahnung, wo ich den Satz las. Er ist gemein und leider nicht von mir.
Ich wünschte, jedes meiner Bücher taugte so nebenbei als Aphrodisiakum. Man liest es, man schluckt es, und nach spätestens einer halben Stunde regt sich die Lust. Aufs Leben.
SCHÖNE WELT
ISLAND
Nicht sterben dürfen, ohne hier gewesen zu sein
»Das war zu viel für ihn«, meinte der Doktor und blickte besorgt auf Monsieur Stendhal, der bewusstlos vor ihm lag. Der französische Schriftsteller war durch Florenz geschlendert und umgekippt. Besinnungslos.
Dieser Tag – über 200 Jahre liegt er nun zurück – ging in die Geschichte der Medizin ein. Wem heute die Sinne schwinden beim Anblick von zu viel Schönheit, der leidet unter dem »Stendhal-Syndrom«. Durchaus heilbar. Bettruhe wird verordnet, und – noch wichtiger – für einige Zeit soll jede visuelle Provokation vermieden werden. Für den Meister galt: vorübergehend keine Aussichten auf blühende Italienerinnen und den betäubenden Glanz italienischer Architektur.
Gut, dass der Mann nie in Island war. Der Schwächling wäre schon beim Anflug in die Knie gegangen. Hier hat nicht Michelangelo gearbeitet, sondern der Teufel. Das trotzige Ende der Welt, behaupten die Wikinger. Ein muskulöser Erdteil mit eisig glühenden Gegensätzen: dunkle Tage und helle Nächte, blaustählerne Himmel und höllenschwarze Wolken. Und nie ein Übergang, immer vehement und plötzlich, immer fordernd und anstrengend. Luft und Erde und Feuer und Wasser für starke Typen. Die Insel ist kein Kurort, hier kämpfen sie noch gegen eine brachiale Natur. Das Land peitscht, bohrt ins Gemüt, überwältigt die gierigen, neugierigen Augen. Aber wer wüsste zu sagen, was heftiger begeistert: die 100 000 Quadratkilometer kleine Insel oder ihre seltsam widerständigen, eher scheuen und großzügigen Frauen und Männer.
Reykjavík, brave, saubere Hauptstadt, nicht schön, nicht hässlich, gar nichts. Bemerkenswert jedoch, dass sie hier einen Fremden anlächeln, dass alle sechs Jahre ein Mord passiert und noch nach 23 Uhr die Kinder im Sommerlicht der Mitternachtssonne Fußball spielen.
Auf seiner Farm, zwei Autostunden Richtung Norden, treffe ich Sveinbjörn Beinteinsson. Sein Haus eine Hütte aus Stein, in den Boden gerammt, niedrig, auf dem Dach wächst Gras. Daneben eine Scheune, ein Schleifstein, ein Wasserloch, im Hinterhof ein Gletscher. Der Wind rast durch das Tal, der Blick fällt auf schneebedeckte Berge, auf einen See, einen Fluss, die Schafe. Der Alte ist Bauer, Poet und »Godi«, ein Hohepriester des germanischen Hauptgottes Thor. Lange hat der heute 58-Jährige gekämpft, dann wurde seine Religion wieder zugelassen. Wir sitzen in der Küche, der Ofen brennt, Bücherkisten stehen herum, die Schreibmaschine, das nie gemachte Bett.
Kein Volk ist so literaturnärrisch wie die Isländer. Sprache als Grundnahrungsmittel, um die elf Jahrhunderte schonungslosen Existenzkampfs auszuhalten: mit Hungersnöten, Fremdherrschaft, Piratengier, christlicher Vergewaltigung und dunklen, ewigen Winternächten.
Eine solche Sprachlust, eine solche Finsternis und eine so gewalttätige, heroische Landschaft mit so viel Nebel, Wind und Feuer speiender Erde verführt zum Fantasieren, liefert tausend Rechtfertigungen für Geistergeschichten, Heldensagen und Götterlegenden.
Sveinbjörn ist ein fröhlicher Kerl. Seine hellblauen, schnellen Augen, der weiße Vollbart, die zerzausten Haare, die Pfeife, die Hosenträger über dem abgetragenen Hemd. Ein paar Hundert Meter von seinem Hof entfernt steht in einer Felswand die Statue von Thor. Dort treffen sich seine rund achtzig Anhänger, viermal pro Jahr. Singen alte Lieder, lesen aus der Edda, essen und trinken, lachen. Seine Landsleute respektieren den Kauz, kaufen seine Gedichte, hören im Radio seine sanften und zornigen Gedanken über die Dummheit der Menschen.
Sveinbjörn ist ganz irdisch. Er erzählt von organisierten Happenings gegen die Apartheidpolitik in Südafrika und meint zum Abschied: »Hoffentlich gewinnen die Asen (das hiesige Göttergeschlecht!) in Deutschland an Einfluss. Dann wird alles gut mit der Wiedervereinigung.« Er winkt mir nach, grinst selig, sein Gesicht strahlt.
Manche lieben die Wüste mehr als alle anderen Landschaften. Solche Zeitgenossen sind begabt für Island.
Ich fahre weiter nach Norden, entlang des äußersten Rands der Snæfellsnes-Halbinsel. Das Autoradio ist kaputt, gut so. Nichts lenkt ab. Hier, sagen sie, redet nur der Wind. Und der singt mit hundert Stimmen. Die Schotterstraße führt durch ein Terrain für Bibelfilme. Ein Lavafeld, moosbedeckt, eine Ruine steht da, die Holztür schleudert auf und zu. Vier Stunden lang kein Gegenverkehr. Blick hinauf zum olympisch weiß schimmernden Snæfellsnesjökull, von dem Jules Verne einmal schrieb, er sei der Eingang zur Welt. Es ist 22.15 Uhr, und die Sonne blendet so stark, dass ich nur im Schritttempo vorwärtskomme. Die absurden Formen der gefrorenen Lava blitzen im Gegenlicht. Alles könnten sie sein. Götterburgen, ein achtfüßiges Pferd, zwei Drachenohren, der Speer eines zornigen Kriegers. In der Edda findet sich ein Gedicht über die Ur-Erschaffung, dort heißt es: »Und aus des Riesen Fleisch ward die Erde geschaffen/Aus seinem Schweiße das Meer/Aus dem Gebein die Berge/Und aus seiner Hirnschale der Himmel.« Das ist mit dem Presslufthammer geschrieben. Und nur der kann es so hinschreiben, der eine solche Vision gesehen hat.
Am nächsten Tag führt die Strecke an den sechzehn Fjorden der Westküste entlang. Viele Kilometer wurden erst vor Kurzem geöffnet, endlich lässt der Winter nach. Einspurig, kurvig, abschüssig, Rollkies, Steinschlag, keine Seitenbande, scharfe Steigung, die mit Schmelzwasser gefüllten, bis zu vier Quadratmeter großen Schlaglöcher, wieder die Sonne, wieder der Wind, wieder die Hunde, die zu einem abgelegenen Berghof gehören und kläffend hinter dem Wagen herjagen. Mein russischer Lada, »siberiaproof« und Vierradantrieb, verkrustet unter einer soliden Schmutzschicht.
Oben auf der Passhöhe stehen bescheidene Notunterkünfte, alles liegt sauber verpackt bereit: Socken und Mützen, ein Gaskocher, ein Funkgerät, Schokoladenkekse und Maggi-Spargelcremesuppen.
Oft bin ich allein auf dieser Reise. Und nie fühle ich mich einsam, gar klein und winzig. Im Gegenteil, ich empfinde Selbstvertrauen und Starksein. Hier bin ich noch einmalig und vorhanden, nicht unsichtbar und ausgelöscht in der Masse. Zudem weiß man sich von der Fürsorge der Isländer beschützt. Ich frage einen Mann, der einen umgestürzten Telefonmast repariert.
Wo gibt es in der Gegend Benzin?
Sechs Kilometer weiter. Klopf an die Tür und erkundige dich nach Einar von der Zapfsäule. Klappt es nicht, komm wieder, und mir fällt bestimmt etwas ein, um dir zu helfen.
Ich muss nicht zurück, Einar ist da und tankt voll. Um neun Uhr abends erreiche ich Isafjördur, ganz im Nordwesten des Landes. Ein Fischerdorf mit knapp 3000 Einwohnern. Die 700 Meter hohen Felsen schützen den Naturhafen und verhindern im Winter jeden Sonnenstrahl. Drei Monate lang ist es kalt, sturmverweht, schneeversunken und düster. Zieht endlich die Sonne über die Berge, dann heulen manche vor Freude, und alle trinken ihren »Sonnenkaffee«. Kein Wunder, dass ich zum dritten Mal in wenigen Stunden den hiesigen Tophit, den Reggae-Song aus Jamaika, höre: »Oh Kingston Town/The place I long to be …« Noch eine Überraschung: Ich sehe einen Trabant. Die sozialistischen Rauchkerzen verkaufen sich gut auf der Insel. Autos sind teuer, mit ebendieser Ausnahme, jenen vierrädrigen Rußkesseln, die in immerhin 45 Sekunden auf volle 60 km/h jagen.
Als ich am nächsten Morgen Isafjördur verlasse, hebt gerade der Postbote ab. Hier fliegt der Briefträger, viele Dörfer haben ihre eigene platt gewalzte Wiese, die Landebahn. Neben mir sitzt Jon, ein junger Bursche, Autostopper. Gestern ging das Schuljahr zu Ende, und heute beginnt sein Ferienjob, drei Monate lang. Mit 16 ist jeder für sich verantwortlich, die Unterstützung der Eltern hört auf. Die Kids sind nicht wehleidig, packen an, über tausend Jahre Überleben macht stark. Der Halbwüchsige sagt den erstaunlichen Satz: »Immer heißt es, alles soll Spaß sein, easy, no problem. Aber das funktioniert nicht. Wir Isländer nehmen das Leben, wie es kommt. Ohne zu maulen.«
Am dritten Abend bin ich in Brekuækur, einem Bauernhof, der ein paar einfache Zimmer vermietet. Und Pferde. Ich entscheide mich für Lettir, einen windfarbenen Hengst. Ponys treibt ein zähes Verlangen nach Freiheit an. Und als eigensinnig, lebensfroh und zuverlässig gelten sie. Bis ins frühe 20. Jahrhundert schleppten sie Schwangere zur Hebamme, trugen Kranke zum Arzt, zogen Tote ins Grab. Sie bleiben rein wie die isländische Sprache. Kein fremder Gaul darf auf die Insel. Und wer einmal das Land verlassen hat, kann nicht mehr zurück.
Fünf Gangarten beherrschen die Tiere. Und die fünfte gibt es nur hier: den Tölt. Spötter nennen ihn den Säufergalopp, weil Isländer gerne blau werden und jeder Tölt-Schritt sacht auftritt und nie die Sauflust behindert. Abi, der Bauer, und ich reiten durch den Midfjördur, einen Lachsfluss. In der Nähe steht ein flacher Holzbau, das »Lachshotel«, zu dem im Hochsommer Herzchirurgen aus New York und französische Champagner-Magnate jetten, um für 750 Euro pro Tag fischen zu dürfen.
Mitternacht ist vorbei, schwere Wolken hängen, im Gegenwind galoppieren wir (verhalten) über die vom Frost geblähten Beulenwiesen. Ein weißer Gerfalke kreuzt, wir erreichen das Grab von Grettir. Unter dem Stein soll sein Kopf liegen. Nichts ist erwiesen, und doch rührt keiner den uralten Felsbrocken an. Nebel raunen, ein Fluch geistert an diesem Ort, Isländer sind hochbegabte Dramatiker. Grettir ist der Held einer blutgetränkten Familiensaga. Ein ruheloser, unglücklicher Mensch, der bereits als 13-Jähriger als Totschläger auftrat, später lange Jahre als Vogelfreier durch die Einöden Skandinaviens trieb und zuletzt nicht der Rache seiner Feinde entging: Enthauptung.
Wir reiten zurück, halb zwei ist es inzwischen, die hellen Nächte verschieben jedes Zeitgefühl. Abi verspricht für morgen ein herrliches Frühstück mit in heißer Erde gebackenem Braunbrot, Cornflakes, Kaffee und Lysi, dem pissgelben Nationalgetränk, einem kerngesunden, grässlichen Lebertran.
Island garantiert spektakuläre Gefühle. In Akureyri, der größten Stadt im Norden, miete ich eine einmotorige Piper Tomahawk, samt Thorstein, dem Piloten. Der Mann ist Fluglehrer und erkennt Feiglinge schon beim Einsteigen. Mein rechter Handballen schwitzt, tropft auf den Notizblock. Lächerliche 112 PS hat die Zündholzschachtel, unvorstellbar, wie das Ding in schwindelerregender Höhe bleiben soll. Aber ich habe keine Wahl. Von Reykjavík aus umkreise ich per Auto die Insel, doch viele Straßen, die nach innen führen, sind noch immer gesperrt. Also fliegen.
Thorstein entscheidet sich für eine Schocktherapie. Als einer der ersten »dirty winds« uns nach unten wirbelt, erzählt er von den Abstürzen der letzten Jahre. Er übertreibt monströs, lügt mich herztot: »Da vorn, schau, der Felsvorsprung, das war im Januar. Drei Tote. Ach ja, da hinten – siehst du das Schneefeld? – versuchte man eine Notlandung. Leider daneben! Und ein paar Kilometer weiter drüben, ich zeig dir dann den Punkt, brach ein Feuer in der Kabine aus. Erst kürzlich, alle sieben Passagiere ab in den nächsten Krater, Sturzflug.« Jetzt entkommt mir ein hysterischer Lacher, was Thorstein veranlasst, einen Motorschaden zu simulieren, ja, er will unbedingt beweisen, dass die Maschine auch ohne Triebwerk weiterfliegt und durchaus einige Minuten Zeit hat, einen Landeplatz zu finden.
Ach, woher soll einer die Sprache nehmen, um es mit Dutzenden von Weltwundern aufzunehmen? Blick auf den 1700 Meter hohen, schneeglitzernden Herdubreid, den Berg der Götter. Blick auf Odadahraun, die größte Lavawüste auf Erden, einst erbarmungsloses Ziel von Missetätern, einst Trainingsfeld für amerikanische Mondastronauten, Blick auf den 8500 Quadratkilometer riesigen Gletscher Vatnajökull, Blick in den vom Himmelsblau bestrahlten Öskjuvatn, einen kalten, eisglatten Kratersee, der die Sonne, die Wolken und das Flugzeug widerspiegelt.
Hier ist die Welt noch nicht fertig, ja, man starrt auf die wilde, unfassbar grandiose Rohfassung. Ach, Stendhal wäre längst gestorben.
Ich schlafe schlecht in dieser Nacht. Das ist mein persönlicher Rekord: 64,5 Zentimeter breit ist die Matratze. Eine Liegestatt für Leute im Hungerstreik. In Island haben sie keine Betten, nur Kojen. Erinnerung wohl an ihre Seefahrervorfahren, die Wikinger.
Für die Marter werde ich am nächsten Tag belohnt. Hundert Kilometer weiter im Osten liegt der Myvatn-See. Mückenhölle, Vogelparadies. Hier gibt es eine Erdspalte, in der dampfend warmes Wasser verwöhnt. Mit einem Seil lässt man sich hinunter, es hallt, es ist still, das Eintauchen beruhigt.
Das wird ein seltsamer Tag. Nach dem Vergnügen blockiert – mitten auf der Strecke – der Leihwagen. Automatische Vollbremsung. Ohne Grund, kein Wildwechsel, nirgends ein Lebewesen. Ich entkupple, lege den ersten Gang ein, gebe Gas, der Motor jault: Und keinen halben Millimeter bewegen sich die Reifen. Viele Versuche. Pause, ich warte, wieder versuchen. Irgendwann hält ein Sattelschlepper. Der Fahrer probiert das Gleiche wie ich, doch nichts rührt sich. Er nimmt mich mit zum nahen Dorf, ich rufe den Autoverleiher an. Zwei Stunden später kommt Kristjan, der Mechaniker.
Ein peinlicher Augenblick. Der Chef setzt sich hinein und – fährt los. Er checkt hinten und vorn, bockt hoch, findet keine Spur für die Blockade. Ich fahre weiter. Kristjan meinte noch zum Abschied, ich solle unbedingt mit den »Huldufolk« sprechen, den »hidden people«, die als Geister den Menschen bisweilen in die Quere kämen. Vielleicht wollte er mir helfen, nicht das Gesicht zu verlieren, aber in seinen Worten lag nicht die geringste Ironie. Isländer glauben an tausendundeins Gespenster, Wiedergänger, Trolle, Elfen, Astralwesen, Traumgesichter und eben – versteckt in allen Ecken und Enden des Landes – an das Huldufolk. Ich rede dann auch mit ihnen, von wegen Freundschaft und Völkerverständigung.
Der Hokuspokus hilft nicht. Eine Stunde später biege ich von der Ringstraße links ab, Richtung Dettifoss, dem gewaltigsten Wasserfall Europas. Die Straße ist für jeden Autoverkehr gesperrt, ich versuche es trotzdem. Ein Amazonaspfad nach der Regenzeit. Metertiefe Risse erfordern Umwege, Querfeldeinfahrten, langwierige Suche – zu Fuß – nach der geeigneten Spur. Bis ich in einem Flussbett, voll mit Schmelzwasser, badewannentief versinke. Huldufolk oder Torheit, ich will es nicht wissen. Nach langem Marsch erreiche ich einen Hof, jetzt passiert etwas typisch Isländisches. Der Bauer fängt an, ich antworte:
Hello!
I got stuck with my car.
I can help you.
Wir nehmen den großen Traktor, das große Seil, den großen Hund. Zwanzig Minuten später – Sverrir fährt einfach in die Badewannen hinein – sind wir am Tatort. Der Retter kann sich ein Lächeln nicht versagen – also doch Blödheit – und zieht mich heraus. Als hätte ich heute nicht schon genug Fehler hinter mir, biete ich ihm Geld an. Sverrir schüttelt den Kopf.
Die Nacht verbringe ich auf Husey, ganz im Nordosten der Insel. Den 40 Hektar riesigen Bauernhof mit Schafen, Pferden, Robben und einem Gänserich führt Örn, der Lehrer, Farmer, Fischer und Geschichtenerzähler. Sein Hausgeist heißt Mori. Nicht blutrünstig, aber lästig, sagen sie.
Bis nach Mitternacht bin ich im Stall. Zicklein kommen zur Welt, der Bauer als Geburtshelfer, die Mütter schlecken ihre zitternden Jungen ab. Als ich endlich in der Koje liege, warte ich umsonst. Mori kommt nicht und die hübsche Anna, Örns Tochter, auch nicht. Okay, der Tag war gut, man darf nicht alles verlangen.
Die Ostküste entlang, über Seydisfjördur, weiter über Djupinvogur, bis runter nach Höfn. Ich denke an Laure in Paris. Letztes Jahr war sie Gast bei Örn, zum Abschied schrieb sie in sein »Gestabok«: »J’aime Husey, j’aime l’Islande, j’aime la vie.« Oh, Laure, wie recht du hast.
Sensationelles Island. Fahren und staunen. Durch das Seitenfenster die Wildgänse beobachten, die ganz nah ein Stück mitfliegen. Geduldig doofen Schafen ausweichen. Zehntausend Stockfische riechen, die klappernd im Wind trocknen. Pferden nachblicken, die schön sind wie schöne Frauen. Einen toten (kleinen) Vulkan besteigen. Mit dem Schiff zu den Westmänner-Inseln tuckern und, ohne zu zögern – satter Seegang –, die gerade verdauten Käsebrote ins Meer prusten. Einen Leuchtturm besuchen und mit dem Leuchtturmmann reden. Neben einem Fluss sitzen, einmal den Mund halten und dem Geräusch des Wassers zuhören. An einem Heimatmuseum vorbeikommen und über 200 Jahre alte Präservative kichern. Blonden Mädchen zurücklächeln, die tonnenweise Mist ausfahren.
Wie sprachbehindert fühlt sich der Reisende. Man müsste ununterbrochen mit Superlativen um sich werfen, um vom Zauberland Island zu berichten. Beschreibe einer den Jökulsarlon, einen Gletschersee, in dem bizarrblaue Eisberge schwimmen. Eine eisige Orgie aus Schönheit und Wunder. Jedes Wort zerfällt zu Asche, kein Satz kann die Wahrheit erzählen.
Zurück zur Hauptstadt, mit einem kleinen Umweg. Eine knappe Autostunde entfernt liegt die »Blue Lagoon«. Schon von Weitem sieht man die weiß fauchenden Schlote, völlig gefahrlos, reiner Dampf. Die ganze Region wimmelt von kochend heißen, unterirdischen Quellen. Das Kraftwerk nutzt das, speist damit die Heizungen der Umgebung. Was übrig bleibt, wird täglich frisch in die Lagune gepumpt: eine Badeanstalt mitten im Lavafeld. Eine Pharaonenwonne. Den müden Leib ins milchblaue, hautwarme Wasser tauchen. Ihn liegen lassen und tot sein. Ich bin so lange tot, bis ich zwei sich küssen höre, ihre Schemen wahrnehme. Reflexartig kommen mir die wundersamsten Gedanken. Der weiche Boden, die Schwaden, die Körperwärme, die minimale Sichtweite, nicht auszudenken.
Letzter Abend in Reykjavík. Als ich vor drei Jahren zum ersten Mal auf Island war, traf ich Hilda. Unsere Freundschaft hat gehalten. Noch ein Pluspunkt in diesem Land: Die bürgerliche Moral liegt darnieder. Viele uneheliche Kinder, viele öffentliche Verhältnisse ohne Trauschein.
Hilda hat alles vorbereitet, der Koch im »Thrir Frakkar« ist ein alter Freund von ihr, und ich bin bereit für den schweren Gang. Heute gibt es – ausnahmsweise für mich, da unzeitgemäß – »Thorrablot«, eine Art Dankessen für Thor, den Chefgott.
Einmal alle zwölf Monate, Ende Januar, bringen die Isländer es hinter sich. Um sich daran zu erinnern, wie gut es ihnen heute geht und wie mutig und radikal sich ihre oft hungerschmachtenden Vorfahren ernährten.
Es fängt an mit frischem Haifischfleisch. Eine Stinkbombe, penetrant wie ein Kübel Ammoniak, fürsorglich wird sofort »Brennivin«, der einheimische Lieblingsschnaps – Zweitname: »Svarta daudi«, Schwarzer Tod – mitserviert. Zwei Schafsköpfe folgen, einer hundert Tage in Molke eingelagert und hellhäutig, der andere dunkelschwarz abgesengt und gargekocht. Die Augen gelten als Delikatesse. Eine Blutwurst kommt noch, eine gebackene Schafsleber auch noch und – man würgt schon beim Zuhören – leicht angeräucherter Hammelhoden. Der Koch klopft mir freudestrahlend auf die Schulter, Hilda lächelt mitfühlend, ich denke an den berühmtesten Schriftsteller hierzulande, an Halldor Laxness’ Wahlspruch: »Ich schaff’s oder ich sterbe.« Ich schaff’s.
Der zweite Teil des Abendessens gilt als Wiedergutmachung, isländische Küche als Glückseligkeit: Garnelen, Lachs, roher Walfisch, Eis mit Kiwi, Kaffee und hauchdünne Pfannkuchen.
Hinterher fahren Hilda und ich hinunter zum Hafen, Mitternachtssonne bewundern. Irgendwann will sie wissen, was mir in ihrem Land am besten gefallen hat. Ich muss nicht nachdenken, denn seit einer Woche weiß ich die Antwort. Es war kurz hinter Isafjördur, und Jon, der Autostopper, saß neben mir. Fast zwei Stunden redeten wir, und es war unüberhörbar, dass der 17-Jährige heftig an die jungen Isländerinnen dachte. »Und«, fragte ich, »wie soll sie aussehen, deine Lieblingsfrau?« Und Jon antwortet, ohne zu zögern, als wäre alles längst beschlossene Sache: »Sie müsste eine Lederjacke tragen und lachen, wenn der Wind geht.«
ARC DE TRIOMPHE
Rasende Pferde – Kleine Männer – Big money
Wie genau ich mich erinnere. Es war vor langer Zeit und immer um 21 Uhr. Dann hieß es: Kleine Männer gehen früh ins Bett. Ein merkwürdiger Satz, der keinen Widerspruch duldete. Ich war 129 Zentimeter klein und musste schlafen. Basta.
Fünfunddreißig Jahre später taucht der Satz plötzlich erneut auf. Und diesmal löst er nur Heiterkeit aus. Inzwischen habe ich mich auf 1,90 Meter hochgearbeitet und kann unmöglich gemeint sein. Der Fotograf neben mir ist beinahe genauso lang. Keiner meint uns. Die Langen interessieren hier niemanden, sie sind unwichtig. Was zählt, hier im Trainingszentrum von Chantilly, vierzig Kilometer nördlich von Paris, sind die Kurzen. Frühabends legen sie sich hin, um frühmorgens wieder aufzustehen. Um dann sofort das zu tun, wonach sie am innigsten verlangen: Pferde besteigen und lospreschen. Um irgendwann dort anzukommen, wovon Jockeys träumen: vom Siegerpodest des Arc de Triomphe, des elegantesten, des härtesten Galopprennens der Welt.
Die Franzosen leiden. Für so viele außergewöhnliche Dinge sind sie verantwortlich. Wie kaum ein anderes Volk lieben sie die harmonischen Proportionen, das Raffinement, das bewegend Schöne. Bei ihrer Hauptstadt fängt es an, und bei ihren Frauen hört es auf. Meisterstücke, wohin man schaut. Die Erschaffung des wunderschönsten Tiers jedoch, des »pur sang«, des Reinrassigen, haben sie versäumt. Ihre Erzfeinde, die Engländer, waren versessener, erfinderischer. Die »Erfindung« des allerschnellsten Pferds geht auf ihr Konto.
Anfang des 18. Jahrhunderts tauchten drei phänomenale (vierbeinige) Araber auf, Hengste. Die englischen Züchter kreuzten sie mit den »royal mares«, den königlichen Stuten. Und zum Vorschein kamen »thoroughbreds«, grandioser und größer, nervöser und stürmischer als alles andere zuvor.
Dreihundert Jahre später hetzen die Nachkommen dieser orientalisch-britischen »Beschälung« jeden ersten Sonntag im Oktober über den Rasen von Longchamp. Wer gewinnt, nimmt Säcke voller Scheine und den inoffiziellen Titel eines Weltmeisters mit nach Hause. Der »Arc de Triomphe« ist das Ziel des Triumphs. Ein Pferdehimmel mitten auf Erden.
Märchen sind teuer. Und anstrengend. Wer vorne mitreiten will, braucht ein üppiges Bankkonto, ziemlichen Mut und einen unerschöpflichen Atem. Kein Sport für Hüstler. Der Weg der Erfolgreichen ist mit Erfolglosen gepflastert. Wer es schafft, dem gehört das gesamte Zubehör, das diese exklusive Umgebung zu bieten hat: der Ruhm, das Prestige, die Bewunderung, der Neid, die teuersten Gegenstände, die mit Geldscheinen zu erwerben sind.
Wer nicht mitkommt, wer abstürzt, der soll niederknien, wenn nur der finanzielle Ruin zu beklagen ist. Andere stürzen und bleiben als Krüppel liegen. Kleine Männer, die danach als hinkende Wracks Sattelgurte basteln. Vom hohen Ross herunter in die Behindertenwerkstatt. Zwei Wochen in Chantilly geben Einblicke frei auf die Mühsal des Alltags, das Elend der Verlierer und den Glanz der Sieger.
Das Nest hat 11 000 Einwohner und ist Hauptstadt all jener, die ein außergewöhnliches Privileg verbindet: Leidenschaft. Pferdenärrische Liebhaber, die jedes Jahr 365-mal Beweise ihrer Liebe produzieren. Bei Hitze und Frost, bei gemeinem Regen, bei bösem Wind, immer widerspruchslos, immer unaufschiebbar. Damit wir zwei Lange, Fotograf und Schreiber, dies alles mitbekommen, heißt es pünktlich aufwachen. Um fünf Uhr, erbarmungslos täglich, scheppert der Wecker.
Ein paar imponierende Zahlen: Über 3000 Rennpferde werden vor Ort trainiert. Von über 100 Trainern und über 900 Stallburschen. Die alle vom Beruf des Jockeys träumen. Drei Prozent schaffen es, der Rest bleibt im Stall. Allen gemeinsam, den Viechern und den Menschen, sind 2000 Hektar Wald, Wiese, das Licht am Morgen und das Dämmerlicht am späten Nachmittag. Eine Landschaft, die – so ein Dichter bereits vor 180 Jahren – »zu den schönsten Erdteilen gehört, die unsere Welt vorzuzeigen hat«. Keine Dichtung, eher die reine Wahrheit.
Immer der Sonne nach. Um fünf aufstehen, um sechs die Pferde striegeln, zweimal die Woche die Box ausmisten, täglich den Kot wegschaufeln, Stroh rein, Heu und Wasser nachfüllen, Füße und Hufe einfetten, aufsatteln, aufsitzen, um 6.45 Uhr mit dem Training beginnen.
Jeder Trainer hat seine eigene Methode. Dennoch gibt es ein gewisses Raster: Drei Gruppen von Pferden, je nach zeitlicher Entfernung zum nächsten Wettkampf, verlassen im Abstand von etwa zwei Stunden die Ställe. Je näher das Rennen, umso früher hinaus. Das Training selbst dauert zwischen sechzig und achtzig Minuten. Nicht mehr. Zuerst »au pas«, im Schritt, mit »les rênes longues«, den lockeren Zügeln. Lässig und entspannt sitzen die »lads« – die Franzosen haben das englische Wort für Junge, Stalljunge übernommen – im Sattel. Dann »au trot«, im Trab. Zeit, um die Verfassung der Pferde zu erkennen und zu entscheiden, wie lang und wie scharf der anschließende Galopp sein soll. Immer auf der Sandpiste. Doch einmal, jeden Dienstagmorgen, stürmen sie über den Rasen im Hippodrom mit dem Schloss nebenan, dem Frühnebel und der Morgensonne im Hintergrund: »au galop vite«, großzügig übersetzt, im Schweinsgalopp. Letzter Extremtest für das Wochenende.
Um acht Uhr gibt es eine halbe Stunde Pause, Frühstück. Längst haben die Cafés geöffnet. Manche ab 5.45 Uhr. Pferdefleisch, wie böse Menschen behaupten, essen sie in Chantilly nicht. Aber sonst stimmt fast alles: Der Friseurladen heißt »Derby«, das Museum »Lebendes Museum des Pferdes«, ein Restaurant nennt sich »Die Kalesche« und das überfüllteste Café »La chasse à courre«, Die Hetzjagd. Hier ist Stimmung. Die reitenden Cracks schauen vorbei, einer parkt nachlässig seinen Porsche 911 Carrera S vor der Tür. Jeder kennt jeden. Die kleinen Männer verstehen sich gut. Die Fans, das Volk, die Täter, alle lieben sie Pferde, lesen »Paris-Turf«, die auflagenstärkste Pferdezeitung, tippen im dem Kaffeehaus angeschlossenen Wettbüro.
Runde, gemütlich beleibte Journalisten treten auf, notieren den Insidertratsch und die Trainingszeiten, belichten die Favoriten, schlachten noch den letzten Gaul aus, um ein knappes Dutzend anderer Pferdeblättchen vollzumachen. Nie fällt ein gemeines Wort. Die einschlägige Presse fungiert hier als Hofberichterstatter. Die heile Pferdewelt, denn Liebe macht blind. Aber ja.
Chantilly sorgt für jeden. Sogar eine eigene Klinik für zu Boden gegangene Jockeys haben sie. Inklusive »Persival«, eine französische Weltneuheit. Ein Stahlross, ganz wörtlich. Ein stählerner Simulator mit Sattel und Pferdekopf. Er ist auf alles programmiert. Selbst auf scharfen Galopp mit plötzlichem Bocksprung. Eine Art Sparringspartner für den rekonvaleszierenden »cavalier«.
Ein Pferdekrankenhaus darf da nicht fehlen. Das ist ein erstaunliches Bild: so ein bewusstloses Riesenvieh auf einem acht Quadratmeter großen Operationstisch. Im Maul steckt ein Schwamm, trocken hängt die Zunge daneben heraus. Die vier angeketteten Füße ragen nach oben. Der Doc schneidet den Hals auf, entfernt Muskeln, die beim Atmen stören. Zwei junge Frauen, Tierärztinnen, assistieren. Hinterher schneiden sie die Hoden weg. Blut schwappt jetzt aus der seltsamen Körperöffnung. Zuhalten und zunähen. Die beiden schwarzen Kugeln landen im Abfalleimer. Die Kastration bringt für das Springpferd nur Vorteile: Die Sprungkraft verlagert sich nach dem Eingriff stärker auf die Hinterbeine. Und die elenden Schmerzen hören auf, wenn der Unterleib ein Hindernis streift.
Dass Chantilly auch über eines der bekanntesten Zentren verfügt, um hochkarätigen Nachwuchs heranzuziehen, wie einleuchtend. Wer 14 ist, 140 Zentimeter misst und 36 Kilo wiegt, besitzt die besten Voraussetzungen um fünf, zehn, fünfzehn Jahre später in Longchamp zu gewinnen.
Klar, immer nur einer gewinnt, und die vielen anderen satteln eines Tages um auf »maréchal-ferrant«, Hufschmied, oder »headlad«, Oberstallknecht, oder schaffen es nur zum »second-class jockey«, der sich mühselig in der Provinz die Miete ersprintet. Dennoch, sie alle haben Glück.
Denn rechts, gleich neben dem Eingang der Schule, steht das Atelier Epona: nach der keltischen Göttin und Beschützerin der Pferde und Reiter. Der Name führt in die Irre. Die hier arbeiten, hat niemand behütet. Irgendwann fielen sie herunter, um als Behinderte weggetragen zu werden. Das ist ein schneller Beruf. Wer dabei aus dem Sattel fliegt und Pech hat, knallt im Sturzflug ins Elend.
Der Rundgang strengt an. Luc, einer von 27, schildert mit ruhigen Worten sein Schicksal. Dass er jetzt als Hinkebein in die Nähmaschine treten muss, er will es noch immer nicht fassen.
Zurück im Büro, erzählt uns der Leiter der Werkstatt, dass viele den Absturz psychisch nicht überleben. Weil Depressionen sie heimsuchen und sie den kümmerlichen Lohn versaufen.
Die Erinnerung an Lucs Gesicht wirkt umso bedrückender, als ich 48 Stunden später in die Augen eines Siegers blicke. Tolle Augen. Auch sie besoffen. Aber vom Rausch des Glücks und einer unbeschreiblichen Erfahrung. Hier in Longchamp, vierzig Kilometer und eine Welt weit weg vom Jammer der anderen.
Sonntag, den 4. Oktober, ist es soweit. Im Bois de Boulogne, am westlichen Stadtrand von Paris, erwartet Europas nobelste Rennbahn die rasantesten Pferde, die berühmtesten Jockeys, die steinreichsten Männer, die formschönsten Frauen, die gerissensten Spieler, die notorischsten Verlierer, die schillerndsten Angeber.
Alles blitzt, der Bürgermeister hat sogar die Prostituierten, weiblich wie männlich, aus dem umliegenden Gebüsch vertreiben lassen. Fernsehteams drängeln. Hunderte Kanäle werden das Rennen weltweit übertragen. Noch ein Rekord. Der Arc de Triomphe schlägt jeden: den »Breeder’s Cup« in Chicago, das »Derby« in Epsom, das »Grand National« in Liverpool. Die Kroaten schauen zu, die Singapurer und – falls sich im Wüstensand jemand findet, der einen Fernseher besitzt – schwarze Menschen in der Sahelzone.
Heute ist alles vergessen. Die dramatischen Wehklagen, von denen in Chantilly zu hören war: die morose Wirtschaftslage, die irrsinnigen Unkosten für Züchter, Trainer und Besitzer, der Zuschauerschwund, der desolate Zustand vieler der knapp 300 Hippodrome im Land, die Übermacht arabischer und japanischer Ausländer, die mit Geldkisten den Pferdehandel ruinieren, der gefräßige Staat, der von jedem gewetteten Euro seine (dicken) Prozente kassiert.
Jetzt kein Wort mehr davon. Zu heftig ist die Erregung, zu unaufhaltsam die Lust. Eine Klimax naht. 35 000 ganz nah und Hunderte Millionen so fern schauen zu. Das Adrenalin peitscht, vertreibt die lästigsten Nebengedanken.
Hektischer Betrieb. Haufen von Geld stehen auf dem Spiel. Unzählige Wettschalter verführen. Ein kleines Schild davor gibt Auskunft: zwei Euro Minimum für die armen Schlucker. Zweihundert Mindesteinsatz für die Protzer. Über Bildschirme wird laufend die Veränderung der Quoten bekannt gegeben. Franzosen lieben das Prickeln des Wettens, die meisten von ihnen »font le papier«, studieren die Fachblätter, erfahren die letzten Ergebnisse, lesen über die Tagesform, den Stammbaum, die Triumphe, das Gestüt, die Bodenverhältnisse, die Prognosen.
Diesmal ist »Magic Night« Favorit. Bei ihm, so wissen es alle, stimmt alles. Seit Wochen hat er die beste Presse, und die Mehrheit der Experten prognostiziert seinen Sieg.
Das staatlich kontrollierte Wettgeschäft gilt als sauber. Buchmacher wie in England sind verboten. Eine Mafia, die groß angelegt Pferde und Reiter einkauft, gibt es nicht. Schiebereien in der preisgeldbescheidenen Provinz, bei denen ein Besitzer dem anderen Besitzer vorschlägt, an diesem Nachmittag zu verlieren, um hinterher den Gewinn zu teilen: Natürlich, das passiert.
Alles vom Erlesensten. Longchamp fungiert auch als Weltmeisterschaft der Eitelkeiten. Nur CIGA sponsert. Das Unternehmen mit den mondänsten Hotels. Siehe Danieli in Venedig, siehe Imperial in Wien, siehe Excelsior in Rom. Raststätten für Großgrundbesitzer. Pierre Cardin, der Pariser Modeschöpfer, hat Susan, Olga und Lisa geschickt, seine drei Mannequins aus Amerika, Russland und der Schweiz. Damit sie seine »créations« herumtragen und sich beim Siegerfoto als bildschöne Staffage dazustellen. Ein eigens für die Veranstaltung gezaubertes »Eau de Triomphe« wird exklusiv, versteht sich, zum Verkauf angeboten. Das »Restaurant panoramique« – sechs Monate vorher ausgebucht – sollte man nur betreten, wenn man den leichtsinnigen Umgang mit Banknoten gelernt hat.
Um 16.30 Uhr ist es zu spät. Die Sirene dröhnt. Nichts geht mehr. Alle Einsätze, alle Hoffnungen, alle Wünsche sind ab sofort unwiderruflich. Der Pulk der 18 Pferde rast los. Die Rennen davor waren nur Vorspiel. Tonnen von Geld sind nun im gestreckten Galopp unterwegs. Wer im Arc de Triomphe über die klassische Distanz von 2400 Meter gewinnt, wird noch berühmter, hat ein Weltmeisterpferd, streicht als Besitzer über eine halbe Million Euro ein, als Trainer weit über 100 000 und als Jockey fette 50 000. Nicht zu vergessen die jeweils anfallenden (sechsstelligen) Beträge für den Siegergaul als künftigen Zuchthengst.
Ganz oben stehen die Champagnerkübel, unten im Erdgeschoss der Tribüne liegen die Bierflaschen. Als die Pferde in die Zielgerade jagen, setzt ein orgiastisches Geheul ein, so schrill, frenetisch und befreiend, dass man bedauert, wenn um 16.37 Uhr und 39 Sekunden alles vorbei ist. Die langen Gesichter der Verlierer schauen beleidigt auf die Veitstänze der siegreichen Tipper. Magic Night hat haushoch verloren.
Trotzdem, Frankreich feiert. Der Champion heißt »Subotica« und ist wie der Züchter, der Trainer, der Besitzer, der Jockey und der erste Stallknecht reinrassig französisch. Die Marseillaise erklingt, erzfranzösisch. Die einzigen Nichtfranzosen sind die Musiker von der Fremdenlegion, die sie spielen. Ausländische Gauner aus Ost und West. Die Hälfte von ihnen wird von der Polizei gesucht. Wie belanglos. Sanft und selbstbewusst klingt es über Longchamp.