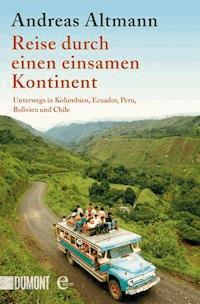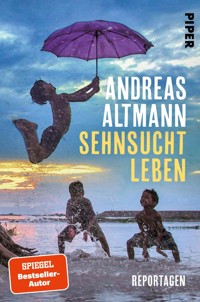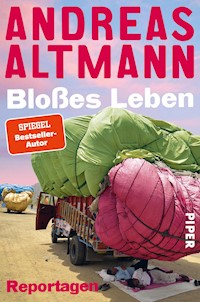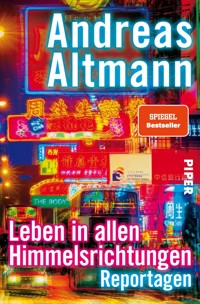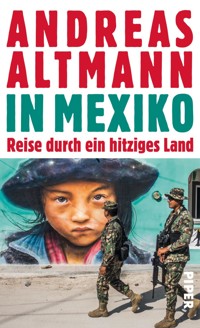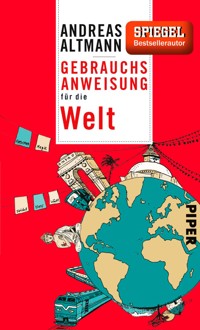13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Andreas Altmann verlässt im Sommer 2003 seine Wohnung in Paris. Im Gepäck 2,77 Euro, ein paar Salamischeiben, zwei Dutzend Zigarillos, Schlafsack, Kompass und ein Taschenmesser. Sein Ziel ist Berlin, sein fester Wille, den Zeitgenossen, die er auf seiner Fußreise trifft, ein paar Storys und ein wenig Geld zu entlocken. Wird er gastfreundlich bewirtet, bestens, hat er nichts zu essen, muss er hungern, wird er zum Übernachten in ein Haus eingeladen, warum nicht. Meist schläft er aber unter freiem Himmel oder sucht in großen Städten nach Notunterkünften. Altmann ist in erster Linie ein Geschichtensammler, der Menschen zum Reden bringt, der hinsieht und zuhören kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.malik.de
Für Athina,
la sauvage,
die Scheue,
die Wilde
Für Walter R.,
den König von Österreich
Mit 27 Farbabbildungen und zwei Karten
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen ungekürzten Taschenbuchausgabe
4. Auflage Februar 2012
© Piper Verlag GmbH, München 2004
Redaktion: Karl-Heinz Bittel, München
Umschlaggestaltung: Dorkenwald-Grafik-Design, München
Umschlag- und Bildteilfotos: Andreas Altmann
Kartografie: Eckehard Radehose, Schliersee
Satz: Sieveking GmbH, München
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Und die Welt ist weit und wild und noch immer verhandelbar.
Terence, ein New Yorker Obdachloser
Einer der die Nähe sucht der andere das Weite.
Thomas Brasch
It’s better to burn than to fade away.
Neil Young
Vorwort
Wer in den Zoo geht und ein Krokodil betrachtet, betrachtet Mitteleuropa. Wohl genährt, träge und bewegungslos liegt es da. Schon erledigt vom pausenlos guten Leben, ist ihm der Hunger nach Aufregungen vergangen. Deshalb stehen in vielen Städten Türme herum, von denen die Ruhelosesten in die Tiefe springen. Kein Reiseversicherungspaket begleitet sie nach unten, um heil davonzukommen. Nein, nur ein Bungee-Gummiband verspricht letzte Rettung. Unglaublich, welche Kraftakte man auf diesem Erdteil unternehmen muss, um sein Herz noch schlagen zu hören.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um den Anwürfen der Verdummung, der Komfortsucht und dem Wunsch nach einem harmlosen Dasein zu entrinnen. Ich hatte Glück, ich saß in meinem Pariser Café und blätterte in einer Illustrierten. Auf einer Doppelseite Werbung sah ich einen Mann vor der Glaswand eines Schaufensters stehen. Er betrachtete einen funkelnagelneuen Sechszylinder, Text darunter: Désir, Sehnsucht. Ich wusste augenblicklich, dass mich andere Sehnsüchte jagen. So kam mir die Idee, von Paris nach Berlin zu marschieren. Immer zu Fuß und immer ohne Geld.
Ich ahnte, dass diese Art, mich fortzubewegen, meinen Leib herausfordern, ihn plagen und piesacken würde. Gleichzeitig bekäme ich täglich, ja stündlich das euphorische Gefühl vermittelt, dass er (der Leib) vorhanden ist und zu mir gehört. Dass ich am Leben bin, dass ich existiere. Zudem kämen mir, hoffentlich, Gedanken in die Quere, von denen ich vorher nichts wusste. Gedanken, die mein Weltwissen bereichern, Gedanken, zu denen mich nur die 1100 Kilometer führen würden.
Das abenteuerleere Mitteleuropa – hier preisen sie das Betreten eines Kaufhauses als shopping adventure – versprach nur noch dann Gefühle, wenn ich mir Gewalt antat. Der Erdteil selbst tat es nicht, ich musste es selber tun. Deshalb gehen und betteln. Die Entscheidung fiel umso leichter, als ich in der Tradition des jüdisch-christlichen Abendlandes erzogen worden war. »Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen«, der Satz leuchtete mir auf Anhieb ein. Ich blieb immer das Gegenteil des eleganten, nie verschwitzten Hallodris, ich war immer Arbeiter, Schwitzer, Sünder.
Um mir Mut zu machen, erzählte ich ein paar Freunden von dem Vorhaben. Statt mich anzufeuern, gaben sie mir den Rest und versprachen ein baldiges Scheitern. Nach spätestens zwei Wochen würde ich im Straßengraben darben, verhungert, verdurstet. Oder überrollt von Männern hinter dem geheizten Lenkrad ihrer Sechszylinder. Ich hörte nicht hin, ich glaube nicht an das Böse, ich glaube an das Böse und Gute.
Es gab noch einen zweiten Grund, warum ich andere über das Projekt informierte. Ich brauchte Zeugen. Damit ich in schwachen Augenblicken an sie denke und mir ihr Gelächter vorstelle, wenn sie erführen, ich hätte aufgegeben. Diese Aussicht versperrte jeden Fluchtweg. Es gab nur losgehen und ankommen. Ein anderes Ende kam nicht in Frage.
Mit einfachen Gesten habe ich mich auf die Reise im Sommer 2003 vorbereitet. Ich lernte, mich nass zu rasieren, ich las die Bücher früherer Wanderer, ich ließ mich gegen Zecken impfen. Und ich fing an, jedem Pariser Schnorrer, dem ich begegnete, einen Euro zu geben. Um der Gerechtigkeit auf die Sprünge zu helfen. Bald würde ich selber schnorren, da konnten ein paar gute Taten meinerseits nicht schaden. Natürlich ist das scheinheilig, trotzdem, ich glaubte daran.
Der letzte Punkt war der heikelste: Einsamkeit üben. Sich im Kopf daran gewöhnen, dass man verdammt allein sein würde. Grundsätzlich bin ich nicht unbegabt für solche Zustände, aber ein zusätzliches Training konnte nicht schaden. »Die Kraft sitzt im Herzen«, meinte Floyd Patterson. Er war Boxweltmeister, er musste es wissen.
Der Marsch sollte durch vier Länder gehen, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Deutschland. Zuerst der Westen der Bundesrepublik, dann der Osten. Dass 1990 eine Wiedervereinigung stattfand, hat sich auch bis in die französische Hauptstadt herumgesprochen. Aber dass die beiden Teile so erstaunlich verschieden blieben, so verschieden eben wie zwei sich ferne Länder, das sollte ich noch erfahren. Beim Wandern, beim Handaufhalten, beim Einsammeln von Storys.
Was ich mir vorher innig wünschte, war am Ziel Gewissheit. Das träge Krokodil erwacht viel intensiver zum Leben, wenn man es ohne Kreditkarte und Sechszylinder besucht. Nähe entstand. Überraschungen passierten, ja Wärme brach aus. Genug jedenfalls, um die Wichtigmacher, die Kalten und Verstockten auszuhalten. Klar, auch sie standen am Weg. In Berlin war ich dankbar für jeden. Einmal mehr hatte ich begriffen, dass Geschichten heilen. Die guten, die bösen, sie alle erklären für einen Augenblick die Welt.
Elfter Juni
Gestern, so sagen jene, die ohne Zahlen nicht leben können, ging die Sonne zum 1825 Milliardsten Mal auf. Als ich ein Kind war und die größte Ziffer herausfinden wollte, schrieb ich auf ein Din-A4-Blatt lauter Neunen. Und Robert, mein Freund, schrieb daneben: »Und eins.« Robert war klüger als ich. Er hatte bereits begriffen, dass ein schnelles Ende nicht zu erwarten ist. Als ich um 6.14 Uhr die Haustür hinter mir schließe, denke ich an den Zwölfjährigen. Zum 1825 Milliardsten und ersten Mal geht die Sonne heute auf. Ich sehe in ihr Gesicht und fürchte mich. Seit Tagen glüht der Himmel.
Stiller, klarer Morgen, Paris s’éveille, Paris erwacht. Zwei Straßenkehrer öffnen einen Gully, Wasser spritzt, die Sonne leuchtet auf ihre schwarze Haut. Wir kennen uns flüchtig, noch nie haben wir miteinander geredet. Keiner von uns lächelt.
Nach dreizehn Minuten lege ich den ersten Pump an. Ich mag den Ausdruck, er steht bei Henry Miller, der zehn Jahre in Paris gelebt hat und bisweilen die Hand ausstrecken musste, um über den Tag zu kommen. Ich muss umgehend lernen, mich zu überwinden. Und die Scham auszuhalten, das Ausgeliefertsein, das ranzige Mitleid.
Als Anfänger betrete ich die erste Bäckerei und sage »Guten Morgen« und »Haben Sie etwas altes Brot für mich, bitte?« Die Bäckerin interessiert nicht einmal mein Bonjour, sie antwort »non« und wendet sich ab. Zwei weitere Pumps gehen daneben, das dritte Weib wirft mir noch die Moralkeule hinterher: »on n’a rien sans peine«, ohne Fleiß, kein Preis.
Frühbegabte sehen anders aus als ich. Aus drei von Kuchen und zwanzig Brotsorten überquellenden Läden hole ich nicht einen Zipfel. Immerhin lehren sie mich von Anfang an, was es geschlagen hat: Niederlagen zu verkraften.
Ich mag keine Verlierer. Noch weniger ertrage ich die pausenlosen Sieger. Ich will zu denjenigen gehören, die bauchlanden und wieder abheben.
Nach einer halben Stunde verlasse ich Paris. Nichts könnte der Stadt gleichgültiger sein. Keine vierzig Minuten sind vergangen, und eine erste Depression nagt. Jeffrey fällt mir ein. Ich merke, dass mein Hirn nach Erinnerungen sucht, die mich nähren, wenn es sein muss, peitschen: Richtung Osten, Richtung Berlin. Habe ich Glück, dann treffen in meinem Kopf die richtigen Bilder und Gedanken ein. Mit ihnen könnte ich es schaffen.
Jeffrey war ein homeless bum, ein obdachloser Nichtstuer, der ruhelos vor dem Haus, in dem ich in New York wohnte, auf und ab rannte. Als ich ihn nach dem Grund für seine Ruhelosigkeit fragte, meinte er: »Walking off my anger«, mir den Ärger aus dem Leib treten. Jeffrey tut gut, ich gehe schneller, will wütend sein wie er.
Durch Montreuil, die erste banlieue, den ersten Vorort. Banlieue ist ein sinniges Wort: »Bannmeile«, hier stranden jene, die es nicht nach Paris geschafft haben. Schon haben die Arbeitslosen auf den Terrassen der Cafés Stellung bezogen und richten sich ein für den Tag. Hier zahlen sie nicht für den Kaffee, hier zahlen sie für die Möglichkeit, möglichst lange hocken bleiben zu dürfen. Einer feilt mit einem Bimsstein die Nägel, einer redet mit sich selbst, einer bohrt in der Nase, bis das Blut den Zeigefinger herunterfließt.
Die nächsten drei Bettelgänge folgen. Ein Metzger schaut immerhin nach, ob irgendwo eine Wurst von vorgestern herumliegt. Rien, alles schon in der Mülltonne. Nicht, dass er auf die Idee käme, mir eine frische anzubieten. Ein Apfel aus einem Obstladen? Von wegen. Ich hole einen Mann mit zwei Baguettes auf der Straße ein. Ob er mir ein Stück abtreten könne? Kommt nicht in Frage, das Brot gehöre ihm nicht. Ich frage einen vierten Mann nach dem Weg, ich will ins drei Kilometer entfernte Neuilly-sur-Marne, er sagt: »Das ist aber weit.« Er ist der Erste, der lächelt. Das erste Geschenk der Reise. Wie dankbar ich bin. Ich ahne, dass das Lächeln eines anderen mich ebenfalls nähren wird. Gerade dann, wenn nichts anderes den Hunger stillt.
Ich komme an einer Bushaltestelle vorbei, wo eine schöne Afrikanerin wartet. Eine Stelle aus Nelson Mandelas Autobiographie fällt mir ein, »Der lange Weg zur Freiheit«: Mandela beschreibt, wie er als junger Rechtsanwalt eines Morgens mit seinem Wagen an einer Endstation in Johannesburg vorbeikam und eine Frau bemerkte, die dazzling beautiful aussah. Die aufwühlend Schöne war Winnie, die bald darauf seine Frau werden sollte. Was wird aus der schönen Afrikanerin werden? Wird ihr der Himmel einen Mann wie Mandela schicken? Oder wird sie in Montreuil verwittern, alle Schönheit loswerden an der Seite eines Blinden, der nicht jeden Morgen das Lied ihrer Schönheit anstimmt?
Ich bin froh um die Assoziationen, die mir durch den Kopf schießen. Was lässt sich sagen über Vororte? Dass sie hässlich wie ein Kropf sind? Wer wüsste es nicht längst. So wäre die erste Entdeckung beim Gehen: Die Neuronen flitzen noch schneller, Gedanken sprudeln, das Hirn hat ein gesteigertes Bedürfnis nach Selbstgesprächen. Womit das genaue Gegenteil von dem passiert, was die Ergriffenen gerne berichten: Das Sprudeln legt sich, die Hirnströme verlangsamen sich, die Gedankenblitze werden rarer, Ruhe kehrt ein. Die Ergriffensten begegnen am Ende gar Gott. Beneidenswert.
In Fontenay-sous-Bois. Ich frage nach der Richtung, und einer weist sogleich nach vorne: »Nehmen Sie den Bus!« Die Stimme klingt eher barsch, so als ob Gehen eine unanständige Beschäftigung wäre. Seltsam, sie ist eine Form von Bescheidenheit und scheint gehörig zu irritieren.
Um 7.59 Uhr ist es so weit, jemand beschließt, mir Gutes zu tun. Ich betrete die Bäckerei Au Levain, zum Sauerteig, und die Frau Bäckerin öffnet eine Schublade und holt sechzehn Teile eines bereits zerkleinerten Baguettes heraus. Sie lächelt sogar. Der Herr Bäcker kommt auch, lächelt ebenfalls, beide erklären freundlich den nächsten Kilometer. Hinter dem zweiten Eck, als ich zu essen anfangen will, wird klar, dass ich vergessen habe, nach der Beißzange zu fragen. Um die harten Brocken mundgerecht zu zerkleinern. Ich finde einen Brunnen, halte die Steine unter das fließende Wasser, um sie aufzutauen. Bis jemand auf das Schild zeigt: Kein Trinkwasser! In der Kirche gegenüber frage ich nach dem Secours catholique, der Caritas im Lande. Ich finde die nahe Tür, aber der Eingang zum Sankt-Martin-Saal ist heute geschlossen. Ab diesem Augenblick weiß ich, dass man nur an bestimmten Tagen Hunger in Frankreich haben darf.
Zwei grundverschiedene Ausgangspositionen: Einer bettelt, weil er es bitter nötig hat. Und einer bettelt, weil er dafür bezahlt wird. Von seinem Verleger. Die Motive sind verschieden, die aktuelle Wirklichkeit ist die absolut gleiche: Wir beide hungern, wir beide sind Bittsteller und müssen uns ausliefern. Und mit dem Ergebnis fertig werden. Dem Hunger des einen wie dem Hunger des anderen ist es völlig egal, wie es zu dem beißenden Gefühl kam. Es beißt. Und das muss aufhören.
Weiter durch die Vorstädte, eine nach der anderen, in jeder wird man von der elenden Vorstellung heimgesucht, hier leben zu müssen. Wie privilegiert ich bin, ich muss nur ein einziges Mal hier durch.
Neuilly-Plaisance, ich bettle zum neunten Mal, ich bitte einen Mann um einen Euro. Er ist gut vorbereitet, er sagt: »Geht nicht, ich bin arbeitslos.« Ich komme an Plakaten vorbei, die niedliche Haustiere zeigen: Campagne nationale contre les abandons, Kampagne gegen das Aussetzen von Hunden und Katzen. Sicher von Brigitte Bardot finanziert, die vor Tagen ein Buch veröffentlicht hat, in dem sie sich als Menschenhasserin und Tierfreundin outet. Ein Mann torkelt vorbei, lehnt sich an eines der Plakate. Er ist zu betrunken, um die Ironie der Situation zu erkennen. Aufrufe, sich um Männer zu kümmern, die, aufgegeben von allen, auch von sich selbst, durch Neuilly-Plaisance torkeln, finde ich nicht.
Um 12.22 Uhr mache ich eine erste Pause, in Chelles. Mit dem Taschenmesser zerlege ich die Baguette-Klumpen. Ich rutsche ab, die Klinge fährt in meinen rechten Daumen. Ich sauge das Blut aus der Wunde. Was mir seltsamerweise das Gefühl von Geborgenheit verschafft, von weniger Verlassensein. Aus dem Rucksack hole ich den mitgebrachten Proviant, die Reste aus meinem Kühlschrank. Ein Reflex aus Kindertagen, ich kann, ich darf nichts wegwerfen. Diese altmodische Ehrfurcht bin ich bis heute nicht losgeworden. Brot ist heilig, basta.
Der andere Grund für das Mitnehmen der sechzehn Salamischeiben und drei Äpfel war meine Mutlosigkeit. Den ersten Tag der Tour wollte ich behutsam beginnen. Ich ahnte bereits, dass mir keiner Kalbsfilets und Schinken-Sandwiches nachwerfen würde. Und dass ich ein paar Stunden Schonfrist einfordern dürfte. Um die Kunst des Bettelns zu üben, um den rechten Ton zu finden, jene Sprache, die verführt und weichspült.
Auf der anderen Straßenseite steht ein Supermarkt. Ich habe mir den Platz ausgesucht, um mich zu quälen, um möglichst früh mit den Härtetests zu beginnen. Ich sehe wohlgenährte Männer und Frauen vorfahren, im Geschäft verschwinden und mit vielen Taschen wieder herauskommen. Wahrhaft beneidenswert leuchten ihre Gesichter. Die Aussicht, immer wohlgenährter zu werden, scheint sie zu erheitern.
Weiter. Weiterpumpen. Auch den Alten in Vaires-sur-Marne überrede ich nicht, er schwindelt: »Ich habe meine Börse zu Hause gelassen.« Ein vergesslicher Tropf, den Weg weiß er auch nicht, aber die nächste Haltestelle, die schon. Ich verstehe das Insistieren auf ein öffentliches Verkehrsmittel jetzt anders. Da es oft keine Bürgersteige gibt, will der Mann mir helfen, am Leben zu bleiben. Mit der Flucht in einen Bus.
Was sich ebenfalls wiederholt: das Erstaunen, das bisweilen leichte Entsetzen in den Gesichtern, wenn klar wird, dass ich tatsächlich zu Fuß in den nächsten Ort will. Sie reagieren, als sollten sie mir die Abzweigung nach Wladiwostok zeigen.
Am Ende aller Vororte marschiere ich auf der Nationale 34 weiter. Vorschriftsmäßig und aus Liebe zum Leben gehe ich am äußersten linken Rand und erkenne sofort meinen Todfeind: den Autofahrer. Ich habe das gleiche Recht wie er, die Straße zu benutzen. Aber er will nichts wissen von diesem Recht, ein ungleicher Kampf beginnt.
Um 12.35 Uhr betrete ich ein Restaurant und begegne dem zweiten Großzügigen an diesem Tag. Nach den sechzehn Baguette-Brocken gibt es jetzt zwei Glas Wasser. Ich trinke mit Bedacht und vermeide heftige Bewegungen, denn hinter der Theke bellen die zwei angeketteten Hunde. Zu jedem französischen Patron, ob Restaurant oder Café, gehört ein Hund. Das ist ein Klischee und immer wahr.
Mir dämmert, dass reinkommen und betteln nicht reicht. Vielleicht reichte es früher. Der Panzer, die tägliche Verhornung, der zähe Wille, den Besitzstand bis auf den letzten Nagel zu retten, verführt nicht zum Spenden. Ein Desaster muss wohl her, um uns wieder an die eigene Menschlichkeit zu erinnern.
Um halb zwei in Lagny-sur-Marne, Endstation für heute. Im Rathaus bekomme ich die Adresse des Secours catholique. Ich finde sie, bin aber zu früh, erst um 14.30 Uhr wird geöffnet. Zwanzig Schritte weiter gibt es einen Parkplatz für Behinderte. Der wurde für mich eingerichtet. Ich deponiere meine Füße dort. Nach den ersten 36 Kilometern Gehen haben sie zu ihrer Hauptbeschäftigung gefunden: vor Schmerzen zu schreien. Ich sitze, und sie schreien.
Pünktlich wird geöffnet. Die freiwilligen Helfer, meist ältere Damen, sind ohne Herablassung, auch ohne die Herablassung des Gutmenschen, der ununterbrochen mitfühlende Blicke auf die leidende Kreatur wirft. So will auch ich freundlich sein und bin die nächsten dreißig Minuten ein anständiger Katholik. Ein Dossier wird über mich angelegt, sie fragen sacht nach meiner Geschichte. Im Gegensatz zu Michael Holzach, der in seinem feinen Buch Deutschland umsonst von den Skrupeln berichtet, sich als armer Schlucker zu präsentieren, obwohl er kein armer Schlucker ist, ja schlimmer, hinterher – für Geld – darüber schreiben wird, im Gegensatz zu ihm bin ich skrupellos. Weil ich als aufrechter Wahrheitsapostel überall hinausflöge. Nur als Elender habe ich ein Recht, hier aufzutreten. Erzählte ich von meinem Projekt, wäre ich draußen. Die schmalen Ressourcen sollen den echten armen Schweinen zuteil werden, nicht einem Reporter, der gern Bücher schreibt. Außerdem spiele ich gern, ich habe mich schon immer gelangweilt, wenn ich zu viele Tage hintereinander derselbe sein musste. Drittens: Wer gut zu mir ist, verdient eine Geschichte. Sie ist mein Anteil, sie ist ein Akt der Freundlichkeit. Weil ich mir Mühe mache und dem anderen damit eine Freude bereite. Zuletzt: Erwähnte ich den Buchvertrag, jeder Zuhörer würde sich umgehend anders benehmen. Diese Information würde wie eine Kamera wirken, die Reaktion des anderen wäre nicht mehr seine natürliche, sondern die Reaktion eines Menschen, der eine Linse auf sich gerichtet fühlt.
Ich erfinde eine heikle Herzoperation, die ich überstanden habe. Und den geleisteten Schwur, hinterher aus Dankbarkeit von Paris nach Berlin zu wandern. Zu Fuß. Und ohne Geld, da der lange Krankenhausaufenthalt mich ruiniert und aus der Bahn geworfen habe, ich erst wieder zu mir und einem Neubeginn finden müsse.
Die Geschichte kommt an. Jeanne d’Arc war auch in dieser Stadt, feste Schwüre lassen auf einen festen Charakter schließen. Nach der Protokollaufnahme nehme ich im Wartezimmer Platz. Acht Personen sitzen schon, Weiße, Schwarze, Araber. Kaffee und Plätzchen werden auf den Tisch gestellt. Instinktiv führe ich mich auf wie ein Kamel, das die Oase erreicht hat. Ich trinke fünf Tassen und esse ein halbes Kilo Kekse. Auch die Kekse, die alle anderen liegen lassen. Ich will den Höcker füllen für Notzeiten.
Das stille Zimmer, keiner redet, Armut macht nicht leutselig. Nur einmal läutet das Handy von Dominique, er ist arbeitslos und ohne Bleibe. Ein abwegiges Bild. Ein Habenichts mit einem Gerät in der Hand, das noch vor kurzem als Insignie des Wohlstands galt. Bei Dominique ist es genau umgekehrt, er hat nichts, aber ein Telefon. Es soll die Verbindung herstellen zum Wohlstand, zur Arbeit, zur Wohnung, zur Rückkehr ins bürgerliche Leben.
Ein Prospekt liegt aus, da steht: »Wir fordern Respekt gegenüber jedem, ungeachtet seiner Hautfarbe, seines sozialen Status, seiner Religion. Wer seinen Enthusiasmus und seinen Humor bezeugen will, bitte bei uns melden.« Secours catholique betreibt auch einen kleinen Friseurladen. Das ist sehr französisch und sehr bewegend: die Einsicht, dass zur menschlichen Würde ein gepflegtes Aussehen gehört.
Man ruft meinen Namen, bittet mich in den Hinterhof. Damit kein Neid entsteht, die anderen sollen nicht sehen, was sie einem Mann alles mitgeben, der nur en passant hier vorbeikommt: Zwei Plastiktüten, prall gefüllt mit 375 Gramm Cornflakes, 350 Gramm Linsen, 125 Gramm Schokolade, einer Flasche Sprite, 28 Teebeuteln, einer Thunfischdose (80 Gramm), zwei Dosen Bauernpastete (je 78 Gramm), einer Dose mit Sardinen (69 Gramm), einer Dose Erdnüsse (160 Gramm), einem Liter Milch. Mit einer Verbeugung wische ich durch den Hinterausgang.
Nur in der deutschen Sprache gibt es das Wort »Vorfreude«. Die mich jetzt antreibt. Auf der Place de la Fontaine, dem Zentrum der hübschen Stadt, hat der Bürgermeister ein paar Bänke aufstellen lassen. Er soll hochleben. Ich lasse mich nieder und ziehe als erstes die Stiefel aus. Seit heute Nachmittag weiß ich um die zwei entscheidenden Vokabeln dieser Reise: gehen und essen. Kann ich gehen? Kann ich essen? Der Rest ergibt sich von selbst.
Ich esse und schaue mir zu. Weil ich mich an eine baglady in Greenwich Village erinnere, die rastlos mit dem Neuarrangieren ihrer bags, ihrer Tüten, beschäftigt ist. Weil alles wieder ausgepackt werden muss, um ein bestimmtes Teil zu finden. Und nach dem Einpacken wieder alles hervorgekramt werden muss, weil man ein anderes Teil vergessen hat. Ich bin diese Alte, denn ich kapiere schnell, dass dieser Aktionismus einen unschätzbaren Vorteil hat: Er hilft beim Zeitschinden. Meine Füße haben heute kein Interesse mehr an Erfahrungen, sie wollen regungslos den Rest des Tages hinter sich bringen. Nach der Pastete, den Sardinen und den Erdnüssen rauche ich. Auch die sechsundzwanzig Zigarillos habe ich aus meiner Wohnung gerettet. Auch sie sind ein Zeichen von Schwäche, ich weiß.
Irgendwann schaffe ich die hundert Meter bis zur Eglise Notre Dame des Ardents. Ich liebe Kirchen. Wenn sie leer sind und dämmrig und durchzogen vom Geruch vieler Kerzen. Im Jahr 1127 hat die Heilige Jungfrau das Dorf vom mal des ardents gerettet, einem Zustand, der zu Wahnvorstellungen und Krämpfen führen kann. Im großen Buch stehen die vielen Bitten der Gläubigen: »Unternimm was, damit ich den rechten Weg finde!« und »Bring das geliebte Wesen zurück an meine Seite!« und – von Joëlle, leicht genervt – »Mach was!« Viele Rechtschreibfehler in den stürmischen Bitten, ich blättere von vorn nach hinten, aber um Rechtschreibhilfe bittet niemand.
Drei Meter von dem Pult entfernt kniet eine Frau. Flüsternd bewegt sie ihre Lippen, ein Dutzend Kerzen schimmern auf ihr Profil. Der Kopf eines intelligenten Menschen, vielleicht Mitte vierzig. Ich höre die Stimme von Erzengel Gabriel und die Stimme des Satans in mir. Der eine sagt, tu’s nicht, der andere wiegelt mich auf. Ich kämpfe mit mir. Und verliere. Weil ich jetzt wissen muss, was hier vor sich geht. Ich nähere mich der Betenden und frage, was sie so selbstvergessen hinauf in den Himmel schickt. Die Neugier sei ein Fluch der Götter, sage ich noch entschuldigend, aber ich kann sie nicht abstellen. Wieder wirkt die heiligste Jungfrau Gutes, denn die Versunkene lächelt. Und beginnt zu reden. Eine andere hätte mich zurückgefaucht, sie, Barbara, schenkt mir ihr Unglück.
Vor zwei Jahren ist sie von Paris hierher gezogen. »J’ai craqué«, ich habe durchgedreht. Ihre letzte Attacke überkam sie kurz vor dem Ortswechsel: Wegen eines Streiks rollten nur wenige Metro-Züge. Die randvoll waren. Barbara mittendrin, Abendverkehr. Irgendwann habe sie zum Schreien angefangen, überwältigt von Angst, Platzangst, Menschenangst. An der Haltestelle Concorde sei sie von Panik getrieben aus dem Waggon gestürzt. Ein paar hätten gleich angeschoben und sie hinausgedrängt. Aber ein junger Mann nahm sie bei der Hand und führte sie nach oben, an die Luft und weg von den Massen. Anschließend seien sie in ein Café gegangen, sie habe ein Glas Wein getrunken und sich irgendwann beruhigt. »Comme un saint dans une mer des brutes«, wie ein Heiliger im Meer der Rüpel sei ihr der Retter vorgekommen.
Dieser Auftritt war nur einer von vielen. Und nicht immer stand ein Gentleman in der Nähe. Ein paar Mal kam die Polizei oder die Ambulanz. Hier in Lagny geht es ihr besser, kleine Stadt, kleine Welt. Aber Barbara lauert auf die nächste Katastrophe. Es kommt ihr vor, als trüge ihr Körper eine Zeitbombe, nur wisse sie nicht, auf welchen Tag, auf welche Stunde die Uhr eingestellt sei. Deshalb kniee sie hier dreimal die Woche nieder und beginne zu flüstern. Damit die Jungfrau die Bombe entschärfe, damit diese Sturzwellen der Beklemmung aufhören.
Ich will auch Kavalier sein und nehme die schwitzenden Hände dieser unglücklichen Frau in meine. Ich bin nicht unglücklich, ich habe noch Kraft, vielleicht hilft ihr die Geste bis morgen früh. Als wir uns verabschieden, denke ich an den Teufel. Wie gut, dass ich auf ihn gehört habe. Er hat einen Riecher für Abgründe und die Untiefen des Lebens.
Die Hitze des Tages hat inzwischen nachgelassen. Wie die Nacht verbringen? Ich frage jemanden, wo man hier im Freien schlafen könne. Ein Park, ein verlassener Kinderspielplatz, irgendein stilles Eck? Der Mann denkt nach, sagt, unten entlang der Marne gebe es sicher eine Möglichkeit. Aber schwierig, denn »Zigeuner treiben sich in der Gegend herum«.
Ich gehe über die Brücke zum Fluss, Enten, Ruderer, die frühe Abendsonne, sehr friedlich. Zwei Bänke neben mir sitzt eine Gruppe Männer, der Jüngste steht und unterrichtet den Koran. Er führt das große Wort, die fünf anderen lauschen. »Allah hört und sieht alles«, höre ich. Während der Eifrige sich am Bart zupft und redet und immer neue Beispiele vom Allesseher und Alleshörer Allah vorbringt, geschieht etwas ganz Irdisches. Von der Brücke her nähert sich eine Frau, eine hübsche Frau. Und Allah und ich sehen, wie die sechs heimlich zur Seite schielen.
Wie beruhigend, dass eine weibliche Brust, obwohl zur Hälfte bedeckt, imstande ist, letzte göttliche Wahrheiten zu unterlaufen. Und mit nichts weiter, mit keinem Wort, mit keinem Versprechen auf Ewigkeit sechs gottesfürchtigen Männern für Minuten den Verstand raubt. Das ist ein wunderbarer Beweis, dass Schönheit wirklich ist und alles andere daneben kläglich auf der Strecke bleibt. Der Busen ist überirdisch wahr und die himmlischen Wahrsagungen nichts als Behauptungen.
Wie versöhnlich diese Szene auf mich wirkt. Weil ich wie viele zusammenzucke, wenn sie dem Gefasel eines Fanatikers begegnen. Der Auftritt der Schönen aber zeigt, dass das halbe Dutzend Bärtiger nicht anders ist als ich, als wir. Anrührbar von Sehnsucht, von Eros, von der Nähe einer Frau.
Das brave Lagny, um halb zehn überrede ich nochmals einen Cafébesitzer zu einem Glas Wasser. Die Straßen sind bereits leer, nur noch ein paar Angeber schneiden mit quietschenden Reifen die zwei schärfsten Kurven. Männer in Unterhemden lehnen am Fenster und blicken auf Straßen, auf denen so wenig passiert wie in den Wohnungen hinter den Männern in Unterhemden. Der Vollmond leuchtet, und irgendwo blinkt Brasserie, ein Mann lehnt an der Tür, es ist der Patron, er wartet, er wartet vergeblich.
Ich sitze auf den Stufen des Bahnhofs. Von Dominique habe ich erfahren, dass hier um 23 Uhr das Rote Kreuz vorbeikommt und Essen verteilt. Bald bin ich nicht mehr allein, andere Hungrige kommen, den roten Fusel (Beau soleil) unterm Arm. Drei torkeln ums Eck wie drei schlechte Schauspieler, die drei Betrunkene mimen. Aber das Trio ist stockbesoffen und schwankt trotzdem linkisch. Jemand hat ein Kofferradio mitgebracht, er sucht einen Sender, den er nie findet. Die anderen beschließen, noch ein Bier zu kaufen. Während der zähen Verhandlungen, wie das um diese Zeit noch zu machen sei, kommt die Ambulanz.
Zwei Männer und zwei Frauen steigen aus, alles Freiwillige. Für jeden von uns gibt es eine Suppe. Oder zwei. Verwöhntes Frankreich, selbst in der Runde dieser notorischen Verlierer fragen sie jeden höflich: »Quel parfum désirez-vous?«, welche Geschmacksrichtung wünschen Sie? Ich nehme eine Hühnerbrühe. Für die Zahnlosen steht auch ein Instant purée zur Verfügung. Ich frage Catherine, warum sie als Berufstätige nebenbei als guter Mensch von Lagny unterwegs ist. Sie, eher cool: »Ich halte es nicht aus, nur für mich zu leben. Ein Abend pro Woche gehört den andern.«
Nach einer Dreiviertelstunde fahren die vier weiter, zum nächsten Bahnhof. Wer nicht mehr gehen kann, auch wankend nicht mehr nach Hause finden würde, wird aufgeladen und abgeliefert. Mich liefert niemand ab, kurz vor Mitternacht mache ich mich auf die Suche nach einem Schlafplatz.
Zwölfter Juni
Entlang der Marne ist das Gelände zu steil, auch von allen Seiten einsehbar. Ich gehe zurück über die Brücke, finde einen Parkplatz, viele Autos stehen in der letzten Reihe, dahinter liegt ein Grasstreifen. Das sieht nicht schlecht aus. Ich muss schleichen, denn an der Einfahrt lungert eine Gruppe Jugendlicher neben den laufenden Motoren ihrer Autos. Sie trinken Bier und reden. Am Ende des Grasstreifens gäbe es einen Baum, er verspricht eine gewisse Intimität. Aber ich schaffe die sechzig Meter nicht, weil ein einparkender Pick-up meinen Fluchtweg bestrahlt. Ich ducke mich, will erst weiter, wenn der Besitzer und seine Beifahrerin verschwunden sind. Sie verschwinden aber nicht, lassen nur den Hund raus. Wahrscheinlich soll er irgendein Wagenrad anpinkeln. Das blöde Tier findet mich natürlich, schnuppert und zieht desinteressiert weiter. Ein kluges Tier, mit keinem Laut verrät es meine Anwesenheit.
Eineinhalb Stunden muss ich warten. Der Pick-up bleibt, die Jugendlichen bleiben. Vielleicht bereiten sie eine Mutprobe vor wie in dem Film »...denn sie wissen nicht, was sie tun«: James Dean und Corey Allen rasen in zwei Autos auf ein Kliff zu. Wer als Letzter vom Fahrersitz springt, ist der größere Held. Hier könnten sie auf die Marne lospreschen. Irgendwann wird mir klar, dass Nicholas Ray die Szene vor fünfzig Jahren drehte. Inzwischen steht mutig sein nicht mehr an erster Stelle. Vor Wochen konnte man lesen, dass die französische Jugend durchaus glücklich sei. Die Zukunft sehe so schlecht nicht aus. Vom Losrasen und todesmutigen Abspringen war nichts zu erfahren. Der berufliche Lieblingswunsch der glücklichen Jugend sei fonctionnaire: Beamter.
Um 1.35 Uhr haben die jungen Beamtenanwärter genug Bier konsumiert, sie räumen das Feld. Der Pick-up ist inzwischen auch verschwunden, in wenigen Sekunden bin ich am Ziel. Ich breite die Aluminiumfolie aus, krieche in den Schlafsack, schaue auf meinen Schrittzähler: 56.705 Schritte waren es von meiner Haustür bis unter den großen Baum.
Um 5.27 Uhr aufstehen, gerädert. Durch das totenstille Lagny gehen, überall hängen Plakate, sie zeigen ein großes Huhn, der dazugehörige Text: La vie. La vraie. Ein Huhn im Supermarkt zu kaufen, bedeutet das Leben, das wahre Leben. Schon frühmorgens ist die Hure Sprache unterwegs. Und hurt.
Bergauf, an jedem dritten Gartenzaun steht chien méchant, bissiger Hund. Ein Privatdetektiv bietet auf einem großen Schild seine Dienste an. Ich habe kaum geschlafen, die Neuronen sausen auch nachts, der Boden war hart, meine Hüften sind beleidigt. Heute ist der zweite Tag und ich bin verletzbarer als gestern. Ich denke an schöne Frauen, die mich vorbeigehen sehen, die Haustür öffnen und mich hereinwinken. Aber keine öffnet, keine winkt, stattdessen: chien méchant, chien méchant, chien méchant. Böse Hunde statt sanfter Frauen. Das wahre Leben, was ist das? Das tiefgekühlte Huhn im Supermarkt? Meine Träume? Mein zorniger Körper? Ein Satz unter einer Zeichnung des französischen Cartoonisten Sempé fällt mir ein: J’ai froid, j’ai faim, je veux de l’amour, mir ist kalt, ich habe Hunger, ich will Liebe.
Als ich die Stadt verlasse, zwingt mich der dichte Gegenverkehr, einen Meter links neben der Nationale 34 zu gehen, durch hohes Gras. Ich bilde mir ein, dass jeder mir zuruft: »Kehr um, du bist lächerlich, du hast keine Chance!« Ich hole die über Nacht wieder hart gewordene Schokolade hervor. Wenn schon keine Liebe, dann wenigstens den Ersatz für Liebe. Zwischendurch entsteht so etwas wie Glück, Glücksfetzen. Halbe Minuten lang gibt es kein Auto auf der Welt, sie ist dreißig Sekunden lang still und gefahrlos. Dann kommt der Krach zurück, wie eine Springflut tost die Blechlawine vom Horizont auf mich zu.
Ich träume von einem Gerät, das Laute in Lautlosigkeit verwandelt, eine Art Lärmschlucker. Der Apparat wäre eine Sensation, er sollte ähnlich effizient sein wie das Rohr, das sich rücksichtsvolle Gangster auf ihre Pistolen stecken und mit dem aparten Wort silencer beschreiben: Stille-Macher: ein Schalldämpfer eben, der sich kinderleicht auf zwei Menschenohren schrauben lässt. Diskret, formschön, in allen Farben.
Wandern oder wandern ohne Geld, da liegt ein Himmelreich dazwischen. Hätte ich Kreditkarten und Scheine dabei, könnte ich meinen Magen bei jedem Knurren auf die baldige Ankunft in einem Restaurant vertrösten, jenem magischen Ort, in dem ein guter Geist nach kurzem Wortwechsel in der Küche verschwindet und Minuten später Speis und Trank auf den Tisch stellt. Könnte bei jedem Schrei meiner Füße gedanklich ins abendliche Hotelzimmer fliegen und ihnen eine Badewanne versprechen, in der sie faulenzen und einschlafen dürfen. Könnte meinen beleidigten Hüften ein Bett in Aussicht stellen, das sie baumwurzelfrei willkommen heißt.
Nach zwei Stunden erreiche ich St-Germain-sur-Morin. Vor der ersten Ampel sitzen fünfzig einsame Männer und Frauen in ihren Autos und warten, bis sie weiterdürfen. Richtung Arbeitsplatz. Den sie fürchten oder hassen. Ihre Gesichter sind nicht eindeutig, nur eindeutig unglücklich. Die fünfzig bemitleiden mich sicher. Ich bemitleide sie auch, wir sind quitt.
Geht es mir schlecht, denke ich schlecht. Die Kleinstadt strengt an. Ich betrete drei Cafés hintereinander und bettle um nichts anderes als ein Glas Leitungswasser. Alle drei Besitzer des Wasserhahns reagieren unwirsch, das Glas verweigern sie nur aus Feigheit nicht. Einer sucht mit Bedacht das kleinste aus. Warum tut er das? Ich bin schweißgebadet, jeder sieht auf den ersten Blick, dass ich die letzten Tage auf keiner Beauty Farm verbracht habe.
Vor Jahren lief in Frankreich der Film Un monde sans pitié, eine Welt ohne Erbarmen, ich bin gerade mittendrin. Selbst schuld, ich habe meinen Charme überschätzt. Alle meine Freunde, aber wirklich alle, denen ich von meinem Vorhaben erzählte, hatten mich gewarnt. Vor der Gnadenlosigkeit der Welt, vor der Hartleibigkeit ihrer Bewohner, vor der Übermacht der Habgierigen. Ich war überrascht von dieser Sicht der Dinge, sie passte nicht in mein Menschenbild. Ich glaube an beide, an die Hartherzigen und die Warmherzigen. Aber vielleicht habe ich etwas versäumt, die Zustände sind wohl härter, unnachsichtiger, ja, unromantischer geworden. Inzwischen kennen wir den Neoliberalismus, den Börsenwahn, den Hanswurst, der den Satz »Geiz ist geil« erfunden hat.
Ich denke an den Patron meines Cafés in Paris, der jeden Bettler mit einem Befehl an der Tür abfängt: »Dehors!«, raus! Man kann Monsieur Alfred verstehen, weiß man doch, dass weniger Gäste kommen und konsumieren, wenn sie angeschnorrt werden. Und trotzdem, wie unmenschlich klingt das scharfe Wort.
Wäre ich Überlebensgenie Rüdiger Nehberg, ich hätte es leichter. Meine Magenwände bestünden inzwischen aus Panzerplatten. Alle fünf Kilometer würde ich einen überfahrenen Igel verspeisen und mit einem Holunderröhrchen die links und rechts liegenden Pfützen ausschlürfen. Vielleicht als Nachspeise noch einen Frosch goutieren, den ich vorher einer Ringelnatter aus dem Schlangenleib presste.
Ich will mir Zeit geben, der Charme wird kommen. Wie die Warmherzigen. Noch bin ich Anfänger, noch fange ich erst an mit der Kunst des Nichthabens, kenne noch nicht die Gesten und Töne, die einer braucht, um den andern zu beeindrucken.
Um 8.22 Uhr die erste Pause, außerhalb der Stadt. Ich habe noch immer Reserven von gestern. Ich bearbeite weiter das Steinbrot, dazu Bauernpastete und Linsen. Hinterher zähle ich die ersten Blasen. Sechs. Es gibt keine »richtigen« Stiefel, es gibt nur falsche Füße. Noch hat jeder, der einen Gewaltmarsch unternahm, spätestens am zweiten Tag hinauf in den Himmel geflucht. Als ich wieder aufstehe, stehe ich auf wie ein frisch Operierter. Bis zu diesem Augenblick wusste ich nicht, wie viele Muskeln man hat, die wehtun können.
Nach einer halben Stunde wird es besser, ich verlasse die gräuliche Nationale 34 und biege links ab auf eine ruhigere Landstraße, die D 21. Sonne, kein Schatten, der jetzt elf Kilo schwere Rucksack, aber bisweilen ein Zeichen der Freundschaft: Ein Autofahrer weicht großzügig aus, scheucht mich nicht in den Straßengraben, er ahnt meine Mühsal. Ich werde dankbar für die geringste Äußerung von Mitgefühl.
Das englische Wort travel (reisen) ist mit dem französischen Wort travailler (arbeiten) verwandt. Ich gehe auf Straßen nach Berlin, nicht querfeldein. Auch wenn es riskanter ist. Die Entscheidung fiel bereits gestern. Definitiv. Den mitgebrachten Kompass werde ich dem nächsten Schulkind schenken. Jetzt ist Erntezeit, jeder Bauer würde mich auf die Mistgabel spießen, wenn ich seinen Weizen niedertrampelte. Zudem kenne ich mich auf dem Land nicht aus, wüsste nicht, wie mich ohne GPS exakt positionieren. Ich bin das, was die Franzosen einen garçon de ville, einen Stadtjungen, nennen. Ich muss an Männern und Frauen vorbei, nicht an Flora und Fauna. Mit Gesichtern, Körpern und Stimmen kenne ich mich aus. Dazu kommen mir Assoziationen, für sie habe ich ein Koordinatensystem. Erst in ihrer Nähe, nah den Besitzern der Körper, kann ich um Geld, Nahrung und Geschichten betteln. Und den einfachen Traum träumen, irgendwann in einem strahlend weißen Bett die Nacht verbringen zu dürfen.
Um elf Uhr erreiche ich La Haute Maison, im Rathaus unterrichtet der Lehrer im einzigen Klassenzimmer. Ich dampfe vor Hitze, und er erklärt mir, dass es hier keinen Laden gibt, nichts, wo ich einen Pump anlegen könnte. Ich gehe Richtung Kirche, beim Näherkommen sehe ich eine Frau im Gebäude nebenan verschwinden. Ich sehe, wie sie sich hinter einer Gardine versteckt und mich beobachtet. Ich rufe in das geöffnete Fenster hinein. Sie weiß, dass ich sie gesehen habe, sie zieht den Vorhang zur Seite und kommt heraus. Ich strecke ihr die leere Flasche entgegen, die ich aus einem Abfalleimer gezogen habe. Ob sie einen Liter Wasser für mich habe? Durch das vergitterte Tor nimmt sie das Plastik entgegen. Mein Hemd klebt nass auf meiner Haut. Wo bin ich gelandet? In der Bronx der achtziger Jahre? Wo sie um ihr Leben fürchten mussten, wenn sie das falsche Wort aussprachen? Oder in einem erbärmlichen Kuhdorf, in dem sie von der Bronx so viel wissen wie in der Bronx von La Haute Maison? Oder fürchten sie hier Zustände wie in der nur sechzig Kilometer entfernten Pariser Métro, wo alle zehn Minuten ein Hautkranker einsteigt und mit seinem Lamento loslegt? Sicher nicht. In diesem Kaff gibt es keine Aidskranken mit Kaposibeulen, wahrscheinlich bin ich hier der erste Bettler seit dem Ende des zwanzigsten Jahrhunderts.
Die Alte kommt zurück. Nicht, dass sie inzwischen auf die Idee gekommen wäre, mir etwas Zusätzliches anzubieten. Mit dem einen Liter Wasser ist sie am äußersten Rand ihrer Großzügigkeit angelangt.
Minuten später lerne ich eine weitere Lektion dieser Reise, jetzt eine gute, eine wichtige. Schwarze Wolken ziehen auf, ein Platzregen folgt, fieberhaft suchen meine Augen nach einem Unterschlupf. Auf der anderen Straßenseite steht eine Telefonzelle, ich renne drauflos und stelle mich hinein. Von dort aus sehe ich die Frontseite der Kirche, mit einer Bank unter dem Vordach. Ich renne wieder los und lerne: Mitten in der Scheiße macht das Leben eine Kurve. Jetzt habe ich die Bank, das Wasser, ich darf die Füße freilegen, das nasse Hemd ausziehen und das Reservehemd überstreifen. Das ist ein Akt von Zivilisation, ein Akt höchster Sinnlichkeit meinem Körper gegenüber. Wie die Hand eines Wunderheilers legt sich die frische Baumwolle auf meine brennenden Nackenmuskeln. Vorsichtig zünde ich ein Zigarillo an, ich rauche, ein schwer verdientes Glücksgefühl verwöhnt meinen Leib.
Weiter. Vorbei an umzäunten Einfamilienhäusern. Einmal geben die Hecken den Blick frei auf ein nächstes, furchtbar wahres Klischee. Die Sonne brütet, und das Familienoberhaupt wäscht das Familienauto. Hier wurde es zur Krönung der Schöpfung erkoren, es steht mitten im Garten, mitten auf dem Rasen. Rufe ich hinein, blickt der Autowäscher herüber und verschwindet wortlos in seiner Festung. Was für ein menschenscheues Gesindel. Hier erschrecken sie vor jedem fremden Gesicht.
Um 15 Uhr erreiche ich Pierre-Levée, ähnlich trostlos. Die leere Straße, sogar der Bäcker hat den Laden zugenagelt und ist davon. Hier könnte ich nur vor Scheunentoren und Traktoren niederknien und betteln.
Ich betrete das einzige Café. Ich muss noch eine Schwäche beichten, die letzte nach der Salami, den Äpfeln und Zigarillos. Aus Paris habe ich das Kleingeld mitgebracht, das mir vom Vorabend geblieben war. Zwei Euro und siebenundsiebzig Cent. Es gibt keine Entschuldigung, nur so viel: Die Münzen garantieren – zumindest die ersten Tage – die Zufuhr von Kaffee, ohne den ich nicht leben will.
Ich stelle mich an die Theke, da ist er billiger, nur achzig Cent. Eine widerliche Bude, man fühlt sich sogleich wie ein Schwarzer, der im tiefen Mississippi eine Whites only-Bar besucht. Drei wortkarge Rednecks, die mit Fremden nie und untereinander fast nie reden, lungern neben mir. Einer schafft immerhin einen Satz mit acht Silben: »J’ai déjà mangé aujourd’hui«, ich habe heute schon gegessen. Ich versuche zwei Fragen, sie werden nicht beantwortet. Stumm schiebt der Patron die Tasse herüber, das Glas Wasser muss ich ihm abringen. Wir schaffen das alles ohne ein Lächeln.