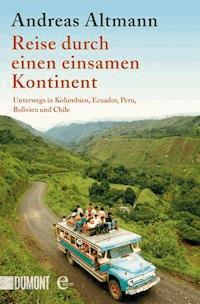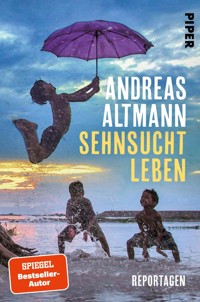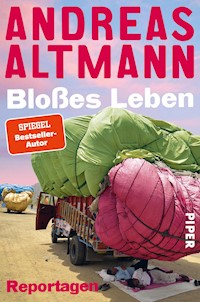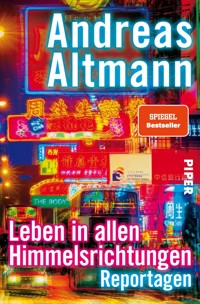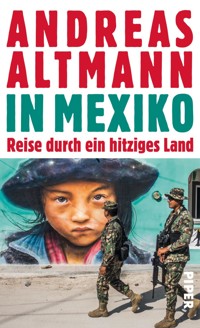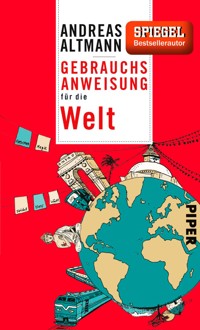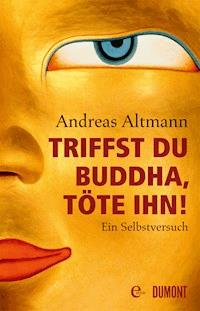9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Andreas Altmann knüpft da an, wo sein Bestseller »Das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter und meine eigene Scheißjugend« aufgehört hat. Nie wieder Altötting, das war klar, aber was will er wirklich? Die Antwort heißt: LEBEN. Drogen und Frauen, exotische Länder und Ideen, Verbrechen und Mönchstum: Nichts, was er nicht ausprobiert hätte. Altmann schildert das mit Schonungslosigkeit gegen sich selber – und mit Leidenschaft und Witz. Es sind die Geschichten eines Davongekommenen, der beschlossen hat, endlich das Leben auszukosten bis zum letzten Tropfen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.dewww.andreas-altmann.comFür das Geheimnisvolle und so Geschwungene, für Dich, für Dich allein Ein Teil dieser Geschichten erschien erstmals 2005 unter dem Titel »getrieben« im Verlag Solibro, Münster Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe 1. Auflage 2013ISBN 978-3-492-96189-9 © 2013 Piper Verlag GmbH, München Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Wenn ich etwas von Kind an, und ohne jeden Lehrer, weiß, so: daß nichts auf der Welt zu haben ist, du nicht und niemand. Ich bin ein begeisterter Habenichts.PETERHANDKE Etwas vom Anker Losgerissenes und frei Treibendes.WALTWHITMAN
VORWORT
Das wird ein seltsames Vorwort. Hier will der Autor dem Leser vom Buch abraten. Sagen wir, dem falschen Leser. Das wäre im vorliegenden Fall der moralisch einwandfreie Zeitgenosse, der zartnervige, der genitalzonenfreie, der von aller kriminellen Energie erlöste, jener eben, der gern zum »guten Buch« greift. Hier greift er daneben.
Die Schlauen unter uns werden mich sogleich entlarven. Als einen Trickreichen, der hier scheinheilig falschen Alarm schlägt, um die Erregungsindustrie anzukurbeln. Ach Gottchen, wenn es nur so wäre. Nein, mein Warnschuss hat Gründe.
Ganz nah ran, hieß die Devise. Manchem ist das zu nah. Nichts wird hier »überhöht«, nirgends taucht eine »Metaebene« auf, nicht eine Zeile Literatur. Nur Geschichten, die ich erlebt habe, bescheidener formuliert: die mir widerfuhren. Bin eben nur Reporter. Bin sklavisch abhängig von der Realität, von dem, was mir die Welt an Geschenken und Zumutungen überlässt. Und die »reportiere« ich, schreibe sie auf. Schenkt mir die Welt nichts, bin ich am nächsten Tag arbeitslos. Denn noch nie lag ich im Bett und der Plot eines Romans kam über mich. Bis jetzt kam nie etwas, sprich: Immer musste ich das Bett verlassen und »leben«, jeden Satz dieser Seiten »erleben«.
Ich vermute, dass ich diese »Erlebnisse« wohl meiner Jugend verdanke. Über die ich in »Das Scheißleben meines Vaters, …« berichtet habe. Anders gesagt: Meine Lebenswut hat Wurzeln. Wie Trotz, wie Aufmüpfigkeit, wie den unwiderruflichen Schwur, alles anders zu machen, als es mir eingebläut wurde. Meine Geschichten, meine Sprache erzählen ganz nebenbei auch davon, wie Verwundungen und Schmähungen – erfahren an Leib und Seele – zu einem umtriebigen Leben anstacheln können.
Die gemeinen Leser werden nach der Lektüre dennoch behaupten, der Inhalt des Buches wäre erfunden. So aberwitzig klingt manches. Wenn die Gemeinen wenigstens diesmal recht hätten. Dann wäre ich ein veritabler Schriftsteller, dann wüsste ich endlich, wie ich meine alten Tage verbringe. Als Geschichtenerfinder, als einer, der die Welt – im Kopf – neu zaubern kann. Auf der Terrasse meiner Finca, irgendwo in Andalusien.
Nein, soweit wird es, werde ich, nicht kommen. Bin ja immer nur ein umtriebiger Schreiber, der als Matrix nicht viel mehr hat als sein bisschen Dasein. Und die Chuzpe – ja, die schon – sich auszuliefern.
Natürlich berichte ich nicht die Wahrheit. Gewiss die Wirklichkeit, noch präziser: jene Wirklichkeit, an die ich mich erinnere. Immerhin bin ich verwegen genug und unterschlage nicht meine Abstürze, ja Mittelmäßigkeiten und Feigheiten. Lauter Zustände, die belästigen statt trösten. Ein »Lebenshilfebuch« ist es wohl nicht geworden. Betrug, schwerer Diebstahl, Impotenz, misslungene Nähe, Homosex, Drogen, Hysterie, AIDS, Liebesunfähigkeit. Wer will sich das zumuten?
Oder doch ein Buch, das beim Leben hilft? Weil es von Tatsachen berichtet, denen so viele von uns begegnen. Weil ein Mensch – na ja, der neugierige – wissen will, wie ein anderer handelt und wie er behandelt wird. Und wie er davonkommt. Oder eben nicht. Hier kann er es nachlesen. Und seine Lehren daraus ziehen. Wenn er denn mag.
Dieses Buch – Dies beschissen schöne Leben – ist die Neuauflage von getrieben, das vor ein paar Jahren in einem anderen Verlag erschien. Für die jetzt vorliegende Ausgabe wurden alle Storys überarbeitet, zudem fünf neue Geschichten eingefügt. Darunter »Die Vergewaltigung«, es dauerte, bis ich einen Verleger fand, der sich traute, diesen Text zu veröffentlichen.
Noch etwas: Ein halbes Dutzend Essays stehen auch im Buch. Sie klingen weniger drängend und stürmisch. Damit der Leser sich kurz ausruhen kann vom Fortissimo der Storys. Die ihn vielleicht an den Rand seiner Belastungsfähigkeit treiben. Und wohl oft ungestüme Widerreden hervorrufen.
»Shoppen und Wellness« las ich einst in einer Anzeige. Lockruf einer Stadt. Uff, auf dass mir die Bekanntschaft dieses Orts auf ewig versagt bleiben möge. Wie gut, dass ich einmal mehr einen Zeitgeist verschlafen habe. Mir graut vor der Wohlfühlgesellschaft, ich fordere noch immer überschwängliche Gefühle, will auch in Zukunft zittern vor Freude, wenn eine Aufregung hinter mir liegt. Das gnädige Glück des Frühgeborenen, desjenigen, der vor der Erfindung der Virtualität auf die Welt kam, das ist das meine. Und all jener, die ihr Recht auf ein eigenständiges, eigenwilliges Leben nicht verraten haben. Ihnen ist dieses Buch gewidmet.
DIE ABENTEUER
CELESTE
Liebe soll etwas Verbotenes haben. Das schärft die Wachheit, das Wissen um ihre Verletzbarkeit. Liebe ist ein Geschenk an die Tapferen. Hört die Tapferkeit auf, geht die Liebe weg. Fast ein Jahr lang war Celeste dazu bereit. Heimlich und mutig hielt sie durch.
Als wir uns zum ersten Mal trafen, kam die Amerikanerin gerade aus Malaysia zurück. Mit einem kleinen Umweg über ihren Gynäkologen. Sie wollte wissen, ob sie schwanger war. Von ihrem Freund, mit dem sie in Asien unterwegs war. Und mit dem sie gemeinsam in Paris lebte. Celeste arbeitete als Reporterin, er als Fotograf. Der Befund war negativ. Wäre es anders gewesen, sie hätte es ebenfalls akzeptiert. Sie mochte den Mann.
Einer ihrer Arbeitgeber hatte ihr von mir erzählt. Er wollte, dass sie intensiver schreiben lernte, sie wollte das auch. Und so erwähnte der Mensch meinen Namen. Am nächsten Tag rief Celeste an, sagte »Hi« und den Grund, warum sie mich sprechen wollte. Ihre freche Neugier war bestechend, wir verabredeten uns.
Eine knappe Stunde lang saßen wir im Café Le Bastille. Mir fiel auf, wie attraktiv sie war. Kein hübsches Collegeface, nein, ein richtiges Frauengesicht. Good talking. Sie schien intelligent, vif, fleißig. Und auf lässige Weise bescheiden. Da ich keine Ahnung hatte, wie jemands Kunst des Schreibens zu verbessern, zitierte ich einen Großmeister. Henry Miller gab jedem den energischen Rat, es ordentlich mit der Sprache zu treiben. Henry, wörtlich: »Du musst sie jeden Tag ficken, sie watschen und auf den Kopf stellen, sie von vorn und von hinten stoßen. Dann, vielleicht, wird sie Laute von sich geben, die überraschen.«
Celeste verkraftete den Satz, notierte ihn sogar. Als wir uns verabschiedeten, war ich nicht sicher, ob Millers Bemerkung nicht eine Spur zu heftig geklungen hatte. In der Metro wusste ich plötzlich, warum ich ihn ausgesprochen hatte. Ich wollte die Frau provozieren, ihr das Schreiben ausreden. Ich zweifelte an ihrer Stärke, an ihrem Willen, für den Weg zur Spitze stark genug zu sein. Sie schien mir zu versöhnlich, nicht im Besitz dieses Feuers, das gefräßig genug in ihr loderte: damit sie eines Tages bereit war, für alles zu bezahlen. Denn nur wer lodert, hat das Recht zu schreiben.
Seltsamerweise rief sie ein paar Tage später wieder an, schlug den Besuch einer Lesung mit Doris Lessing vor. Wir gingen ins British Council. Sie hörte aufmerksam hin, notierte wieder, erinnerte sich hinterher an hundert Details. Irgendwann wurde mir bewusst, dass ich mit einer schönen Amerikanerin durch Paris schlenderte, um ihr beim Reden über Doris Lessing zuzuhören. Während des Sushi-Essens erwähnte sie mehrmals ihren Freund, sprach gut und sanft von ihrer innigen Beziehung. Zwischendurch hatte ich den Eindruck, dass sie die Innigkeit einmal zu oft erwähnte. Als wollte sie mir signalisieren, mich in keine falschen Hintergedanken zu verirren.
Ich musste für drei Wochen verreisen. Bisweilen erinnerte ich mich an Celeste. Ohne sie zu begehren und ohne von ihr zu träumen. Aber ich mochte den Gedanken an jemanden, der Sprache liebte und nach ihr suchte. Zu ihrem Geburtstag schickte ich ihr zwei Zeilen aus einem Rilkegedicht: »Gib deine Schönheit immer hin / ohne Rechnen und Reden. / Sie spricht für dich. Und sagt: Ich bin.« Mit dem Feuer spielen, das wollte ich schon. Dachte ich.
Noch zweimal sahen wir uns. Dann wurde ich nervös. Entdeckte ich doch etwas Drittes an ihr: Wärme. Kein kaltes Großstadtweib flanierte da neben mir, kein nachdrücklich gepflegter Body mit einem frigiden Herz. Celeste war ein warmer Mensch. Auch das noch.
Dennoch, ich war noch immer guten Willens, das Schwärmen auszuhalten, nichts zu versuchen, um die Träume in die Wirklichkeit zu zerren. Außerdem gab es da einen anderen Mann. Ich wollte phantasieren, nicht sündigen, nicht eindringen.
Sie fing wieder an, jetzt das zweite Mal. Das Telefon klingelte und Celeste verkündete, dass sie umgehend bei mir sein würde. Punkt. Dann hängte sie ein. Dreißig Minuten später betrat sie meine Wohnung und legte sich auf den Futon. Ohne ein Wort der Erklärung.
Kein Handgriff ging mir daneben. Ich verdunkelte etwas, machte Tee, massierte behutsam ihre Stirn. Täuschte sie doch ein leichtes Kopfweh vor. Instinktiv begriff ich, dass es sich um einen Test handelte. Ein schneller Fick war das letzte, was sie sich bei mir abholen wollte. Sie spionierte mich aus, suchte nach Indizien, ob ich grundsätzlich als Mann in Frage käme.
Der Fotograf war noch immer ihr Freund, noch immer lieb, noch immer wichtig. Aber er war das, was die Franzosen »mou« nennen, matt, etwas träge. Zudem ein Schweiger. Kein Teilnehmer, kein Widersprecher, kein Sucher. Nie sprach sie gemein über ihn, aber aus ihren Nebensätzen war unschwer zu erraten, was den beiden fehlte. Eben Leidenschaft, crazyness, so ein heftig sprudelndes Gefühl, verliebt zu sein. Die erste bürgerliche Todsünde – ranzige Routine – hatte die zwei bereits infiziert.
Wir beide waren neu füreinander, wir blühten. Eine schwer zu stillende Sucht nach Kommunikation brach aus. Unter dem Deckmantel der Liebe zur Sprache konnte sie das vor sich, so vermutete ich, rechtfertigen.
Wir trafen eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen. Sieben Minuten von ihrer Wohnung entfernt gab es ein Postamt, bei dem sie meine Briefe an sie abholte. Wollte ich sie telefonisch sprechen, ließ ich es einmal läuten. War sie allein, rief sie zurück. Hob der Fotograf ab, war ich der harmlose Alex, ein mit amerikanischem Akzent plappernder Computerfreak, der Celeste ein neues Programm verkaufen wollte. Oder wir faxten. »Früher gab es Liebesbriefe, heute gibt es Liebesfaxe«, kritzelte ich einmal. Sie antwortete nicht, die größeren Wörter waren ihr suspekt.
Kurz nach Mitternacht, schon im Bett liegend, begannen unsere pillow talks. In Paris lagen drei Kilometer zwischen unseren Köpfen, außerhalb von Paris manchmal der halbe Erdumfang. Das Ritual war jedes Mal unaufschiebbar, denn einer von uns hatte tagsüber einen Satz, ein Wort gefunden, worüber jetzt unbedingt geredet werden musste. Bisweilen endeten unsere nächtlichen Diskurse mit dem Geräusch eines blitzschnell aufgelegten Telefonhörers. Der Fotograf war in ihr Schlafzimmer gekommen.
Nach einem dieser Gespräche – ich lag gerade auf einem amerikanischen Kopfkissen – fingen meine Schmerzen an. Ich hatte mich verrechnet. Dass der Fotograf über so ungehinderten Zugang zu ihrem Bett verfügte, verwundete mich plötzlich. Ich hatte mir ursprünglich vorgenommen, ihn zu übersehen, ihm die eher unerotische Aufgabe zukommen zu lassen, sich um den täglichen Grind der Beziehung zu kümmern. Mir wollte ich die Höhepunkte reservieren. Jetzt beschloss ich, den Fotografen zu besiegen. So phantasierte ich.
Ich rannte los. Mit Hilfe der Weltliteratur besang ich ihre Schönheit. Mit Hilfe meiner Versessenheit machte ich ihr den Hof. Wenn ich irgendetwas von dieser Frau begriffen hatte, dann ihr Verlangen nach einem Mann, der verrückt nach ihr war. Ihr Freund war nicht verrückt. Er war nice.
Es fiel leicht, von dieser Frau zu singen. Natürlich bin ich Opfer moderner Schönheitsideale: die glatte Haut, die weiblichen Formen, das schöne Gesicht. Doch davon laufen Heerscharen durch Paris. Aber Schönheit wirft mich erst dann um, wenn hinter dem »visage« ein Hirn fiebert. Wenn in den graugrünen Augen Neugier funkelt, so eine Sucht nach Welt und Wissen und Sprache. Sie hatte das, was ein französischer Schriftsteller »la troisième pensée« nannte: die Fähigkeit, blitzschnell zu kombinieren und aus einem ersten und zweiten Gedanken einen dritten, einen neuen, einen überraschenden, zu formulieren.
So besaßen wir nur noch ein Problem: ihren Argwohn. Sie selbst nannte sich eine »one man woman«, eine Frau, die nur zu einem Mann gehören wollte. »You only«, alle anderen Formulierungen ließen sie kalt. Ich aber, so spottete sie, sähe anders aus, bestimmt nicht wie ein »one woman man«. Ich ging nicht darauf ein. Ich hatte noch immer keine Ahnung von den Abgründen ihrer Angst.
Vier Monate nach ihrem ersten Hi begann mein Siegeszug. Der Fotograf war ohne sie unterwegs und Celeste allein in Paris. Ich entführte sie und fuhr mit ihr auf ein Schloss nach Chantilly-Gouvieu, eine halbe Stunde außerhalb der Hauptstadt. Zwischen den elegantesten Rennpferden der Welt und einem Märchenwald stand ein Hotel, das mir exquisit genug erschien, um in einer der Schlosskammern unsere erste Nacht zu verbringen.
Wir nannten sie später »the blue night«, weil der hellblaue Nachthimmel durchs Fenster leuchtete. Natürlich lagen wir an allen Körperteilen angezogen im Bett. Immerhin ließen wir unsere Lippen frei, so war lange Zeit, um alle in den letzten hundertzwanzig Nächten versäumten Küsse nachzuholen.
Zwei Tage später landete ich in Kabul. Dort schien es nicht gefährlicher zu sein als in Paris. Die erste Nachricht, die ich via BBC hörte, handelte von einem Bombenanschlag in der Metrostation St. Michel, ganz in der Nähe ihrer Wohnung. Eine Terrorwelle algerischer Fundamentalisten hatte begonnen. Ich vergaß den afghanischen Bürgerkrieg und jagte in Schrecken, die mir neu waren. Über das Satellitentelefon des Roten Kreuzes versuchte ich, sie zu erreichen. Diesmal trat ich – wie vorher besprochen – als indischer Arzt auf, als alter Freund, der sich um Celeste sorgte. Vergebliche Versuche, mit ihr zu sprechen. Ich hinterließ eine Nachricht. Erst Tage später kam ein Fax von ihr durch: Alles o.k.
Die einmonatige Trennung hatte mich wund gerieben. Wäre Sehnsucht ein Volk, dann war ich inzwischen China. Als ich zurückkam, hatten wir ein einziges gemeinsames Frühstück und ein Dutzend heimlicher Küsse. Anschließend begleitete ich sie zum Flughafen, Celeste musste nach Amerika. Ich hielt den Gedanken nur aus, weil wir uns für New York verabredet hatten, zwei Wochen später. Ihr Freund war noch immer ihr Freund und ich noch immer der Mann, auf den sie sich nicht verlassen wollte. Ich gab ihr ein Gedicht von Sheenagh Pugh mit, Sometimes. Da stand, was sie jetzt wissen musste: »Sometimes a man aims high, / and all goes well.«
Ich disziplinierte mich mit Arbeit. Bisweilen unterbrochen von dem Gedanken, dass es in Paris pro Quadratmeter mehr begehrenswerte Frauen gab als auf irgendeinem anderen Quadratmeter der Welt. Und dass ich ein paar tausend Meilen weit fliegen würde, um die eine, die einzige, zu treffen, die mir das Herz verwüsten konnte.
Als ich sie am John F. Kennedy Airport wiederfand, römisch elegant in einem italienischen Hosenanzug, mich auf den letzten zehn Metern zu ihr noch einmal daran erinnerte, dass sie zu alledem noch klug war und Wörter liebte, da schwindelte mir für den Bruchteil einer Sekunde und ich begriff, dass solche Höhen einen Preis haben und dass ich dieses Mal bereit war, ihn zu zahlen.
Auf dem Parkplatz stand ihr gelber MG, vor Tagen erst – nach langen Monaten in der Garage von Grandma – ausgemottet. Celeste war Waise und Grandma war die Mutter ihrer Adoptivmutter, die den Säugling vor siebenundzwanzig Jahren aus einem Krankenhaus in der amerikanischen Provinz geholt hatte. Kurz darauf lief der Adoptivvater davon, vom tatsächlichen Vater wurde nie eine Spur entdeckt. Die beiden Frauen aber hielten durch, behüteten das Kind mit allem, was sie hatten. Celestes Bedenken mir gegenüber hatten wohl auch mit der Erinnerung an ihre abwesenden Väter zu tun.
Aber heute war ein sonnengelber Tag in New York, unsere brüchigen Kindheiten schienen so belanglos. Auch das bewunderte ich an ihr. Celeste war nicht larmoyant, ging nicht hausieren mit ihrem Unglück. Ich musste sie fragen, erst dann erzählte sie. Und hinterher nie wieder.
Wir brausten Richtung Norden, wir hatten schwer gearbeitet und verdienten die nächsten zehn Tage Ferien. Now or never, jetzt roch ich meine Chance, jetzt war zehn kanadische Tage und Nächte lang Zeit, dieser Frau beizubringen, dass ich bis in meinen schlaflosen Herzmuskel hinein nach ihr verlangte. Und dass diese Sehnsucht ihr Leben bereichern würde. Diesmal würde ich gewinnen. Mit dem Fotografen einen Atlantik weit weg und mit mir so nah, so unausweichlich nah, jetzt konnte ich nicht mehr verlieren. Ich Träumer.
Kanada hielt jedes Versprechen. Nichts fehlte. Nicht die Tiefenschärfe, nicht die Pferde, nicht die Blockhütte, nicht das Kaminfeuer. Und nicht Charles Bukowskis Hot Water Music, ein Text, der von einem Liebespaar erzählte, das im Blue Moon Hotel übernachtete. Ich hatte das Buch wohlweislich mitgebracht, eines Abends – endlich – passte die folgende Stelle: »Es war verblüffend, dass hin und wieder eine Frau erschaffen wurde, die so aussah, es war zum Verrücktwerden. Victoria war ein schöner, verrückt machender Traum.«
Sechs Monate kannten wir uns jetzt und Celeste war nun leichtsinnig genug, sich mitten auf einer kanadischen Prärie durchgehend unbekleidet neben mich zu legen. Hatte ich doch – nicht wissend, woher ich die Kräfte nehmen wollte – versprochen: »Einfädeln«, so hatte es Henry Miller gelegentlich genannt, kam nicht in Frage. Sie war sinnlich und altmodisch. Ohne Liebe war sie nicht bereit, Liebe zu machen. Ich solle Langmut zeigen, solle »beweisen«.
Die Titanenpflicht fiel leichter als befürchtet. Not macht zärtlich, Not macht schwindlig. Da wir uns »das Letzte« verboten hatten, fanden wir hundert vorletzte Aktivitäten, um unsere Körper in Aufregung zu versetzen. Trotzdem, es kamen Augenblicke, in denen wir beide (ja: beide) nur mit Hilfe heiligmäßiger Selbstbeherrschung die »Pforte zur Todsünde« – so einst mein Religionslehrer – vermieden.
In einem dieser Momente fiel Celeste der passende Ausdruck ein: »It’s like going to the ramp.« Ein Bild aus Cap Canaveral, wo man steil nach oben ragende Raketen – wenn der donnernde Vergleich erlaubt ist – zur Rampe schafft. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass der Flugkörper kurz darauf abgeschossen wird. Anders hier, irgendwo unter den Sternen von British Columbia, wo ich des Öfteren vor Explosionslust zitterte und nie in den Himmel rauschen durfte. Dass während unserer letzten Nacht – wir schlitterten jetzt in einem feinen Hotelzimmer zur Rampe – die Alarmglocke im Flur losgellte, empfand ich schließlich als Erlösung. Wer weiß, ob ich noch einmal durchgehalten hätte. Nur noch das Jaulen anrückender Feuerwehrzüge hielt ich für schrill genug, um mich an mein Versprechen zu erinnern.
Falscher Alarm, nichts brannte im Haus. Kichernd kehrten wir in unser Bett zurück. So blieb es bei ihren Konditionen: Erst bei Ausbruch der Liebe würden wir todsündigen. Nicht eine Stunde zuvor. Und da Liebe von ihr zu mir noch nicht ausgebrochen war, musste ich beweisen, dass ich der Liebe wert war. So einfach, so fordernd lautete der Eintrittspreis.
Meiner infatuation, meiner Vernarrtheit, so nannte sie das, der glaubte sie schon. Am nächsten Morgen hängte ich Brechts »After I had gone« (Als ich nachher von dir ging) an den Badezimmerspiegel, die zweite, die poetischste Strophe hatte ich rot umringelt:
Since we passed that evening hour
You know the one I mean
My legs are nimbler by far
My mouth is more serene.
Und seit jener Abendstund
Weißt schon, die ich meine
Hab ich einen schönern Mund
Und geschicktere Beine.
Letzter Morgen, schwieriger Morgen. Celeste stellte den MG bei Freunden unter, ich rief beim VIPTransport Service an und bestellte eine Super Stretch Limousine, diese acht Meter langen Zuhälterschlitten. Mit Chauffeur, mit Bar, Fernseher und Telefon. Am wichtigsten waren die dunklen Fensterscheiben. Denn wir heulten den weiten Weg zum Flughafen. Ich, weil ich erfahren musste, dass die zehn Tage und zehn Nächte nicht ausgereicht hatten, um sie endgültig zur Liebe zu überreden. Sie, weil sie anfing zu begreifen, wie nahe wir uns gekommen waren und wie unfähig sie schien, sich zu entscheiden.
Nicht zu fassen: In einem unserer kanadischen Badezimmer hatte ich eine Arztrechnung (für sie) von einem gewissen Dr. Singh gefunden, Chiropraktiker in Brooklyn. »Misalignment«, stand da, ihr Becken war, so der Doktor, »schlecht ausgerichtet«. Erstaunlich, denn ich fand es bisher auf geradezu sinnverwirrende Weise intakt.
Als ich Celeste darauf ansprach, platzte eine kleine Bombe. Unter leichtem Würgen beichtete sie die Geschichte ihres mitgenommenen Unterleibs. Höchstwahrscheinlich war dafür der seit drei Jahren an ihr tätige Fotograf zuständig. Denn ihre intimste Stelle schien er von Anfang an mit einer Art Trichter zu verwechseln, in den sich nach ein paar hurtigen Friktionen komplikationslos ejakulieren ließ. An ihren fünf Fingern konnte Celeste die Viertelstunden nachzählen, in denen auch für sie etwas an sinnlicher Wonne abgefallen war. Das letzte Mal im letzten Jahr. Inzwischen hatte sich ihr Skelett verbogen, schief gestellt von einem linkischen Liebhaber. Deshalb wohl ihr Hunger nach Langsamkeit, nach zarten Griffen und Zögern.
Wir nahmen zwei verschiedene Maschinen, besser so. Möglich, dass jemand Celeste in Paris abholen würde. Noch am Flughafen hatte ich mir ein Buch gekauft, The Bridges of Madison County, eine famos kitschige, Millionen Mal gedruckte Lovestory, deren mutloses Ende nichts dazu beitrug, mich zu beruhigen. Aber die Lektüre half, meinen schwelenden Verdacht zu verstärken: Von »Angst« – dieses deutsche Wort gab es seit ein paar Jahren auch in Amerika – war mehrmals in dem Bestseller die Rede.
Während der zehn Stunden Flug dämmerte mir, was ablief. Da war kein Kampf zwischen dem Fotografen und mir. Der Kerl schien brav und überschaubar, der starrte in keine Abgründe, den versuchte nichts. Celeste mochte ihn noch immer. Trotz seiner plumpen Auftritte als Beischläfer. Der Kampf ging zwischen mir und ihrer Angst. Ich war für sie ein Angstmacher, ein Jäger, einer, der nichts wissen wollte von der Zeit nach der Eroberung. Sie hielt mich für einen interessanten Schwächling, der nicht mehr viel wert war, sobald er gewonnen hatte.
Dass Celeste noch immer, trotz so vieler Mangelerscheinungen, an die Wiederaufstehung der Liebe zwischen ihr und dem Fotografen glaubte, auch das musste ich auf dem Weg zurück nach Europa einsehen. Das hatte sie mit so vielen anderen Frauen gemeinsam: dieses Nicht-Loslassen-Wollen, dieses Nicht-Begreifen-Können, dass es vorbei war.
Wie auch immer. Ich rannte weiter auf sie zu. Und sie wich nicht aus. Zwei Stunden, nachdem wir gelandet waren, liefen alle Kommunikationsmittel wieder auf Hochtouren. Wieder unter strenger Geheimhaltung. Trotz meiner jetzt beißenden Eifersucht erkannte ich, dass das Verbotene der Garant unserer Geschichte war. Solange sie verboten und heimlich war, konnte uns nichts misslingen, bestand keine Gefahr, in die Fallen der Gewöhnlichkeit zu tappen. Heimlich flüstern, heimlich Botschaften lesen, heimlich diesen schönen Menschen in einen dunklen Toreingang dirigieren und alles Bloßgelegte abküssen. Jede dieser Tätigkeiten bewahrte uns vor dem Fluch der Unlust und der Mühsal eines geregelten Lebens zu zweit.
»You are the perfect thrill provider«, sagte Carol Lombard in Lubitschs To be or not to be zu ihrem Helden, der sie immer (diskret) in der Garderobe besuchte, während ihr Ehemann auf der Bühne den Langweiler Hamlet deklamierte. So wollte ich, dass Celeste zu mir redete. Ich wollte nicht aufhören, sie mit dem thrill, mit Aufregung, mit Aufregungen, zu versorgen.
Ich ließ eine Kiste zimmern, breiter als ihre Haustür, und suchte ein Taxi, einen Kombi, um das Ungetüm vor ihre Wohnung zu transportieren. Alles war genau kalkuliert. Als ihr Freund auf die Straße trat und um die nächste Ecke bog, bat ich den Fahrer, vorzufahren und bei Celeste zu läuten. Ich war inzwischen ausgestiegen und beobachtete, hinter einem Bauzaun versteckt, was nun passieren würde. Der Dicke läutete und Celeste kam herunter. Sie muss sofort begriffen haben, woher das riesige, blau eingewickelte Paket kam, denn in furioser Eile versuchte sie, es in den Flur zu zerren. Vergeblich, trotz der rührenden Hilfe des Fahrers. So mussten sie es mitten auf dem Trottoir zerlegen, mitten in Paris. Um es klein genug zu bekommen für den Weg über die Schwelle.
Zwanzig Minuten später – ich besaß jetzt ein Mobiltelefon, um keinen Ton von ihr zu versäumen – rief sie mich an. Hatte sie doch in der zwei Kubikmeter großen Verpackung nichts anderes als ein halbes Gramm Papier gefunden, ein Billet für einen Abend mit Serge Reggiani, im Olympia, dem bekanntesten Konzertsaal der Stadt.
Reggiani war einer meiner französischen Lieblingssänger, er besaß diese souveräne, menschenfreundliche Resignation, von der ich so elend weit entfernt schien und die ich jedem neidete. Aber ich schlug ihn aus einem ganz bestimmten Grund vor: Er würde das Lied »Sarah« singen und ich wollte, dass Celeste es hörte. Damit es ihren Argwohn dämpfte.
Drei Tage später hörten wir es, mehrmals, denn der Refrain kam sechs Mal: »La femme qui est dans mon lit n’a plus vingt ans depuis longtemps.« Reggiani sang da von einer Liebe, die durchhält, auch wenn die Frau in seinem Bett schon lange nicht mehr zwanzig Jahre alt ist. Celeste weigerte sich zuzulassen, dass ich anders sein, anders werden könnte. Anders, als sie vermutete. Dass aus einem Jäger ein Behüter werden konnte, eben einer, der nicht von ihr loslassen würde, auch dann nicht, wenn der Rausch der Vernarrtheit vorüber war.
Ich schien jetzt überzeugt, dass ich bei ihr durchhalten würde. Ich lief nicht mehr schreiend weg, wenn diese Frau davon sprach, Mutter werden zu wollen. Ich ertrug die so irrwitzige Vorstellung, irgendwann Vater zu sein. Ich befreundete mich mit so fremd klingenden Wörtern wie »sexuelle Treue«.
Jacques Prévert hat einmal davon gesprochen, dass Liebende einen Code brauchen, Symbole, poetische Zeichen, um miteinander zu kommunizieren. Celeste war möglicherweise im falschen Jahrhundert geboren worden, denn sie träumte von Helden und Rittern, die Schwerelosigkeit zauberten und auf geflügelten Pferden ihr angebetetes Ritterfräulein entführten.
Ich spielte gern den Ritter. Leider fehlte mir das Talent zum Minnesang. So strich ich abends durch die Metro, um einen zu finden, der als Eroberer auftreten und nebenbei noch singen konnte. Nach einer Woche entdeckte ich Terence, einen seit vierzehn Jahren durch den Untergrund von Paris ziehenden Musiker aus Nebraska. Schöner, impertinenter Schmalz lag in seiner Stimme. Ich führte ihn von der Metro zurück an die Erdoberfläche und ließ ihn in einem stillen Café vorsingen. Er passte.
In der Rue Saint-Denis, mitten im Nuttenviertel, fand ich einen Kostümladen. Ich verkleidete den Amerikaner als d’Artagnan, mit schwarzem, weitem Filzhut, Henri-IV-Bart, rotem Wams und goldglänzender Schärpe. Rechts baumelte ein mondäner Degen.
Zwei Tage später fuhr ich den Mann zu seinem Arbeitsplatz, dem Bürgersteig gegenüber Celestes Wohnzimmerfenster. Etwas Herzbewegendes geschah. Terence fing an, auf seiner Gitarre zu zupfen und wundersam ölig Elvis Presleys »I can’t help falling in love with you« zu seufzen, als nicht nur Celeste ihre Balkontür im dritten Stock öffnete, sondern sieben andere Fenster aufgingen und lauter Frauengesichter zum Vorschein kamen, die alle still und ergriffen zuhörten, wie Terence, der Ritter aus Nebraska, um elf Uhr abends in eine laue Pariser Oktobernacht Elvis’ Liebesschnulze wimmerte.
Da ich Celeste an diesem Morgen um zwei Dinge gebeten hatte – einen Brief an sie bei unserem Postamt abzuholen und abends zu Hause zu sein –, wusste sie sofort, wer der Auftraggeber von Terence war. Den Brief sollte sie erst lesen, wenn »the hanky-panky« vorbei war. Hanky-panky war unser Deckname für alle Kitzel, die wir uns gegenseitig verschaffen wollten.
Der Amerikaner verbeugte sich, genoss den von fröhlichem Gekicher begleiteten Applaus und verschwand. Ich sah, von weitem, Celeste das Kuvert öffnen, in dem ein langer Liebesbrief lag. Der schwerwiegendste Absatz darin sprach von einer bestimmten Rasse von Enten, die – einmal zusammen – sich nie wieder trennen. So dramatisch und nach ihr hungernd hatte ich es hingeschrieben. Mein Leben schien jetzt nur ein Ziel zu haben: dieser Frau nah zu sein und ihr die Angst zu nehmen, noch einmal verlassen zu werden.
Die Idee, dass alles anders war, dass von meinen Mutmaßungen und Kopfgeburten nicht eine stimmte, dass ich auf geradezu groteske Weise etwas vor mir verheimlichte, diese Idee kam mir nicht. Ich schien noch immer nicht stark genug, die Wirklichkeit zu ertragen.
Celeste schmolz, die abendliche Szene mit einem singenden Ritter ließ für Stunden ihre Alarmglocken ruhen. Am nächsten Morgen um sieben Uhr früh – ihre Haut war noch warm vom Bett, das sie mit dem Fotografen geteilt hatte – stand sie vor meiner Tür, schob mich zur Seite und legte sich splitternackt in mein Schlafzimmer. Sie schnatterte jetzt vor Lüsternheit, ließ fast alles zu, auch das Allervorletzte, nur nicht, noch immer nicht, alles.
Hinterher heulte sie, ihre Schuldgefühle kamen so garantiert wie ihre Lustwellen. Sie hasste Lügen, sie hasste das Gefühl, kein Verlangen mehr nach dem Fotografen zu spüren, sie litt unter ihrem Mangel an Mut, dem Mut, sich zu entscheiden.
Wir mussten uns trennen. Um wieder im ganz normalen Leben zwischenzulanden. Ich ging nach Afrika, sie mit dem Fotografen nach Indien. Die Entfernung tat uns drei Tage lang gut, dann begann von Neuem das jonesing. Das ist ein Ausdruck der Crackheads in Brooklyn, er beschreibt das Zittern. Weil der Nachschub fehlt, weil nichts ins Blut strömt, das besänftigt. Auch funktionierten keine pillow talks zwischen einem indischen Dorf und einem afrikanischen Kraal. Als ich endlich in eine größere Stadt kam, erfuhr ich die ersten News. Sie klangen nicht gut.
Celeste panikte. Sie wollte nicht mehr, dass ich nach Rajasthan kam, um gemeinsam eine Woche durch unser Lieblingsland zu reisen. An dem Tag, an dem ihr Freund zurück nach Paris flog, sollte ich einfliegen. So war es besprochen. Die Lügengeschichten machten sie krank, denn eine Tonne Falschmeldungen sollte sie ihm einreden, um plausibel zu machen, warum sie ohne ihn in Indien bleiben wollte.
Ich nahm nichts zur Kenntnis, verweigerte die Annahme der Nachrichten. Wenn sie darauf bestand, mich auszuladen, dann musste sie das von Angesicht zu Angesicht erledigen. Ich jedenfalls würde die sechstausend Kilometer zurücklegen, und wäre es nur, um mir eine Absage anzuhören.
Das muss ihr imponiert haben, denn zuletzt kabelte sie einen hinreißenden Text: »Would it be rude to ask you for a test? If ever the hanky-panky goes out of control?« Eine Zeile aus einem Hollywood-Film. Jetzt war sie bereit für alles. Dass ich tagelang transpirierte, bevor ich das Ergebnis des Aidstests in Händen hielt, auch das schien mir nur Teil eines langen, steilen Anlaufs hin zu dieser Frau. Aber in Asien würde ich ankommen bei ihr, würde ihrem Körper und ihrem Denken näher sein als jeder andere. Sie würde mich wählen. Mich, den Einfältigen, der noch immer nichts begriffen hatte.
In einem seiner Tagebücher hatte Albert Camus einmal notiert, dass »diejenigen Liebenden Narren sind, die glauben, die Welt um sie herum wäre verschwunden.« Aber Camus war nie in Indien gewesen, hatte nie erfahren, dass auf diesem Erdteil die Spielregeln der übrigen Menschheit nicht gelten. Erst recht nicht für Liebende, die Indien lieben.
Irgendwo in 10000 Metern Höhe über Teheran müssen wir uns, der Fotograf und ich, gekreuzt haben. Um vier Uhr morgens landete ich im Hotelbett Celestes. Wir waren glücklich und zaghaft wie Kinder. Der Kampf mit ihrem penetranten Gewissen hatte sich schon abgeschwächt, das Rauschgift Indien wirkte bereits.
Am nächsten Tag buchten wir einen Termin in einem Schönheitssalon. Mit keiner Silbe hatten wir die Möglichkeit einer vollständigen, auf nichts mehr verzichtenden Liebesnacht erwähnt. Sie schien da, sie war nur noch eine Frage von ein paar Tagen und Nächten der Vorbereitung. Deshalb die Idee, den Beauty Shop aufzusuchen. Wir wollten schön sein und geschmeidig, wollten unsere Haut, unsere Hände und Fingerspitzen einstimmen. Damit sie nichts falsch machten, wenn die »Stunde des Erkennens« (Salomon) gekommen wäre.
Indien schenkte uns alles, was wir wollten. Am späten Nachmittag heuerten wir den so höflichen Jubatt und seinen mit rosenweißen Deckchen ausgelegten Ambassador an und verließen New Delhi Richtung Traum. Eine warme Novembersonne strahlte, an der ersten Bahnschranke setzte sich ein Vogel auf den rechten Scheibenwischer, der Mond zog auf, Jubatt raste – wie alle anderen Inder um uns herum – leichtfertig durch die Nacht.
Am nächsten Abend fanden wir den Ort, an dem uns keine Ausflüchte mehr einfielen. Die Fata Morgana hieß Samode Palace und lag eine knappe Autostunde außerhalb von Jaipur. Als wir durch das Palasttor in den Hof einfuhren, war die einzige Antwort auf den Wahn: aussteigen und niederknien. Die von schönen alten Männern mit gezwirbelten Schnauzbärten und rajasthanrot leuchtenden Turbanen gesäumte Schlosstreppe führte direkt in den Himmel. Stiller Himmel, nur das Knistern der brennenden Fackeln war zu hören. Und das leise Kichern von Jubatt, der triumphierend »voilà« sagte, unverhohlen stolz auf eines der Weltwunder seines Landes.
Wir fragten nach dem spektakulärsten Zimmer und bekamen es: Nummer 21, das frühere Schlafgemach der Maharani, der Frau des Maharajas. Als Yogi, der Hausboy, die Kerzen anzündete und die Fenster hinaus zu den indischen Sternen öffnete, fielen mir drei Wörter aus dem Traktat desSteppenwolf ein, die jetzt genau passten. Hermann Hesse hatte da vom »Schaum des Augenblicksglücks« geschrieben, der den gerade Glücklichen niederwalzt: der grandioseste Schlafplatz der Welt, zwölf mal sieben Meter, ein Zyklopenbett mit Baldachin, zwei mit Kaschmirdecken und Seidenkissen ausgelegte Lümmelecken, kleine weichleuchtende Lichtquellen, ein Sechs-Sterne-Badezimmer mit einem Sechs-Sterne-Badezimmervorraum, die hohe Decke, die Bilder, die Spiegel, der Duft, das unvorstellbare Gedächtnis dieser orientalischen Suite, die während langer Zeit so vieles gesehen haben musste.
Erst in der zweiten Nacht trauten wir uns. Wir lagen oben auf dem Palastdach, dem Mond noch einmal zehn Meter näher, und Celeste las laut aus Ryszard Kapuścińskis Imperium vor, las die mit ätzender Schärfe geschriebenen Seiten, auf denen Stalin seine ersten »Säuberungen«, seine ersten Massaker, arrangierte.
Hinterher kam mir die Idee, dass ich die folgenden Stunden wohl dem ehemaligen Generalsekretär der KPdSU verdankte. Seine Barbareien trieben Celeste und mich zusammen, unser Bedürfnis nach letzter Nähe war durch kein Schuldgefühl mehr aufzuhalten. Wir krochen unter den Baldachin.
Wir hatten Glück, nichts missriet uns, die acht Monate Karenzzeit schienen nicht umsonst. Sex war noch immer die innigste, unbegreiflichste Privatheit, die zwei sich antun konnten. Dazu kam die Freude, ein nächstes Geschenk zu entdecken: Celestes erotische Begabung. Kein Funken panamerikanischer Puritanismus in ihr. Wie selbstverständlich gab und nahm sie. Aber ich registrierte ihre Vorsicht und verstand, dass ihr Körper sich inzwischen gegen etwaige Missbräuche gerüstet hatte. Ein, zwei Ängste ankerten zäh in ihrem Unterleib. So schnell begriff ihr Nervensystem nicht, dass ihr neuer Liebhaber die Lust mit ihr teilen und nicht sie plündern und alles allein haben wollte.
In Paris kam die Rechnung. Celeste kehrte zurück zu dem Lusträuber. In meinen niederträchtigsten Momenten begann ich, den Verdacht zu hegen, dass sie von dem Fotografen abhängig war. Nicht finanziell, bestimmt nicht. Sexuell erst recht nicht. Wohl auf einer ungreifbaren Gefühlsebene: Strahlte er doch etwas aus, was sie beruhigte. In ihm lauerte keine Gefahr, auf eine befremdliche Weise schien sein Phlegma sie zu beschützen. Er machte nicht Angst. Sogar sein Äußeres verschaffte ihm Pluspunkte. Der kleine Bauch schien ein Gütezeichen für inneren Frieden. Nichts nagte in ihm. Mich nannte sie einmal einen »Krieger«. Krieger beschützen nicht, Krieger führen Krieg.
War sie auch risikobereit in ihrem Beruf, mit ihrem Innenleben ging sie achtsamer um. Hielt Ausschau nach der soft option, nach einem aufgeräumten Leben, nach der wahnwitzigen Illusion von Sicherheit und Ewigkeit.
Vielleicht muss jeder eines Tages für den Schmerz bezahlen, den er in einem anderen auslöst. Vielleicht auch nicht, so genau weiß das niemand. Ich jedenfalls hatte Zahltag: Bevor ich Celeste zum ersten Mal traf, hatte ich mich von Rosza getrennt. Gescheite Frau, good looking, a business woman mit Columbia-Abschluss. Ich mochte sie, aber Liebe kam nie in Frage. Der letzte Abend geriet uns zur Farce. Wieder sollte ich mich zur unvergänglichen, unwiderruflichen Einehe bekennen, inklusive aller totmachenden Ingredienzen. Natürlich Kinder, natürlich Haus, natürlich das komplette Panoptikum bürgerlichen Elends. Wie ein Sechzehnjähriger in der Hochpubertät lief ich davon.
Jetzt, nur Monate später, war ich an der Reihe: hinnehmen das bittere Bewusstsein der Unentschiedenheit eines anderen, lernen, dass auch andere Männer begehrenswert waren. Wie siegreich ich mich bei Rozsa gefühlt hatte und in welche Taumel von Ausgeliefertsein mich jetzt mein Verlangen nach Celeste riss.
Ich begriff noch immer nicht, was geschah.
Ich war der Krieger. Und ich war »Poponov«. So hieß ein russischer Reporter, der sich vor langer Zeit in Wladiwostok zu Fuß auf den Weg nach Moskau gemacht hatte. Die Geschichte dieses Mannes gefiel mir, ich wollte hartnäckig sein wie er. Nur wollte ich nicht nach Moskau, ich wollte zu Celeste. Sie schien weiter entfernt als die neuntausend Kilometer zur russischen Hauptstadt. Doch wäre ich tapfer und besessen wie Poponov, ich würde ankommen.
Auf einem Flohmarkt besorgte ich mir drei alte Hosen, ein Hemd, zwei fleckige Pullover, ein fransiges Sakko, zwei verschiedene Turnschuhe und einen langen, intensiv riechenden Schal. Am nächsten Morgen, um 5.15 Uhr, schlurfte ich als Penner verkleidet aus dem Haus. Es war jetzt Winter, vier Grad unter Null. Dreitausend Meter waren es bis zu Celestes Wohnung. Fünf Meter links von der Haustür setzte ich mich auf das Trottoir, vermummte bis auf die Augen mein Gesicht und zog einen Pappdeckel hervor, auf dem ich von meinem Schicksal als armer Teufel erzählte. Ich wollte ihr nah sein, und wäre es als abgerissener Obdachloser. Ich wollte ihr beweisen, dass sie mich haben musste.
Es war gemein kalt und die Einwohner von Paris entdeckten ihre Wärme. Weihnachtszeit. Zwei Mädchen brachten Kaffee vorbei, eine bot an, die Samu anzurufen, eine Art Rotes Kreuz, das sich um die Elendsgestalten der Stadt kümmerte. Ich lehnte ab, spielte den verdrehten Outsider, der niemanden in seiner Nähe aushielt. Eine Geschäftsfrau von gegenüber brachte ein Mittagessen, Fisch mit Reis, ein Alter spendierte ein Sandwich, ein Ehepaar kehrte zurück in die Wohnung und holte eine Strickjacke. Eine Schöne lächelte und zog eine Tafel Schokolade aus ihrer Krokotasche. Nur einer stänkerte und predigte. Von wegen faul sein und schnorren. Trotzdem, nach der Predigt warf er ein paar Münzen in den Plastikbecher.
Um 11.15 Uhr verließ Celeste das Haus. Sie sah mich nicht einmal, bog nach rechts in die andere Richtung ab. Und sie war nicht allein, neben ihr ging der Fotograf. Ich tastete nach meinem eisigen Hintern und beschloss, dazubleiben und zu warten. Irgendwann würde ich Glück haben.
Minuten später wurde es dramatisch. Aus gänzlich unerwarteter Richtung. Meine Blase drängte. So wäre nichts einfacher gewesen, als in ein nächstes Café zu gehen und nach einer Toilette zu fragen. Ich fragte. Erfolglos. Ich sah zu kaputt aus, keiner ließ mich über die Schwelle. So lief ich – nun gejagt von brausender Not – über den Quai de la Tournelle zur Seine hinunter. Da war der Not kein Ende, denn nun stellte sich heraus, dass zwei der drei Flohmarkthosen mit einem stramm vernähten Hosenschlitz versehen waren. Mir blieb nichts anderes übrig, als im hellsten Dezemberlicht drei bizarr gestückelte Beinkleider abzustreifen und in verschämter Hocke in die Seine zu machen. Dabei redete ich mir ein, dass es nicht viele Liebende in Paris gab, die zu solch lächerlichen Positionen bereit waren, um einer Frau nahe zu sein.
Ende der Leseprobe