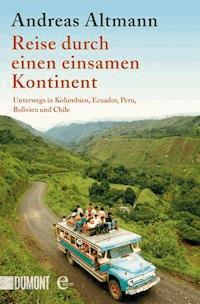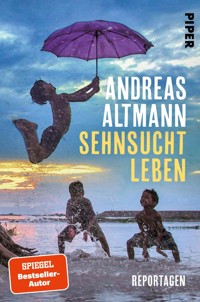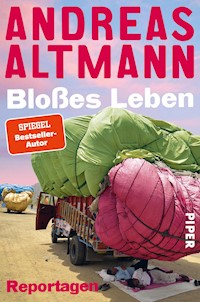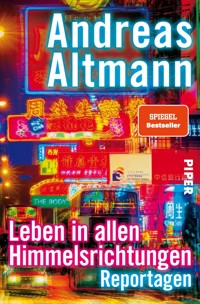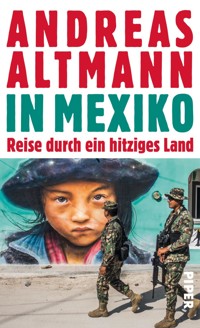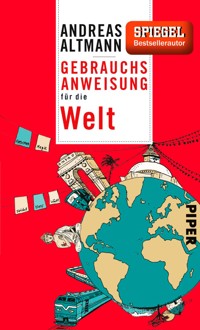21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Feier des Lebens und des Überlebens Dieser wunderbare neue Erzählungsband des großen Reporters und Weltbürgers Andreas Altmann enthält nur unveröffentlichte Texte. Er erzählt darin in seiner unnachahmlichen Sprache von prägenden Begegnungen und besonderen Erlebnissen, reflektiert über das In-der-Welt-Sein und die Abgründe der menschlichen Existenz und berichtet von außergewöhnlichen Orten, beeindruckenden Charakteren und ihren Schicksalen. Dabei spart er auch die alltäglichen Absurditäten unseres gesellschaftlichen Lebens nicht aus. Sein Blick für das Kleine und ganz Große der menschlichen Seele und seine klugen Reflexionen machen diese Texte zu etwas ganz Besonderem – ein großes Leseerlebnis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotiv: plainpicture / Joseph Fox
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Motti
Vorwort
Morning has broken
Corona
Das Handwerk des Lebens
Das Mädchen am Fluss
Beruf Reisen: 82 Behauptungen
Der Augenblick, der mein Leben veränderte
Auschwitz
Der Dieb – unloaded
Der Flüchtling
Die Toten
Ein glücklicher Mensch
Lob der Höflichkeit
Ein Mann
Eine Frau
Helden und Duckmäuser
Hundert Wunden und eine unverbrüchliche Liebe
Die neue Weinerlichkeit
New York
Leichtigkeit
Raub in Brasilien
Schlaflosigkeit
Und wenn ein Mann einen Mann liebt …
Wunder Sprache: 73 Annäherungsversuche
Zurückkommen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Das Buch gehört Helge, einem Mann, der als weißer Rabe durchs Leben geht. So einmalig ist er. Er kann und tut so vieles, was wir vielen nicht können und nicht tun.
Chirurg sein und Leben retten
Schönheitschirurg sein und glücklich machen
Elvis impersonator
Gedichte-Deklamator
Buchliebhaber
Sprachliebhaber
Damenfüße-Fetischist
Heiterer Angeber
Held und Frauenheld
Todernster Grübler
Verschenker
Wing-Tsun-Kämpfer, blitzschnelle martial art aus China, die unter anderem fordert: »Schütze die Schwachen und Kleinen, durch die Kampfkunst forme deinen Charakter.«
Ah, da fällt mir ein, dass er am liebsten – wenn wir uns sehen – seine tausend Muskeln um mich schlingt und so lange und so heftig drückt, bis ich um Gnade flehe. Diese Art von Begrüßung ist einer seiner ultimativen Liebesbeweise.
Bert Brecht hat ein famoses Gedicht geschrieben, bei dem er an Helge gedacht haben muss. So schenken Bert und ich ihm die folgenden Zeilen.
Die Freunde
Wenn du in einer Kutsche gefahren kämst
Und ich trüge eines Bauern Rock
Und wir träfen uns eines Tags so auf der Straße
Würdest du aussteigen und dich verbeugen.
Und wenn du Wasser verkauftest
Und ich käme spazierengeritten auf einem Pferd
Und wir träfen uns eines Tags so auf der Straße
Würde ich absteigen vor dir.
Wisława Szymborska: Ich begeistere mich und verzweifle.
Charles Bukowski: Niemand hat so viel Seele, dass er gegen die Nerven ankommt.
Joan Didion: Wir erzählen uns Geschichten, um zu leben.
Edgar Davids: Ich teile die Welt in Freunde, Helden und Idioten ein.
Vorwort
Vor einiger Zeit las ich einen Bericht über Brigitte Bardot. Drei Seiten lang in der Le Monde. Einst weltberühmtes Sexsymbol, dann weltberühmte Tierschützerin. Sie erwähnte unter anderem, mit welcher Leichtigkeit sie mit vierzig ihre Schauspielkarriere aufgegeben hatte. Ein Film mehr mit ihr würde den Weltenlauf nicht ändern. So grandios sei ihr Talent nicht gewesen, um nicht unbekümmert davon zu lassen. Sie sah sich nie wie viele ihrer Kolleginnen, für die dieser Beruf alles bedeutet, ja, die sich jenseits der Kamera kein Leben vorstellen können. Sie konnte es. Was sie anschließend souverän bewies.
Unbescheidenerweise musste ich beim Lesen an mich denken. Obwohl nie Sexbombe und nie weltberühmt. Aber die Einsicht, dass keine meiner Zeilen etwas bewirken, je irgendwen beeinflussen wird, die kam bei mir an. Mit der Erkenntnis, dass die Menschheit durchaus auf meine Begabung – die mir manche bescheinigen – verzichten könne.
Das war nicht immer so. Früher, als ich anfing zu schreiben, war ich von Übermut ergriffen: Ich erfinde die Sprache neu, hier kommt ein Wunder auf die Leserschaft zu, hier setzt einer entscheidende Maßstäbe.
Heute kichere ich, sobald ich mich an diesen Größenwahn erinnere. Denn in der Zwischenzeit musste ich erfahren, dass es andere auch können – vielleicht besser. Und dass wir keine neue Sprache haben. Was wir haben, wenn wir es haben: Talent und die Bereitschaft, uns zu schinden. Um anzutreten gegen einen übermächtigen Gegner: das Genie deutsche Sprache.
Zurück zu Madame Bardot. Gewiss, ihr Interview brachte mich ins Grübeln. Plötzlich gefiel mir die Vorstellung, das Schreiben aufzugeben. Zugegeben, nur als Gedankenspiel. Da ich nichts anderes kann, wofür mir jemand mehr als fünf Euro pro Tag zahlen würde, zudem mir alle Kraft fehlt, um Mensch und Tier zu retten, muss ich wohl bis auf Weiteres hocken und tippen.
Wie erfreulich, mit der Zeit verging mir jeder Anflug von Hochmut. Wie die so aberwitzige Idee, »der Welt den Spiegel vorhalten« zu wollen. Das moralisch Hochgerüstete verließ mich. Jede »Mission« schien mir von nun an verdächtig zu sein. Was bleiben soll, unbedingt: Texte für helle Köpfe zu verbreiten. Die beim Lesen mitdenken und mitfühlen. Was für ein Geschenk an einen Autor.
Die Folge: Ich mäßigte mich, ich hörte auf, mich zu überschätzen. Das Einzige, was mich in Zukunft antreiben sollte, war eine Tagebuchnotiz von Gabriel García Márquez, die ich in der Nationalbibliothek in Bogotá gefunden hatte. Die paar Wörter klangen wundersam trocken und cool: »Ich glaube, die revolutionäre Aufgabe des Schriftstellers ist es, gut zu schreiben.« Irgendwann las ich noch einen Satz von ihm zum Thema: »Warum ich schreibe? Um Frauen kennenzulernen.« Unheimlich, was Männer alles unternehmen, um zu gefallen.
Schreiben ist die nackte Maloche.
In Boulder, im Bundesstaat Colorado, traf ich am Naropa-Institut den finnisch-amerikanischen Übersetzer, Professor und Dichter Anselm Hollo. Der Dreiundsechzigjährige, erfolgreich und angesehen, leitete an der Universität einen Literaturkurs, an dem ich während ein paar Stunden – als stiller Zuschauer – teilnehmen durfte. Einer seiner vielen intelligenten Sätze, die ich notierte, ging so: »The basic line of writing is: tell a story!« Aus seinen weiteren Ausführungen habe ich in etwa verstanden: Erzähle eine Geschichte, stringent, zügig. Erzähle sie so, dass man sie beim ersten Lesen versteht. Moralisiere nicht, vermeide Detailhuberei, denke stets beides gleichzeitig: Inhalt und Form. Weder das eine noch das andere ist wichtiger, sie bedingen sich.
Ein kluger Gedanke in elegante Worte verpackt ist der Traum aller, die Sprache lieben. Kommt sie in Hochform daher, dann ist sie bisweilen imstande, uns die Trägheit des Herzens (»the inertia of heart«) auszutreiben. Eine Zeit lang, immerhin.
Noch ein Hinweis, bitte. Er bezieht sich auf das vorliegende Buch. Den Begriff »Reiseschriftsteller« finde ich eher bizarr. Das hieße ja nichts anderes, als dass so einer nur auf Reisen lebt und schreibt. Den Rest seines Daseins passiert nichts, da ist er tot. Noch ist es nicht so weit, ich bin jeden Tag, auch zu Hause in Paris, lebendig und jeden Tag – nebenbei – ein »writer«. Das ist einer, dem Dinge zustoßen, die er irgendwann veröffentlicht. Wenn sie denn bemerkenswert sind. Dabei ist vollkommen egal, wo es gerade brennt. Das Einzige, was zählt: Rührt es mich an, und könnte es andere anrühren? Ob ich in der Metro eine mutige Frau beobachte oder in New York durch die Subway fliege: Szenen eben, die uns etwas vom Leben auf Erden berichten.
PS: Erstaunlich, doch beim Stoffsammeln für dieses Vorwort fiel mir wieder die Nachricht einer Leserin ein (ich hatte sie radikal verdrängt), die mir vor Monaten gemailt hatte, dass ich ihr das Leben gerettet hätte. Das Leben! Mit einem Buch. Da ich als Reporter zuerst grundsätzlich nichts glaube, habe ich intensiv nachgefragt. Eine Art Kreuzverhör, mit detaillierten Fragen, um herauszufinden, ob hier jemand pathetisch übertreibt oder tatsächlich die Wirklichkeit berichtet. Aber ihre Geschichte blieb kohärent. Keine Widersprüche, auch später nicht. Zudem schrieb sie ruhig, ohne Drama, ohne Superlativ in der Wortwahl.
Was war geschehen? Die junge Frau, Ende zwanzig, hatte eine widerliche Kindheit hinter sich, später zwei Begegnungen mit schwer übergriffigen Männern. Was zuletzt nicht ohne psychische und psychosomatische Folgen blieb: auch strudelnde Depressionen, auch eine kaputte Niere. Was nicht aufhörte, was nur bedrohlicher wurde. Also packte sie eines Tages ihren Rucksack und fuhr in ein Land mit viel Meer an allen Küsten. Dort, im Atlantik, wollte sie aufhören zu leben. Das war ihr Plan.
So weit, so schaurig, aber: Ein Freund, wohl wissend um ihre Gefährdungen, hatte ihr meine Biografie mitgegeben, »Das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter und meine eigene Scheißjugend«. Und Anna, so soll sie heißen, fing an zu lesen, nachts im Zelt. Und sie las so, wie ich es mir immer gewünscht hatte: nicht als Bericht aus dem Fegefeuer, sondern als rotzige Abrechnung, angetrieben von einem unbedingten Willen, nicht zu zerbrechen. Und Anna dachte, so schrieb sie mir: Was der kann, kann ich auch – davonkommen und ein anderes Leben finden. Und sie baute das Zelt ab und kam zurück. Nicht geheilt, aber mit der Kraft, nach einem Ausweg zu suchen. Einem sanfteren als dem Tod. Was ihr offensichtlich gelungen ist.
Okay, ich widerrufe kurz. Ein Mal hat ein Buch von mir den Lauf der Dinge verändert. Ich will mich nicht beklagen.
Morning has broken
Ein Sommertag, eine laue Brise und eine Temperatur, die nichts als Glück verheißt. Das kommen wird – wenn auch über Umwege.
Ich sitze auf der Terrasse eines Cafés, das noch nicht offen hat. Eine Frau, wohl eine Angestellte, kommt und fordert barsch, mich zu entfernen. Sie müsse die Kette aufsperren, die die Stühle verbindet. Seltsam, denn das Schloss befindet sich fünf Meter entfernt. Mein Hinweis zählt nicht. So wenig wie der Wunsch, einen Espresso zu bestellen. Die Frau mit dem Schlüssel will ihre kleine Macht nicht hergeben, verstanden, hier wirtschaftet eine Unglückliche, die jetzt um 8.53 Uhr ihr Unglück mit mir teilt.
Die toxische Luft vertreibt mich, ich gehe über die Straße, warte stehend. Um neun macht das Postamt hier auf, wo ich ein nach Wochen gefundenes Päckchen abholen soll. Zeit genug, um der Unglücklichen zuzuschauen, wie sie gleich wieder um sich schießt. Ihr Giftbecher scheint randvoll zu sein: Eine ältere Dame fährt mit ihrem Rollstuhl nah an ein Tischchen des Cafés heran, ganz offensichtlich, um den Sonnenplatz zu genießen. Mit einem Kaffee vermutlich. Doch auch Behinderte haben hier keine Chance. Die Kriegerin verweist sie eiskalt auf die Tatsache, dass das Café noch geschlossen hat. Ich schaue auf die Uhr, noch drei Minuten geschlossen. Jedes Gramm Macht zählt.
In der Soziologie gibt es den Begriff des »eskalierenden Commitments«: Man hat in etwas investiert und kann nicht mehr aufhören – selbst wenn man spürt, dass es falsch läuft –, weiter zu investieren. Statt frühzeitig und mit überschaubarem Verlust auszusteigen.
So etwas Ähnliches passiert hier – im übertragenen Sinn. Mag sein, dass die Missgelaunte eine leise Stimme hört, die ihr rät, von ihrer Boshaftigkeit zu lassen und einen friedlicheren Gang einzulegen. Aber sie ist in Fahrt, ihr Unmut – über was nur? – ist nicht zu bremsen. So geifert sie, haltlos ihrer Laune ausgeliefert.
Früher hätte ich gepöbelt, ihr zurückgegeben, was sie verdient. Ja, mich gefragt – Prolo, ich weiß –, ob sie schlecht gevögelt wird. Oder zu wenig. Heute kann ich an mich halten, auch weil ich Leute kenne, die gut und viel gevögelt werden und trotzdem eher trostlos durchs Leben gehen. Die Gründe müssen folglich tiefer liegen als in einem dürftigen Sexleben.
Als ich von Paris nach Berlin zu Fuß und ohne Geld wanderte, kam ich durch eine Kleinstadt, wo es ein Büro gab, in dem les gens du voyage – das wären die Roma, die Sinti und alle ohne festen Wohnsitz – einen Gutschein über zehn Euro bekamen. Den konnten sie im nahen Supermarkt einlösen. Nur Alkohol, den gab es dafür nicht.
Die Frau hinter dem Schreibtisch war ausgesprochen höflich, ja, durchaus bekümmert. Ich sah bereits aus wie jemand, der auf der Straße lebte. Etwas Wehmütiges war um sie. Was wahrscheinlich nichts mit ihrem Beruf zu tun hatte, nichts mit dem, was sie jeden Tag sah. Nein, vielleicht war es die Traurigkeit einer kaputten Liebe oder der Verlust eines Menschen. Oder die Aussicht auf eine böse Krankheit. Klar, nur Mutmaßungen.
Unversehens war ich, bildete ich mir ein, gerührter von ihr als sie von mir. Und wollte plötzlich Magier sein, der nur das eine erlösende Wort aussprechen müsste: um diese Frau zu retten, ja, sie in einen Zustand von Heiterkeit und Leichtigkeit zu zaubern.
Jener harmlose Größenwahn hat mich seitdem nicht verlassen. Obwohl es das eine Wort nicht gibt. Dennoch, bisweilen träume ich. Auch heute, als ich dem Café-Drachen zusehe, wie er schwer beladen den Tag beginnt.
Ich gehe zur Post, die endlich öffnet. Doch wir dürfen nicht hinein, weil eine Post-Frau uns wegscheucht: »Treten Sie zurück, ich will die Tür öffnen.« Ein überraschender Satz, denn niemand steht im Weg. Okay, die zweite Unglückliche, noch eine, die kommandieren muss, um sich am Leben zu fühlen.
Wie heißt es in Morning has broken von Cat Stevens: »Mine is the sunlight, mine is the morning.« Aber hier haben wir zwei, die vom Sonnenlicht an einem hellen Morgen nichts wissen wollen. In ihren Köpfen ist es düster, traurig bewölkt.
Ein Tagtraum fällt mir ein, der mich seit Jahrzehnten begleitet: Ich bin wieder einmal als Master of the Universe unterwegs und kann bestimmen, dass ein »Vorfall« wiederholt wird. Freilich unter entschieden angenehmeren Voraussetzungen. Wobei die ungute Fassung verschwindet, automatisch überschrieben wird: So hätten wir eine Frau, die mich auf der Terrasse freudestrahlend begrüßt, und eine andere Frau, die schwungvoll mit einem Lächeln die Tür aufsperrt, und einen Mann, mich, der als Weltmann mit einem bestechend coolen Grinsen ein Problem aus der Welt schafft.
Wie kindlich, denn wie niemand unter den acht Milliarden kann ich Geschehenes ungeschehen machen. Die Vergangenheit bleibt, unverbesserlich. Und dennoch, ich kann versuchen, sie neu zu inszenieren. Wie heute, wie jetzt, da ich gerade stark bin, nicht gekränkt, nicht nachtragend, dafür himmelblau bestrahlt und federleicht: Ich gehe mit einem friedlichen Körper zurück ins Café, mit einem Gesicht, das nichts als Wohlwollen signalisiert. Und die Unwirsche sieht mich, ist smart und versteht sogleich mein Angebot. Gewiss, ihr Lächeln ist noch scheu, noch nicht sicher, ob es dem Frieden trauen soll.
Als sie den Espresso und das Baiser bringt, tun wir so, als wäre vor fünfzehn Minuten nichts geschehen. Okay, das entscheidende Wort habe ich noch immer nicht entdeckt, aber bisweilen gelingt mir eine Mühelosigkeit, die andere von ihrer Mühsal befreit. Ein paar Momente lang. Immerhin.
Corona
Irgendwann, nachdem der zweite Lockdown beschlossen war, fiel mir ein Satz von Woody Allen ein: »Die Ewigkeit kann lang dauern, besonders dem Ende zu.«
Zurück auf Anfang. Als es März 2020 ernst wurde mit der Pandemie, hatte ich einen Unfall in Paris, wo ich lebe. Ein Autofahrer war so freundlich und drängte mich, den harmlosen, den geruchlosen, den lautlosen Radfahrer, zur Seite. Mein rechtes Knie knallte auf das Trottoir, und ich lag flach. Der Täter gab unbekümmert Gas und verschwand.
Knie und Wade verbogen sich die folgenden Tage. Ich reiste nach Deutschland, um mich untersuchen zu lassen. Da inzwischen die Krankenhäuser verpflichtet waren, »nicht absolut notwendige« Eingriffe zu verschieben, musste ich – bald ausgerüstet mit Orthese und zwei Krücken – betteln gehen. Um eine barmherzige Seele zu finden, die bereit war, mich zu operieren. Da eine konservative Heilung nicht mehr infrage kam. Zu heftig die Verletzung. Ich fand den Barmherzigen, der meinen Fall für »absolut« erklärte, denn weiteres Warten hätte bleibende Schäden bedeutet.
Fünf (!) Wochen nach der Kollision kam ich unters Messer, mit Vollnarkose. Um drei Stunden später das Krankenbett wieder frei zu machen. Ich war entlassen.
Sorry, ich hatte mich getäuscht, schon jetzt begann die Ewigkeit.
Einen Tag und eine Nacht hielt das Knie still, noch anästhesiert. Dann näherte ich mich dem ersten Kreis der Hölle. Noch keine Hölle, aber entschieden näher dran. Die Aussage eines befreundeten Chirurgen fiel mir ein: dass Knie besonders begabt sind für Schmerzen.
Acht (!) Monate zog sich das hin, täglich und nächtlich sediert mit Diclofenac und Tilidin. Unmöglich herauszufinden, ob bei der Operation gepfuscht worden war oder nicht. Die nächste Komplikation: Ich war mitten im Schreiben eines neuen Buchs, mit einem Abgabetermin Anfang November. Am Schreibtisch sitzen ging nicht mehr, ich zog um auf den Futon. Mit dem Rücken an der Wand konnte ich das Bein ausstrecken, vor mir ein kleines Tischchen. Legte ich mich in die Badewanne, musste die Freundin mich herausheben: 75 Kilo, begleitet von lautem Geschrei.
Ich will nicht klagen. Bisweilen – wer weiß, warum – gab die Pein für eine Stunde Ruhe, und ich war imstande, die Seligkeit zu genießen, die ein Opioid dem Körper schenken kann.
Corona war gnädig mit mir, nie erreichte das Virus meinen Rachen. Trotzdem, die Kollateralschäden waren beträchtlich – vom Reiseverbot nicht zu reden. Von den drei weiteren Skandalen gewiss: die geschlossenen Cafés – wo sonst täglich lesen, sprich, anderer Leute kluge Fundsachen entdecken? Die verriegelten Kinos – wo sonst so folgenlos denken, fühlen und weinen dürfen? Und der größte Skandal: das Auftreten jener Hanswurste, die unter dem Pseudonym »Querdenker« lautstark bewiesen, dass man hirntot sein und sich gleichwohl bester Gesundheit erfreuen kann.
Ich hielt durch, das Manuskript landete rechtzeitig auf dem Schreibtisch der Verlegerin, und ich humpelte – Orthese am Bein und die Krücken in beiden Händen – brav und regelmäßig zum Physiotherapeuten. Und hörte nicht auf, trotz gemeiner Verrenkungen, mich jeden Tag eiskalt zu duschen. Vor langer Zeit hatte ich beschlossen, an keinem Tag Opfer sein zu wollen.
Wem ich diese Sturheit verdanke? Den acht Monaten, die ich als junger Kerl in einem japanischen Zenkloster verbracht hatte. Mein Ziel war, weder Buddhist zu werden noch das Göttliche zu finden. Ich versuchte etwas viel Anstrengenderes, ich wollte mein Leben in den Griff bekommen.
Aller Anfang war schwer, auch damals in Kyoto. Denn sogleich musste man damit beginnen, sich von einer seiner Lieblingsbeschäftigungen zu trennen: sich rastlos in Selbstmitleid zu baden und blindlings andere für die eigenen Abstürze haftbar zu machen. Jetzt hieß es, das Spiel der Infantilisierung zu unterbrechen und zu lernen, als Volljähriger aufzutreten. Als einer, der Verantwortung übernimmt für das, was er sagt, und für das, was er tut. Das würde dauern, hieß es. Und es dauerte.
Zen ist nicht für jede und jeden die Antwort. Ein Amerikaner, nur wenig älter als ich und der zweite Ausländer im Kloster, nahm sich in seiner Zelle das Leben. Natürlich war die Praxis der Meditation nicht der Auslöser der verzweifelten Tat. Philip war schon mit Depressionen hier angekommen. Und dagegen braucht es andere Mittel, kein stilles Sitzen auf einem Kissen erlöst aus einem solchen Leid. Im Gegenteil, das Maß an Strenge und die endlosen Stunden vollkommen verschwiegenen Versenkens werden die Einsamkeit verstärken.
Viele Jahre später sah ich Bohemian Rhapsody, den grandiosen Film über Freddie Mercury. In einer Szene gibt der Vater dem jungen Freddie drei Regeln mit: »Good thoughts, good words, good deeds«, was in Zen-Sprache übersetzt weniger moralisch klingt: Klare Gedanken, klare Worte, klare Handlungen.
Wer exakt denkt und das Gedachte exakt formuliert, darf damit rechnen, dass er in einer Weise handelt, die seinen Vorstellungen und Wünschen am nächsten kommt. Natürlich, auch Intuition kann helfen. Aber ich bin nicht sonderlich begabt dafür, ich traue mehr dem Verstand.
Corona hat gezeigt, wo man landet, wenn man das Denken einstellt und »gefühlten Wahrheiten« vertraut: auf der Intensivstation oder in der Urne.
In den langen Monaten der Plage erinnerte ich mich oft an ein Wort des Roshis, des Abts im Kloster. Nicht, dass ich jeden Tag stark genug gewesen wäre, um es mit dem Satz aufzunehmen. Doch er diente als Vademecum, als sanfte Peitsche. Damit ich nicht zum ambulanten Tränensack mutiere: »Die meisten begreifen alles, was ihnen widerfährt, entweder als Segen oder als Fluch. Manche sehen darin eine Herausforderung.«
Das Handwerk des Lebens
Vor einiger Zeit stand ich vor meinem kambodschanischen Schuster. Mit der Bitte, die Stiefel neu zu besohlen. Vor einem Jahr hatten wir uns das letzte Mal gesehen. Wir mögen uns, er hat Witz. Ich setzte mich auf den Kundenhocker und fragte ihn, wo er die vergangenen zwölf Monate gewesen sei. Und mit einem feinen Sinn für Lakonik antwortete Song: »Here.« Die Nächte zu Hause bei Frau und vier Kindern. Und die Tage hier, auf einem Trottoir in Phnom Penh. Wäre ich achtsamer, hätte ich mir die Frage sparen können. Wo sonst sollte der arme Teufel sein Leben verbringen? Wenn nicht täglich auf seinen zwei Quadratmetern, mitten in der hübsch abgasversauten Hauptstadt?
Himmel, habe ich ein Glück! Das ich gewiss nicht verdiene und für das ich mich in keinem Moment schäme. Und nicht eine Sekunde lang bemitleide ich Song. Wie stets strahlt er Gleichmut aus, so eine lässige Zufriedenheit. Bin mir nicht sicher, wer beneidenswerter ist, er oder ich?
Ich will mich nicht beschweren. Ich darf in der Welt herumfahren und nach Frauen und Männern suchen, die mir einen Blick in ihre Seele gewähren. Viel inniger kann es zwischen zwei Wildfremden nicht werden. Jemand erzählt aus seinem Leben, und ein anderer hört zu.
Mir ist allemal recht, wenn Sprache Gefühle auslöst – auch die bitteren, auch die todtraurigen. Ich will nicht ausweichen, keinem Wort, keinem Gefühl. Ich mag Menschen, die mich verwirren, die clever auf meine Sicherheiten zielen.
Mich nach jeder Begegnung eine Spur intelligenter bewegen: Wer könnte sich da beklagen?
Doch bisweilen täusche ich mich: Da sitzt ein Flachkopf, der nur Flachheiten preisgibt. Man bohrt, man bohrt weiter, dennoch, nur Holzwolle kommt zum Vorschein. Dann verdufte ich. Alles ist willkommen, nur kein Geleier aus 1001 Plattheiten. Wie sagte es Jack Kerouac? »Life is holy and every moment is precious.« Den Satz hat er mit der Keule geschrieben. Viele haben ihn noch nie gehört.
Ob Sprache jene aufwecken kann, die schon tot sind, bevor sie offiziell begraben werden? Zweifel sind erlaubt.
Irgendwann schreibe ich über sie, über all die, die sich tatsächlich trauen, auch ihre Widersprüche, die Niederlagen und dunklen Zonen auszuhalten. Die sich nichts weglügen. Und erkenne mich wieder. Nicht in allem, aber fraglos hie und da. Jeder Mensch ist mein Niveau.
Vor nicht langer Zeit, während ich in meinen Mac tippte, erinnerte ich mich an eine Zeile, die auf der Fassade einer französischen Schule stand: »Schreiben heißt das Glück suchen.« Von wegen, schreiben heißt das Glück finden.
Beide Arten von Glück sind ein Geschenk. Einmal die Nähe von Fremden, die mich an ihrem Schicksal teilhaben lassen, einmal sinnieren und Schreiber sein dürfen – hinter verschlossener Tür, unerreichbar, fern jeder Stimme. Nur das unhörbare Summen des Computers.
Habe ich schon erwähnt, dass ich ein Weltmann bin? Ah, das pompöse Wort hat bei mir eine durchaus bescheidene Rechtfertigung: Ich bin es, weil ich in die Welt verliebt bin. Wie jeder sich einen Weltmann (oder eine Weltfrau) nennen darf, der mit einem Freundschaftsvertrag in der Tasche loszieht. Die Erde als Freund.
Der Satz klingt wie ein Märchen, denn unser Ein und Einziges, unser Planet, hat eine Menge Feinde, unheimliche Feinde. Die vor Urzeiten beschlossen haben, dass zu viel niemals genug sein kann. Gnadenloses Wachstum als Antwort auf die Leere in uns, die wir nicht loswerden.
Wer heute seinen Rucksack schultert, der muss auch die klaffenden Wundstellen verkraften, die Mondlandschaften, die Betonwüsten, die dahinsiechenden Wälder, die Meere, die Flüsse, sie alle ächzen unter einer namenlosen Gier. Der unsrigen.
Ich will kein Robinson Crusoe sein, der sogleich plant, seine Insel zu kolonisieren. Will lieber Marco Polo nacheifern, der stets nur zeitweise Gast war, nie Beutemacher, nie Aggressor, nie einer, der erobern musste. Er wollte nur schauen, nur wissen, nur begreifen. Und immer staunen. Über jedes Weltwunder, an dem er vorbeikam.
Moral predigen ist ätzend. Nicht vieles ödet rabiater an als Texte, die mit dem erigierten Zeigefinger verfasst wurden. Wer will schon belehrt werden? Vielleicht funktioniert verführen. Mit Worten, die ganz nebenbei, eher nachlässig eine Idee verbreiten, die zu mehr Sanftmut anstiftet. Damit wir abrüsten und weniger radikal auf die Natur einprügeln.
Ich versuche stets, meinen pädagogischen Eros zu zügeln. Und scheitere, oft. Wie jetzt: Wer immer hier mitliest, messieurs-dames, ich will Sie zur Liebe zur Welt und zur Liebe zum Reisen überreden. Sagen wir, so reisen, dass die Welt dabei nicht vor die Hunde geht. Früher hätte ich an dieser Stelle ein paar Hardcore-Regeln abgefeuert, überzeugt, dass Zorn die Zustände ändert. Wie vermessen, wie müßig. Heute verstecke ich mich hinter einem, der es besser kann als die meisten von uns, hinter Antoine de Saint-Exupéry. Der Franzose, der Schriftsteller (Der kleine Prinz), der Verwegene und Pilot, der mit vierundvierzig Jahren bei einem Aufklärungsflug vor der Küste von Marseille von einem deutschen Jagdflieger abgeschossen wurde. Er notierte einmal: »Wenn du ein Schiff bauen willst/So trommle nicht die Menschen zusammen/Um Holz zu beschaffen/Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen/Sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.«
Das ist umwerfend klug. Und ohne einen Funken Wut geschrieben. Was für künftige Seeleute gilt, soll auch für alle acht Milliarden Einwohner der Erde gelten: Wer seinen Wohnort liebt, unseren unvergleichlichen Globus, ihn achtet, sich nach ihm sehnt, der wird ganz selbstverständlich mit Respekt und Bewunderung mit ihm umgehen. Wem derlei Liebe fehlt, der wird über ihn herfallen, der wird ihn sich – bereits in der Bibel steht der Aufruf zu diesem Verbrechen – »untertan« machen. Und Untertanen behandelt man schäbig, man beutet sie aus, denn ihr Wohl verspricht null Mehrwert.
Die einzige Gier, die keine Spur der Verwüstung hinter sich herzieht, ist die Neugier. Sie will nicht haben, sie will sein, will näher kommen den Myriaden Rätselhaftigkeiten.
Wir lesen oder hören, was wir durchaus bejahen. Heimlich geben wir dem Autor oder der Autorin recht, die uns auf dunkle Ecken – Verzagtheit, Bequemlichkeit, Angst – in unserem Leben hinweisen. Er (sie) spricht etwas aus, was uns alle angeht. Heftiger als uns lieb ist. Aber wir schieben den Mahnruf weg, Ausflüchte sind prompt zur Hand, und der Teufelskreis der Routine lässt uns nicht los. Eisern. Eisern lang. Bis wir am Ende unserer Tage in Tränen ausbrechen über die Sehnsüchte, die wir stillschweigend begruben. Long ago.
Zuletzt die Geschichte von einer, die es sich anders überlegte. Grandios anders. Eine gute Geschichte, die tatsächlich davon erzählt, was uns Rilke schon vor Urzeiten aufgetragen hat: »Du musst dein Leben ändern!«
Und das beginnt mit der Sprache. Sprache als Herzschrittmacher. Und sei es der innere Monolog, bei dem wir mit uns selbst reden. Wo ein Mensch unhörbare Pläne schmiedet. Weil er mit dem, was er an Leben hat, nicht zufrieden ist. Wer nun über genügend Entschiedenheit und Willen verfügt, der setzt um, was er sich ausgedacht hat. Jeder kennt das mitreißende Gefühl, wenn aus vagen Worten Wirklichkeit wird, wenn man imstande ist, eine über viele Jahre eingeschlagene Richtung zu verlassen und sich woanders hinzutrauen. Mit der unwiderruflichen Absicht, dort anzukommen, wo es lebensfroher zugeht, sinnlicher, mit gewiss weniger Stumpfsinn.
So ist nun die Stunde von Mariella gekommen, die mir eine erstaunliche Mail schrieb, ihr erster Satz: »Sie haben mich infiziert, Herr Altmann.« Das ist kein schöner Anfang, aber ich sollte gleich erfahren, dass sie ihn ganz und gar bildlich meinte. Nun, sie habe, so fuhr sie fort, ein Buch von mir gelesen und dieses Buch – eine Reise durch Indien – habe ihr »den Rest gegeben«. Es sei das Streichholz gewesen, »um die Lunte anzuzünden«. Die das Fass in ihr sprengte, ein Fass voller Wut und Depressionen und beschädigter Träume. Bestimmte Absätze seien »wie Peitschenhiebe« auf ihr gelandet.
Okay, der Autor infiziert, gibt den Rest, legt Feuer und peitscht seine Leserinnen und Leser!
Auf jeden Fall habe sie drei Tage nach der Lektüre angefangen, ihr altes Leben abzureißen, sprich, konkrete Schritte unternommen, um allem Unglück zu entrinnen: der faden Stadt, der faden Ehe, dem faden Beruf. Und ein paar Monate später war sie alles los, auch das Haus – auch fad. Und ging davon.
Mariellas Mail kam mit einem Foto. Da sah man die vielleicht Fünfzigjährige in der Hütte ehemaliger Menschenfresser sitzen. Mitten in Borneo. Sie lächelte triumphierend. An den Rand des Fotos hatte sie ein Zitat von Kurt Tucholsky gekritzelt (es stand im Indienbuch): »Und höre nachts die Lokomotiven pfeifen, sehnsüchtig schreit die Ferne, und ich drehe mich im Bett herum und denke: Reisen …«