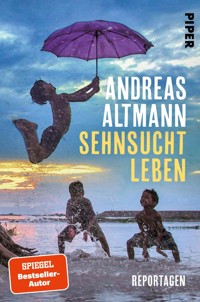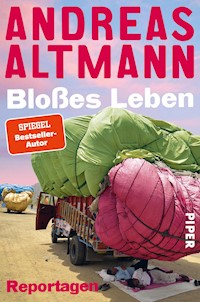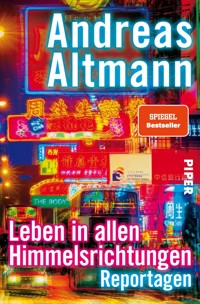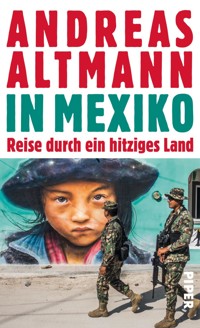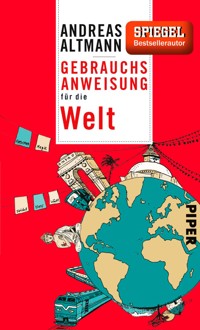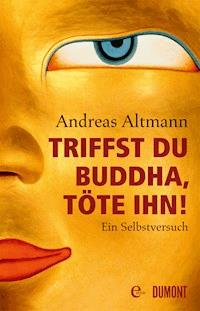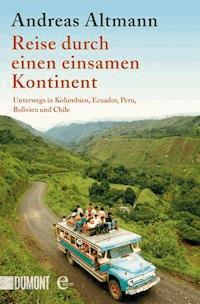
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ob Señora Botero de Mejia, eine Greisin, die durch die Straßen von Bogota zieht und Nahrungsmittel an die Ärmsten verteilt, ob der Schuhputzer Xavier in Ecuador, der sich für die Geheimnisse der Sprache interessiert, ob eifersüchtige Rentner oder strenggläubige 16-jährige Mütter: Andreas Altmann destilliert aus ihren Lebensgeschichten ein unsentimentales Porträt des heutigen Südamerika und zeigt, dass Gier und Zerstörung nur eine Handbreit von Barmherzigkeit und Liebe entfernt sind. So trifft er in Cali auf unbeugsamen Lebensmut bei einem Fußballspiel, in dem blinde Spieler einem klingenden Fußball hinterherjagen. In Ayacucho begegnet er dem Mitgefühl in Person der 78-jährigen Angelica, die mit ihrer Organisation Anfasep den Angehörigen der Opfer aus den peruanischen Terrorjahren hilft. Und in Quito lernt er, was Einsamkeit bedeutet, als er im Frauenzuchthaus „El Inka" die zu acht Jahren Haft verurteilte Deutsche Anna besucht. Dabei mischt sich in seine Wut über den Zustand der Welt immer neu seine Liebe zu den Menschen, deren Lebenswille und Schönheit. Andreas Altmann hat ein wunderbar intensives, witziges und nachdenkliches Reisebuch geschrieben, fesselnd bis zur letzten Seite.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2010
Sammlungen
Ähnliche
»Altmann wertet nicht, er fühlt mit, er sieht das Elend, aber er sieht auch Witz, Schönheit, Poesie.« Elke Heidenreich über ›Weit weg vom Rest der Welt‹ Ob Señora Botero de Mejia, eine Greisin, die durch die Straßen von Bogota zieht und Nahrungsmittel an die Ärmsten verteilt, ob der Schuhputzer Xavier in Ecuador, der sich für die Geheimnisse der Sprache interessiert, ob eifersüchtige Rentner oder strenggläubige minderjährige Mütter: Andreas Altmann destilliert aus ihren Lebensgeschichten ein unsentimentales Porträt des heutigen Südamerika und zeigt, dass Gier und Zerstörung nur eine Handbreit von Barmherzigkeit und Liebe entfernt sind. Dabei mischt sich in seine Wut über den Zustand der Welt immer neu seine Liebe zu den Menschen, deren Lebenswille und Schönheit. Andreas Altmann hat ein wunderbar intensives, witziges und nachdenkliches Reisebuch geschrieben, fesselnd bis zur letzten Seite. Andreas Altmann
Andreas Altmann
REISE
DURCH EINEN EINSAMEN KONTINENT
Unterwegs in Kolumbien,
Ecuador, Peru, Bolivien und Chile
Für Annlie, die nie aufhört, mich zu beschenken
Für J., den Wunderknaben
Ich habe die schwerste Sünde begangen,
die ein Mensch begehen konnte:
Ich war nicht glücklich
Jorge Luis Borges
Die Menschen sind das Interessanteste von allem
David Hockney
Es gibt nichts Schöneres als das Leben
Teófilo Stevenson
VORWORT
Die erste Seite soll warnen. Vor einer Wut und vor einem Fehlkauf. Damit keiner auf die seltsame Idee kommt, er hält einen Reiseführer in Händen. Um seine Ferien zu planen. Kein Hotelbett wird getestet, keine Klobrille inspiziert, kein Wort fällt über den Machu Picchu, kein Museum und kein Heiligtum kommen vor, keine Beschreibung »farbenfroher Märkte« soll einschläfern. Nie und nimmer Folklore. Bücher darüber gibt es bereits, eisenbahnwaggonweise, als Eintopf, eher fad.
Ich will es anders versuchen. Ich reise durch den Kontinent wie einer aus dem 21. Jahrhundert. Wo immer ich bin, bin ich vor Ort, bin da. Und bin gleichzeitig vernetzt. Ich höre eine Radionachricht, ich lese die Zeitung, irgendwo flimmert ein Fernseher, E-mails warten. Sie alle lösen Querverbindungen aus, Hintergedanken, bringen den Fleck, an dem ich mich gerade aufhalte, in Verbindung mit der Welt. Jeder Moment zeigt mir, dem Fremden, wie sehr ich mich von den anderen unterscheide. Und wie sehr wir uns ähneln.
Die seltsamsten Namen tauchen in dem Buch auf: der heilige Franziskus, Brad Pitt, Gandhi, Rafael Alberti, Angela Merkel, Prinz Charles, Michael Jackson, Josef Mengele, Pamela Anderson, Saint-Exupéry, Robert Redford, Eric Clapton und Paul Schäfer, der Mann mit dem Glasauge. Ein paar Namen von vielen. Keiner von ihnen ist Südamerikaner. Und dennoch haben sie mit dem Kontinent zu tun. Auf direkte, auf indirekte, auf verschlungene Weise.
Das gräuliche Wort global klingt auf einmal klug. Der Reisende ist ein Globus. Er ist in Kolumbien, und im selben Augenblick trägt er in seinem Kopf die Welt mit sich herum. Das »naive« Reisen ist vorbei, vorbei seit der Erfindung der modernen Reportage, modern im Sinne von überall lesbar, hörbar, sehbar. Herodot war auch Reporter, aber erst 2400 Jahre nach seinem Tod gelangten seine Aufzeichnungen über den Atlantik hierher. Heute muss der Reisende und Gejagte rasender Zeiten froh sein, wenn er sein Bett erreicht, ohne von einem gerade stattgefundenen Massaker erfahren zu haben. Am anderen Ende des Planeten.
Deshalb der Warnruf. Es wird nicht beschaulich, es wird anstrengend. Wie das Leben zurzeit, wie die Welt. Ich will reisen (und schreiben) wie einer, der sich auf Zumutungen einstellt. Wie einer, der ein Land nicht als Solarium begreift, sondern als Territorium, dessen Einwohner ihm etwas beibringen. Über sich, über ihn, über den Stand der Dinge. Alles, was passierte, alle Seitenblicke, Szenen, Aufregungen, Annäherungen, Nervenproben und Innigkeiten, löste in mir etwas aus. Eine Freude, einen Zorn, einen Fluchtgedanken, eine Gegenmaßnahme, ein Verlangen nach mehr, ein hartnäckiges Staunen. Jeder Mann, jede Frau, die mir über den Weg liefen, machten mein Leben reicher. Von keinem bin ich weggegangen ohne das Gefühl, beschenkt worden zu sein. Und wäre es mit einem Blick auf seine Wunden, sein schwärendes Herz. Oder seine Begeisterung, seine Sehnsucht nach Leben.
Gabriel García Márquez sagte einmal: »Für die Europäer ist Südamerika ein Mann mit Schnauzbart, Gitarre und Revolver. Sie verstehen uns nicht.« Natürlich verstehen wir sie nicht, aber dennoch begreift der aufmerksame Besucher, dass der Erdteil so viel mehr bietet als drei trostlose Klischees. Er bietet so ziemlich alles.
NACH SÜDAMERIKA
Die Reise beginnt mit einem Knall. Ich sitze in einem Café des Pariser Flughafens und ein Polizist stürmt herein, ruft streng: »Dehors!«, raus! Fluchtartig verlassen wir den Ort. Minuten später fliegt ein Koffer in die Luft, der verdächtig lang allein herumstand. Gesprengt von Spezialeinheiten. Augenblicke danach kommt der Besitzer gerannt, die Explosion hatte ihn von der Toilette geholt. Da er sich laut beschwert, können alle mithören. Trotz des offensichtlichen Pechs ist das eine lustige Geschichte. Ein Mann rennt von einer Kloschüssel auf seinen zerfetzten Koffer zu.
Ein Knall auf dem Weg nach Kolumbien, irgendwie klingt das stimmig.
Flug mit Air France. Das Übliche, enge Sitze, wenig Luft, Videokonsole. Fliegen ist grausam, nur abstürzen ist grausamer.
Mein Nebenmann liest, ich störe und frage nach seinem Buch. Er zeigt lächelnd auf den Titel: Von der Kunst, Fehler zu machen. Wir reden. Der Mensch ist Dozent, Geisteswissenschaftler an einer deutschen Universität. Nach den ersten zehn Worten schließe ich die Augen. So wärmend ist seine Stimme, so entwaffnend. Als er erfährt, dass ich in Paris wohne, erzählt er eine Geschichte, die man sogleich glauben will: Aus beruflichen Gründen musste Thomas M. einst in die französische Hauptstadt. An einer Kreuzung spricht er eine Frau an, lädt sie zum Abendessen ein. Sie lehnt das Angebot ab. An der nächsten Ampel wiederholt er seine Einladung, jetzt sagt sie zu. Zwei Stunden später suchen sie nach einem Hotelzimmer.
Das ist keine Bettgeschichte, das ist eine Liebesgeschichte. Seit drei Jahren. Ich kann mir vorstellen, warum Viviane nachgab. Zwischen den beiden Häuserecken spulte sie mehrmals die Stimme des Fremden ab. Und ließ sich wärmen und einlullen. Andere brauchen Geld, einen strahlenden Körper, Macht. Nicht Herr M., er braucht nur den Mund aufzumachen, und eine schöne Frau hängt sich bei ihm ein.
Zwischenstopp in Atlanta. Der Passbeamte fragt: »Beabsichtigen Sie, sich an kriminellen oder unsittlichen Handlungen zu beteiligen?« Ich liebe solche Fragen, denn nie würde man sie glauben, begegnete man ihnen nicht persönlich. Idiotismus kann erheitern, ich antworte: »Not today«, und darf passieren.
KOLUMBIEN
Nachts im Hotelbett in Bogotá, ein Bett, an das man nur durch eine Stahltür herankommt, lese ich noch die Zeitung. El Tiempo berichtet, dass die kolumbianische Hauptstadt das Jahr mit fünf Prozent Zuwachs abschließt. Fünf Prozent mehr Mord und Totschlag. Auf der nächsten Seite steht ein Bericht über eine 82-Jährige, die ab sechs Uhr morgens durch ihr Stadtviertel zieht und armen Schluckern etwas zum Essen bringt, tagaus, jahrein. Ich werde irgendwann begreifen, dass die beiden Meldungen viel von diesem Land berichten, ja sein Herz beschreiben: das voll mörderischen Zorns ist und grausam und kalt sein kann. Und so verwirrend oft großzügig ist, mitfühlend, fürsorglich.
Vor dem Einschlafen werfe ich noch einen Blick in das Zimmer, sauber, einfach, ein Bett, ein Stuhl. Ich frage mich, warum ich mir das antue. Ich vermute, dass ich meine Reflexe überprüfen will. Jenen Reflex vor allem, mit wenig leben zu können. Oder ob ich schon einknicke und nach Komfort Ausschau halte, nun endlich ein Wohlfühl-Kasper geworden bin, den keine andere Leidenschaft mehr treibt, als sich ununterbrochen wohlzufühlen.
Beim Frühstück treffe ich Seymour aus Wisconsin, ein Autoschlosser, der sein Leben zwischen Werkstatt und Welt aufgeteilt hat. Irgendwo dazwischen hat er noch Platz für seine Frau. Dennoch ließ er sein Mobiltelefon zu Hause, sagt: »Es gibt ein Menschenrecht auf Allein-sein-Dürfen.« Lange Zeit hat der 52-Jährige mit sich gekämpft, bevor er hierher kam, ließ sich immer wieder einschüchtern von den Gräuelberichten der Presse. Gerade hat seine Regierung vor Reisen durch Kolumbien gewarnt. Diesen Aufruf quittiert der Mechaniker mit dem Satz: »Ich bin froh, dass ich nicht mehr hinhöre. Wir sterben nicht an den Gefahren, wir sterben an unserer Angst vor diesen Gefahren.« Ich stecke die Mailadresse des Handwerkers ein. Brauche ich einen klugen Gedanken, werde ich mich melden.
Ich wohne in der Nähe von La Candelaria, dem ältesten Teil der Stadt, er erinnert noch am ehesten an ihre koloniale, 450 Jahre alte Vergangenheit. Weiter nördlich liegen das Geld, das Businesszentrum, die noblen Unterkünfte. Im Süden wuchern die berüchtigten barrios, die Verhaue der Armen und Sprachlosen. In den letzten 50 Jahren hat sich die Bevölkerung verzwanzigfacht. Acht Millionen sollen es heute sein.
Ich gehe in die Kirche von San Francisco, er ist mein Superheiliger, die Grenzenlosigkeit seiner Liebe habe ich noch immer nicht verstanden. Ein Priester spricht gerade, man hört sofort hin. Kein fetter Pfaffenton, dafür frisch, genervt, aggressiv, die ersten Worte: »Vivimos en tiempos terribles«, wir leben in schrecklichen Zeiten. Er meint es ganz irdisch, ganz kolumbianisch. Die Gewalt ist seit 200 Jahren das Leitmotiv dieses Landes. Durch das dunkle Schiff spazieren Sicherheitsbeamte, ihre Schlagstöcke werfen Schatten an die Wände, viele Kerzen leuchten.
Eine Frau rückt neben mich. Sie ist stämmig, vielleicht 45. Kurz zuvor, sagt sie, habe sie in einem Heftchen mit Gebeten gelesen, inständig die Mutter Gottes angefleht, doch endlich »Kolumbien von den Terroristen zu säubern«. Wir flüstern, sie will wissen, wie ich dazu stehe. Ich frage Señora Flor, warum nach so vielen Gebeten »zur Jungfrau aller Jungfrauen« die Terroristen noch immer wüten. Darauf die erstaunliche Antwort: »Weil wir nicht stark genug an sie glauben.« Sie, Bianca Flor, glaube: »Hackt mir heute jemand das linke Bein ab, dann wird mir die heilige Maria morgen ein neues nachwachsen lassen.« Für Augenblicke will man einen Menschen beneiden, dem ein so siegessicherer Wahn durchs Leben hilft.
Vor dem Tor zur Kirche sitzt eine Bettlerin, ihr fehlen ein Arm und ein Bein. Sie sitzt seit 13 Jahren hier, erzählt sie, und noch immer wartet sie auf zwei neue Gliedmaßen. 200 Schritte weiter liegt der Parque Santander, Eisverkäufer, Zeitungsjungen, einsame Gitarristen, sorglose Faulpelze und Taschendiebe ziehen herum. Ich sehe eine Frau auf einer der Bänke sitzen, neben ihr liegt ein Schild, das darüber informiert, dass sie aus der Hand lesen kann, Tarotkarten legen und für jede »limpieza de negocios« zuständig ist, jegliches Geschäft in Ordnung bringt, sei es privater oder beruflicher Natur. Ich setze mich daneben, für 5000 Pesos (zwei Euro) verspricht Alicia, mein Leben aufzuräumen und nebenbei noch die Zukunft zu verkünden.
Zufällig fällt ihr Pappkarton um, die Rückseite ist ebenfalls beschrieben. Da steht, dass die Wahrsagerin die Quecksilber-Produzenten von Chile anklagt, denn Winde hätten das Gift nach Argentinien getragen, und ihre Tochter sei daran gestorben. Alicia zeigt mir ihren Pass, sie wurde 1948 in Buenos Aires geboren. Später habe sie in Harvard Wirtschaft studiert und einen Norweger geheiratet. Mir wird umgehend klar, dass Alicias Geschichten mehr Aufregungen versprechen als ihre Visionen über meine Zukunft.
Nun, inzwischen wäre der Gatte wieder nach Oslo zurückgekehrt, sie habe kein Geld, um ihn anzurufen, und er wisse nicht, wo sie zu erreichen sei. Allerdings besitze sie einen letra de valor von ihm, einen Wertbrief über »1 000 000 US-Dollar«, den er vom Pentagon bekommen hat. Für »Spezialdienste«. Leider geheim! Alicia zieht ein Stück festes Papier aus der Tasche, ganz ähnlich einer Dollarnote. Eine Million steht drauf und ein paar Bibelsprüche, darunter der Hinweis, dass all jene in der Hölle landen, die nicht umkehren. Alicia zeigt auf das Wasserzeichen, alles echt. Das Problem: Sie kann den Scheck nicht versilbern, keine hiesige Bank akzeptiert den Schein.
Jetzt komme ich ins Spiel, ich solle darüber nachdenken, ob ich nicht jemanden in einem US-Geldinstitut kenne, der den Wertbrief einlöst. Alicia würde mir dann eine Vollmacht ausstellen, mit der ich kurz nach Washington düse, die Bündel in den Koffer schichte und den Packen hier in Bogotá abliefere. Die 15 Prozent Kommission für meine Kuriertätigkeit könne ich gleich behalten.
Stunden später gehen wir auseinander. Nicht eine Minute will ich bereuen, habe ich doch bei der Verrückten etwas gelernt: Je versessener ich ihre Widersprüche und Abwegigkeiten hinterfragte, umso versessener delirierte sie. Nie würde ich sie eines Widerspruchs überführen. Denn sie verfügt über der ganzen Menschheit Erfindungsgabe, während ich mit nichts anderem als der kümmerlichen Wirklichkeit antrete.
Ach ja, als wir uns zum Abschied die Hände reichten, trug Alicia mir die Freundschaft an, »pero propia, sin sexo«, aber sauber, ohne Sex. Ich schaute in die Augen der bald 60-Jährigen, die leicht wasserfüßig und heiter in der Sonne saß. Warme Augen, ohne Arg.
Auf dem Weg zu einer Bank fallen mir wieder die vielen Männer in Zweireihern auf, der gute Schnitt, der elegante Umgang ihrer Körper mit dem Stoff. Die Welt der Machos, wie erfreulich sie sein kann. Hier haben sie noch Regeln, hier gibt es noch eine Kleiderordnung. Sie trägt definitiv zur Verschönerung einer Stadt bei.
Als ich das Wechselbüro betrete, hält gerade ein gepanzerter Transportwagen, der Fahrer bleibt am Steuer, der Zweite bezieht mit Pumpgun zwischen Panzer und Gebäude Stellung, der Dritte huscht hinein und kehrt mit gezogener Pistole und dem ihm anvertrauten Geldsack zurück auf die Straße. Dann klettern beide Männer – mit dem Rücken zuerst und nie die Umgebung aus den Augen lassend – zurück in den Fond. Die zwei wissen, dass ihre Bewegungen gut aussehen, auch schmücken die kugelsicheren Westen. Ihr Beruf vermittelt tatsächlich das Gefühl, am Leben zu sein. Weil stündlich gefährdet. Ein leichtes Grinsen auf ihren Gesichtern scheint der Beweis dafür, dass sie das Drama genießen. Mit quietschenden Reifen ziehen sie ab.
Zehn Meter weiter, mitten unter den Bankmenschen, scheint niemand in Gefahr. Papier raschelt, der Fotokopierer summt, Aktenordner werden bewegt, neun todfade Fragen muss ich beantworten, endlich kommt das Geld. Man kann an Sicherheit krepieren. Ein eher leiser Tod geht hier um, mit ihm kann man alt werden.
Ich mache mich auf den Weg zur Biblioteca Nacional. Wie immer auf Reisen muss zwischendurch ein Ort her, an dem Stille herrscht. Zum Schreiben. Bogotá ist ein Kessel, angefeuert von Autofahrern, die irgendwann vergessen haben, die Hupe loszulassen. Ich wandere an Männern vorbei, die ihre Handys in die Luft strecken (ambulante Telefone). Und an Mädchen vorbei, die Zettel reichen (Adressen zum nächsten Hinterhofpuff). Plötzlich fällt mir ein Interview mit Salman Rushdie ein. Er sprach über seine Zeit als Flüchtling vor der Fatwa Komeinis, als er – beschützt von Agenten des Scotland Yard – von einem Versteck ins andere huschte. In diesen Jahren habe er gelernt, »überall zu schreiben«. Das ist eine Kunst.
Ein intensiver Papierkrieg muss sein, auch hier, um die Nationalbibliothek betreten zu dürfen. Sogar die Seriennummer des Mac wird notiert. Dann durch den Metall-Detektor. Als erfreuliche Überraschung steht in der Eingangshalle eine Ausstellung über das Leben des berühmtesten Schriftstellers des Landes, den die Kolumbianer zärtlich »jefe« nennen, Chef. Zwischen den Fotos, Büchern und Zeitungsartikeln finde ich einen umwerfenden Satz von ihm über das Handwerk des Schreibens: »Ich glaube, die revolutionäre Aufgabe des Schriftstellers ist es ...« – während man das liest, vermutet man sogleich, eingedenk, dass Gabriel García Márquez ein »linker« Autor, ja ein Freund von Fidel Castro ist, dass der Satz brav und ideologisch gefestigt weitergeht, etwa: »ist es, die Massen zum Kampf zu mobilisieren« oder »die Erde bewohnbarer zu machen« oder »den Neoliberalismus zur Hölle zu jagen«. Nein, ganz anders, genial trocken heißt die ganze Zeile: »Ich glaube, die revolutionäre Aufgabe des Schriftstellers ist es, gut zu schreiben.« Voll Freude packt man die Klugheit ein und will sie nie mehr vergessen.
In den Lesesaal. An der Rezeption liegt ein Buch aus, reflexartig werfe ich einen Blick hinein. Wobei es zu einem winzigen, phantastischen Zwischenfall kommt: Ich werde höflich, aber bestimmt darauf hingewiesen, dass das Anfeuchten der Fingerspitzen zum Zwecke des Umblätterns untersagt ist. Mit Dankbarkeit nehme ich den Verweis entgegen. Zeitgenossen, die achtsam mit bedrucktem Papier umgehen, verringern die Einsamkeit, sind ab sofort Freunde.
Der Ort des Geistes ist geräumig und fast leer. Jeder von uns drei Anwesenden hat elf Tische für sich. Umstellt von Büchern, die schützen gegen die Anwürfe der Welt. Brüchige Illusion. Nach zwei Stunden hole ich meinen Weltempfänger hervor, über Kopfhörer höre ich ein Gespräch mit einer gewissen Natalia Springer, die ihr neues Buch vorstellt: Desactivar la guerra, den Krieg beenden. Natürlich handelt das umfangreichste Kapitel vom Krieg in ihrem Land Kolumbien. Sie erwähnt mehrmals den Begriff »DDR«: D(esmarme), D(esmovilización), R(eintegración), Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung der Terroristen in die Zivilgesellschaft. Die drei Begriffe als Schlüssel zum Frieden.
Mutige Frau, mutige Kolumbianer. Bedenkt man, dass dieses Volk den Bürgerkrieg erfunden haben könnte, dann scheint die Idee friedlicher Aussichten gewagt. Nach 1817, nach der mit Tonnen von Blut errungenen Unabhängigkeit von Spanien, entstanden zwei politische Parteien: die Konservativen und die Liberalen, über die sich noch immer nicht mit Bestimmtheit sagen lässt, wer von beiden mehr Schrecken und Hoffnungslosigkeit über seine Anhänger und Gegner gebracht hat.
Ging das 19. Jahrhundert blutverschmiert zu Ende, so fing das 20. noch blutroter an. Der Krieg der tausend Tage nahm seinen Lauf, er endete diesmal mit einem Sieg der Konservativen und dem Tod von etwa 100 000 Menschen. Eineinhalb Generationen später begann eine Periode, die heute in den Geschichtsbüchern schlicht la violencia, die Gewalt, genannt wird. Mit 300 000 Leichen, bescheiden geschätzt.
Für alle Untaten gab es konkrete Anlässe, sie allein erklären aber nicht die Impertinenz, mit der sie hier an Mord und Totschlag festhalten. Es scheint, als würden die Väter den Hass an ihre Söhne vererben. Dazu kommt – und kein Fremder entgeht dieser Erfahrung –, dass das kolumbianische Volk über die zügellose Begabung zum Extrem verfügt. In alle Richtungen, hin zum Guten, hin zum Blindwütigen: eben liebesfähig, hassfähig, trunken vor Freude und Trauer, immer getrieben wird von einer irrationalen, so sagen sie selbst, »Begierde zu leben«.
Das physische Auslöschen des Gegners – sei es ein politischer Rivale oder der Liebhaber einer abtrünnigen Geliebten – gilt als Konstante in der Geschichte Kolumbiens. Sie wissen das und schlagen sich an die Brust. Und haben keine Ahnung, wie damit fertig werden.
Es wird noch komplizierter. Mitte der sechziger Jahre entstanden die ersten Guerillagruppen, Rebellen, die sich vornahmen, gegen die rabiaten Ungerechtigkeiten in diesem (stinkreichen) Land zu kämpfen: Die Armut der einen und der schamlose Luxus der wenigen, die gedemütigte Landbevölkerung und jene, die sie demütigen, standen sich gegenüber. Der Kampf um eine »bessere Welt« – bescheidener wollten es die Guerilleros nicht formulieren – nahm seinen Anfang.
20 Jahre später wurde Kolumbien Drogen-Export-Weltmeister und aus tapferen Empörern wurden – heute tödlich miteinander verfeindete – Terroristen: Die FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, etwa 18 000 Mann) und die ELN (Ejército de Liberación Nacional, etwa 4000 Mitglieder), die beiden noch heute aktiven Gruppen, säen den Terror, finanzieren mit dem Handel von Kokain ihren Wahn von einem sozialistischen Kolumbien. War einst der Campesino ihr Lieblingsmensch, so avancierte der Bauer jetzt – jeder Bauer, der sich weigerte, Kokafelder anzubauen oder Unterschlupf zu gewähren – zum bevorzugten Mordopfer.
Noch verwirrender: Der Bettelarme hatte (und hat) nur dann eine Chance, durch einen Genickschuss der Revolutionäre umzukommen, wenn er bis dahin den Nachstellungen der AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) entkommen war. Die paramilitares, so ihr inoffizieller Name, entstanden als rechte Gegenbewegung zum linken Schrecken, als lose Union von Großgrundbesitzern, Mafiosis, Politikern, hohen Militärs und arbeitslosem Fußvolk, die mit gleichen Mitteln – Drogen, Entführungen, Hinrichtungen, Enthauptungen – nach einem »Colombia mejor« strebten, einem besseren Kolumbien.
Durch das abendliche Bogotá zurück ins Zentrum. Schon beim Fragen nach dem Weg erfährt man die Freundlichkeit seiner Bewohner. Mit welcher Hingabe sie antworten, durchaus besorgt um das Wohl des Fremden. Meist kommt zur Information noch ein Warnruf. Unbedingt bestimmte Ecken meiden! Weil dort garantiert eine Handvoll Kanaillen lauert. Auch das gehört zur Liebe zum Extrem: Das Dramatisieren des Alltags, der lustvolle Wink auf Unheil und Fährnis.
Ich beschließe, die Greisin zu besuchen, jene, die durch die Straßen von Bogotá zieht und Nahrungsmittel verteilt. Ich rufe bei der Zeitung an, in der jener Artikel über sie erschienen ist, erhalte eine Telefonnummer und spreche Minuten später mit Señora Leonor Botero de Mejía. Claro, sagt eine frische Stimme am anderen Ende, noch heute Nachmittag könne ich vorbeikommen.
Ich bin neugierig auf diese Frau wie auf einen Vertreter einer aussterbenden Rasse. Jene, die sich nicht infizieren ließ von den Orgien der Raffsucht. Die unverbrüchlich daran festhält, dass noch andere Gesetze im Universum kursieren. Leonor ist, wenn der Bericht denn stimmt, jemand, der es lebenslänglich mit der Liebe und dem (möglichen) Verrat an der Liebe aufgenommen hat. Wer will keine Heldin kennenlernen.
Um 15 Uhr sitze ich in ihrem Wohnzimmer, plüschig und randvoll mit Nippes. Sofort fällt die Haltung der alten Dame auf, kerzengerade, tadellos geföhntes Haar, gepflegte Fingernägel, rote Lippenstift-Lippen, die klaren, vifen Augen. Kein Lumpenweib wirtschaftet hier. Sieben Kinder hat sie in die Welt gesetzt, vor langer Zeit starb der so vermisste Mann. Sie hat mehrere Operationen hinter sich, zwei wegen ihrer chronischen Gastritis. Stress plagt sie.
Täglich steht sie kurz nach fünf auf, um sieben verlässt sie das Haus, geht zum Markt, kauft Naturalien, stapelt sie auf einem Handwagen, fährt von Bruchbude zu Bruchbude und verteilt, was nötig ist, um über den Tag zu kommen. Nebenbei spornt sie an, leuchtet mit ihrem Lächeln in jede Baracke, gibt jedem etwas von ihrer Kraft. Kommt sie mittags nach Hause, schreibt sie hübsch gefaltete Bettelbriefe, die sie einmal pro Monat unter die Türen der Wohlhabenden schiebt. Damit sie die nötigen Scheine rausrücken. Kommen zu wenige (auch in Kolumbien zeigen sich Reiche eher zögerlich beim Loslassen von Eigentum), geht Leonor Altpapier sammeln. Für die Tonne bekommt sie umgerechnet 88 Euro. Gelernt, sagt sie, habe sie die Menschenfreundlichkeit von ihren Eltern. Mitgefühl üben mit jenen, die weniger Glück hatten, war Teil der Erziehung.
Ich frage sie, wie sie an die Liebe Gottes glauben kann, wenn sie ein Leben lang mit ansehen musste, wie die einen stinken vor Geld und die anderen stinken vor Armut. Die 82-Jährige, eher unbeeindruckt: »Die Not und der Kampf sind eine Herausforderung, die bestanden werden müssen, um ins Reich Gottes einzugehen.« Erstaunlicherweise erwähnt sie andere Religionen, Islam, Buddhismus, das Judentum, jede hätte ihre Berechtigung, jede habe etwas Gutes in die Welt gebracht. Man hört überrascht hin, hier redet keine närrische Katholikin vom allein selig machenden Katholizismus, sondern eine Weltbürgerin. Ob sie Angst vorm Tod habe? Das nicht, aber die 90 würde sie gern schaffen. Worauf sie allerdings keinen Einfluss habe, denn »der liebe Gott hat alles schon notiert, jeder hat seine Stunde«.
Als wir uns verabschieden, habe ich natürlich noch immer nicht verstanden, wie dieser Transfer von Energie stattfindet. Wie kommen Leute wie Leonor an diese Liebesfähigkeit heran? Während andere nichts oder dürftig wenig davon abbekommen. Okay, sie hat sich Gott erfunden. Trotzdem, man will sie um diese Erfindung beneiden. Kann doch ein Gottloser dabei etwas lernen: Die mürben Zweifler heben nicht ab, nur die Wissenden. Oder jene eben, die davon überzeugt sind, dass sie wissen. Sie sind nicht zu bremsen.
Leonor füttert sabbernde Alte, Sylvester Stallone bereitet seinen nächsten Rocky-Bimbo-Film vor und die Hardcore-Darstellerin Annabel Chong hat es geschafft, sich an einem Tag von 251 Männern begatten zu lassen. Sie alle kommen ans Ziel. Weil sie etwas anstiftet. Und wäre es der feste Wille, als muskulöser Strohkopf oder begnadete Nymphomanin in Erinnerung zu bleiben. Solange dieser Wille nicht in Frage gestellt wird, so lange ist kein Halten. Wie bei Señora Leonor Botero de Mejía aus der Calle 66 in der kolumbianischen Hauptstadt. Sie nährt ihr Herz mit der Fürsorge um andere. Glücklich wohl jeder, in dem ein Feuer lodert.
Auf dem langen Weg zurück drückt mir ein Junge einen Wisch in die Hand. Mit der Adresse eines Detektivs, der sich darauf spezialisiert hat, flüchtige Verlobte oder Ehefrauen ausfindig zu machen. »¡No sufras más en silencio!«, leide nicht mehr im Stillen. Auf der Visitenkarte sieht man einen lassoschwingenden Reitersmann, der die (flüchtige) Frau einfängt. Ich lächle, Jorge nickt lässig mit dem Kopf nach hinten. Ich blicke auf, ein Pornokino steht da. Verstanden, der Kleine arbeitet nebenbei als Zutreiber. Und tatsächlich, als ich eine Karte kaufe, bekommt er ein paar Pesos als Kommission.
Mir fällt ein befreundeter Reporter ein, der darauf bestand, jede Tür aufzumachen, hinter der er eine Story vermutete, die ihn bereichern könnte. »Denk nicht, geh rein.«
Enfermeras a domicilio läuft, Krankenschwestern auf Hausbesuch. Wie nicht anders zu erwarten, kümmern sie sich um das Sorgenkind Nummer eins des Hausherrn. Schlechte Bildqualität, aber dank imposanter primärer und sekundärer Geschlechtsmerkmale sind sie, die wahren Hauptdarsteller, nicht zu übersehen.
Plötzlich muss ich an die so vorbildliche Señora Leonor denken und ihre Bemerkung, dass der liebe Gott schon deshalb keine schöne Welt will, weil jeder eine Herausforderung braucht. Um an ihr zu wachsen. Wie wahr. Man sieht die Anstrengung des Protagonisten, die beiden (nimmermüden) Schwestern siegessicher von einem Gipfel zum nächsten zu katapultieren. Und rechtzeitig sein maßgebliches Arbeitsgerät in die Kamera zu halten, um uns alle am finalen Höhepunkt seiner (ins Freie jagenden) Manneskraft teilhaben zu lassen. Beim Hinausgehen fällt mir auf, dass ich noch nie einen Pornofilm mit einem Nachspiel sah. Berufssteher »kommen«, hinterher verschwinden sie, werden ohne Umstände ausgeblendet.
Witzigerweise gibt es heute in der hiesigen Presse einen Bericht über die Frage, ob sexuelle Aufputschmittel von der Krankenkasse bezahlt werden sollen oder nicht. Ein Gesetzesentwurf wurde bereits eingebracht. Begleitet vom Aufschrei der moralisch Einwandfreien, die sofort darauf verwiesen, dass das Land – über die Hälfte seiner Einwohner lebt unter der Armutsgrenze – bei Gott andere Prioritäten habe als die erotische Funktionstüchtigkeit erschöpfter Männer. Das stimmt natürlich, aber die Argumentation der Befürworter entbehrt nicht einer gewissen Raffinesse: Frustrierte Liebhaber (und ihre frustrierten Liebhaberinnen) sind für Kolumbien durchaus eine Gefahr. Familien können daran zerbrechen, Ehebruch nähme überhand, die gedemütigten Caballeros ließen ihre Wut an der Gesellschaft aus, sprich, Terror und Gewalt dauerten an, kurzum: Wer ein erfülltes Liebesleben habe, sei versöhnlicher, rechtschaffener.
Beim Frühstück lese ich, dass die Ciudad Bolívar die herausforderndste Gegend der Hauptstadt ist, mit den meisten Banden und den schießwütigsten Arbeitslosen, fast jeden Tag ein Mord, ein Totschlag. Ich gehe zur Touristinformation, will um einen Plan bitten und nach der besten Busverbindung dorthin fragen. Das wird lustig, die Frau denkt, sie habe sich verhört, und verweigert die Auskunft. Ich muss betteln und höchste Vorsicht versprechen. Mehrmals. So erfahre ich, dass die öffentlichen Verkehrsmittel nur zur »baja parte«, zum unteren Stadtteil fahren, nicht nach oben, zur »alta parte«. Denn der Zugang würde von rivalisierenden Gangs bewacht, jede besorgt um ihr Territorium, um ihre Schutzgelder (Ladenbesitzer zahlen, um beschützt zu werden vor denen, die vorgeben, sie zu beschützen). Für weitere Todesfälle sorgen die »Rekrutierungsbüros« der Paramilitares, die nach Nachwuchs Ausschau halten. Damit alle wissen, wie die Spielregeln funktionieren, wurden in der Vergangenheit mehrere (unwillige) Jugendliche liquidiert. Damit andere 17-Jährige begreifen, wie sie enden, wenn sie sich nicht rekrutieren lassen.
Ich will nicht sterben, ich weiß nur aus Erfahrung, dass erstens grundsätzlich und grandios übertrieben wird, dass zweitens ein Weißer (ohne Kamera, schmucklos und zu Fuß) nicht sofort standrechtlich erschossen wird und dass ich drittens Geschichten suche.
Nicht leicht, dorthin zu gelangen. Im Bus sitze ich ganz hinten, neben mir eine ältere Lady. Da in diesem Land nichts leichter ist, als mit einem Fremden ein Gespräch zu beginnen, reden wir. Dummerweise bin ich ehrlich und sage, wohin ich fahre. Nun schlägt Curieta, die Lady, die Hände über dem Kopf zusammen. Unsere zwei Sitznachbarinnen tun es ihr nach. »Dios mío, bitte, bitte, fahren Sie nicht dorthin!« Es wird noch absurder, denn alle um mich Besorgten wohnen in der Ciudad. Beschwichtigungsversuche meinerseits werden negiert, Curieta übernimmt nach kurzer Debatte mit den anderen das Kommando und verspricht, nicht mehr von meiner Seite zu weichen. Die 74-Jährige kommt gerade von einem Arztbesuch, hat zwei Hüftoperationen hinter sich und misst genau 154 Zentimeter. Einen geeigneteren Bodyguard kann man sich nicht wünschen. Als wir endlich ankommen, befiehlt sie, aus der Bustür humpelnd: »Folgen Sie mir!« Bald werde ich wissen, woher sie die Chuzpe nimmt.
Der Wind treibt den Staub über die Straßen, weht die Plastiksäcke von den Müllhaufen. Das riesige Bolívar besteht aus über 300 verschiedenen Vierteln, verstreut über die Hänge der umliegenden Hügel. Curieta lebt in Potosí, einem Sammelsurium zusammengenagelter Buden, manche schief, manche gerade. Hunde lungern, schmutzige Kinder schauen herüber. Armut ist langweilig, sie sieht überall gleich aus.
Wir gehen los. Als wir an einem Shop mit Lebensmitteln vorbeikommen, sagt Curieta, dass sie mir ein Mittagessen kochen will, kauft ein und bittet, die Waren anzuschreiben. Erst nach längerem Feilschen darf ich zahlen. Am Ende einer steilen Geraden erreichen wir ihre Behausung, vier Wände mit einem Blechdach, zur Straßenseite zwei vergitterte Fenster, die Löcher mit Pappe verstopft. Das Vorhängeschloss klemmt, es dauert, bis die Tür aufgeht.
Dahinter eine muffige Hitze, Zementboden, auf Ziegeln liegt ein Holzbrett, darauf das ungemachte Bett, in vier Schachteln befindet sich Curietas Besitz, nur Wäsche, ein paar Toilettenartikel, Schuhe. Kabel hängen quer im Zimmer, ein kaputter Spiegel steht neben dem Fernseher in der Ecke. Die Hintertür führt auf einen kleinen Hof, drei mal zwei Meter. In einer Nasszelle befindet sich ein Gaskocher und daneben, hinter einer Wand, die Kloschüssel ohne Brille. Die Hausbesitzerin hat eine Mauer parallel zum Nachbarhaus hochziehen lassen, gespickt mit eingemörtelten Glasscherben. Damit sich jeder die Arme und Hände blutig reißt, der hier einbrechen will. Plötzlich dreht jemand ein Radio voll auf, von irgendwoher kommt die Stimme von Franco de Vita, er singt die schöne Schnulze: »Te amo desde el primer momento en qué te vi«. Ich liebe dich seit dem Moment, in dem ich dich das erste Mal sah. Ich frage Curieta, ob sie glücklich ist. »No.« Und warum nicht? »Estoy sola«, ich bin allein.
Curieta kocht und erzählt. Ihr Mann war Campesino, sie kam aus der Mittelklasse. Nach 13 Jahren, drei Töchtern und einem Sohn ist er davon. Mit einer anderen. Eine offizielle Scheidung gab es nie. So ist sie seit 52 Jahren verheiratet und seit 39 Jahren einsam. Javier hat sie oft geschlagen. Ich frage mehrmals, warum. Sie weiß es nicht, sagt nur: »Er war Bauer.« Das soll als Erklärung reichen, ein Bauer eben, und Bauern schlagen.
Monatlich bekommt sie 350 000 Pesos (140 Euro) Rente. Sie hat in einer Kleiderfabrik gearbeitet, kann schneidern. Damit verdient sie noch heute ein Zubrot. Die Nähmaschine steht bei einer ihrer Töchter, aus Sicherheitsgründen. Spräche sich herum, dass in der Hütte ein so nützliches Werkzeug zu holen ist, es wäre schon verschwunden. Sie verschweigt sogar ihren früheren Beruf in der Nachbarschaft. Die Information würde genügen, um auf sie aufmerksam zu machen. Denn Schneiderin zu sein gilt als solide, besser verdienend. Besser jedenfalls als ein ungelernter Tagelöhner.
Meist schaut sie fern, ab 17 Uhr durchgehend. Dann liegt sie im Bett und starrt ins dunkle Eck, aus dem es hell flimmert. Sie mag alles, Hauptsache, sie hört »Stimmen«. Ich begreife für einen Augenblick den Nutzen eines Geräts, das sie hier »caja tonta« nennen. Und hätte die Idiotenkiste keinen anderen Sinn, als die Einsamkeit von Señora Curieta zu lindern. Ohne die Stimmen würde sie noch verlassener im Bett liegen.
Das wird ein heiteres Mittagessen, auch wenn wir nur mit dem Blechteller in der Hand auf einem Steinsockel sitzen. Curieta zählt wieder die (lange) Liste der Gefährdungen auf, von denen wir hier belagert werden. Wobei sie vollkommen sorglos bleibt. Denn jeden Morgen bete sie zum Erzengel Michael (»der mit dem Flammenschwert«), und somit sei die Sache erledigt. Der Schwertträger beschütze sie rund um die Uhr, »aus jeder Himmelsrichtung«. Würde es dennoch heikel werden, flüstere sie nochmals den Namen ihres Helden, und die Gefahr ist gebannt. Kurz bevor wir aus dem Bus gestiegen waren, hatte sie auch geflüstert. Zu meinem Schutz. Tapfer sagt sie: »Gott ist in meinem Herzen und das Herz ist der Tempel Gottes.« Die Sonne strahlt auf unsere Nudeln mit Hackfleisch, Vögel zwitschern, Curieta hat die Augen geschlossen, für einen Augenblick scheint sie nicht allein.
Ich frage sie, ob sie keinen Versuch unternommen habe, die Einsamkeit einzudämmen, jemand anderen zu finden, der anständig ist und nicht prügelt. Sie sagt, ich sei naiv. Nein, sie hat ihr Schicksal hingenommen, wie andere Frauen ihrer Generation in ähnlicher Lage. Als Mutter mit vier Kindern, als arme Mutter mit armen vier Kindern, »da schaut dich keiner mehr an, du wirst unsichtbar«.
Bevor es dunkel wird, begleitet sie mich zurück zur Bushaltestelle. Widerstand zwecklos, sie ist für mich zuständig. Potosí hat sogar ein Zentrum, ein paar geteerte Straßen, kleine Cafés, Läden, Werkstätten. Jeder vor Ort zahlt Schutzgeld, auch die Busunternehmen, die hier durchfahren. Curieta begleitet mich, sie erklärt alles. Sie fragt, ob es in Deutschland auch so aussieht, so zugeht. Unbehelligt erreichen wir unser Ziel, nicht ein Pistolero lief uns über den Weg. Als ich durch das Fenster noch einmal winke, sinkt mir das Herz. Nur die Flimmerkiste und ein Erzengel sind der Einsamen geblieben. Beide virtuell, beide ohne Haut, ohne Wärme.
Der Abend wird dennoch vergnüglich, im Buchladen Panamericana begegne ich Paulo Coelho. Wer kennt das nicht, diese immer wiederkehrende Begegnung mit Schriftstellern, zu denen man eine innige Beziehung unterhält? Innig, weil man sie bewundert, oder innig, weil man mit geradezu perversem Gusto in ihre Bücher blickt, immer auf der Suche nach dem phantastischen Nonsens, den sie so übermütig und siegessicher der Welt zumuten. Heute – früher habe ich geschäumt – fliegt ein helles Grinsen über mein Gesicht, wenn ich Paulo treffe. Wie jetzt, als ich mich zum Lesetisch begebe und er schon daliegt, dreifach daliegt, mich wieder einlädt zu lauthalsem Gelächter. Wie immer in seiner Nähe bin ich haltlos und blättere drauflos.
Der Teufel ist in Hochform und lenkt meine Aufmerksamkeit auf El año 2006 con Paulo Coelho, eine Art aphoristisches Vademecum, ein Kalender, um mit den Sprüchen des Meisters durchs Jahr zu ziehen. Zur Stärkung, als Wegweiser zu den Geheimnissen des Lebens.
Ich gestehe, ich leide augenblicklich gern, denn ich finde so fein ziselierten Schwachsinn, den ich selbst Paulo, dem Ex-Werbefuzzi, nicht zugetraut hätte. Hier eine Kostprobe. Im Gegensatz zu vergifteter Nahrung stirbt keiner an ihr, aber eine Ohnmacht kann den ungeübten Leser durchaus niederstrecken. Leider schaffe ich nur drei Sätze, da mich das Personal mit dem Hinweis vertreibt, dass Abschreiben aus nicht gekauften Büchern verboten ist.
Erste Perle: »Die Engel benutzen den Mund unseres Nächsten, um uns Ratschläge zu geben.« Nicht schlecht, doch kostbarer noch: »Ein Krieger darf den Kopf nicht hängenlassen, denn dabei würde er den Blick auf den Horizont seiner Träume verlieren.« Und jetzt, gar unbezahlbar: »Wenn man den eigenen Dämon nicht in sich erkennt, dann zeigt er sich gewöhnlich in der Person, die einem am nächsten steht.« Wen das nicht umwirft, den wirft nichts mehr um. Heiter wankend trete ich hinaus in eine laue kolumbianische Nacht, will auch Krieger sein und mich nie mit hängendem Kopf erwischen lassen.
Als Antiserum habe ich noch einen vierten Satz gefunden, fürs Abschreiben war keine Zeit mehr, aber die Zeilen waren so klug und so wahr, dass einmal lesen reichte, um sich für immer an sie zu erinnnern. Paul Theroux, der amerikanische Schriftsteller, hat sie notiert: »Erst wenn man unterwegs ist, begreift man, dass die größte Entfernung die größten Illusionen weckt und dass Alleinreisen sowohl Vergnügen als auch Strafe ist.«
Gestärkt betrete ich das Pasaje, der Name des Cafés passt zu einem Reisenden, drei verschiedene Bedeutungen hat das Wort: Textstelle, Fahrkarte, Überfahrt. Gitarrenspieler kommen und suchen nach Liebespaaren. Vor schmusenden Frauen bleiben sie nicht stehen. Ein Mann mit einem kleinen Kasten streicht durch die Reihen und verkauft Stromstöße: Der Kunde nimmt zwei Metallstücke in seine Hände und der Stromverkäufer erhöht per Kurbel die Dosis. Ein belebendes Kribbeln wandert durch den Körper. Bis es wehtut und man »aufhören« schreit. »Para el corazón«, sagt der Alte verschmitzt. Unsere müden Herzen stimulieren, das hat was.
Eine Dicke kommt mit ihrem Bauchladen herein, geht Richtung Klo. Ich kenne es, es ist winzig. Da wir uns in Kolumbien befinden, kann sie ihr Hab und Gut nicht unbeaufsichtigt abstellen, folglich muss alles hinein, Mensch und Ware: Bei bereits geöffneter Tür probiert die Frau verschiedene Körperhaltungen, um über die Schwelle zu gelangen. Nicht einfach, besteht doch bei jeder Schieflage die Gefahr, dass 200 Kaugummis und Lutscher den Laden verlassen und zu Boden segeln. Aber irgendwann ist sie drin, mit dem Gestell auf dem Kopf. Denn anders kann sie ihr Geschäft nicht erledigen. Bliebe die Tür offen, dann sähe man jetzt ein drolliges Bild. Nach einiger Zeit kommt sie heraus, mit gelöstem Gesichtsausdruck. Bewundernswert.
Ein Mann setzt sich neben mich. Er hat ein Säckchen Esmeraldas dabei. Das ist nicht überraschend, in Bogotá stehen sie an vielen Ecken, um Schmuck anzubieten. Er fragt, ob ich ein paar Steine kaufen will. Als ich dankend ablehne, bietet er mir Kokain an, kiloweise. Ich frage Fidele, wie ich die Fracht in meinem Rucksack nach Frankreich schaffen soll. Das wäre kein Problem, viele seiner europäischen »amigos« wären sicher angekommen. Außerdem bräuchte ich es ja nicht selbst zu transportieren, ich könne eine »mula«, einen Esel, engagieren. So nennen sie hier die professionellen Drogenspediteure, die den Stoff als biedere Touristen verkleidet über den Atlantik schaffen. Jeden Tag, laut Fidele, verlassen knapp 200 Esel die kolumbianische Hauptstadt, Richtung Europa und USA. Was der umgängliche Dealer für sich behält: Zivilbeamte fliegen mit und observieren diskret die Fluggäste. Wer nichts isst, wird verdächtigt als einer, der den Magen schon voll hat. Mit Präservativen, drall von Rauschgift.
Ein Zeitungsverkäufer bringt El Tiempo, die weitverbreitetste Zeitung des Landes. Seit Monaten, so steht da, haben Diebe ein neues Lieblingsobjekt. Nachts ziehen sie als (angebliche) Altpapier-Tandler durch die Straßen Bogotás und entfernen Kanaldeckel. Ein paar Schläge mit der Brechstange genügen, um sie aus der Verankerung zu lösen. Anschließend verstecken sie das Teil im vollgerümpelten Karren, peitschen das Pferd und jagen davon. Zum nächsten Deckel. Am Morgen wird das Diebesgut in einer Schmiede abgeliefert, wo sie den Beton weghauen, um an die 20 bis 25 Kilo Eisen ranzukommen. Zum Weiterverkauf an Gießereien. Ein Delikt mit bisweilen tödlichen Folgen. Weil Kinder in die jetzt offenen Kanallöcher fallen. In Kolumbien, so schreibt der Journalist, klauen sie alles, auch das, was niet- und nagelfest ist. Die Stadt hat deshalb eine Kampagne gestartet: »Nein zum Raub von Kanaldeckeln!« Der Leser solcher Nachrichten müsste eigentlich bestürzt sein. Aber irgendwie funktioniert das nicht, man will grinsen, kann gar nicht anders, als sich (auch) darüber zu amüsieren.
Diese unheimlichen Gegensätze. Morgens aufwachen und den Armee-Sender hören, der immer wieder in die Verstecke der Terroristen ruft, um die Jungen dort – auch sie oft von der FARC zwangsrekrutiert – zur Umkehr zu bewegen. Als Lockmittel werden eine berufliche Ausbildung versprochen, Überbrückungsgeld sowie aktive Hilfe bei einem beruflichen Neustart. Nur wer nachweislich Blut an den Händen hat, soll vor Gericht. Der Verteidigungsminister wird heute interviewt, er verspricht jedem den Tod, der mit dem Töten nicht aufhört.
Jetzt das Glück. Das Bett verlassen, auf die Straße treten und sogleich ahnen, dass in Minuten eine schier unerklärbare Lebensfreude ausbrechen wird. Weil man um die Ecke biegt, mitten auf die Morgensonne zugeht, von einem fliegenden Händler eine Zeitung kauft, schon das Aroma eines kolumbianischen Kaffees riecht und sich immer – nur noch Schritte entfernt – darauf verlassen kann, dass Señora Jenny jeden mit heiterer Freundlichkeit bewirten wird, der ihr Lokal betritt. Und weil bald jeden bezaubernde Geschöpfe umzingeln, die hier ebenfalls frühstücken. Es stimmt also, was die Kolumbianer, die Angeber, behaupten: dass die betörendsten Frauen Südamerikas ihr Land bevölkern. Das ist eine Gnade, das ist ein Fluch. Der Stoßseufzer von Gabriel García Márquez legt Zeugnis davon ab. Auf die Frage, warum er schreibe, antwortete er kleinlaut: »Um schönen Frauen näherzukommen.«
Zum Busbahnhof, eine lange Fahrt durch eine Stadt, die nie einen Schönheitspreis gewinnen wird. Ich will weiter nach Medellín, aber alle Plätze sind ausverkauft. Nur noch Tickets für eine Nachtfahrt gibt es. Doch die will keiner, denn jeder will nach neun Stunden ankommen und nicht erst – da auf der Strecke entführt – nach einem fünfjährigen Zwischenstopp im Urwald. Rund um die Uhr von Maschinenpistolen bewacht. Das Sicherheitspersonal verteilt an den Schaltern Zettel, auf denen Vorsichtsmaßnahmen aufgelistet sind, um der Gefahr einer Geiselnahme zu entgehen: Nur tagsüber fahren, nicht unnötig anhalten, keine Fremden mitnehmen, nur bekannte Busunternehmen benutzen. Ich kaufe ein Ticket für einen Fensterplatz für morgen früh. Ich versuche immer tagsüber zu reisen. Auch in friedlicheren Gegenden. Ich will das Land sehen, will es ununterbrochen anschauen.
Unser Sicherheitsbedürfnis ist ein zweischneidiges Schwert. Natürlich ist jeder dankbar, dass sein Leben nicht alle halbe Stunde bedroht wird. Anderseits: Wie viel entgeht uns, weil die Angst uns pausenlos züchtigt und schwächt? Das zeigt die erstaunliche Geschichte (und ich habe sie sinnigerweise hier erfahren) eines gewissen Bobby Leech, die uns darüber aufklärt, dass höchste Gefahren bestanden werden können und eine banale Geste den ewigen Tod beschert: Bobby war ein Haudegen, schloss sich 1911 in ein Fass ein und jagte die Niagarafälle hinunter. Und überlebte. Klar, verbeult, zerschunden, aber am Leben, bald schon wieder einsatzfähig. Jeder, der bereits neben dem Weltwunder stand, hat eine Ahnung, wie gering die Aussichten für den Wagehalsigen waren, heil davonzukommen. Aber die Story geht weiter. Jahre später wandert Mister Leech nach Neuseeland aus, wandert über eine Bananenschale, rutscht aus und bricht sich das Genick. Das ist selbstverständlich auch eine lustige Geschichte. Weil sie uns Mut macht und jeder Vorhersehbarkeit widerspricht, zweimal widerspricht. Auf überraschende Weise verringert sie unseren Angstpegel.
Auf der Fahrt zurück in die Stadt sitzt mir im Bus ein Ehepaar gegenüber. Unschwer zu erkennen, dass beide aus einfachsten Verhältnissen stammen. Auffallend auch hier das außergewöhnlich attraktive Gesicht der Frau. Seltsamerweise starrt ihr Mann sie nicht an, nicht bewundernd, nicht atemlos. Er sitzt und döst. Weiß er überhaupt, wie schön sie ist? Verwittern Frauen deshalb so schnell (und auf diesem Kontinent schneller als sonstwo), weil bald kein Bewunderer mehr sie bewundert? Weil aus der Göttin ein Haushaltsgerät wird, das ohne größeres Aufsehen zum (vielfachen) Brutkasten mutiert, zur Köchin und Wäscherin?
Ich erinnere mich an den Kommentar eines arabischen Freundes. Saïd sprach davon, dass der Schleier eine Art Todesurteil für die Frauen seines Landes bedeute. Weil keine Blicke, keine Männerblicke, mehr die Augen einer Frau träfen. Nichts in der Welt dränge mehr darauf, dass die Schöne schön bleibe. Der Schleier als Sargdeckel, der die Toten von den Lebenden scheidet.
Beim Mittagessen frage ich Rubi, die Bedienung, ob sie glücklich sei. Ja, sagt sie, aber nur zur Hälfte. Weil sie, die 17-Jährige, mit 16 ein Kind bekam und der Kindsvater davonlief. Eine langweiligere Geschichte kann man auf diesem Erdteil nicht finden.