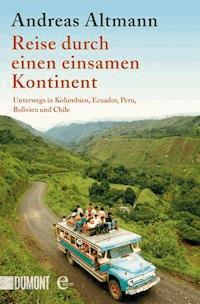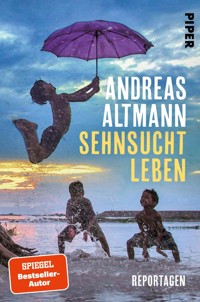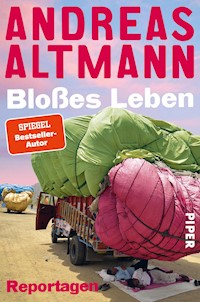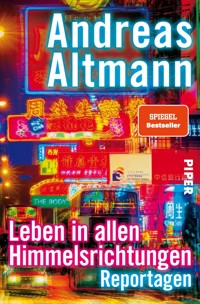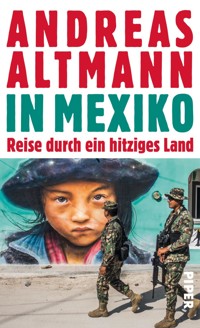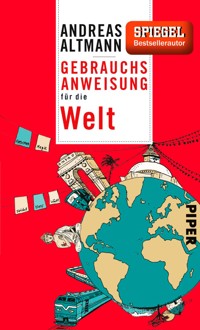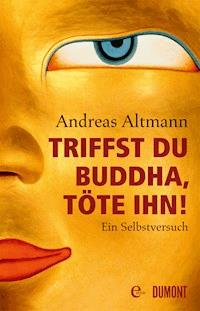12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Neu-Delhi, Brazzaville, Wien oder Hanoi: Andreas Altmann hat schon die unterschiedlichsten Orte als Heimat erlebt. Radikal ehrlich und voller Poesie nähert er sich einem Begriff, der so aufgeladen wie schwer zu fassen ist. Er schildert, wo auf seinen Reisen ihm Heimatverbundenheit, Heimatfreude und Fremdheit begegneten, welche Fragen zu Herkunft und Identität er sich stellt – und wie wichtig für ihn Freundschaften, Sprache, Musik sind, um sich heimisch zu fühlen. Er erzählt von den intensivsten Momenten unterwegs und in seiner Wahlheimat Paris, in die er immer wieder zurückkehrt. Und von der Leere der Wüste, der Einsamkeit und Stille, in der er die größte Vertrautheit empfindet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.malik.de
© Piper Verlag GmbH, München 2021
Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, kohlhaas-buchgestaltung.de
Litho: Lorenz & Zeller, Inning am Ammersee
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Cover & Impressum
Zitate
Widmung
VORWORT
Das Glück des Augenblicks: Galway
DEUTSCHLAND
Das Glück des Augenblicks: Sahara
MUSIK
Das Glück des Augenblicks: München
SPRACHE
Das Glück des Augenblicks:New York
FREUNDE
Das Glück des Augenblicks:New Delhi
HEIMAT
Das Glück des Augenblicks: Wien
FRAUEN – Männer – Liebe
Das Glück des Augenblicks: Hanoi
TIERE
Das Glück des Augenblicks: Brazzaville
ZEN
Das Glück des Augenblicks:Mexico City
KÖRPER
Das Glück des Augenblicks: Paris
MENSCHEN
Stanisław Jerzy Lec:
Die Muttersprache ist das Vaterland der Schriftsteller.
Eric Burdon:
Jeder braucht ein Anderswo.
Mahmoud Darwish:
Ich lernte alle Wörter und habe sie alle zerteilt, um ein einziges Wort zu schaffen: Heimat.
Das Buch gehört meinen Freunden. Die es noch immer mit mir aushalten. Sie haben so vieles, was mir fehlt. Was sie mich nie spüren lassen, ja, sie benehmen sich, als wäre ich ihnen ebenbürtig. Das schaffen nur sie. Manche tun so, als würden sie mich brauchen. Das ist der Gipfel von Wertschätzung. Der Teufel soll mich holen, sollte ich je die Freundschaft verraten, ach, nicht zur Stelle sein, wenn einer von ihnen um Hilfe ruft.
VORWORT
Wenn man eine Liebe an die Wand fährt, findet man – hoffentlich – eine neue. So ähnlich sollte man beim Verlust der Heimat handeln: Will man sie loswerden, weil die Erinnerung an sie wie Schlangengift das Herz verseucht, so desertiere man und suche sich eine andere Unterkunft, eine andere, brandneue Heimat.
Leicht gesagt, ich weiß. Die einen gehen mit einem Freudenschrei, die anderen tränenüberströmt. Von allen soll erzählt werden.
Für mich war Blut nie dicker als Wasser. Bin ich doch ein Meister im »Cut«-Sagen, einer, der unwiderruflich Frauen und Männer und Orte aufgibt, wenn sie mir nicht mehr guttun. Oder ich ihnen. Sie weder im Kopf noch im Bauch gehobene Stimmung auslösen, so ein Gedankensprühen, so ein romantisches Ziehen im Solarplexus. Bin selbst dann davon, wenn das Bleiben mir materielle oder sinnliche Boni verschafft hätte, Genüsse wie Wohlstand oder erotische Zuwendung.
Ich bin sogar der eigenen Familie entlaufen, von der Verwandtschaft gar nicht zu reden. Immer von der rüden Überzeugung getrieben, dass ich in ihrer Nähe nicht vom Fleck komme, dass mein Hirn stillsteht, ja, schlimmer, dass es schrumpft, weil weit und breit nichts blüht, was es nährt. Ja, Flucht muss sein, da ich jeden Morgen mit dem bedrohlichen und gewiss anspornenden Gedanken aufwache, dass ich nur ein einziges verdammtes Leben habe. Somit käme mir jedes Verweilen an »Stellen«, an denen kein Leben stattfindet, wie eine Todsünde vor. Wie trefflich das Wort, denn bliebe ich, versündigte ich mich schwer an mir selbst.
Kann einer das Leid noch zählen, das sich seit Millionen Jahren – pyramidal – anhäuft: weil Leute nicht voneinander loskommen? Oder hocken bleiben an Plätzen, die sie täglich näher an den Abgrund treiben. Oder sie, diskret und unspektakulär, in die so verschwiegene Depression der Ausweglosigkeit manövrieren. Wie sagte es Perikles, der siebengescheite Grieche: »Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit. Das Geheimnis der Freiheit ist der Mut.« Ohne den geht es nicht. Ein mutloses Leben? Das klingt schauerlich.
Jedes Fortgehen – ganz gleich, von wem und von was – braucht Schneid. Manchmal ein bisschen, manchmal ein bisschen viel. Eine neue Heimat – oder ein neuer Mensch: lauter unbekannte Kontinente. Wer kein Glück hat, fährt mitten hinein in sein nächstes Unglück.
Die Angst ist da. Deshalb muss Courage her. Meist wird sie den Mutigen belohnen. Mit der unbändigen Freude, dass er sich getraut hat. Und der wunderlichen Einsicht, dass kein Desaster wartet, sondern Aussichten auf ein innigeres Leben: upgraded, nach oben befördert, da, wo es sich freier atmet, da, wo weder Schwunglosigkeit noch Bore-out die Wirklichkeit ersticken.
Ich darf hier mitreden. Ich erblickte die Finsternis der Welt in einer Brutstätte aus Bosheit und Bigotterie und landete – über dornenreiche Umwege und Irrläufe – irgendwann in Paris: The City of Lights. Ich wüsste keinen schöneren Landeplatz auf Erden.
Ob Paris als Heimat taugt? Oder benötige ich – ich wäre nicht der Einzige – mehrere, ja, viele »Dinge«, die man Heimat nennen könnte? Die Antwort ist so einfach: bestimmt! Die Behauptung gilt umso mehr für jene, die ihre »natürliche« Heimat verließen, verlassen mussten. Aus Überdruss, aus Furcht zu verkümmern, aus Sorge ums Leben, aus Liebe, aus Hass, was weiß ich.
Heimat – was das magische Wort auch bedeuten mag – muss sein. Der Mensch braucht Lichtquellen, einen Kreis, dessen Teil er ist, Sprache, die ihn behütet, andere Sterbliche, deren Nähe ihn stärkt, eine Gesellschaft, deren Vereinbarungen er grundsätzlich bejaht, eine Wohnung, in die er sich vor dem Rest der Menschheit zurückziehen darf.
Ein unendliches Buch müsste man schreiben, um alles zu benennen, was heimatliche Empfindungen auslösen könnte. Mir reicht keine Stadt, kein Land, ich suche überall auf dem Globus nach etwas, an das ich den Sticker »Heimat« kleben kann. Jeder Fund beruhigt mich in einem Universum, durch das wir mit 107 000 Kilometern pro Stunde rasen. Eher ziellos, eher verloren. Und da ich an eine himmlische Heimstatt mit einem Himmelsherrscher mittendrin nicht glaube, mir diese ultimative Heimat stets als Hirngespinst erschien, bleibt mir nichts als die Erde und ihre Bewohner. Hier muss ich heimisch werden. Gelingt mir das, bin ich das geworden, was mir als Traum seit meiner Jugend durch den Kopf schwirrt: ein Weltbürger. Das wäre einer, der in der Welt zu Hause ist.
Das Glück des Augenblicks: Galway
Tage bevor ich nach Galway kam, hatte mich eine Frau verlassen. Nein, so stimmt es: Sie wollte ihren Freund wegen mir nicht aufgeben. Nun gibt es viele Arten, um mit einer solchen Niederlage fertigzuwerden. Die Unwillige beschimpfen, sich als Loser verdammen, über ihren Liebsten herziehen oder mit einer Whiskyflasche im Eck hocken und sich in Selbstmitleid ersäufen.
Für all das bin ich nicht sonderlich begabt. Auch von der Nutzlosigkeit derlei Taten überzeugt. Zudem unfähig, wie ein antiker Held um die schöne Beute zu kämpfen. Will eine von mir nichts wissen, wird sie ihre Gründe haben. Sie umstimmen? Wie soll das gehen? Mit einer Hymne auf meine Einzigartigkeit? Andere können das, ich nicht.
Natürlich fühlte ich den Stich im Herzen. Aber ich verfüge über ein robustes Immunsystem. Für den Körper und für – die »Seele«. Ich gesunde rasch, das ist ein Gen und bestimmt keine Leistung. Jeder Schwinger auf meine Gefühlswelt – geht es um Nähe oder andere Komplikationen – wird erstaunlich schnell weggesteckt. Weil ich längst ein Allheilmittel gefunden hatte: tun.
Irland ist wunderschön. Und noch wunderschöner, wenn jemand Bölls »Irisches Tagebuch« gelesen hat. Und am grandiosesten für einen reisenden Schreiber. Denn die Iren sind ein sprachbesessenes Volk. Sie produzierten, gemessen an der Bevölkerung, die meisten Literaturnobelpreisträger – ein ganzes Quartett. In jedem Pub und unter jedem Baum sitzt ein Weltmeister, der nur den Mund aufmachen muss, und ein sagenhaftes Englisch kommt zum Vorschein. Wer hier keine Heimat findet, wo sonst?
Aber für meine ewige Irlandliebe sorgten nicht die vier Berühmtesten, auch nicht die 4,7 Millionen Einwohner, die gewiss eines Tages ebenfalls berühmt werden, sondern: Susan in Galway. Ich hatte so leichtes Spiel mit ihr, und mein Anteil daran – es wird gleich offenkundig – war eher bescheiden. Alles an diesem 6. September hatten die Götter bereits für mich arrangiert.
Frühmorgens fuhr ich mit dem Schiff zu den Aran-Inseln, etwa zwei Stunden westlich der Küste. Ich wanderte die zwölf Kilometer nach Dún Aonghasa, einer Befestigung aus der Bronzezeit. Gegen jede Gewohnheit pflückte ich Blumen entlang des Wegs.
Abends, zurück auf dem Festland, ging ich in die Cottage Bar, die Zimmerwirtin hatte sie mir empfohlen. Livemusik gab es und natürlich die lokalen Poeten. Bizarrerweise hatte ich den Strauß mitgenommen, bunt und wild, Glockenblumen, Margeriten und Enziane. Warum habe ich ihn nicht im Pensionszimmer gelassen? Ich weiß es nicht. Es geschah vollkommen unbewusst.
An der Bar kam ich mit Sean ins Gespräch, einem jungen Musiker. Wir redeten – Männer halt – über die drei Mädels, die als Barkeeper arbeiteten. Er kannte sie seit Langem, sprach nur freundlich von ihnen. Da sich kein Bekannter hier befand, vor dem ich mich hätte blamieren können, sagte ich ihm, dass ich gern Susan (das wusste ich inzwischen) kennenlernen würde. Statt mir zu verraten, wie ich das am intelligentesten inszeniere, meinte er trocken »no problem«, stand auf und erzählte ihr von einem – dabei deutete er auf mich –: »who would like to get to know you«.
So sind die Iren, und ich bin schuldlos. Und Susan lachte, und wir plauderten. Ab 23 Uhr hatte sie frei, und wir zogen ins Myles Lee Pub. Das soll es geben und das gibt es: das kleine Wunder zwischen Frau und Mann. Zwei treffen sich, und von Kopf bis Fuß sind sie miteinander einverstanden. Und als die Sperrstunde kam, durften die Gäste im abgedunkelten Raum sitzen bleiben. Noch ein Geschenk des Himmels, da ja Schummrigkeit – nur ein paar Kerzen brannten – die Nähe beschleunigt.
Ich zog meinen Notizblock heraus. Tags zuvor hatte ich den Thoor Ballylee besucht, nur zwanzig Kilometer von Galway entfernt. Einer der Weltberühmten im Land hatte dort in einem uralten Festungsturm gelebt: William Butler Yeats. Ein Lieblingsdichter. In dem Museum fand ich die englische Originalfassung eines Gedichts, das ich schon lange kannte. Und las es nun Susan vor. Ich wusste, dass Poesie, selbst wenn es keinen direkten Zusammenhang zwischen dem Inhalt und der aktuellen Situation gab, wunderlich verheerende Wirkungen im Gemüt einer Empfänglichen auslösen konnte. Und Susan, die Irin, die Sprachverliebte, bat mich, die letzten Zeilen nochmals zu zitieren. Und Yeats, der Nationalheilige, und ich, der Wildfremde, gaben ihr jetzt den Rest: »… I have spread my dreams under your feet/Tread softly because you tread on my dreams«, die Träume breit ich aus vor deinen Füßen/Tritt leicht darauf, du trittst auf meine Träume.
Die 27-Jährige, sonst so sprudelig, schloss die Augen, Musik, komponiert aus nichts als aus Buchstaben, flutete gerade durch ihren Körper. Okay, das Gift war angekommen.
Spätnachts schlenderten wir zu ihr. Und vor dem Haus, in dem sie wohnte, sagte sie einen Satz, den ein Mann, wenn er denn maßloses Glück hat, wohl nur einmal in seinem Leben von einer Frau zu hören bekommt: »Möchtest du auf eine Tasse Tee mit hinaufkommen?« Das ist ein Männersatz, aber hier im romantischen, nachtstillen Galway hat ihn Susan ausgesprochen, ruhig, ganz ernst gemeint.
Jetzt lief der Tag zu beispielloser Hochform auf: Das »Mithinaufkommen« erwies sich als durchaus ungewöhnlich, da im Erdgeschoss die Eltern schliefen, somit der Weg über Tür und Treppe gesperrt war. Siehe Irland, siehe Katholizismus und rastlose Heuchelei.
Susan überlegte kurz und drückte dabei sacht ihren linken Zeigefinger auf meine Lippen, machte Zeichen, ihr geräuschlos zu folgen. Neben dem Komposthaufen des schmalen Gartens lehnte eine Leiter, aus Holz, etwa drei Meter lang. Verstanden, ich nahm sie, wir schlichen die paar Schritte zurück, und Susan deutete auf ihr (halb offenes) Fenster im ersten Stock.
Das Leben hätte gerade nicht herrlicher sein können. Susan stieg voraus, glitt in ihr Zimmer und flüsterte: »Come on in.« Und ich kam. Und legte den Blumenstrauß auf den Tisch. Dann küssten wir uns.
Über eine Stunde küssen. Küssen und ein bisschen mehr. Aber nicht alles. Nie wäre ich auf die Idee gekommen zu drängen. This was a perfect day, und ich hatte kein Recht, ihn mit einer falschen Geste zu ruinieren.
Kurz vor vier – der Vater hatte Frühschicht, er würde bald aufstehen – kletterte ich nach unten, trug die Leiter an ihren Platz und winkte hinauf zu Susan, die verträumt und ziemlich unbekleidet zurückwinkte. Ich musste mich losreißen, so phänomenal war das Bild.
Als ich durch die menschenleeren Straßen Richtung Lin’s Guesthouse wanderte, wurde mir klar, dass Galway alles hatte, um auf meinem privaten Heimat-Atlas zu landen: in dem jeder »Punkt« unserer Erde steht, der – halblaut ausgesprochen – ein sehnsüchtiges Seufzen auslöst. Die Gründe dafür können so verschieden sein. An diesem Sommertag waren es Susans Lippen, die nun wie tausend irische Sterntaler meine Haut bedeckten. Und Yeats’ Poesie. Und diese Nacht, durch die vom Meer her eine warme Brise wehte.
DEUTSCHLAND
»Deutschland ist ein schwieriges Vaterland«, der Satz stammt von Willy Brandt. Die fünf Worte lassen ahnen, dass eine haltlose Liebe zu diesem Land so einfach nicht funktioniert.
Was für Denker, was für Dichter, was für Musiker, was für Künstler, was für grandiose Erfindungen und Entdeckungen. Eine Hochkultur, die der Welt unglaubliche Gedanken und Taten geschenkt hat.
Und was für ein Morden, was für ein Schlachten, was für ein namenloses Grauen. Eine Barbarenclique, die der Welt das dunkelste Kapitel der Menschheitsgeschichte vermacht hat.
Ich bin ein Nachgeborener und fühle mich für die Gräuel meiner Väter nicht verantwortlich. So wenig, wie ich mir die Verdienste von Herrn Goethe an den Hut stecken darf. Ich misstraue jedem, der mit dem Büßerhemd durchs Leben geht. Geknickt und voller Büßerstolz. Eher albern. Was ich vermag, ziemlich bescheiden: so reden und so tun, dass ein Flair von Leichtigkeit – ach, wie grandios wäre das – von mir ausgeht. Da überzeugt, dass Frauen und Männer, die beschwingt unterwegs sind, nie auf die Idee kämen, andere Frauen und Männer auszurotten.
Gewiss, die so unschuldige Begeisterung für Deutschland wird sich nicht einstellen. So ist es meine Trotzdem-Liebe. Denn es hat sich inzwischen herumgesprochen, dass ein Volk ohne Achtung und Wohlwollen für das Land, zu dem es gehört, nicht existieren kann. Verachtung füreinander und Hass auf alles, was als Staat auftritt, führen mitten ins Reich der Finsternis. Die Weimarer Republik hat es vorgemacht.
Auf der anderen Seite: Patriotismus ist ein problematisches Wort. Wörtlich übersetzt, bedeutet es nichts anderes, als Verbundenheit zu seiner »patria« – lateinisch für Heimat – zu empfinden. Aber ja, nur zu. Liebe für die Seinen, das ist ein friedliches Unternehmen. Wenn, ja, wenn immerhin eine Herzkammer übrig bleibt, um andere Länder und ihre Bewohner zu achten und zu bewundern. So hätten wir den Deutschen als Weltbürger.
Als rasend begabt dafür sind mir meine Landsleute bisher nicht aufgefallen. »Heil Deutschland!« scheint viele, zu viele jedenfalls, noch immer zu berauschen. Sieht man sie paradieren, dann fallen zuerst ihre Visagen auf. Sie ähneln durchaus der Armseligkeit ihrer (braunen) Sehnsüchte: irgendwie dumpf, irgendwie lauernd. Jedes Mal machen sie Angst, denn ihre Wut gilt auch denen, die nicht dazu zu bewegen sind, Fremde zu verabscheuen und aus »unserem Deutschland« zu jagen. Sie wollen es sauber im Land, ihr Traum sind 83 Millionen reinrassige Stiernacken.
Zur Erinnerung: Es braucht keine Million fremder Gesichter, um seine Verachtung zu mobilisieren. Die Randale in Hoyerswerda vor dreißig Jahren war nur der Auftakt zu einer Reihe blutig rassistischer Übergriffe. Damals reichten schon ein paar Hundert »Undeutsche«, um den Mob zum Kochen zu bringen.
Klar, auch das hat sich herumgesprochen: Die Migranten sind nur ein Grund für das Unglück jener, die vom germanischen Reinheitswahn nicht lassen können. Der nächste heißt Globalisierung, die verbreitet Ängste, reißt Grenzen ein, spielt sich kosmopolitisch und international auf: und hängt ab. Und Verlierer sind verführbar, und jeder, der als Sündenbock taugt, ist hochwillkommen. Und der Schwächste in einem Land, der Fremde, ist der willkommenste Sündenbock.
Man wette darauf, dass der Glücksquotient der notorisch Mürrischen nicht bemerkenswert steigen würde, wenn alle »Schuldigen« verschwänden. Die Stinklaune bliebe, und so müsste man sich auf die Suche nach neuen Bösewichten machen. Was für ein Scheißleben.
Wenn ich ihnen zusehe beim Hassen und Brüllen, sehe, wie sie dem Ruf der Horde folgen, dann frage ich mich, ob Deutschland mir jetzt näher ist oder sich von mir entfernt. Wohl näher. Weil das, was ich (trotzdem) liebe, besudelt wird. Und Mitgefühl produziert Wärme. Ich mag ebenfalls ein sauberes Deutschland und radikal entnazifiziert mag ich es am liebsten.
Ich bin meinem Land schon deshalb zugetan, weil wir ein parlamentarisches Regierungssystem geschafft haben. Es ist natürlich wie alles, was mit Geist zu tun hat, gefährdet. Geht es in die Brüche, dann bekommen wir wieder einen starken Mann. Beruft sich der Rachsüchtige zudem auf einen Allmächtigen (Herr H. fühlte sich von der »Vorsehung« beschützt), müssen wir uns erst recht Sorgen machen: Unzählige werden sich aufs Neue bereit erklären, für Landesfürst und Himmelsfürst das eigene Leben wegzuwerfen. Und das der anderen.
Dass offiziell die Trennung von Kirche und Staat stattfand (inoffiziell wird weiterhin da und dort gemauschelt), ist noch ein Grund, Deutschland hochleben zu lassen. Jede Aktion, die Machtkartelle spaltet, ist ein Segen für die Menschheit.
Schon erstaunlich, wie mühsam es ist, jeden Menschen zur Menschenwürde zu überreden. Zu überzeugen, dass sie nicht nur ihm, sondern auch den Übrigen zusteht. Dass sie unantastbar sei, klingt wie eine ferne Mär. Etwa acht Milliarden befinden sich augenblicklich auf dem Planeten. Ob alle täglich ihre angemessene Ration Würde beziehen, das Grundnahrungsmittel, ohne das keiner über die Runden kommt?
Spotlight: Ich bin in der U-Bahn einer Großstadt unterwegs. Ein Mann kriecht auf seinen beiden Beinstümpfen durch den Mittelgang, um eine Spende bittend. Das wäre die erste Entwürdigung: dass einer im stinkreichen Europa so überleben muss. Aber das reicht nicht. Die meisten daddeln sorglos auf ihren Handys weiter, als der Alte an ihnen – unüberhörbar, unübersehbar – vorbeizieht.
Man schließt zuweilen die Augen. Um die Minuten auszuhalten.
Das geht durchaus: sein Land schätzen und dennoch im Ausland leben. Wie ich. Schon lange. Irgendwie finde ich das hip. Auf jeden Fall hipper, als in ein und demselben Kaff auf die Welt zu kommen und sie dort wieder zu verlassen. Klingt das arrogant? Von mir aus, doch der Mensch braucht Abwechslung. Sonst vergrindet er.
Da die deutsche Sprache jenes »Teil« Deutschlands ist, das mich am innigsten mit ihm verbindet, ja, ich blindlings verliebt bin in sie, spielt Entfernung keine Rolle. In modernen Zeiten kann ich sie überall hören, überall lesen.
»Wer kennt England, der nur England kennt?«, heißt es. Der Blick auf das eigene Land fordert Distanz. Dann sieht man die Unterschiede, sieht auf das, worauf man nie verzichten möchte, und das, worum man die anderen beneidet. Jedes Werturteil besteht aus Vergleichen. Venedig ist ein Traum, weil Chongqing ein Albtraum ist. In den Schwarzwald verschaut man sich, weil man Landschaften aus Beton im Kopf abgespeichert hat. Das Schöne wird sichtbar, weil das Hässliche existiert. Wäre alles schön, gäb’s nichts Schönes. Wäre alles hässlich, wüssten wir nicht, was das ist. Würde die Erde nur aus Deutschland bestehen, wir Deutschen hätten keine Ahnung von uns.
Der Mensch muss raus, muss weg, er soll von der Welt wissen und lernen: die intelligenteste Voraussetzung, um ein kosmopolitischer Patriot zu werden.
Jeder hat seine Gründe, warum er Deutschland lobt. Ich bin jetzt tapfer und verkünde, dass mich die Titel eines Fußballweltmeisters, eines Autoweltmeisters und eines Exportweltmeisters nicht in freudigen Irrsinn treiben. Früher habe ich dagegen gemault, wenn die Massen in den Stadien tobten. Inzwischen bin ich milder geworden. Aber ja, sie sollen sich amüsieren. Solange sie nicht »Neger raus« und »Schwule Sau« schreien, bin ich durch und durch tolerant. Dennoch, ob die Deutschen am weltmeisterlichsten einen Ball in ein 7,32 breites und 2,44 Meter hohes Gehäuse knallen, noch ehrlicher: Nicht vieles ist mir so piepegal.
Als ich auf einer Amerikareise nach Orlando kam und dort Disneys »Magic Kingdom« besuchte und entdecken durfte, dass Deutschland von drei Bierkrüge schwingenden Lederhosendodeln »repräsentiert« wurde, war ich beleidigt. Ich muss kein »great, greater, greatest Germany« vorgeführt bekommen, doch ein Trio Besoffener als Quintessenz meines Landes, das ist ein starkes Stück.
Dann kam die Jahrtausendwende, und die Amerikaner machten es wieder gut: Albert E., der Große, wurde – die Konkurrenz war kolossal – vom Time Magazine zum »Mann des 20. Jahrhunderts« gewählt. Und Johannes G., das andere Genie aus einer früheren Zeit, wurde zum »Mann des Jahrtausends« bestimmt.
Ich war beruhigt. Und hochgestimmt, ja, gerührt. Ich schwärme immer von Deutschland, wenn sein Name im Zusammenhang mit Scharfsinn auftaucht. Wenn seine Geschenke an die Welt zur Entdeckung dieser Welt beitragen. Und wenn es Warmherzigkeit – so geschehen 600 Jahre nach Gutenberg – beweist und einer knappen Million Frauen und Kindern und Männern, die vor Tod und Teufel flohen, eine erste Unterkunft gewährt. Wie sagte es Marek Halter, der Schriftsteller aus Paris: »Gut ist, was Menschen hilft zu leben, und böse, was sie daran hindert.«
Ich rede so (auch) aus eigennützigen Motiven: Vielleicht geht es mir eines Tages dreckig, und jemand läuft mir über den Weg, der mir keine Moralpredigt hält, sondern etwas zum Essen herausrückt, ja, sich nach einem Platz zum Schlafen für mich umhört. Das Leben funktioniert nur, zumindest auf Dauer, wenn ich – in den Zeiten, in denen ich stark bin – bereit bin, mich vom Unglück eines Unbekannten bewegen zu lassen. Nur nehmen, das endet früher oder später, eher früher, ungut.
Jede Heldentat generiert hässliche Nebenwirkungen. Ich weiß um die Komplexität des Themas, ich weiß, dass manche die Gastfreundschaft missbrauchen und niederträchtige Taten begehen, ich weiß, dass manche lügen und ihr Leid erfinden, ich weiß, dass so mancher Nachhilfeunterricht in Menschenrechten und zivilisierter Grundordnung benötigt.
Das ändert nichts an der Großtat, die irgendwann in den Geschichtsbüchern stehen wird. Um bis ans Ende der Welt zu leuchten.
Noch ein Absatz zur Eindeutigkeit. Im Französischen gibt es den Begriff »angélisme«, in dem das Wort »Engel« steckt. Wer davon befallen ist, redet wie ein himmlisches Wesen, immer von Reinheit und Naivität getrieben, immer bereit, nichts von den dunklen Schatten in uns, in uns allen, wissen zu wollen.
Unmissverständlich: Wen Not heimsucht, weil seine Heimat in Flammen steht, weil ein Krieg wütet, weil eine Bande blutrünstiger Gangster regiert, weil irgendein Wahn zur Jagd auf Homosexuelle anstiftet: Der hat jedes Recht auf Schutz. Gerade in Deutschland, das über mehr Geldhaufen und Geltung verfügt als (fast) alle anderen Nationen. Und dieses Land – jetzt kommt die Gegenleistung – hat das Recht, dass jeder, der von dieser Hilfestellung profitiert, die »Spielregeln« akzeptiert: dass wir uns mitten in Europa befinden, wo Frauen so viel gelten wie Männer, wo Eros auf Verführung beruht und nicht auf Zwang, wo religiöse Zeloten und ihr Geschrei nach einem »Gottesstaat« nicht geduldet werden, wo Eigeninitiative – wie die neue Sprache lernen wollen, wie die Neugier auf die neue Umwelt – ein hochgeschätztes Gut ist.
Wer das als Flüchtling mitbringt, der soll willkommen sein. Nein, er muss sich dafür nachts nicht in Schwarz-Rot-Gold wickeln, nicht jede halbe Stunde »Ich liebe Deutschland« schmettern, nicht pausenlos und demütig »Thank you« flüstern. Doch er sollte verstehen, dass ein Gastgeber einen friedlichen Gast erwarten darf.
Die Zahlen sprechen für sich: So viele der Flüchtlinge wissen das, sind guten Willens. Und die »anderen« Deutschen, die nicht grundsätzlich die Nichtdeutschen hassen und die penetrant auf ihrer Menschenfreundlichkeit bestehen, wissen das auch. Ich höre gern von ihnen. Sie erinnern uns daran, wie wir sein könnten. Wären wir nur seltener vernagelt, seltener verbittert, seltener gefroren in unserer Herzenskälte.
Das ist fraglos sexy: jemandem – ohne Pose, ohne Ergriffenheit über sich selbst – ein bisschen das Leben zu erleichtern. Für Momente sein Ego wegzupacken, ja, sich dabei zu beobachten und festzustellen: Hilfsbereitschaft erhöht die Lebensfreude. Das scheint genetisch – neben dem Gen der Gewalt – in uns Menschlein zu sein: teilen wollen. Nicht gleich fifty-fifty, aber etwas.
Jetzt ist Zeit für eine kleine Geschichte. Ich muss sie erzählen, weil ich in einer bekannten Wochenzeitung las, dass laut einer Umfrage 41 Prozent der Einwohner der Ex-DDR glauben, dass man sich heute, im 21. Jahr des 21. Jahrhunderts, »nicht freier ausdrücken kann als vor 1989«, sprich, nicht freier als im ersten deutschen Arbeiter- und Bauernstaat. Sogleich fiel mir ein Satz des französischen Mathematikers und Philosophen René Descartes ein: »Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Jeder glaubt, genug davon zu haben.« Der Aphorismus ist 400 Jahre alt und noch immer brandaktuell.
Nun die Story zum Thema Redefreiheit, ja, Handlungsfreiheit in der »Deutschen Demokratischen Republik«: Im Sommer 1981 kam ich mit dem Zug aus Polen nach Görlitz, ein Aufenthalt von zwei Stunden war vorgesehen, bevor es weiterging nach Berlin. Wir durften alle die Waggons verlassen und ins Bahnhofsrestaurant gehen. Ich brauchte Ostmark, wollte in Ostberlin Bücher kaufen. Der Schwarzkurs war mindestens viermal höher als der offizielle. Da ich wusste, dass sie hier an Devisen interessiert waren, legte ich demonstrativ einen DM-Hunderter auf den Tisch, fuhr nachlässig mit den Fingern darüber und suchte den Blick der Kellnerin, als sie näher kam. Sie verstand sofort, fragte nach der Bestellung, notierte und flüsterte blitzschnell: »Toilette!«
Nach ein paar Minuten war sie hinter der Tür mit dem WC-Zeichen verschwunden, ich schlenderte nonchalant hinterher und verschwand mit ihr im (abschließbaren) Damenklo.
Etwas Unglaubliches passierte, das schlagartig offenbarte, dass sie sich in großer Gefahr wähnte. Sie fing zu zittern an, aber so heftig, dass sie ihre beiden Hände nicht mehr kontrollieren konnte. Sie presste sie zusammen, krallte sie ineinander. Als wollte sie verhindern, dass sie zu flattern beginnen, ja, irgendwo anstoßen und unser Versteck preisgeben. Mit ihrem Kopf, der ihr noch gehorchte, deutete sie auf ihre rechte Hosentasche. Für elegantes Fragen und Bitten war augenblicklich keine Zeit, ich griff hinein, zerrte vier Scheine hervor, alle blau und mit Rauschebart Marx, steckte sie ein, zog den meinen blauen heraus, mit dem Porträt des feingliedrigen Sebastian Münster, hielt ihn ihr vor die Augen, sie nickte, und ich verstaute ihn bei ihr. Jede Bewegung schnell und konzentriert. Dann lauschen, dann hinaus und ins Wirtshaus. Theresa blieb noch, die Angst musste erst ihren Körper verlassen. Es dauerte, bis sie zurückkam.
Noch ein letzter Gedanke zu dem hübschen Wort »Vaterland« (die Engländer sagen »motherland«, ähnlich hübsch). Vorweg eine kurze Episode: Als ich durch Palästina reiste, kam ich nach Jenin, Stadt im Norden. Mittendrin sah ich ein seltsames Denkmal, ein alter Steinbrocken, auf dem stand: »In memory of the fallen German airmen«, zur Erinnerung an eine deutsche Fliegerstaffel, die in den Jahren 1917/18 die Ottomanen (die Türken) im Kampf gegen aufständische Beduinen unterstützte. Die Namen von getöteten Zwanzigjährigen (!) waren eingemeißelt. Ich las sie mehrmals, um zu spüren, was sie bedeuten: dass kriegslüsterne Befehlshaber – hier deutsche – bisweilen gern ein Blutbad nehmen und dafür das Leben anderer vernichten. Und dass Zwanzigjährige, statt den Generälen die Pickelhaube durch die Schädeldecke zu rammen, sich mit einem Hurra auf den Lippen vernichten lassen.