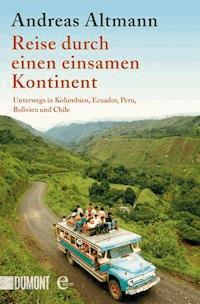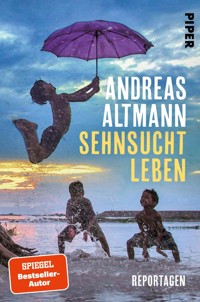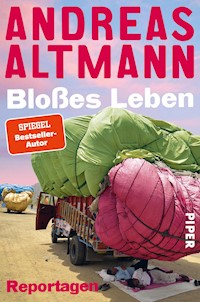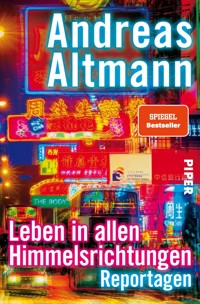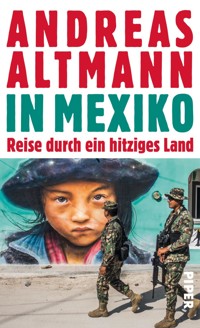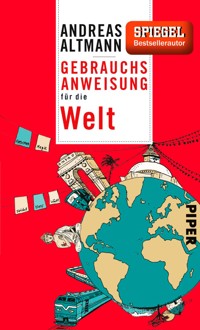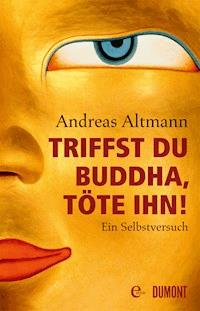7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Andreas Altmann begibt sich ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Mit dem Greyhound-Bus fährt er von New York bis San Francisco – eine Reise voller Abenteuer. Er zeigt uns ein Amerika, das kein Reiseführer zu zeigen vermag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Andreas Altmann
IM LAND DER FREIEN
Mit dem Greyhound durch Amerika
Von Andreas Altmann sind im DuMont Buchverlag außerdem erschienen: Reise durch einen einsamen Kontinent Im Land der Regenbogenschlange Sucht nach Leben Triffst du Buddha, töte ihn!
eBook 2011 DuMont Buchverlag, Köln Alle Rechte vorbehalten © 2010 DuMont Buchverlag, Köln Erstmals erschienen 1999 im Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH
Für Jene, die so lange auf sich warten ließ
Wir alle haben zwei Leben: Eines, das wir träumen. Und ein anderes, das uns ins Grab bringt.
Fernando Pessoa
In wilden Schmerz verfallen bei dem Gedanken, man könnte womöglich eines Tages auch Visitenkartenoder Höflichkeitsbriefe versenden, heiraten, Kalender kaufen –oder dieses oder jenes andere Leben annehmen.
Alain Fournier
Ich lache, um das Lebensgeschäft in meinem Körper
ATLANTIK
Flug über Grönland. Ich sitze Gangseite. Als ich den Kopf nach rechts drehe, landet mein Gesicht im Hintern eines Dicken. Um einem zweiten Dicken auszuweichen, war der erste dicke Hintern – siehe enge Serpentinen im Hochgebirge – ganz offensichtlich auf der Suche nach einer Ausweichstelle.
Das ist ein zauberhafter Anfang für eine Reise durch die Vereinigten Staaten von Amerika. Blitzartig und grinsend ziehe ich meine Nase zurück. Andere grinsen auch. Sofort wissen wir, wo wir in ein paar Stunden ankommen werden: in Amerika, dem Land, in dem laut Statistik über eine Milliarde Kilo Speckschwarten zuviel existieren. Ich stelle meine Augen auf Weitwinkel um. Nur so, will ich mir einbilden, darf man sich diesem Kontinent nähern. Längst habe ich begriffen, dass Dünne auf einer so riesigen Fläche nichts verloren haben. Hier tragen sie XXL, nur sie passen.
Mein Nasenstupser in einen heftig gespannten Hosenboden macht mich wach. Sekunden später erinnere ich mich eines lautlosen, überwältigenden Vorfalls in der Zona Rosa, einem Stadtteil von Mexico City. Der Ort liegt dreitausend Meilen von unserem Zielflughafen JFK entfernt. Und dennoch, das dortige Erlebnis war der jetzigen Situation so ähnlich. Ich verließ eine Bank und trat hinaus auf die Calle Hamburgo. Wo normalerweise geräuschvoller Betrieb herrscht, war es seltsam still, ja heilig still. Männer und Frauen eilten aus ihren Läden und blieben mit offenem Mund davor stehen. Der Grund ihres maßlosen Erstaunens war unübersehbar: Eine junge, leicht bekleidete Frau mit knapp sitzenden Shorts, Fotoapparat und Beinen aus einer anderen Welt promenierte an ihnen vorbei. Ich mag mich verschätzen, aber allein ihr Unterleib brachte es auf hundertfünfzig Kilo. Ihr Fleisch schwabbelte, es war zu kraftlos, zu degeneriert, um noch irgendeine Konsistenz aufzuweisen. Speckringe kringelten sich in zweifacher Ausführung um ihre Fußgelenke. Unbekümmert unterhielt sie sich mit ihrem Begleiter. Sie sprach Englisch mit amerikanischem Akzent.
Nicht die drei Zentner nacktes Fett machten uns sprachlos. Es war die Nonchalance, die Mühelosigkeit, mit der dieser Mensch sein Schwergewicht vor aller Welt ausbreitete. Ich glaube, wir bewunderten beide: sie, die Frau, und sie, die Amerikaner. Seliges Volk, einziges Volk wohl, das sich so aufzutreten traut. Was für betuliche Bedenkenträger wir übrigen Nicht-Amerikaner sind. Wer von uns würde wagen, zweihundert bare Pfund Oberschenkel in hautenge Hot Pants zu zwängen und damit beschwingt spazieren zu gehen? Derlei auseinanderquellende Mitmenschen würden in Europa in einer Intensivstation versteckt werden oder als Zirkusnummer durch die Provinz tingeln.
Neben mir sitzt Ajit, ein schmaler Afghane, der nun Gemüse in Brooklyn verkauft. Als der Dicke sich in mein Gesicht drückte, lächelte er verschämt. Jetzt, eine halbe Stunde später, sagt er wie als Entschuldigung für seine heitere Schadenfreude: »You know what? America is a freak show.« Das ist ein schlauer Satz, gerade dann, wenn man das Wort »freak« in seiner ursprünglichen Bedeutung versteht: Anomalie. Ein freak of nature ist eine Laune der Natur. Lauter Launen der Natur, lauter freakige, monströse Widersprüche, die bis jetzt noch jeden Europäer überforderten. Wer hier durchreist, macht eine Bestandsaufnahme. Vom Fassen der Ungetümer keine Spur.
Nehmen wir die 1,2 Milliarden Kilo Menschenspeck. Ich ging in Paris an Bord mit einem gerade erschienenen Buch der amerikanischen Autorin Joan Jacob Brumberg. Titel: The Body Project. Darin beschreibt sie den zähen Kampf amerikanischer Teenager, noch magersüchtiger, noch spindeldürrer aufzutreten als alle anderen Spindeldürren. Das Bodybuilding-Studio als Büßerzelle, der Körper als Schlachtfeld, die Seele als ein Hort gnadenloser Selbstjustiz: Ich bin nicht schlank, also bin ich nichts. Nebenbei wird das Land von Cindy Crawfords Forever slim-Videos überschwemmt, scheint ein gewaltiger Prozentsatz von Männern und Frauen besessen von Kim-Basinger-Brüsten, lassen sich Millionen Dickhäuter von einer Pharmaindustrie terrorisieren, die auch Todesfälle nicht aufhalten, den Markt mit gesundheitsruinösen Abmagerungs-Tabletten zu versorgen.
Nach dem Ende des Films im Bordkino fällt mir zum ersten Mal auf, dass in amerikanischen Filmen kaum Dicke vorkommen. Klar: Die schönen Schlanken spielen und die Dicken schauen zu.
Bewundernswertes Amerika. Alle Widersprüche scheint es zu schlucken. Denn hier gedeiht das so unbezahlbare Talent, mit dem zufrieden zu sein, was aus einem – irgendwann, irgendwann nach der letzten Diät – geworden ist.
So begreife ich diese Reise durch die Staaten auch als Therapie. Empfehlenswert für alle wie mich, die für die immer vergebende Liebe dem eigenen Leib gegenüber nie begabt genug waren. Die Dicken machen Mut. Ich bin dünn. Als Zwölfjähriger war ich so abgezehrt, dass man mir riet, beim Baden nicht den Besen zu vergessen: als Paravent für mein besendünnes Knochengerüst. Einmal brachten Freunde einen Topf Leuchtfarbe mit. Sie wieherten vor Vergnügen. Ich solle mich damit anstreichen. So bestünde keine Gefahr, dass andere Badegäste versehentlich in mich hineinrennen. So unsichtbar spitz und mager kam ich daher. Sehnsüchtig fing ich an, auf Dicke zu blicken. Sie hatten alles, was mir fehlte: die Schwere und das Leichte.
Ruhiger Anflug auf New York. Sarkastisch, wie so viele Abendländer, sehe ich zuallererst den Grünspan auf der Freiheitsstatue. Ajit sagt: »Wie schön.« Seit drei Jahren lebt er hier. Nicht mehr im Kugelhagel sein Brot verdienen zu müssen, das muss schön und gut sein. So hat er jetzt Zeit und träumt den amerikanischen Traum. Den Traum, es vom Tellerwäscher, der in einer von Kakerlaken und Ratten verseuchten Küche das grindige Geschirr spült, zum rasanten Leben eines millionenschweren Hotelbesitzers zu bringen.
Habe ich Ajits rudimentäres Englisch richtig verstanden, so liegt in der Nähe seines zweirädrigen Gemüsekarrens eine Filiale der A&P-Lebensmittelkette. Ein Milliardenunternehmen, das von A wie Atlantik bis P wie Pazifik den nordamerikanischen Markt mit Supermärkten überzieht. Irgendwo in dieser Größenordnung scheint auch Ajits amerikanischer Traum angesiedelt. Er sagt den wunderbar blöden Satz, den er gleich bei seiner Ankunft auswendig gelernt hat: »Winning isn’t the most important thing, it’s the only.«
Solide, geniale Hirnwäsche. Lustig, wohltuend und vielversprechend. Weil sie bravourös ablenkt und somit kaum einer auf die Idee kommt, von der amerikanischen Realität zu träumen. Sie ist weit weg vom Traum, so weit weg wie das Salär des A&P-Vorstandsvorsitzenden vom Dritte-Welt-Lohn der 30 Millionen, die mit McJobs ihr Dasein fristen. Das sind all diejenigen »Berufe«, die eine Lehrzeit von fünf Minuten verlangen und – wenn sich der Arbeitgeber an das Gesetz hält – mit knapp über fünf Dollar pro Stunde entlohnt werden. Die Tätigkeiten sind so grausam fad wie die Produkte der Firma McDonald’s, die als Namensgeber für die McJobs verantwortlich zeichnet.
Amerikaner sind Träumer. Und jeder andere Neuankömmling, der dieses Land betritt, träumt mit. Und trotzig halten sie daran fest. Die Verbissenheit ist in der Verfassung verankert, jeder hat das Recht auf die Jagd nach Glück. So aberwitzig anders die Wirklichkeit auch sein mag, vom Zusammenspinnen riesiger Dollarhaufen wollen sie nicht lassen. Die Einbildung als Placebo. So unverwüstlich wie der liebe Gott und die Trompeten von Jericho.
Siehe Jeremy. Irgendwann nach Grönland waren der Dicke und ich in der Warteschlange vor den Toiletten miteinander ins Gespräch gekommen. Jeremy zeigte sich als sensibler Mensch. Er erinnerte sich an meine im Weg stehende Nase und an die Tatsache, dass er sie mit seinem Hinterteil kurzerhand aus dem Weg geräumt hatte. Er fragte mich freundlich, warum ich nach Amerika käme. Und ich antwortete wahrheitsgemäß: Um durch sein Land zu reisen. Das gefiel ihm: »If you have a big dream, go for it.« Auch er sei augenblicklich hinter seinem großen Traum her. In einem Nest in Ohio baue er gerade eine eigene Fernsehstation auf. Hundertvierzehn Kanäle können die Einwohner bereits empfangen. Warum nicht hundertfünfzehn?
Was lernen wir aus Jeremys großem, großem Traum? Dass alle träumen. Auch die nimmermüden Popcornfresser auf ihren Sofas, auch die Mutter, die heute in den USA Today steht, weil sie ihre cracksüchtige Tochter über den Haufen schoss. Als die Polizei eintraf, stammelte sie überwältigt: »We were winners. We had a house, we had a car, we had an American Express Card.«
Dass in diesem Land ein paar Dutzend Millionen Träume pro Tag abstürzen und dass ein paar Millionen die Abstürze nicht mehr ertragen, da sie die Diskrepanz zwischen Kopfgeburt und tatsächlichem Leben schlichtweg überfordert, sie also nie winners werden, also immer losers bleiben. Und sich folglich zudröhnen oder zur handlichen Smith & Wesson greifen: All das mindert um nichts meine Faszination für Amerika. Träume haben mich seit je gelangweilt. Nichts scheint sensationeller als geplatzte Illusionen und die dahinter verborgene Wirklichkeit.
Ajit gab das Stichwort: Amerika als Monstrositätenkabinett. »Think big«, das ist das Lieblingsmantra des homo americanus, das Codewort eines außer Rand und Band geratenen Größenwahns. Was nicht big ist, hat keine Existenzberechtigung.
Schon bei der Sprache fängt es an. Kommt kein einziger Superlativ in einem Hauptsatz vor, stimmt die ganze Konstruktion nicht. Ein rekordloser Satz ist ein sinnloser Satz. Das amerikanische Hirn reagiert nicht auf Nebensätze. So zögerte der Sprecher der Fernsehnachrichten an Bord einen Augenblick, als der Filmbericht eines Pferderennens eingespielt worden war, bei dem mehrere Traber kollidierten. Die Tatsache, dass sich dabei ein paar Jockeys die Schädel eingerannt hatten, war nicht der Grund der Besorgnis. Erst als ihm aus dem Off signalisiert wurde, dass »es sich um den drittgrößten Reiterunfall der letzten zwei Jahre handelt«, entspannten sich seine Züge. Die Meldung stimmte jetzt, ein Superlativ war gefunden, die Gefahr, dass die Zuschauer schon zur Konkurrenz rüberzappten, um dort eine Sensation verpasst zu bekommen, schien für die nächsten Minuten gebannt.
Um nicht falsch verstanden zu werden: Nichts fürchterlich Mörderisches muss vorkommen, um die amerikanische Psyche zu bewegen. Auch die Bekanntmachung eines Fliegenschisses tut es. Sagen wir, die Veröffentlichung des Vorschusses, den Joan Collins für die Niederlegung ihrer Memoiren von ihrem Verleger erhalten hat. Die Memoiren sind ein Fliegenschiss. Ihr Stil ist ein Fliegenschiss. Nur der Vorschuss ist weltrekordverdächtig, also muss er an die Öffentlichkeit.
Man darf den Amerikanern alles vorwerfen, nur nicht den Mangel an Unterhaltungswert. Wer durch die Staaten zieht, ohne regelmäßig von Lachkrämpfen traktiert zu werden, dem ist nicht zu helfen. Weinerliche Reiseberichte über Nordamerika, geschrieben von ununterbrochen beleidigten Europäern, gibt es schon genug. Ich habe mir geschworen, mich zu amüsieren. Das wird nicht immer gelingen. Das Heitere wird mich verlassen und ich werde, zerknittert von zuviel Geschmacklosigkeit, anfangen zu schluchzen. Aufrufe zur guten Laune sind eben genauso erfolgreich und flüchtig wie Ermahnungen zur Menschenliebe. Ich weiß es genau: Humor und Wärme werden mich gelegentlich im Stich lassen. Besonders dann, wenn sich die Begegnungen mit den Inhabern vakuumverpackter Kleinhirne häufen. Jeremy sprach es schonungslos aus: »Too many braindead people in Ohio.«
Nach diesem Satz habe ich zum ersten Mal in diesem Land schallend gelacht, wenn auch noch Meilen über ihm. Denn Jeremy erzählte von der kleinen Bürgerinitiative in seiner Heimatstadt, die ihm das Leben beim Installieren seines 115. Fernsehkanals schwer mache. Die Hirntoten hätten noch immer nicht begriffen, »dass Vielfalt alles ist«.
Es knallt. Hart schlägt das Fahrwerk der Boeing 767 auf der Piste auf. Heute flog der Copilot nach New York.
IN NEW YORK
Max Frisch fragte einst: »Warum reisen wir? Auch dies, damit wir Menschen begegnen, die nicht meinen, dass sie uns kennen ein für allemal. Damit wir noch einmal erfahren, was uns in diesem Leben möglich ist. Es ist ohnehin schon wenig genug.«
Im achten Stock einer großen Bank, mitten in Manhattan, habe ich eine Verabredung mit Masazumi Nakayama. Vor Jahren studierten wir gemeinsam an der New York University. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, hat er meine Schwachstellen wieder vergessen. Bei ihm bin ich neu, er ist gnadenlos japanisch, schlachtet mich sofort mit seiner Großzügigkeit, lässt keinen Augenblick ungenutzt, damit ich das Konto meiner Schuldgefühle ein weiteres Mal überziehe.
Der Vierundvierzigjährige hat einen erstaunlichen Lebenslauf hinter sich. Für ostasiatische Verhältnisse – Stichwort Familienbande und Tradition – geradezu revolutionär. Im Jahr 1982 heiratete er auf Hawaii. Die Eltern blieben fern. Die Schwiegertochter tauge nichts, sagte der Vater, sie habe nichts zu bieten. Masazumi – Freunde dürfen ihn »pumpkin« nennen, so kürbisrund ist sein Gesicht – verließ Nagasaki. Allein die physische Nähe des Vaters deprimierte ihn.
Ein paar Monate später brach der nackte Hass aus, kälteste Zeiten nahten: Masazumis Mutter starb, der Vater verbot Masazumis Frau, an der Beerdigung teilzunehmen. Sie stellte Masazumi vor die Alternative: Ich oder die Tote. Masazumi konnte sich ein weiteres Leben nicht vorstellen, ohne beim Begräbnis seiner Mutter anwesend zu sein. Seine Frau verließ ihn. Masazumi saß einen Tag lang heulend neben dem kleinen toten Körper. Er heulte aus mehreren Gründen, nicht zuletzt aus Verachtung für den gnadenlosen Vater.
Im Sommer 1986 bot ihm die Citibank an, in New York zu arbeiten. So kam er nach Amerika. Der Tod seines Vaters, auf den er so lange gewartet hat, interessiert ihn heute nicht mehr. Sein Hass ist müde geworden und der Einsicht gewichen, dass manchen Vätern und Söhnen nicht zu helfen ist.
Natürlich hat Masazumi Zeit für mich, auch während der Geschäftszeiten. In den letzten elf Jahren ist er bis zum Vice-President seines Geschäftsbereichs aufgestiegen. Er kümmert sich um die japanische Klientel in den Staaten. Er reist viel und muss jedem Gesprächspartner erfolgreich einreden, dass seine Bank mehr Profit abwirft als die Konkurrenz. Sein Soll für dieses Geschäftsjahr – schlanke 25 Millionen Dollar – haben seine Kunden der Bank bereits überlassen.
»Greed is good«, zitiert Masazumi ironisch den Wall-Street-King vergangener Tage, Michael Milken, der im Gefängnis landete und der als bescheidener Mensch die Zelle verließ, um von nun an kleinlaut als Sozialarbeiter mit Vollbart seinen Unterhalt zu verdienen.
»Was ist Glück?« wurde Freud einmal gefragt. Und der damals Dreiundsiebzigjährige antwortete: »Sich einen Kindertraum erfüllen.« Inzwischen weiß auch Masazumi, dass Geldscheffeln kein Kindertraum ist. Die Aussicht, noch zwanzig Jahre lang je 25 Millionen heranschaffen zu müssen, erschreckt ihn. Seit langem muss er die tägliche Angst loswerden, dass ein noch Gerissenerer als er auftaucht, dass es zu viele Banken geben wird, dass die Gegner noch weniger Schlaf brauchen als er selber.
Wir gehen in den Dealing Room seiner Bank, er als Vizepräsident darf einen Wildfremden mitbringen. Das ist der Raum, wo gehandelt wird: Aktien, Warengeschäfte, Obligationen. Zweihundert Männer und Frauen vor Hunderten von Bildschirmen, ihre hungrigen Augen pausenlos auf der Suche nach einem Deal. Masazumi stellt mich ein paar seiner Kollegen vor. Das ist glatte Wirtschaftssabotage. Denn die wollen höflich sein und können nicht. So schauen sie in mein Gesicht und schielen gleichzeitig auf den Bildschirm, der unschätzbar hinreißender ist als ein Typ, der keinen Deal verspricht. Denn Sekunden entscheiden hier über Gewinn und Verlust, und der Schauder, diese Momente zu verpassen, peitscht sie zurück an ihre Schreibtische.
Ich vermute, dass sich Masazumi in meiner Nähe wohlfühlt. Jemand, der keine Ahnung von Geld hat, versetzt ihn sicherlich in einen Zustand tiefster Entspannung. Zudem sind Ahnungslose wie ich ein dankbares Publikum. Sie holen noch Luft und staunen, wenn sie etwas erzählt bekommen, wo Insider nur blasiert mit dem Kopf nicken.
Wir überqueren die Madison Avenue, auf der gegenüberliegenden Seite steht die St. Peter’s Church, seltsam geduckt unter einem anderen Wolkenkratzer, der ebenfalls zur Citibank gehört. Im Erdgeschoss gibt es ein hübsches Café, unser Ziel. Neben der Kirche steht ein kaputter Alter, an seinem Gürtel hängt ein Bauchladen voller Bleistifte, händeringend ruft er der vorbeiflutenden Welt zu: »For the grace of god buy a pencil.« Ich kaufe einen Bleistift für Masazumi und er beschenkt mich dafür mit einer umwerfenden Geschichte: Bevor die Bank zu bauen anfing, kaufte sie die bereits existierenden Häuser auf. Um sie abreißen zu lassen und Platz zu machen für den Neubau. Nur die Besitzer der Kirche wollten nicht verkaufen. Also kam es zu einer echt amerikanischen Lösung: Die Herren Pfarrer verkauften den »Luftraum« oberhalb der niedrigen Kirche. So steht das Kirchlein jetzt unter dem Teil eines Wolkenkratzers, der erst in 15 Meter Höhe beginnt.
Das ist so eine Story, über die Naive hinterher noch tagelang kichern, von dem Raffinement gerührt, mit dem sie hier wachen Geschäftssinn, das Rentabilitätsprinzip und die Sorge um ihr Seelenheil unter einen Hut bringen. Der Herrgott im Schatten des einzig sichtbaren Gottes, des Geldes: Das ist ein kleiner Geniestreich. Bert Brecht fällt mir ein, erschöpft vermerkte er während seiner Exiljahre in Santa Monica: »Hinter jedem Baum vermutete ich ein Preisschild.« Armer B. B., für seine Phantasmen vom alles versöhnenden Sozialismus war Amerika wahrhaftig der höllischste Platz, den er sich aussuchen konnte.
Wir fahren ins Hunmura, ein Restaurant im Süden Manhattans, das feine japanische Küche bietet. Ich weiß bereits im Taxi, dass Masazumi sein Ehrenwort brechen und mich nicht zahlen lassen wird. Aber ich kenne noch nicht den Grund, den er diesmal erfinden wird. Zwei Stunden später stellt sich heraus: Er sei hier bekannt, lauter Japaner, und er verlöre für immer sein Gesicht, wenn er sich von einem Nicht-Japaner einladen ließe.
Der Westen hat Spuren in ihm hinterlassen. Nicht asiatisch scheu, mit Mut zieht er Bilanz, spricht genau das aus, was er seit Jahren fühlt. Ich weiß, dass er wieder geheiratet hat. Amanda, eine Kolumbianerin. »A good wife«, sagt er und fängt an, von seiner Mutlosigkeit zu erzählen: »Wer viel riskiert, der wird viel gewinnen oder viel verlieren. Ein banaler Satz. An der Börse ist das nicht anders als im ganz normalen Leben. Deshalb entscheiden sich so viele für die Ehe, sie ist kein wirkliches Risiko. Deshalb wirft sie am AQ – dem Abenteuer-Quotienten – gemessen, so wenig ab. Schützt aber gleichzeitig vor den Abgründen der Freiheit. ›Freiheit ist ein harter Lehrmeister.‹ Der Satz ist fürchterlich wahr. Zu hart für die meisten, also entspricht die Temperatur ihres Lebens der ihrer Bereitschaft zum Risiko: lauwarm. Mein Leben ist lauwarm.«
Mit großer Seelenruhe zieht Masazumi die Bilanz seiner eigenen Existenz. Ohne geschwätzige Eitelkeit, ohne Bitte um Verständnis, ohne mildernde Umstände, wie auswendig gelernt beichtet er. »Jeder erfindet sich eine Geschichte«, schreibt Max Frisch, »und die hält er dann für sein Leben.« Bei Masazumi ist es umgekehrt: Er erfindet nichts, er findet nichts Gutes in seiner erfolgreichen Karriere, spürt nur Scham über den Verlust seiner Träume. Die einmal so weit weg waren von der Realität eines Mannes, der jedes Jahr zwölf Monate Zeit hat, um 25 Millionen Umsatz anzuhäufen. Das zuzugeben ist tapfer, sehr tapfer.
Himmlisch sakeblau steigen wir in den Limousine Service, den das Restaurant für uns bestellt hat. Masazumi scheint jetzt unbetrübt. Die Beichte war wichtig, the file is closed. Der Ekel über das amerikanische rat race wird weiter an ihm nagen. Reden wird er nicht mehr davon. Ob er über die Kraft verfügt, zu seinen Träumen zurückzukehren, wird er allein entscheiden müssen, mutterseelenallein. »If you have a goal, you have a problem«, sagt er zum Abschied. Nun scheint er auf der Suche nach anderen Zielen, nach anderen Problemen. Sinnlicheren, sinnenfroheren.
Norman Mailer notierte einmal begeistert: »Wer nach New York kommt, sieht zuerst einmal nur Frauen. Und was für Frauen.« Das hat der Meister mit der höheren Arroganz derjenigen verkündet, die irgendwann für immer hier leben. Wie recht er hat. Denn so viele Geradegewachsene, so viele große Elegante treten in der Provinz nicht auf. Sie wandern aus, hierher. Die Stadt hat ein Auge für Pracht, schmeichelt den Eitlen, versorgt jeden mit Arbeit, der bereit ist, sein Schönsein als Ware auszubeuten.
Vor Jahren wurde ein Witzbold bekannt, der am Holland Tunnel ein Schild mit der Aufschrift »America« installierte. Es zeigte Richtung New Jersey, Richtung Westen, Richtung Trostlosigkeit und müdes Leben. Jeder darf New York verfluchen. Aber an Öde und Mangel an Aufregungen wird hier keiner zugrunde gehen.
Mir bleiben zwei Tage in Manhattan und ich habe mir im Flughafenbus schon geschworen, die Schönen nicht anzuschauen. Andere kennen die Namen der Sterne, ich kenne die Namen der Einsamkeiten: Weil ihnen die Augen bluten vom Hinsehen auf begehrenswerte Gesichter, die sie nie kennenlernen werden. Weil die Zeit fehlt, weil die Frau von einem anderen Mann begeistert ist, weil irgendwo ein Abfahrtsignal schrillt, das man nicht versäumen darf.
Zudem leben wir in den snoring nineties. Es gab einmal die roaring twenties und die wild seventies. Das ist lange her. Sex gilt heute als eher unnütz, als gefährlich sowieso, sich ausziehen und loslegen als Zeitverschwendung, als eher lästige Unterbrechung beim Einsammeln von Geld. Einer Umfrage zufolge geschlechtsverkehren Männer und Frauen in diesem Land achtzehn Minuten lang miteinander. Pro Woche. Nicht, dass sie es übertreiben. Aber immerhin glatte siebenundsiebzig Sekunden alle zwölf Stunden.
Die New York Times berichtet von einer Auktion, bei der Plakate und andere Memorabilien, die an den Summer of Love 1967 erinnern, zu fetten Preisen versteigert wurden. Heute erinnern wir uns an fröhlichen Sex und bezahlen sogar für diese Erinnerungen. Hirnsex scheint verführerischer als die tatsächliche nackte Menschenhaut. Immer mehr erregen sich, heißt es an anderer Stelle, am Cybersex im Internet. Unergründliches Männerherz: verruckelte Bilder von unverschämt falsch stöhnenden Damen als willkommene Alternative zu dem, was die Japaner »homban« – the real thing – nennen?
Als ich die Park Avenue hinunterschlendere, höre ich über mein Walkman-Radio einen spanischsprachigen Sender. »¿Como superar la masturbación?« heißt der Beitrag der Stunde: »Wie besiege ich die Selbstbefriedigung?« So weit sind wir schon, sogar das Onanieren wollen sie abschaffen. Trotzdem, so ein Titel wärmt den einsamen Reisenden. Er verführt zum Grinsen und gibt Einblicke, in welch dunkle Gassen sich die sexual correctness inzwischen schon verrannt hat.
Dass sich nun auch die Mexikaner zu solch moralinsauren Ausritten hinreißen lassen, beweist das dringliche Bedürfnis Amerikas nach umgreifender Sauberkeit. Ich ertappe mich dabei, für Sekunden über eine Lösung – die Abschaffung des heiligen Onan – nachzudenken: Was könnte man mir und allen anderen Aufgewühlten mit auf den Weg geben, um uns die Versuchung auszureden? Um uns – »hacia las manos de Jesu Cristo« – zu den Händen von Christus hinzuführen. Das ist das Schönste an den moralisch so Erregten: ihre unfreiwillige Komik, der Wortwitz, den sie so begabt-naiv in ihren Entrüstungen unterbringen.
Ich biege ab in die Fifth Avenue. Die Stadt, so zeigen die Zahlen, ist friedlicher geworden. Bürgermeister Rudolph Giuliani gilt als Aufräumer. Andere Bürgermeister reisen an, um bei ihm zu lernen. Auch sie wollen aufräumen wie er. Das heißt nie, das Problem zu lösen. Das heißt immer: mehr Polizei und mehr Macht für die Polizei.
Ein paar warten immer noch darauf, weggeräumt zu werden. Ein sinnloses Unterfangen. New York wird sie behalten, auch auf der teuersten Straße der Welt: die Treppenhocker und lauthals Verzweifelten, die Abfallwühler und Mondsüchtigen, die Tagundnacht-Schlurfer und Zigarettenstummel-Endverbraucher, die Ganzkörperverschorften und auf alle Zukunft Abgemeldeten. Sie werden übrigbleiben bis zum Jüngsten Tag, werden die Schönen, die Effizienten, die vom Konsum Gezeichneten daran erinnern, dass sie, die anderen, noch immer da sind.
Kein war on hunger, kein war on poverty – schon Nixon hat diese Kriege angezettelt und verloren – wird sie verschwinden lassen. Einer rennt mit nach oben gestrecktem Pappdeckel an mir vorbei, schreit, was er schon schriftlich niedergelegt hat: »The end is at hand.« Das passt, denn neben dem nagelneuen Armani Exchange liegt einer mit saftigen Karzinombeulen, bedeckt mit einem Stück Papier, auf dem es jeder lesen kann: »Homeless with Aids«. Was kommt danach? Was kann noch fürchterlicher klingen, als keine eigenen zehn trockenen Quadratmeter zu haben und von einer tödlichen Krankheit weggerafft zu werden?
Ich flüchte in den nächsten Barnes&Noble-Buchladen. Will schauen, lesen und die Verlierer vergessen. Und habe kein Glück. Wie vom Teufel dirigiert, stoße ich auf eine deutsch-englische Ausgabe mit den Gedichten von Paul Celan. Der ist der letzte, der einen jetzt aufrichtet. Aber Celan meistert die Sprache mit so berührender Wucht, dass auch seine unseligsten Gedichte überwältigen mit erbarmungsloser Schönheit. Man weiß nie, was bei ihm tiefer geht: die Freude über seine Wörter oder der Schmerz über die grauenhaften Dinge, die er hinschreibt:
Käme
Käme ein Mensch
Käme ein Mensch zur Welt, heute,
mit
dem Lichtbart der
Patriarchen: er dürfte,
spräche er von dieser
Zeit, er
dürfte
nur lallen und lallen,
immer-, immer-
zuzu.
(Pallaksch, Pallaksch)
ABSCHIED VON NEW YORK
Am nächsten Morgen verlasse ich meine kleine Pension in der Nähe der Columbus University, Westside, ein paar Blocks von Harlem entfernt. Ich suche Zeitungen und ein Café. Als ich die Dicke vor einem Geldautomaten auf der Straße liegen sehe, weiß ich Bescheid. Eine solche Stellung in dieser Gegend ist eindeutig. Im selben Augenblick denke ich an den so rührigen Bürgermeister. Unübersehbar, ein paar Ganoven laufen noch frei herum in seiner Stadt.
»He’s got the money«, schreit mir ein Passant zu. »He« ist nicht der Bürgermeister, sondern der Ganove, der die Dicke ansprang, ihr das soeben gezogene Geld entriss und – schon ein Häusereck weiter – im gestreckten Galopp das Weite suchte. Wir zwei wetzen hinterher. Ein dritter Passant, informiert von unseren Notrufen und dem Langfinger ganz nahe, stellt sich dem Dieb in den Weg. Tollkühn und vergebens. Denn die Fliehkraft des Flüchtigen ist rasanter als die Standfestigkeit des Tollkühnen. Auch der ist dick, aber nicht dick genug, um jetzt nicht gemeinsam mit dem augenblicklichen Geldbesitzer auf dem Trottoir zu landen. Nun liegt ein zweiter dicker Mensch am Boden. Der Dünne, unverdrossen mit einer Hand die Dollarnoten umklammernd, schnellt nach oben und läuft – von zwei Vollbremsungen begleitet – über den Broadway und biegt unaufhaltsam in die 114. Straße ein.
Als wir Sekunden später ankommen, ist niemand mehr zu sehen. Eine Polizeistreife hält jaulend neben uns. Nachdem wir den zwei dicken Bullen – nun sind vier Dicke in den Fall verwickelt – erklärt haben, dass wir die Verfolger sind und nicht die bad guys, suchen wir gemeinsam. Nichts. Dann hilft ein Zufall. Ich erinnere mich plötzlich, dass ich gestern in dieser Straße zwei Notizblöcke kaufte. Die banale Erinnerung blieb haften, denn das Schreibwarengeschäft lag in einem Keller, eine gusseiserne Wendeltreppe führte zu ihm hinunter. Ein paar Meter weiter sehe ich jetzt die Treppe, denke noch, das wäre ein gutes Versteck, schaue von oben hinunter, nobody, leer und still, das Geschäft noch verschlossen.
Und dann doch. Schon im Abwenden registriere ich eine winzige Bewegung. Der einzige Fehler des Gehetzten. Da seine Haut schwarz war wie das Dunkel, in dem er sich versteckte, hatte ich ihn nicht bemerkt. Warum er aus dem Schutz der Dachrinne trat, hinter der er sich versteckt hatte, ich werde es nie wissen. Ich rufe die beiden Dicken, routinemäßig wird er verfrachtet. Sie verlangen noch meine Adresse für weitere Zeugenaussagen. Ich hinterlasse falsche Angaben.
Beim Frühstück geht es mir schlecht. Ich habe plötzlich Gewissensbisse über meinen Eifer. Ein armer, dünner Kerl mit zerfetzter Hose und sechzig geklauten bucks. Geklaut aus den dicken Fingern einer Frau, die sicher das Geld weniger verzweifelt benötigte als er. Ich beschließe, beim nächsten Mal niemanden zu entdecken.
Ich packe, mit der Subway und dem Rucksack geht es zur 42. Straße. Auch die ließ der Bürgermeister abreißen, auch die soll fleckenlos und todsündenfrei werden. Komplette Häuserzeilen ehemaliger Sexshops, Pornokinos und klebriger Hotelzimmer wurden von der Betonbirne zertrümmert. Damit endlich Ruhe ist vor der Wollust, damit Platz wird für unsere wahren Sehnsüchte: Walt Disney Inc. klotzt gerade, riesige Einkaufspassagen wachsen. Ersatz – das deutsche Wort ist heute Teil der amerikanischen Sprache – scheint erotischer als das Original.
Zwischen der 6. und 7. Avenue steht ein Mann, den Albert Camus einen Helden des Absurden genannt hätte. »We sell golden diamonds«, ruft er den vorbeieilenden Fußgängern zu und versucht gleichzeitig, einen Stoß Waschzettel loszuwerden. Stuart ist Inhaber eines klassischen McJob. Seit sieben Jahren ruft er der Menschheit »We sell golden diamonds« zu. Wir reden und ich erfahre, dass er leidet. Das ist ein Fehler. Wer nicht über die Begabung verfügt, seinen IQ zu senken, den wird es jeden Tag acht Stunden lang in den Abgrund einer Depression reißen. Denn er wird nie vergessen können, dass er einmal für etwas anderes auf die Welt kam, als zwischen New Yorks 6. und 7. Avenue »We sell golden diamonds« zu blöken.
Da lobe ich mir Reverend Terence Cormack. Keine hundert Meter vor meinem Ziel, dem Port Authority Bus Terminal, hat er mich erwischt: beim Betrachten eines der letzten noch einsehbaren Schaufenster voller Werkzeuge und Apparaturen zur Maximierung der Lust und anderer Schweinigeleien. »You must be reborn again«, so donnert er mir mit seinem batteriegepufferten Lautsprecher in den Rücken. Ich drehe mich um und da steht er, einäugig, riesig, goldberingt, drohend und dreizackig lächelnd zugleich. Er gehört zu der attraktivsten Horde von Wahnsinnigen, die diese Stadt für alle Sünder bereithält: den ambulanten Seelsorgern und Freelance-Erlösungspredigern, die jeden in die Hölle fluchen, der sich ihren Erlösungstiraden verweigert. Ich weiß, was es geschlagen hat: Eine Taufe ist fällig. Ohne Wiedergeburt, mitten auf der 42. Straße um Schlag elf morgens, gibt es für mich kein Weiterleben mehr.
Ich nicke ergeben und Cormack fährt ab, legt seine beiden Hände um meinen Kopf, fragt nach meinem Namen (»Andrew«) und jagt einen flammenden Monolog ins Mikrofon, mich zwischendrin auffordernd, ihm hinterherzujagen, ihm nachzubeten, was er hinauf in den Himmel schleudert: dass der Herr mich vom Pfad der hemmungslosen Brunst zurückholen und ins »kingdom of moral embellishment« heimholen soll, ins Königreich der moralischen Verschönerung. Denn »Andrew from Paris