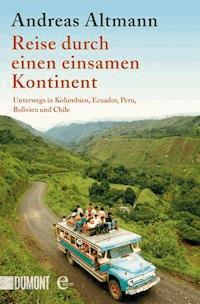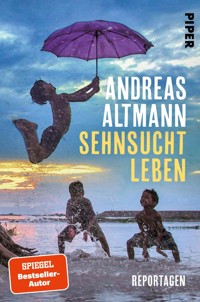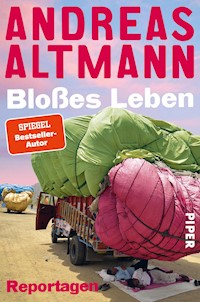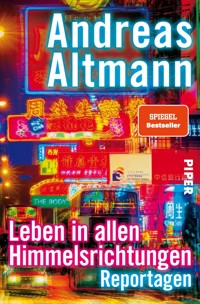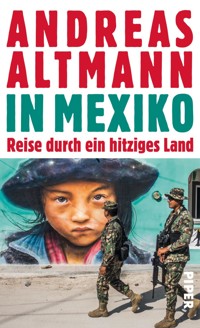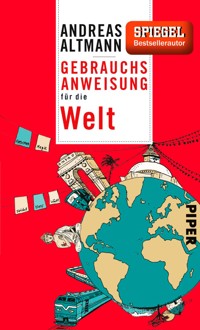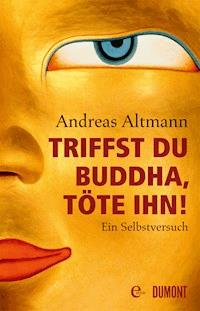
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Andreas Altmann ist das Gegenteil eines Esoterikers: aufgeklärt, kritisch, meinungsfreudig. Aber auch ein rastloser Reiseschriftsteller braucht Momente der Ruhe, um sich zu sammeln. So kam Altmann nach Indien. Was er suchte: Einkehr und Klarheit. Was er fand: Ein Trainingscamp des inneren Friedens. Von Neu-Delhi fährt er nach Varanasi, erkundet die wichtigsten Stätten des Buddhismus – und landet durch Zufall im Meditationszentrum von S.N. Goenka. Seit vierzig Jahren unterrichtet der Guru Buddhas wichtigste Meditationslehre. Jede Form der Ablenkung ist untersagt. Und die Regeln sind streng: Alle mitgebrachten Gegenstände werden eingesammelt, kein Radio, keine Drogen, kein Sex, kein Strom, keine Gespräche. Altmann befolgt alles, nur eines nicht: das Verbot des Schreibens. Und ganz am Ende bewahrheitet sich die Weisheit, dass Buddha lehrt, Buddha zu überwinden. Andreas Altmann hat eine klarsichtige, persönliche und mutige Reportage geschrieben, die auch den Hiergebliebenen die Augen öffnet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Andreas Altmann
TRIFFST DU BUDDHA,
TÖTE IHN!
Ein Selbstversuch
Wenn du an eine Weggabelung kommst,
beschreite sie.
Ein Zenspruch
Ihr sollt niemals aufhören zu leben,
ehe ihr gestorben, welches manchem
passiert und ein gar ärgerliches Ding ist.
Jacques Offenbach
Ende der Welt
durch das Aufhören der Wärme.
Gustave Flaubert
Für Jene so nah, so beunruhigend nah
Für Ulli S., den Unverbrüchlichen
VORWORT
Zuerst seien die Zarten beruhigt. Auf den 255 Seiten wird keiner geschlachtet, totgemacht oder hinterrücks gemeuchelt. Auch kein Erleuchteter. Der Autor wird sich in kein Kloster schleichen und beim letzten »Om« die Dynamitstangen zünden. Er wird sich auch nicht auf Buddha-Statuen werfen, um sie in Stücke zu sprengen. Das »Töte ihn!« im Titel hat eine ganz andere Bedeutung. Weit weg von Gewalt, von jeder Art Schmerz. Doch, einen Trennungsschmerz gibt es.
Seit Jahren will ich über meine Erfahrungen mit dem Buddhismus schreiben. Die auf drei Kontinenten und über lange Zeiträume stattgefunden haben. Ich habe mich nicht getraut. Aus verschiedenen Gründen, einer heißt schlicht: Unbegabung. Ich bin nicht sonderlich talentiert für Spiritualität. Obwohl ich fähige Lehrer hatte. Bin eher verstockt, eher reserviert. Zudem leicht entnervt vom esoterischen Getuschel, das sich spirituell aufführt und doch nur der weltweiten Verdummung zuarbeitet.
Aber jetzt habe ich das Buch geschrieben. Nicht über die früheren Erlebnisse, sondern über die neuen. Die Reise liegt nur kurz zurück. Den endgültigen Anstoß für das Unternehmen gaben die fünf Meter Literatur zu Buddhas Lehre, die bei mir zu Hause stehen. Nicht, dass ich jeden Band fertig gelesen hätte. Oft habe ich irgendwo in der Mitte abgebrochen, oft ihn verdrossen zurückgestellt. Als Buchleiche, mit dem Vermerk: »Vorsicht, Gutmensch« oder »Vorsicht, Sprüche« oder »Vorsicht, Gebrauchsanweisung für Heilige«. Man will nicht glauben, was alles an Lamas, Oberlamas, Abgesandten des obersten Lamas, an Mönchen vom Berg der sieben Wiedergeburten, an letzten Inkarnationen und Gurus von eigenen Gnaden, was alles an »Erhabenen« in die westliche Welt schwärmt, um uns so prachtvoll-nutzlose Weisheiten zu übermitteln wie: »Der wahrhaft Erwachte kennt kein Ich mehr und keine Wünsche des Ichs.«
Man darf vermuten, dass die Schwärmer – viele von ihnen durchaus guten und weisen Willens – zu lange auf dem Dach der Welt gelebt haben, zu verborgen in Himalaya-Verliesen oder verwunschen einsamen Klöstern saßen. Sie wissen nicht, wie es im tatsächlichen Leben zugeht: Im Fernen Westen, bei uns, den Modernen, den von hundert Ängsten Getriebenen, den Schlaflosen, den Friedlosen, den Freudlosen, den standhaften Wegschauern. Wüssten sie es, die Weisen würden vielleicht ihre Wundertüten voll von »Erleuchtungsgeist« und Nirwana und Ichlosigkeit wieder einpacken. Und etwas anbieten, was uns konkreter, weniger abgehoben und weltfremd hilft. Denn Hilfe, das scheint gesichert, brauchen wir. Viel leerer kann es in unserem Leben nicht werden.
Dazu eine Anekdote, um Klarheit zu schaffen: Ich hatte in allen vier Mathematik-Schulaufgaben eine makellose Sechskommanull hingelegt. Im Abschlussjahr. Makellos, da ich jedes Mal ein vollkommen unbeschriebenes Blatt abgab. Ich war (bin) ein Zahlen-Legastheniker, eine endlose Null, eine »beispiellose Ernüchterung« (mein damaliger Rektor). Frage nun: Hätte ich die abschließende Abiturprüfung geschafft, wenn mir Herr Einstein Privatunterricht zum Thema Relativitätstheorie gegeben hätte? Natürlich nicht. Gerettet hat mich ein Freund, der mit mir drei Wochen lang das Einmaleins paukte und mich anschließend auf einen, und nur einen, geometrischen Lehrsatz drillte. Und so kam ich davon, mit einer glorreichen Fünf.
Die Lehre daraus? Man verschone uns mit Aufrufen zur Abschaffung unseres Ichs. Das Ansinnen ist so weltfern wie die Hoffnung eines 20-jährigen Einmaleins-Schülers auf den Nobelpreis für Physik.
Dass uns der Osten etwas beibringen kann, wer würde dem widersprechen? Aber er soll uns nicht überschätzen. Sein Ich gibt der Weiße Mann nicht her. Andererseits: Manche haben auf einmal genug von ihrem Super-Ego, sie wollen es abspecken. Eine Sehnsucht treibt sie nach einem Leben mit weniger Gier, weniger Protz. Und mit mehr Freundlichkeit, mehr Nähe. Und mehr Ahnung von dem, was reich macht, und dem, was erniedrigt.
Dieses Buch erzählt von einem Mann, den ich in Indien getroffen habe. Auch ein Lehrer. Aber (fast) ganz von dieser Welt, zudem radikal spirituell, sprich, radikal antireligiös. Er verschenkt etwas, was teurer nicht sein könnte. Dabei beherrscht dieser Inder kein einziges Wunder, niemand schluchzt vor Ergriffenheit bei seinem Anblick, keiner wirft sich ihm zu Füßen. Im Gegenteil, er fordert von jedem, nie die eigene Verantwortung aufzugeben, nie nach dem Herrgott und anderen Göttern Ausschau zu halten und immer alles – immer – auf den Prüfstand der Vernunft zu stellen.
Sein Geschenk könnte man mit einer Art Rüstung vergleichen. Allerdings luftleicht und wunderbar beweglich. Man kann sie überall tragen. Sie stört nie, im Gegenteil, sie schmückt. Denn sie schützt den Geist vor den Anwürfen der Verblödung und die Innenwelt vor den Frostschäden schleichender Verrohung. Zugleich kann der Panzer ungemein porös werden. Dann lässt er Wärme durch, Wohlwollen, Nachsicht für viele, auch für sich.
Gewiss, das Anlegen der Rüstung dauert. Man muss es lernen, üben, wieder üben. Das tut weh, frustriert, sorgt für Attacken der Mutlosigkeit. Davon redet das Buch. Und von den Glücksgefühlen, die zwischendurch immer wieder aufblitzen. Und im Laufe der Zeit zunehmen, an Zahl, an Tiefe. Davon redet es auch. Wer den Typ in Indien besucht, bekommt ein Krafttraining verpasst. Damit der Herzmuskel nicht nachlässt, ja wieder eine Innigkeit ausbricht, die uns irgendwo, irgendwann verloren ging.
DIE SUCHE
Einchecken in Paris, Flug nach Indien. Lesen. Seitenlang berichtet die Presse über eine Handvoll Terroristen, die vor zwei Tagen über Mumbai (Bombay) hergefallen sind. Mit »Allah Akbar« auf den Lippen mähten sie 168 Männer und Frauen nieder. Als ich im Jahr zuvor nach Sydney aufbrach, waren die Zeitungen gerade voll mit Reportagen über einen Arzt, der mutmaßlich dort als Terrorist agierte. Vor dem Start zu meiner Südamerikareise gab es am Flughafen Charles de Gaulle einen Bombenalarm. Ein Zufall nach dem anderen, unbestritten. Trotzdem, man wünscht sich lustigere Zufälle.
Aber es wird lustig. Makaber lustig. Unter »Vermischtes« steht, dass Gerd Sonnleitner, der Chef des deutschen Bauernverbandes, von einer »Verzehrzurückhaltung« spricht, die nun auch die Milch- und Molkereiprodukte erreicht habe. »Früher«, so der Oberbauer, »wurde etwa ein Drittel der eingekauften Nahrungsmittel weggeworfen.« Leider heute nicht mehr, deshalb der Rückgang. Und der muss aufhören, so seine Mahnung an das deutsche Volk. Es soll, kurzum, wieder mehr einkaufen und mehr wegschmeißen.
Der Irrsinn, von dem ich gerade lese, bestärkt mich. Die einen vernichten Menschen, die anderen das, was in meiner Jugend einmal »Geschenk des Himmels« hieß. Auch deshalb fliege ich nach Indien: um jemanden zu suchen, der weder »Ungläubige« durchlöcherte noch Käsetonnen auf Müllhalden schleuderte. Herrn Buddha. Einen, der cool mit anderen umging und Respekt vor dem zeigte, was wir heute Natur nennen, unsere Welt. Eben jenen, der meinen (unseren) Zynismus mit Gedanken und Ideen bremst, die möglicherweise dabei helfen, dem Wahn der Gegenwart behänder zu begegnen. Richard Gere wurde einmal gefragt, warum er sich dem Buddhismus zugewandt hatte, und seine Antwort klang pathetisch und sonnenklar: »Um nicht verrückt zu werden.«
Natürlich werde ich nicht Buddha treffen. Er ist tot wie alle anderen Toten. Will einen Zeitgenossen finden, der mich (wieder) an ihn, an Buddhas Welt-Anschauung heranführt. Und natürlich will ich kein Buddhist werden. Ich kann es nicht. Seit dreißig Jahren bin ich von ihm fasziniert und noch immer zu schwach für seine Ansprüche. Aber ich will näher an ihn ran, will endlich den Umgang mit einem Werkzeug lernen, das garantiert zur Lebensfreude beiträgt.
Bedenkt man, was uns täglich anranzt und vergiftet, dann scheint mir das Unternehmen gerechtfertigt. Bedenkt man zudem die vielen Griesgrämigen und Trostlosen, Neidhammel und Wichtigtuer, denen man stündlich über den Weg läuft, dann ist zu vermuten, dass wir alle – wir Vielen – eine Brise Leichtigkeit, Menschenfreundlichkeit und Swing vertragen könnten. Denn ich weiß noch immer nichts Innigeres, was einer dem anderen schenken kann, als sein Glück, sein Glücklichsein.
Es gibt viele Möglichkeiten, sich Linderung zu verschaffen. Auch Lachen lindert, wie jetzt bei der Zwischenlandung in Bahrain. Ich gehe auf den Buchladen zu und mitten im Weg steht Paulo, als Bücherturm voller »Brida«-Exemplare. Paulo Coelho hat wieder zugeschlagen. Ich bin schwach wie ein verdurstender Alkoholiker und greife hinein. Furchtbares, ich weiß, erwartet mich, aber ich kann nicht anders. Der Eso-Schwadroneur macht süchtig. Bei P. C. muss man nicht lange blättern, der Schwachsinn lauert an jedem Zeileneck, »… und furchtlos begannen sie Liebe zu machen, weil Gott die Unschuldigen schützt. Sie spürten nicht länger die Kälte. Ihr Blut raste mit solcher Geschwindigkeit durch ihre Venen, dass sie sich einige Kleider vom Leib riss und er auch.« Ist das nicht bestrickend blöd? Und so geht es weiter: »Und sie stand nun vor ihm und schnatterte wie ein Glühwürmchen vor Geilheit. Und er glühte gleich mit. Denn Gott liebt die Nackten und furchtlos Geilen.«
Ok, der Glühwürmchen-Einschub ist von mir, aber der geneigte Leser erkennt sofort, dass ich es auch kann. Schreibt einer so windig über Sex, weil er im tatsächlichen Leben, mitten im Bett, auch nur windigen Sex produziert? Oder fuhrwerkt er zwischen den Laken noch blindwütiger als am Schreibtisch? Wir werden es nicht erfahren.
Von der Propaganda-Maschinerie wird der Brasilianer als »spirituell« verkauft. Das schöne Wort ist ein heftig geschurigelter Begriff, arg verhurt. Ich will mich anstrengen, um als Schreiber nicht selbst in die Untiefen esoterisch verblasenen Schunds abzustürzen. Dennoch, von Coelho, dem Meister argloser Idiotisierung, kann man lernen. »Negative learning«, sagen die Engländer: So nicht!
Beim Weiterflug lese ich über einen, der sich bei dem Thema auskennt. Der Dalai Lama gibt zu, dass sein »mittlerer Weg« nach jahrzehntelangen Verhandlungen mit Peking gescheitert sei. Die chinesische Staatsmacht prügelt und foltert weiter in Tibet. Armer Lama, geistige (spirituelle!) Auseinandersetzung funktioniert nur, wenn beide Seiten Geist mitbringen, um sich in der »Mitte« zu treffen. Wenn beide wollen. Chinas Staatschef Hu Jintao hat sich vor zwanzig Jahren als Gouverneur der Region und »Schlächter von Lhasa« einen Namen gemacht. Einen blutigen. Schlächter schlagen den Kriegspfad ein, von einem mittleren Weg, einem der Fairness und des Kompromisses, wollen sie nichts wissen. Immer erstaunlich, wie gelassen die Gesichtszüge des Dalai Lamas bleiben. Auch dann, wenn er eine Niederlage verkündet und von den Todfeinden seines Volkes spricht. Er kann nicht hassen, sagt er.
Landung frühmorgens in Neu-Delhi. Ich habe nicht einmal einen Plan A, nur die Absicht, im indischen Meer der 1,1 Milliarden den einen zu finden (die eine, auch gut), der Vertrauen verbreitet. Einen, in dessen Nähe ich klüger werde, vielleicht einsichtiger, vielleicht robuster im Umgang mit der Welt. Ich lasse mein Gepäck im Hotel und streune durch die Stadt. Ich will Glück haben, der Zufall soll mich einholen.
Jedes heute geschriebene Indien-Buch ist in hundert Jahren noch immer aktuell. Nur die Zahlen müsste man ändern. Statt einer satten Milliarde Einwohner wären es im Jahr 2110 eben 25 Milliarden. Und aus den räudigen Hunden sind 25 Mal so viele räudige Hunde geworden. Und auch die Armee der heiligen Kühe wird sich auf Indiens Straßen gigantisch vergrößert haben. Wie die Armee der sich rasend vermehrenden Blechkühe.
Kein Geduldsfaden ist so lang wie der indische. Der Inder kann aus seinem Haus treten und von Kackhaufen umzingelt sein. Und trotzdem nichts fühlen, keine Wut, nichts riechen, keinen Gestank. Oder alles fühlen und alles riechen. Und sich dennoch nicht aufbäumen.
Und bei uns, den fremden Besuchern, jenen mit den kleineren Herzen, hat sich auch nichts getan. Noch im 21. Jahrhundert wird jeder indische Abgerissene, der uns zu nahe kommt, einen Adrenalinschub auslösen. Weil wir noch immer nicht fähig sind, kaltschnäuzig an ihm vorbeizugehen. So wenig wie unbeschwert ein paar Münzen herauszurücken. Die einen von uns gehen genervt weiter, die anderen rücken genervt ein paar Rupien heraus. Indien ist ein gigantischer Spiegel. Jeder darf hineinblicken und sich anschauen. Wer das Land im selben Zustand verlässt, wie er es betreten hat, kam schon als Leiche. Denn die Radikalität des Subkontinents ist sein Trumpf. Ein Reisender, der sich traut, läuft Gefahr, als ein anderer wieder abzureisen. So einer wäre ich gern.
Für einen Schriftsteller ist das Land ein Dorado. Gibt es doch kein Volk, das sich bedingungsloser vom Zauber der Wörter verführen lässt. Ich gehe an einer Bruchbude vorbei und lese »Palace Hotel«. Daneben ein »Super-de-Luxe-Hotel«, noch eine Bruchbude. Die Wörter glitzern, das zählt. Nicht der schäbige Verputz, nicht die mit Sperrmüll möblierte Rezeption. Das ist das Geheimnis der Inder. Diese Fähigkeit, sich aus der Wirklichkeit herauszukatapultieren. Sprache als Zaubertrank, als Sprungbrett in eine fantastische Welt.
Am Connaught Place, dem Zentrum von Neu-Delhi, steht ein Hare-Krishna-Stand. Sie hüpfen und jubilieren, wie überall auf der Welt sind sie auch hier freundlich und harmlos grotesk. Ich bekomme ein Büchlein mit dem Titel: »Chant and be happy«, mit den Lehren des Gründers der Bewegung, Swami Prabhupada. Sogleich lese ich das Gespräch, das der Meister mit John Lennon und Yoko Ono – beide bekennende Sympathisanten – geführt hat. Thema war das weltberühmte Mantra der Bewegung: Hare Krshna, Hare Krshna, / Krshna Krshna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, / Rama Rama, Hare Hare.
Der »Erleuchtete«: »Das Mantra singen ist das empfohlene Verfahren, um unsere Herzen zu reinigen. Jeder, der regelmäßig Hare Krishna singt, braucht nichts anderes mehr zu tun. Er ist bereits in der richtigen Ausgangsstellung. Er braucht auch keine Bücher mehr zu lesen.« Darauf Yoko Ono: »Yes, I agree.«
Wer wäre jetzt nicht gern Popkünstler? Initiiert vom Guru. Mit einem Vierzeiler fürs Glück. Und nie mehr lesen und denken müssen. Sonnig trällern reicht. Auch ich will mein Herz waschen. Einer der Gründe, warum ich hier bin. Aber ich will dabei mein Hirn behalten, will immer zuerst überlegen und dann ja sagen. Oder nein.
An Tempelmauern kleben ein paar Telefonnummern. Von Leuten, die ein »retreat« anbieten, eine Möglichkeit, sich für eine gewisse Zeit zurückzuziehen. Zum Stillsein, zur Meditation, zum Nachdenken über das eigene Leben, den Status quo. Nichts anderes suche ich. Aber ich komme nicht bei den angegebenen Telefonnummern durch, die Leitungen wackeln, der andere hört mich nicht, plötzliche Unterbrechung. Geheimnisvolles Indien. Ich lasse los, bin plötzlich geduldig.
Mit der Metro nach Old Delhi. Scharfe Kontrollen, sogar die Handtaschen werden geröntgt. Alles blitzsauber, kein Fetzen Papier liegt herum. Kaum hat man die Station Chandni Chowk verlassen, betritt man wieder vertraute Umgebung. Am Ausgang liegen die Krüppel, die Bettler, die Verrückten, die heiteren Faulpelze. Das alte Delhi ist eine kleine Hölle. Wer sie bedenkenlos betritt, wird das Schöne entdecken.
Hinter dem Rathaus-Park – einst verwüstet von Indiens Überbevölkerung, nun gesperrt – liegt ein Tempelchen, von dicken Bäumen umgeben. Eine Enklave für die Sadhus, die Wandermönche. Links und rechts brausen die sieben Todsünden der Menschheit vorbei, aber hier ist es still, nur sanftes Glockenbimmeln und Vogelzwitschern. Kein Ungemach kommt hier herein. Nur singen oder Tee schlürfen oder schlafen am helllichten Tag.
Noch ein Heiliger kommt. Bevor er mit seiner Bettelarie beginnt, frage ich ihn, ob er glücklich sei. Und er tappt in die Falle und sagt: »Yes, I am, very much so«, dann kurze Pause, dann: »Please, you help me.« Ich bin noch immer sanft und eiskalt und antworte vollkommen logisch: »Nein, DU hilfst mir, denn DU bist glücklich.« Das leuchtet ihm ein. Denn was ist sinniger, als dass die Glücklichen den Glückloseren beistehen?
Als ich die Oase verlasse, begegne ich sogleich wieder der ersten Todsünde im Land, der Armut. Ein Mann sitzt am Straßeneck, nur eine Armlänge vom indischen Abgastod entfernt. Und wäscht sich. Gründlich mit Seife und einem Kübel Wasser. Irgendwann sehe ich, dass er sich nur kniend bewegen kann, verdreht staken seine Waden in die Luft. Der Verkehr kümmert ihn nicht, nicht die Fußgänger, vollkommen unbehelligt putzt er sich. Um sich zuletzt einen Lunghi umzubinden, das Leibtuch. Das ist ein starkes Bild. Ganz frei von Elend. Nur Stärke und Disziplin sind zu sehen.
Ich suche die Adresse von Mahabir, seit achtzehn Jahren bin ich mit dem Alten befreundet, 2002 haben wir uns das letzte Mal gesehen. Als ich Straße und Hausnummer endlich finde, steht ein Mann davor, der sich als Anant vorstellt. Einer seiner Söhne. Ohne weitere Fragen bittet er mich hinein. Sein Vater ist tot, gestorben vor ein paar Monaten. Immerhin muss ich heute nicht schwindeln, denn sicher hätte ich wieder schwören müssen, nie mehr zu rauchen und nie mehr Fleisch zu essen. Hätte wieder gräuliche Bilder anschauen müssen von raucherbeinzerfressenen Gesichtern und bestialisch geschlachteten Tieren. Mahabir konnte nicht mal Fliegen töten. Mit einem Wedel fegte er den Boden vor seinen Füßen. Vor jedem Schritt. Damit kein Unheil über indische Mikroben kam.
Der Vater vererbte seine Güte an Anant, gewiss. Wie seinen Beruf, Broker. Auf allen drei Stockwerken flirren augenblicklich die Zahlen der Weltbörsen über die Computer. Kunden und Mitarbeiter sitzen davor und diskutieren über Kaufen und Verkaufen. Mahabir war Mitbegründer der Firma. So widersprüchlich kann ein Mensch sein. Wie jetzt der Sohn, der alle Profite eine Stunde lang vergisst und mich bewirtet. Die halbe Küche wird aufgefahren, kein Erbarmen für den Gast, die Vorspeisen, das Hauptgericht, die Sweets, die Lassis, die drei Tassen Kaffee. Bis ich, ein Kilo schwerer als zuvor, an das Waschbecken treten darf, an dem ich mir beim letzten Mal die Hände eingeseift habe. Und Mahabir noch hurtig ein Insekt entfernte. Damit der Vorgang des Reinigens »ohne zu töten« vonstatten ginge. Jetzt spüre ich den Druck hinter den Augen, auch berührt von der Erinnerung an einen, der so radikal alles Leben achtete.
Am Abend finde ich ein Restaurant, in dem ich essen, bleiben und schreiben darf. Ohne vom Orkangeschrei eines Fernsehers gemeuchelt zu werden. Ich weiß noch immer nicht, in welchem Land die läppischsten Programme produziert werden. Der Wettbewerb ist hart, das internationale Kopf-an-Kopf-Rennen lässt keine eindeutige Entscheidung zu.
Vor Tagen las ich, dass »Expressive writing« die Glückshormone sprudeln lässt. Wenn jemand einem anderen gegenüber – schriftlich – seine Dankbarkeit ausdrückt, dann überkommt den Dankbaren ein Gefühl von Freude. Das glaube ich sofort. Ich sitze zwei Stunden, um in mein (digitales) Tagebuch zu tippen, und rede von nichts anderem als meinen Schulden dem wundersamen Indien gegenüber.
Den Rest des Abends lesen. Die Presse schwingt bereits zurück, aufs übliche Niveau. Vorne noch die Fotos mit Leichen über den üppig gedeckten Tischen der Luxushotels, in denen die Islamisten ihre Kalaschnikows leerfeuerten, und Seiten weiter schon wieder ein Portrait von Paris Hilton. Mit der brennenden Frage darunter, ob sie sich tatsächlich von Benji Madden getrennt hat. Oder er von ihr. Vorne wird gefragt, woher die Mörder und Brandstifter kamen, und hinten will man wissen, wie es in Miss Hiltons Bett aussieht. Wir oszillieren zwischen Grausamkeit und Erniedrigung.
Eine Zeitungsredaktion hatte die clevere Idee, die neuen Sicherheitsmaßnahmen im Land zu checken (Titel der Recherche: »Who needs terrorists with policemen like you?«). Denn ein Ruck ging nach dem Massaker durch den Subkontinent. Überall und immerzu soll ab sofort kontrolliert werden. Um den nächsten Anschlag zu verhindern. (Nur im Irak waren Al Qaida und Co. mörderischer unterwegs.) Aber Indien bleibt Indien. Die Journalisten gehen mit Revolvern bestückt durch Metalldetektoren, das Gerät pfeift – und keiner vom daneben lungernden Sicherheitspersonal reagiert. Auch Indien kann nicht aus seiner Haut. Seine Einwohner haben kein Talent für den, sagen wir, deutschen Sicherheitswahn. Das kann schreckliche Folgen haben oder – wie so oft – für einen weniger paranoiden Alltag sorgen.
Und dazwischen stehen die Geschichten, die man voller Bewunderung und Neid zu Ende liest. Ein Polizist, der an der berühmten Victoria Station (57 Tote, 87 Verletzte) mit einem alten Karabiner auf die Terroristen zurannte, um sie abzulenken. Ein Teeverkäufer, der die Nerven behielt und am Kugelhagel vorbei einen Notausgang für Passanten fand. Ein Schaffner, der sich als Schutzschild vor eine alte Frau stellte. Wer von uns Lesern solcher Botschaften träumt nicht davon, dass er am Tag X Herzkammern in sich entdeckt, von denen er bisher nichts ahnte. Die etwas Grandioses von ihm zeigen, etwas, das allem widerspricht, was ihn bisher an sich zweifeln ließ.
Am dritten Tag weiß ich, was ich will. Ich gehe zum nächsten Bahnhof und fahre nach Varanasi. Abgedrehter und heiliger kann ein Ort auf diesem Erdteil nicht sein. Ich handle rein intuitiv, wüsste kein Wort zu sagen, warum ich dort eher den einen treffen soll, der das hat, was ich brauche. Oder, intelligenter formuliert, der mir zeigt, wie ich es in mir finde. Denn natürlich kann keiner dem anderen irgendwelche Kräfte schenken. Sie sind nicht übertragbar, nie. Ein japanischer Zen-Meister hat es einwandfrei formuliert: »Schau, da drüben steht das Scheißhaus. Ich kann dir nur die Richtung zeigen, doch scheißen musst du selbst.« Wie vulgär, wie weise.
Vorbei an einem Teil des indischen Volkes, das entlang der Gleise seine Notdurft verrichtet, in der Hocke, entspannt. Nach einer halben Stunde wird die Welt ansehnlich, grün, die ersten Sonnenstrahlen zwischen den Nebelschwaden. Ochsen schauen herüber. Die Reisfelder, die Stille, wie Elfen sehen die Kinder von ferne aus. Eine Landschaft wie im Märchen. Märchenhaft schön und verwunschen. Ich bin ein hoffnungslos irdischer Mensch. Aber auch die Gottlosen, die immer Weltlichen, suchen etwas, was über sie hinausgeht, was ein Gefühl von Nähe und Vertrautheit zu den anderen herstellt: wie der Blick auf die Natur oder das Erleben von Kunst, wie das Lesen eines Gedichts, wie die Wärme eines anderen Körpers, wie Musik, wie das Versinken in etwas, das auf unerklärliche Weise reicher macht, tiefer und beschwingter.
Ankommen und mit einer Fahrrad-Rikscha in die Altstadt Varanasis fahren, immer die endlose Godaulia Street entlang. Ich liebe diese Straße, sie gibt einen Blick ins indische Herz frei. Legionen von Vehikeln wälzen sich aneinander vorbei, wie ein gigantischer Fischschwarm sehen wir aus, wir 20 000 oder 30 000, die sich um diese Uhrzeit genau hier begegnen. Blitzhaft, verschwommen, nichts als eine Woge aus Leibern, Eisen und Blech. In Europa hätten wir längst den Bürgerkrieg aus gerufen, nicht hier. Dank ihres genetischen Erbguts führen die Einwohner gerade den nackten Irrsinn vor und nichts passiert. Keine Toten, keine Verletzten, kein Zeitverlust.
Die Stadt hat zwei oder drei oder vier Millionen Einwohner. So heilig geht es hier zu, dass jeder Tote ein glücklicher Toter ist. Weil er neben dem heiligen Ganges verbrannt und versenkt wird, ja, anschließend umstandslos und ohne lästige Wiedergeburt ins Nirwana abhebt. Sagen sie, glauben sie. Seit unheimlich vielen Jahren. Dass der Fluss inzwischen als Giftbrühe daherkommt, glauben sie nicht. Keiner der tausend mal tausend (wissenschaftlichen) Nachweise beeindruckt sie. Jeden Morgen kehren sie an seine Ufer zurück und zelebrieren den »holy dip«, das heilige Eintauchen. Hoch und heilig und immer versaut.
Am nächsten Morgen bin ich an den Ghats, den Treppen, die hinunter zum Wasser führen. Ich sehe einen jungen Kerl, der sich bis auf die Unterwäsche auszieht. Er hat nur ein Stück Seife dabei, sonst nichts, keine Creme, keine Bürste, kein Shampoo, keinen Kamm, kein Handtuch. Und er taucht unter, taucht auf, seift sich ein, auch die Haare, taucht wieder unter, wieder auf. Und kommt zurück zum Ufer, schüttelt den Haarschopf und zieht sich an. Das Hemd, die Hose, die Sandalen. Was für eine Unbeschwertheit, was für Gesten der Freiheit, was für eine souveräne Missachtung der Regeln eines »gesunden Lebens«.
Ich flaniere. Suchte ich systematisch, ich wäre tausend Jahre in Indien unterwegs. Ich will meiner Intuition vertrauen. Bin ich in Hochform, so erkenne ich das Glück, das mir begegnet. Bin ich dunkel und verbittert, gehe ich ihm zielstrebig aus dem Weg.
Ein Mann stellt sich vor mir auf, ein Bürogesicht, verschmitzt. Er mustert mich, und die Götter schenken uns folgenden Dialog, er beginnt:
– You look like an American actor.
– I don’t look like one, I am an American actor.
– I knew it, I saw you yesterday on tv.
Man muss (sich) nur überzeugend darstellen, und alles, absolut alles, wird geglaubt. Der Verschmitzte wird jetzt nach Hause laufen und erzählen, dass er einen amerikanischen Schauspieler getroffen hat. Morgen kommt einer vorbei und sagt, er sei erleuchtet. Und wieder werden sie es für wahr halten. Glauben ist tatsächlich wie Opium, er bewahrt vor jeder Kopfarbeit, macht dösig und trüb. »Selig die Einfältigen, denn ihrer ist das Himmelreich.« Verlockender kann man zur geistigen Trägheit nicht einladen.
In diesem Land gibt es den Irrsinn umsonst. Doch jetzt tritt er noch heiterer auf. Wieder ein Mann (Frauen stellen sich einem Fremden in Indien nicht in den Weg), schönes weißes Haar weht über seine Stirn, das lange weite Hemd wallt, der Shiva-Tupfen auf der Stirn leuchtet. Ah, ein Windei, ein Hochstapler, kleinste Körperbewegungen verraten es. Und Yudai übertrifft all meine Vorfreude. Er stellt sich als Wahrsager vor, hat mit je einem »master degree« in »Astrology« und »Sociology« an der hiesigen Banaras Hindu University abgeschlossen. Inzwischen besitzt er vier Häuser und vier Bankkonten. Erzählt er, gelassen. Dass er mir jetzt für ein paar Rupien seine Dienste anbietet – »I see your future« – steht natürlich in keinem Widerspruch zu seinen Sprüchen. Ich bin umgehend einverstanden. Nie käme ich auf die Idee, für die »Wahrheit« zu bezahlen, nein, ich entlohne immer für die Show, das hinreißende Brimborium.
Yudai hat das gesamte Programm dabei, »palm reading, face reading, star reading, everything.« Er singt, schaut auf meine Hände, mein Gesicht, auf den Ganges, »she is my god, my inspiration«, schaut auf die vollkommen unsichtbaren Sterne, schaut gespannt auf seine Notizen und fordert mich mehrmals auf, den Mund zu halten, denn er müsse sich einstimmen, müsse auf Mother Ganga hören, sie würde ihm die Geheimnisse über mich einflüstern.
Zinnober vom Feinsten und das Ergebnis – wie viele Männer hat Yudai schon ins Glück geredet? – kann keiner übertreffen: Uralt werde ich, »over 91«, dabei unheilbar gesund und strotzend, »you are and you stay a sexy man, women like you«. Ich bin den Tränen nahe und fordere ihn auf, den Satz deutlich zu wiederholen. Was er tut. Und noch hinzufügt: »Sun loves to you«, ich frage, was das bedeuten könnte, und höre, dass derjenige, den die Sonne liebt, »goes high«, erreicht die Spitzenposition, bleibt unschlagbar oben. Ich bin jetzt verwegen genug und frage den schamlosen Fantasten nach Zuständen, die nicht so gut aussehen in meinem Leben. Denn keiner kann auf Dauer nur tadellos und sexy sein.
Und Yudai pariert wie ein Profi: »Ja, die Montage und Donnerstage sind nicht deine Glückstage, da könntest du mit einem Schiff versinken.« Na klar, an diesen Tagen bin ich immer auf Wasserwegen unterwegs. Aber dann sagt er etwas Erstaunliches: »Money transaction is no good action«, erklärt, dass ich lieber Geld verschenken soll als borgen. Den Hinweis hätte ich gern früher gehört. Er hätte mir einiges erspart. An Herzbeschwerden, an Euro.
Aber die Situation ist zu munter, um sie jetzt zu verdunkeln durch die Erinnerung an den Verlust. Als ich Yudai frage – wir sitzen zehn Meter neben dem Fluss –, warum sich die Inder so besessen waschen, statt eine Umweltzu schaffen, die sie weniger oft zur Besessenheit zwingen würde, antwortet er lächelnd: »Very good question, but only god knows.« Und lehnt sich zurück. Ein hungriger Geist quält ihn nicht. Er mutmaßt wohl, dass Denken ihn in Schwierigkeiten bringen könnte, die Ruhe käme zuschanden. Voller Verwunderung blicke ich auf das Schlitzohr. Er besitzt das, was ich auch will. Nicht immer, aber zuzeiten. Diese Gleichgültigkeit, diesen Waffenstillstand mit der Welt. Er ist wahrscheinlich damit geboren, ich muss sie mir holen, sie umständlich und mühsam erkämpfen.
Ich täusche mich. Wir gehen essen, rasch findet sich ein Restaurant. Und ich begreife, dass es verschiedene Gleichgültigkeiten gibt. Yudai, der Inder, würde sich nicht wehren (ok, ich übertreibe leicht), wenn die Welt vor seinen Augen auseinanderbräche, tausend Rikscha-Wallahs versänken, die Luft des Massenverkehrs ihn zugaste, der Ganges Weltrekord-Giftquoten aufwiese, Yudai wäre dabei, würde es schlucken, inhalieren, mitmachen, kein Schrei entkäme ihm.
Und dann taucht ein anderer Stress auf, ein »persönlicher«, und jetzt rastet der Inder aus: Ich bitte Yudai, den Wirt für mich um ein paar Zwiebeln als Beilage zu bitten. Er gibt die Meldung in einem harschen Ton weiter, so, als wollte er den Mann beschuldigen, mich, seinen Bekannten, nachlässig zu bedienen. Kaum hat der Wirt die Aufforderung gehört, rennt er auf unseren Tisch zu, hebt die Chapatis hoch, die auf meinem Teller liegen und zeigt schnaubend auf die Zwiebelscheiben darunter. Ich sage umgehend »thank you«, eben ein banales Missverständnis, will weiteressen. Von wegen. Denn jetzt legen die beiden los. Statt die »Wirklichkeit« zu sehen, einen Kunden eben, der versehentlich um etwas bat (und meine Bitte an Yudai war ohne jede Gereiztheit), sehen die beiden rot und ziehen in den Krieg. Der eine sah eine Nachlässigkeit, möglicherweise einen Betrug, und der andere einen Landsmann, der ihn öffentlich abkanzelte. Statt freundlich etwas zu bestellen und statt souverän darauf zu reagieren, gehen beide in Gefechtsstellung. Sie sehen nicht den Augenblick, sie sehen »neurotisch«, wiederholen irgendein Debakel aus ihrer Vergangenheit, wollen jetzt einander besiegen. Nein, sie sehen nicht, sie stieren einander an. Und brüllen los.
Hier könnte der Buddhismus aushelfen, fällt mir im Getümmel ein. Eine Lehre, die penetrant darauf besteht, das wahrzunehmen, was »ist«: eben die Fakten und Tatsachen zur Kenntnis zu nehmen, nicht das vollgeblasene Ego und seinen Wunsch nach Rache. Was die beiden hier vorführen, sind wir alle. Gestochen scharf legen sie Zeugnis von dem Eifer ab, mit dem wir unsere Lebenskraft verschleudern. Die wir woanders so nötig hätten. Der Buddhismus hat etwas Federndes, das ihn so elegant erscheinen lässt. Die zwei Männer hier haben gewaltigen Stress und federn in keiner Sekunde.
Nur unter Aufwand letzter autoritärer Maßnahmen – ich drohe Yudai, ihm nicht die vereinbarte Summe auszuzahlen, übe gleichzeitig beschwichtigende Gesten Richtung Restaurantbesitzer – kommt es nach zehn Minuten zu einem erbosten Rückzug. Dürften sie, wie sie wollten, sie hätten längst nach Pfannen und Kochtöpfen gegriffen. Dennoch, ich mag die Szene. Sie erinnert mich selbstverständlich auch an mich. Und wie recht ich daran tat, nach Indien zu reisen. Auf eine neuerliche Suche. Um nicht als einer zu enden, der noch als Greis wie ein 16-Jähriger die Nerven verliert. Ohne Swing, ohne jede Eleganz.
Am nächsten Tag steht Plan A. Ich werde jene vier Orte in Indien besuchen, die jedem Buddhisten nah sind. Wenn ich auf dieser langen Reise dem einen nicht begegne, von dem ich nichts weiß, als dass ich ihn brauche, dann ist mir nicht zu helfen. Doch ich bin zuversichtlich, dieses Land ist eine Schatztruhe.
Ich fahre per Taxi nach Sarnath, erste Station, etwa zwölf Kilometer außerhalb von Varanasi. Dort, so verkünden alle buddhistischen Legenden, hat Buddha zum ersten Mal zu seinen Schülern gesprochen. Ich gehe zum Mulagandhakuti-Tempel, erbaut 1931. Hier wird eine Reliquie des Verehrten aufbewahrt. Heißt es. Man sieht sie nicht, keiner hat sie wohl je gesehen. Dafür gerät man ins Blitzlichtgewitter von hundert Touristen-Kameras, die sie auch nicht sehen.
Draußen wurden ein paar Tafeln mit Sätzen des Erleuchteten aufgestellt, der modernste: »Jene, die das Wichtige als wichtig erkennen und das Unwichtige als unwichtig, werden beim Wichtigen ankommen.« Der Bestseller Simplify your life zeigt, dass die Menschheit noch 2500 Jahre später nach jener Kraft sucht, die sie vom Schrott – dem geistigen, dem materiellen – befreit.
Ein paar Schritte weiter wurden sechs Statuen aufgestellt, Buddha und um ihn die fünf ersten Schüler. Eine Gruppe Besucher, ein Trio, sitzt vor einer Nonne, die den »historischen« Zusammenhang erklärt. Dabei schielt einer auf eine schöne Inderin, eine antwortet auf das Klingeln ihres Handys und der dritte schaut (heimlich) auf seine Uhr. Alle drei sind nicht »da«, nur anwesend. Vorsorglich haben sie die Masken der Andacht mitgebracht. Sie sind nicht andächtig, aber sie wissen, wie man auftreten muss, um diesen Eindruck zu vermitteln. Sie spielen Spiritualität. (Dabei würde andachtslose Achtsamkeit völlig reichen.)
Mich deprimieren solche Bilder. Alles scheint gleich wichtig. Die Hübsche, was die Frau erzählt, was auf der Uhr steht, was der Anrufer sagt. Nein, nicht gleich wichtig, eher gleich unwichtig. Nichts ist fesselnd genug, um uns zu fesseln. Wie oft passiert uns das? Zappend durch die Wirklichkeit zu rennen und nicht »ergriffen« zu werden. Wie oft? Ein Leben lang? Zur Klarstellung: Es geht nicht um schäbige Kritik. Die anderen sind nur das Spiegelbild, in das ich blicke. Um mich zu erschrecken und, immerhin, wieder zu ermahnen, dass ich nicht zappen will. Ich will die Tiefe, will dieses umwerfend schöne Gefühl der Hingabe.
Reality check als Fußnote, mitten im Buddhaland: Weder für die Existenz Jesu noch Mohammeds noch Buddhas gibt es wissenschaftliche Beweise. Weiß man um die menschliche Fähigkeit, sich oft von Gerüchten und anderen Hirngespinsten zu nähren, so liegt die Theorie nahe, dass sie erfunden wurden oder nur vage mit jenen Personen zu tun haben, die der Legendenbildung als Vorlage dienten. Keiner der drei hat schriftliche Notizen hinterlassen. Auch keiner von denen, die sie persönlich gekannt haben. Alles, was sie, die Legendären, (angeblich) sagten, haben andere überliefert. Nach deren Ende, lange nach deren Ende. Und sich bald über die »wahre« Lehre gestritten, bisweilen bekriegt. Und wieder andere haben – über Jahrtausende – ergänzt, durchgestrichen oder anders interpretiert, anders übersetzt. Und wieder gestritten, sich wieder – das betrifft allein die Monotheisten – die Köpfe eingeschlagen.
Die ersten erhaltenen Unterlagen zum Buddhismus wurden knapp fünfhundert (!) Jahre nach Buddhas Tod verfasst. Auf der Insel, die heute Sri Lanka heißt, ein paar Tausend Kilometer von seiner Wirkungsstätte entfernt. In Pali, der damaligen Gelehrtensprache. Obwohl Buddha, so ist zu vermuten, Magadhi sprach. Im Klartext: Ein halbes Jahrtausend über wurde das Gehörte mündlich weitergegeben.
Dazu ein hochmoderner Einschub: ARD und ZDF schalteten einst einen Werbespot, um die Zuschauer davon zu überzeugen, dass ihre Nachrichten eher der Wirklichkeit entsprechen als die ihrer (privaten) Konkurrenten.
Man sah eine Bühne, auf der vier Männer saßen, von links kam ein fünfter dazu, er flüsterte dem Nächstsitzenden folgende Nachricht ins Ohr (siehe http://bit.ly/49FpFo): »Der Außenminister hat dem Plan zur Wirtschaftshilfe uneingeschränkt zugestimmt.«
Der Angesprochene wendet sich an seinen Nachbarn, ebenfalls flüsternd: »Der Außenminister hat den Plan zur Wirtschaftshilfe unabgestimmt eingeschränkt.«
Nun der dritte Mann zu dem Vierten: »Der Wirtschaftminister hat den Plan zur Außenhilfe bestimmt verdrängt.«
Und zuletzt der Vierte zum Letzten: »Der Minister hat nach Plan eine Ausgangssperre für die Wirtschaft verdrängt.«
Und jetzt spricht der Letzte laut zum Publikum: »Wie ich soeben erfahre, hat sich der Minister den Arm nach einem Ausflug in die Wirtschaft verrenkt.«
So viel zur »oral history«. Trotzdem, alle Einwände nehmen den Religionen und dem Buddhismus nicht ihren Reiz. Ob nun wörtlich überliefert oder mehr oder weniger fantastisch nachgedichtet, scheint eher zweitrangig. Was zählt, ist ja die »Idee«, die ihren Gründern zugeschrieben wird. Deshalb ist es auch von untergeordneter Bedeutung, ob die Ideen-Stifter real existierten oder nicht. Oder nur nebelhaft dem Bild ähneln, das andere sich von ihnen gemacht haben.
Resümee: Wann immer hier »Buddha sagte« im Text steht, soll der Leser leise anfügen: »Wir haben uns darauf geeinigt, dass Buddha gesagt haben soll.« Und noch ein Befund, um weitere Klarheit in die Verhältnisse zu bringen: Immer werden wir aufgefordert, »großen Respekt vor den Religionen« zu zeigen. Ergriffenes Schaudern soll über uns kommen, wenn von den »göttlichen Weissagungen« die Rede ist. Welch Mumpitz! Respekt vor was? Vor dem klerikalen Lichtertalg, dem prophetischen Geraune, dem inbrünstigen Glaubensschmalz? Alles fabriziert, um uns Angst und Schrecken einzujagen. Davor Respekt? Vor der Intoleranz, zu der sie uns aufwiegeln? Vor der Denkfaulheit, in der wir uns üben sollen? Vor dem schafsfrommen, schafsblöden Geleier, das uns andere Schafe seit ein paar Tausend Jahren vorleiern?
Bedenkt man die Untaten des Christentums, mit Hilfe derer es viele Jahrhunderte lang von sich reden machte, so ist die »christliche Nächstenliebe« eine hübsche Erfindung, die mit der von Jesus angemahnten Liebe nichts zu tun hat. Zumindest nicht in der Wirklichkeit. Die Kirche schien sich eher an das blutrünstige Alte Testament zu halten als an die Aufrufe zu Verständnis und Güte.
Beim Islam ging es nicht menschenfreundlicher zu. Die Anzahl der Blutbäder, die er sich in vielen Teilen der Welt genehmigt hat, verweist direkt oder indirekt auf die vielen Textstellen im »heiligen« Koran, die zu diesen Blutbädern anspornten. Da hilft auch kein Gutmenschen-Sermon über den Islam, die »Religion des Friedens«. Er hilft so wenig wie der penetrante Hinweis auf die »Missverständnisse«, denen Mohammed, der Friedensreiche, ausgesetzt sei. Ganz offensichtlich sind wir anderen, wir Nicht-Moslems, nicht willens, die Botschaft, die friedvolle, zu entdecken.
Und der Buddhismus? Nun, ich will seine Heiligsprechung nicht übertreiben. Denn seine Getreuen sind grundsätzlich nicht besser oder intelligenter. Nehmen wir Tibet, das ja dank der Umtriebigkeit des Dalai Lama immer wieder in der Weltpresse auftaucht. Seit Jahrzehnten legt sich ein leichter Schauer der Ergriffenheit auf das westliche Herz, wenn der Name dieses Landes fällt. Weil man sich, zu Recht, gegen die Banditenpolitik Pekings empört. Und weil man, zu Unrecht, die Ex-Theokratie im Himalaya für den Inbegriff frohsinnig-schneeverwehter Glückseligkeit hielt. Dem ist nicht so. Ein knappes Drittel der vierzehn Lamas wurde ermordet. Opfer erbitterter, innerreligiöser Richtungskämpfe. Als die Kommunisten 1950 das zukünftige »Autonome Gebiet Tibet« überrannten und annektierten, nahmen sie 1,5 Millionen Quadratkilometer in Besitz, deren Infrastruktur der einer Bananenrepublik glich. Kaum Straßen, keine Krankenhäuser, keine nicht-religiösen Schulen, dafür Analphabetentum, hohe Kindersterblichkeit, Bettelarmut, Bonzen-Korruption und untereinander verfeindete Klöster. Das entschuldigt die chinesischen Barbareien in nichts, aber es wirft kein strahlendes Licht auf eine Weltanschauung, die angetreten ist, Eigenverantwortung zu lehren.
Die Liste der Sünden, die im Namen Buddhas begangen wurden, wäre lang. Japan – oh, heiliger Zen-Buddhismus – könnte ein Bataillon strammer Mönche aufweisen, die gern und innig Schwert und Schießgewehr zückten. Im Zweiten Weltkrieg stand die buddhistische Führung resolut hinter Kaiser Hirohito – ebenfalls bekennender Anhänger der Lehre der Friedsamkeit – und bejubelte den größenwahnsinnigen Kriegstreiber.
Wer durch Thailand reist, wird jeden dritten Tag in der Zeitung einen Bericht über randalierende Mönche in einem Puff lesen. Oder über einen Abt, der sich wieder einmal an der Klosterkasse vergriff. Oder über Drogen, die unterm Meditationskissen gefunden wurden. Oder über arbeitsscheue Sonnenanbeter, die sich als Jünger Buddhas verkleideten, um cool auf Betteltour zu gehen.
Letztes (trauriges) Beispiel ist Sri Lanka, dessen bürgerkriegsähnlicher Konflikt 1983 zu lodern begann und erst vor einem knappen Jahr zu Ende ging. Die Mehrheit der (buddhistischen) Singhalesen gegen die Minderheit der (hinduistischen) Tamilen, die einen eigenen Staat forderten. Man konnte sich nur wundern über die Härte, mit der sich Ordensleute für ein schonungsloses Vorgehen gegen die Aufständischen aussprachen. Wie Generäle hetzten sie.
Das zeigt: Auch der Buddhismus hat »schmutzige Hände«, schuldbeladene. Und trotzdem: Sein Schwarzbuch ist – im Vergleich – dünn, sehr dünn, seine Blutlachen noch überschaubar. Das hat wohl (auch) damit zu tun, dass in seinen Schriften kein Schlachtruf steht, der gellend zu Kreuzzügen, Heiligen Kriegen und anderen Schlächtereien antrieb. Nie gab es eine mörderische Inquisition, nie eine Conquista, nie »Hexen«-Verbrennungen, nie sollten »Ungläubige« mit Feuer und Schwert bekehrt werden, nie schrieb jemand eine Rechtfertigung für schwunghaften Sklavenhandel. Und entscheidend – damit fällt der Hauptschuldige aller in seinen Namen begangenen Verbrechen weg – kein »Gott« kommt im Buddhismus vor. Er ist vollendet gottlos, nichts »Heiliges« schwirrt durchs Universum. Buddha war nichts als irdisch, kein »Gottessohn eines Gottvaters«, nie »Prophet des Allgütigen«, keine Inkarnation »göttlicher Macht«, er war immer, immer nur Mensch. Wie beruhigend.
Nota bene: Meine Kritik an den Monotheismen bezieht sich immer auf die Institutionen, die »Stellvertreter Gottes«, die Hochwürden und Muftis und Ayatollahs, ihre angemaßten »Gottesworte«, ihre als »heilig« angepriesenen Bücher. Immer randvoll mit Sprüchen des »Herrn«. Heißt der Herr nun Gott oder Allah. (Wie einleuchtend, dass Damen als Sprüchemacher bei den patriarchalischen Märchenerzählern nicht vorkommen. Eine reine Männerwirtschaft. Wenn uns wenigstens eine Frau erlösen würde. Das nur am Rande.)
Der Verriss betrifft nicht, nicht grundsätzlich, die Christen und Moslems, die diesen beiden Religionen angehören. Darunter gibt es unzählige Männer und Frauen, die sich – vorbildlicher als mancher Buddhist – für das Wohl anderer einsetzen. Das irdische, wohlgemerkt. Die es dabei sogar schaffen, nicht mit brennenden Augen demjenigen, dem sie gerade helfen (und wäre er gottlos), von der Grandiosität ihrer Religion zu predigen. Sie tun, sie helfen, sie halten den Mund. Ich kenne viele von ihnen und ich war immer berührt von ihrer Wärme, ihrer Gastfreundschaft, ihrer Herzensbildung.
Kurioserweise komme ich nie auf die Idee, anzunehmen, dass sie so sind, wie sie sind, weil sie dem einen oder dem anderen Glauben angehören. Den pflegen sie, in meinen Augen, als (unnötigen) Zierrat. Aber ihr gutes Herz haben sie, weil sie ein gutes Herz haben. Weil sie der Mensch sind, der sie sind. Sie handeln nicht als Christen gut, sondern als Stephanie oder Joe, nicht als Moslems, sondern als Aisha oder Bakr. Das wäre so, als verhielte sich ein »Ungläubiger« redlich, weil er ein Ungläubiger ist. Natürlich nicht. Er handelt, weil es ihn drängt, jemandem in Not beizustehen.
Und natürlich gibt es die Pharisäer. Sie tun Gutes und sagen: »Um Gottes Willen«. So klingt ein Offenbarungseid, denn sie offenbaren, dass sie nicht um des »Nächsten Willen« eingreifen, sondern nur an ihr himmlisches Sparschwein denken. Jede gute Tat führt sie gleich eine Himmelssprosse höher. Die Bibel wie der Koran ermutigen ausdrücklich zu dieser Praxis für Scheinheilige. Dass auch viele Atheisten und Buddhisten als Heuchler unterwegs sind – muss ich es hinschreiben?